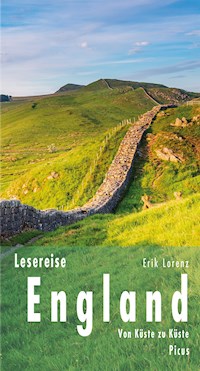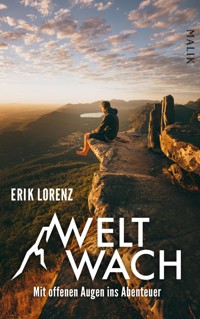Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Preis der Hoffnung
- Sprache: Deutsch
Die erfolgreiche Sabotage der Panzerfabrik ist ein Triumph des französischen Widerstands gegen die deutschen Besatzer - aber Mathieu Trudeaus Freude über den mühsam erkämpften Sieg währt nur kurz. Seine Auftraggeber verdächtigen ihn, seinen Erfolg nur vorgetäuscht zu haben, um weitere Bombardements der Stadt Lille durch die Royal Air Force zu verhindern. Sie verlangen Beweise. Während SS-Mann Emil Blenke verwundet und gedemütigt Rache schwört, bleibt Mathieu nichts anderes übrig, als mit einem Fotoapparat bewaffnet unter den Augen Hunderter Soldaten in die zerstörte Fabrik zurückzukehren ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
EPILOG
EINS
Mathieu hätte sofort zu Dominique eilen sollen, um durch ihn die Nachricht vom geglückten Anschlag an London zu übermitteln, aber seine Freude war zu groß. Es gab jemand anders, dem er zuerst davon erzählen musste. Nachdem er sich von Liam, Alexandre und Vincent getrennt hatte, lief er zur geheimen Wohnung.
Wenige Sekunden nach seinem Klopfen riss Denise die Tür auf. Ihre Augen weiteten sich erschrocken, als sie das getrocknete Blut in seinem Gesicht und auf seiner Uniform sah, aber er gab ihr keine Gelegenheit nachzufragen.
„Wir haben es geschafft!“, rief er und fiel ihr um den Hals, während er die Tür hinter sich mit dem Fuß zuschob. Sie umarmten sich lange und fest und empfanden dabei die ganze Wucht des Augenblicks. Denise schloss die Augen. Mathieu konnte sich die Gefühlswogen vorstellen, die über sie hinwegspülten, denn auch er spürte sie. In seiner Euphorie küsste er sie auf die Wange.
Es war nichts Besonderes, nur eine Geste, aber er hatte sie noch nie geküsst. Er wusste, dass sie sich mehr von ihm ersehnte, und wollte ihr keine falschen Hoffnungen machen. Deshalb nahm er die Hände von ihrem Rücken, um sich aus der Umarmung zu lösen, aber im selben Moment küsste sie ihn zurück, ganz leicht – nicht auf die Wange, sondern auf den Mund. Mathieu rührte sich nicht. Sie küsste ihn erneut, dieses Mal fester, und ihre Augen, eben noch geschlossen, öffneten sich und betrachteten ihn. Ihr Blick war wie eine Liebkosung ...
„Ich muss alles aufschreiben“, sagte sie plötzlich und trat einen Schritt zurück. „Wir müssen sofort ein Sonderflugblatt veröffentlichen und es an die anderen Netzwerke weiterleiten. Jeder soll davon erfahren. Es wird alle ermutigen!“
Sie lief nach oben ins Wohnzimmer, gefolgt von Mathieu, der wie benommen die Stufen hinaufging. Sie schnappte sich Stift und Papier und begann zu schreiben, während er sich aufs Sofa setzte und erzählte. Es war erstaunlich, wie sich L’Homme libre mittlerweile entwickelt hatte. Die aktuelle Ausgabe enthielt Zusammenfassungen französischer Radiosendungen aus London und einen offenen Brief an die Bevölkerung von Lille. Die Inhalte des Blatts gingen mittlerweile weit über oberflächliche Nachrichten und Propaganda hinaus: Sie besaßen politische Tiefe und enthielten Aufrufe zu konkreten Aktionen. Zu Denises Quellen gehörten neben illegalen Radiosendungen auch Zeitungen aus Großbritannien, der Schweiz und Amerika, die sie über einen Kontakt in der amerikanischen Botschaft in Paris erhielt. Im Blatt wurden militärische Entwicklungen, die Lage der französischen Wirtschaft und der Machtmissbrauch durch die deutsche Besatzung thematisiert. Außerdem wurde von erfolgreichen Aktionen des Widerstands berichtet. In jeder Ausgabe argumentierten Denise und ihr Team, Frankreich sei nicht besiegt, solange es solche Aktionen gebe, ob im Großen oder im Kleinen. Wichtig sei nur, so betonte sie immer wieder, dass diese Aktionen diszipliniert und möglichst koordiniert durchgeführt wurden.
Denise hat viel mehr Kraft, als man auf den ersten Blick vermuten würde, dachte Mathieu und sah ihr zu, wie sie seine Schilderungen notierte. Sie war keineswegs langweilig und bodenständig, wie er früher einmal geglaubt hatte. Ruhig und überlegt, das ja, aber zugleich unerschütterlich. Sie hatte weder Wahlrecht noch ein Bankkonto und würde nur schwer eine der vielen Arbeitsstellen ergattern, die bislang der Männerwelt vorbehalten waren, aber sie strafte all jene Lügen, die Frauen weniger zutrauten als Männern. Er hatte zu lange den Fehler gemacht, sie mit Sylvie zu vergleichen. Sie war anders, aber mitnichten schwächer oder uninteressanter. Wenn die Situation eine andere wäre ... in einem anderen Leben ... Aber es sollte nicht sein. Es konnte nicht sein.
Um sich zu beschäftigen, griff er nach den Propagandabroschüren mit der Überschrift „Wo sind nun die Alliierten?“, die er aus dem Polizeikommissariat mitgenommen hatte, und schrieb lächelnd auf das Deckblatt jedes einzelnen Exemplars: „Vielleicht waren sie in Fives?“ Dann steckte er sie ein.
Die Müdigkeit übermannte ihn, und es fiel ihm schwer, die Augen offen zu halten. Wann hatte er das letzte Mal richtig geschlafen? Er konnte sich nicht erinnern. Langsam rutschte er tiefer ins Sofa, legte den Kopf auf die Lehne und schlief fast augenblicklich ein.
Als er nach ein paar Stunden aufwachte, hatte sich Jolie, die Denise mit hierhergebracht hatte, an ihn geschmiegt. Noch immer saß Denise ihm gegenüber und beobachtete ihn. Papier und Stift lagen vor ihr auf dem Tisch. Mathieu blinzelte, und sie lächelte. Es war ein schönes, unschuldiges Lächeln, und doch schwang etwas darin mit, eine Spur von Zweifel oder Sorge.
Die friedliche Stimmung, in der er sich befand, verflog. Ihm wurde bewusst, was er ihrem Vater angetan hatte, indem er Ricard instruiert hatte ihn festzunehmen, und welchen Verrat er damit auch an ihr begangen hatte. Er wandte sich ab und schaute zur Decke. Aus dem Augenwinkel sah er, wie ihre Schultern herabsanken. Offenbar verstand sie sein Verhalten als einen weiteren Versuch, das bisschen Distanz zu wahren, das es zwischen ihnen gab, und fügte sich der Maßnahme still. Es versetzte ihm einen Stich.
Er hatte nach einem genialen Plan gesucht, der dem Guten zum Sieg verhalf, aber ihm war nichts eingefallen, was ihn seinem Ziel nähergebracht hätte, ohne einen furchtbaren Preis zahlen zu müssen. Er hatte sogar dafür gesorgt, dass Denise die Nacht, in der ihr Vater verhaftet wurde, und den darauffolgenden Morgen hier bei ihm verbracht hatte. So hatte er sichergestellt, dass Serge, von dem er wusste, dass er ins Hinterzimmer des Cafés gezogen war, sie nicht gleich in ihrem eigentlichen Zuhause aufsuchen würde, um sie zu informieren.
Manchmal glaubte Mathieu, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnten – die eine ehrgeizig und kompromisslos, die andere tapfer, liebevoll und idealistisch. Welche von beiden war stärker? Welche von beiden definierte ihn? Er dachte an ein kurzes Gespräch mit Thierry zurück, das sie am Abend nach der Stürmung von Liams geheimer Wohnung geführt hatten, während sie auf Dominique warteten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie noch nicht gewusst, ob er Blenke entkommen war. Thierry hatte Mathieus tiefe Besorgnis mitbekommen und ihn zur Seite genommen. „Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dir vertraue“, hatte er gesagt, ohne seine eigene Beunruhigung verbergen zu können. „Ich helfe gern, und ich hege keine Zweifel. Ich weiß, was ich riskiere. Aber ich bitte dich, gefährde nicht das Leben meiner Tochter. Gib auf sie acht. Ich möchte, dass sie bald studiert. Sie hat so viele Begabungen, und sie soll eine gute Zukunft haben. Ihr darf niemals etwas zustoßen.“
Diese Bitte hatte Mathieu schmerzlich daran erinnert, dass er einer solchen Verantwortung bei Kylian schon einmal nicht gerecht geworden war. Und jetzt hatte er diesen liebevollen, aufrichtigen Vater an die Polizei ausgeliefert, um selbst Polizeiinspektor werden zu können und Zutritt zur Fabrik zu erlangen. Ihm blieb nur, zumindest seinen Wunsch zu erfüllen und für Denises Sicherheit zu sorgen.
Als er sich aufrichtete, spürte er schmerzhaft die Rippen, die ihm Kuhn gebrochen hatte, und ihm wurde übel. Jolie machte einen Katzenbuckel, streckte sich und rollte sich in seinem Schoß zusammen.
„Ich glaube, wir haben ein Problem“, sagte Denise. „Es geht um meinen Vater.“
Mathieus Herz verkrampfte. „Was ist mit ihm?“
Sie stand auf und trat an ein Fenster. „Ich war heute früh im Café. Er war nicht dort, aber im Hinterzimmer habe ich das hier gefunden.“ Sie hielt ein zerknittertes Exemplar von L’Homme libre hoch. Mathieu versuchte, fragend auszusehen, aber innerlich tat sich ein Abgrund auf.
„Ich habe Angst, dass irgendwas nicht stimmt“, sagte sie. „Wir haben nie irgendwelche Flugblätter mit ins Café genommen. So fahrlässig sind wir nicht. Wie kann es dort hingekommen sein? Und wo ist Vater?“
Mathieu ließ sich zurücksinken und streichelte Jolie. „Ich weiß es nicht“, murmelte er, konnte das Beben in seiner Stimme aber nicht unterdrücken.
Denise drehte sich zu ihm um und betrachtete ihn durchdringend. „Bist du dir sicher?“ Sie blickte an ihm herab. „Du trägst eine Polizeiuniform“, sagte sie fast überrascht, als habe sie das erst jetzt bemerkt. „Woher hast du sie?“
Das war zu viel. Die dünne, poröse Schicht aus Lügen bröckelte. Er beichtete ihr, was er getan hatte, beichtete, dass ihr Vater in Polizeigewahrsam war, dass ihm womöglich die Todesstrafe drohte.
Um ihren Mund zuckte es, während sie nach Worten suchte. „Du hast ... was getan?“
„Ich ...“ Mathieu fehlten die Worte. Mit tiefem Bedauern sah er zu, wie sich die so mühsam zurückgehaltene Zuneigung, die sie für ihn empfand, Stück für Stück auflöste, so als würde ein Faden nach dem anderen aus einer Decke verschwinden, bis sie zu einem löchrigen Fetzen wurde und sich schließlich gänzlich auflöste.
Er hatte gewusst, dass es so kommen würde. Ihre Verachtung war der Preis, den er für seine Entscheidung bezahlen musste. Er erwog, sich zu rechtfertigen, darauf zu verweisen, dass er es für eine Sache getan hatte, die größer war als alles andere. Darauf, dass der Widerstand schon viele Opfer gefordert habe und dass dieses Opfer besonders wichtig für ihre Mission gewesen sei. Aber schon bevor er die Worte aussprach, klangen sie in seinen Ohren hohl, und so schwieg er.
Denise sagte mühsam kontrolliert: „Es gibt einen Unterschied, ob jemand ein heldenhaftes Opfer bringt oder ob du meinen Vater verrätst.“ Sie atmete tief durch. „Wie konntest du so etwas Furchtbares tun?“
Er zwang sich zu sprechen. „Wir können uns nicht den Luxus leisten, über Richtig und Falsch nachzudenken. Es geht darum, ob wir gewinnen oder verlieren.“
Sie schlug sich die Hände vor das Gesicht und weinte.
Ihm fiel ein, dass er längst bei Dominique sein sollte. Er schaute auf die Uhr: Es war nach Mitternacht. Wer wusste schon, was London tun würde, wenn seine Nachricht zu lange auf sich warten ließ? Vielleicht schickten sie noch heute Nacht erneut Bomber.
„Es tut mir leid.“ Er hob Jolie von seinem Schoß und stand auf.
„Was tust du?“, fragte sie und ließ die Hände sinken. „Du gehst doch jetzt nicht?“
„Es tut mir leid. Ich muss zu Dominique. Ich komme danach sofort zurück.“
„Aber ... was ist mit Vater? Was wird mit ihm geschehen?“
Er hob entschuldigend die Hände. „Es tut mir leid“, wiederholte er. Dann brach er zu Dominique auf.
Auch Dominique öffnete nach dem ersten Klopfen sofort die Tür.
„Du bist es!“, sagte er und zog Mathieu hastig in die Wohnung. Im Wohnzimmer hielt Mathieu die Propagandabroschüre der Deutschen hoch und deutete mit dem Zeigefinger auf seine eigene Notiz: „Vielleicht waren sie in Fives?“ Trotz des Gesprächs mit Denise eben brachte er ein bemühtes Lächeln zustande.
Dominique betrachtete die Broschüre ungläubig. Mathieu hatte ihm nicht gesagt, wann genau der Anschlag stattfinden würde. „Ihr habt es getan?“ Er schluckte schwer. „Heute? Und ihr seid erfolgreich gewesen?“
Mathieu nickte. „Und jetzt werden wir es London erzählen.“
Sie stellten den Transmitter auf den Tisch. Dominique bereitete die Übertragung vor. Mathieu bemerkte, dass seine Hände zitterten. Seine Bewegungen wirkten fahrig, als sei er nicht ganz bei sich. Und war da eine leichte Alkoholfahne? Wie war er an den Fusel gekommen? Auch ansonsten machte er nicht den besten Eindruck. Er war unrasiert, allem Anschein nach auch ungewaschen, und sah bei genauerer Betrachtung weniger ungläubig als beunruhigt aus. Was war mit ihm los?
Natürlich, auch Dominique stand unter immensem Druck. Seine Arbeit als Funker gehörte nach wie vor zu den gefährlichsten im ganzen Netzwerk. Seine Erscheinung musste das Resultat ununterbrochener tage- und nächtelanger Anspannung sein.
Als die Verbindung hergestellt war, diktierte Mathieu die Nachricht über die erfolgreiche Aktion. Jetzt, da er seinen wichtigsten Auftrag ausgeführt hatte, fühlte er sich weniger befreit, als er gehofft hatte. Der Triumph des Sieges wurde durch die Umstände geschmälert. Trotzdem war es die befriedigendste Übertragung, die er je nach London geschickt hatte. Er beendete sie mit den Worten:
MISSION ERFUELLT ENDE
Die Antwort ließ auf sich warten. Als sie kam, begann sie wie erwartet, doch die restliche Nachricht machte Mathieu fassungslos.
GLUECKWUNSCH STOP GUT GEMACHT STOP BITTE FOTOAUFNAHMEN VIA KURIER SENDEN ENDE
„Das darf doch nicht wahr sein!“, sagte er und ließ sich auf einem Stuhl niedersinken, nur um sogleich wieder aufzuspringen. Er hatte genug für die SOE getan. Jetzt waren seine Auftraggeber an der Reihe!
Dominique sah ihn erwartungsvoll an.
„Schreib das folgende“, sagte Mathieu und diktierte:
SCHICKT ERST AUSRUESTING STOP GELD RESSOURCEN ENDE
Dieses Mal kam die Antwort umgehend.
ERST FOTOS DANN AUSRUESTUNG STOP RAF VERLANGT BEWEISE STOP GELD IN US BOTSCHAFT VICHY CODE LATEINLEHRER ENDE
Mathieu seufzte schwer. „Oh Gott, diese Wahnsinnigen!“ Offenbar hofften sie, dass er die Wahrheit sagte, befürchteten jedoch, dass er nur behauptete, die Fabrik außer Gefecht gesetzt zu haben, um die nächste Bombardierung Lilles abzuwenden. Was die Royal Air Force nicht verstand – oder wofür sie sich nicht zu interessieren schien – war die Tatsache, dass das Aufnehmen von Beweisfotos noch schwieriger sein würde, als die Sprengsätze zu platzieren. Bestimmt hatte man die Sicherheitsvorkehrungen weiter verstärkt.
Oder aber die Kontrollen wurden jetzt nachlässiger durchgeführt, da die Deutschen davon ausgingen, dass die Saboteure ihr Ziel erreicht hatten. Außerdem kannte Mathieu sich nun halbwegs auf dem Gelände aus ... Ohne es zu wollen, begann er darüber nachzudenken, wie er es schaffen konnte, die Fotos zu machen.
Der Hinweis am Ende der Nachricht betraf die Finanzen, doch soweit Mathieu wusste, war die amerikanische Botschaft in Vichy weitgehend verlassen, seit Deutschland auch den Süden besetzt hatte. Dort konnten sich höchstens noch ein paar niedrige Beamte aufhalten, die die letzten Kisten packten. Aber vielleicht hatte London ein Netzwerk im Umfeld der Botschaft aufgebaut, das weiterhin funktionierte.
„Es kommt noch was rein“, sagte Dominique und notierte:
BRAUCHEN SCHNELL GEWISSHEIT STOP FOLGENDER PLAN STOP
Der Plan, den die SOE übermittelte, sah vor, dass Mathieu die Fotos machte, in die Normandie fuhr und sie dort einem Widerständler aus einem anderen Netzwerk zukommen ließ. Dieser würde sie dann dem Piloten eines kleinen Flugzeugs übergeben, der die Fotos schließlich nach London bringen sollte.
Der Flieger würde übermorgen Abend in der Normandie landen.
Zwei Tage.
So viel Zeit gaben sie Mathieu, die Fotos zu machen. Wenn er sie bis dahin nicht in der Normandie ablieferte, würden weitere Fliegerangriffe befohlen werden. Dann würden wieder die Bomber über den Nachthimmel fliegen.
Mathieu rieb sich die müden Augen. Er war versucht, die SOE und die Air Force und das gesamte Oberkommando zum Teufel zu wünschen und alles hinzuschmeißen. Er hatte getan, was sie wollten, und er hatte dafür mehr Opfer gebracht, als irgendjemand hätte verlangen können. Er hatte den Agenten Constantin umbringen lassen, als Vorsichtsmaßnahme. Er hatte seine Freunde verraten. Er hatte seine Seele verkauft. Jetzt hätte es genug sein sollen. Herrgott, er hatte ja nicht einmal eine Kamera, seit er seinen Fotoapparat bei Blenkes Zugriff in Liams Unterschlupf zurückgelassen hatte. Und wenn er nicht zum Dienst erschien, würde seine falsche Identität bei der Polizei in kürzester Zeit auffliegen, mit unabsehbaren Folgen für Ricard. Er rieb sich immer fester die Augen, so fest, dass es schmerzte, aber die Müdigkeit verschwand nicht, und auch die inneren Mauern, die ihm zu Leibe rückten und jeden einfachen Ausweg versperrten, lösten sich nicht auf.
„Das können sie nicht verlangen“, sagte Dominique. „Sie können nicht verlangen, dass du in die Fabrik zurückkehrst.“
„Das haben sie aber getan“, sagte Mathieu voll Bitterkeit.
„Wirst du es tun?“
Mathieu atmete schwer und deutete ein Nicken an. „Ich muss es tun.“
Am folgenden Morgen brach Dominique zum Gestapo-Hauptquartier auf. Er hatte keine Sekunde geschlafen – natürlich nicht. Solange Mathieu bei ihm gewesen war, hatte er die Fassade mühsam aufrechterhalten, aber danach hatte ihn die blanke Panik ergriffen. Mathieu hatte es geschafft! Was würde Blenke mit Josie tun, jetzt, da genau das eingetreten war, was er mit Dominiques Hilfe hatte verhindern wollen? Dominique musste sofort mit ihm reden. Aber er befürchtete, dass keine Worte dieser Welt den SS-Mann davon abhalten würden, seine Drohungen wahrzumachen. Am wahrscheinlichsten war, dass Dominique seinem Mörder aus freien Stücken in die Arme lief.
Aber er hatte keine Wahl.
Er wurde sofort zu Blenke durchgelassen. Der Kommandeur saß hinter dem Schreibtisch in seinem Büro. Bei ihm waren seine rechte Hand, Kuhn, und zwei weitere Soldaten.
„Dominique“, sagte Blenke leichthin, aber in seinen Augen loderte eine irrationale Wut. „Ich habe dich erwartet.“ Im Tonfall milder Überraschung fuhr er fort: „Du siehst etwas heruntergekommen aus.“
Blenke war eindeutig der Falsche, um eine solche Beobachtung zu machen, dachte Dominique. Die Augen des Kommandeurs waren rot unterlaufen, das sonst so akkurat gekämmte Haar war in wilder Unordnung, die Uniform übersät mit Brandspuren. Aber vor allem waren da die Verbrennungen im Gesicht. Dominique verspürte bei dem Anblick keinerlei Schadenfreude, sondern nur Grauen: Es resultierte aus der Gewissheit, dass Blenke Josie und ihn für jedes Leid, das er erdulden musste, ob körperlich oder seelisch, tausendfach büßen lassen würde.
Blenke verzog den Mund zu einem merkwürdig schiefen Lächeln. „Kein schöner Anblick, nicht wahr?“
Dominique schwieg.
„Ich weiß schon, ich weiß“, sagte Blenke. Er reckte das Kinn vor und musterte Dominique, so als könne er sich nicht entscheiden, ob er ihn noch ein wenig beobachten oder sofort mit dem Stiefelabsatz zertreten sollte. „Ich bin der Letzte, der andere für ihre Erscheinung kritisieren sollte, nicht wahr? Das denkst du doch? Aber du gibst auch nicht gerade ein hübsches Bild ab. Wirklich nicht.“ Blenke legte die Hände mit den Innenflächen nach oben auf den Schreibtisch. „Ach, Dominique, schau uns an. Wie ist es nur so weit gekommen?“
Blenke drückte sich von der Tischplatte hoch und griff nach seinem Stock, der ihm entglitt und klackernd auf dem Boden aufschlug. Kuhn schnellte nach vorn, hob den Stock auf und reichte ihn seinem Vorgesetzten. Langsam kam Blenke hinter dem Schreibtisch hervor. Er legte sich die linke Hand auf seinen Rücken und lief auf den Stock gestützt einmal im Zimmer auf und ab.
„Moment mal. Ich weiß, wie es so weit gekommen ist.“ Er blieb stehen und betrachtete Dominique. „Ich meine mich zu erinnern, dass wir die eine oder andere Abmachung hatten. Wie zum Beispiel, dass du als meine Ohren und meine Augen fungierst, um Trudeau zu belauschen und zu beobachten. Aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich plötzlich seltsam taub und blind.“
Blenkes Worte waren schneidend. Die eisige Kälte, die sich hinter der Jovialität verbarg, ließ Dominique frösteln. Und trotzdem war etwas an dem Kommandeur anders als sonst, etwas, das über sein äußeres Erscheinungsbild hinausging. Er sprach die Drohungen, die in jedem einzelnen Satz mitschwangen, ein kleines bisschen weniger gemein aus. Natürlich bestand kein Zweifel an seiner Grausamkeit, aber er wirkte irgendwie zerstreut, abgelenkt.
„Ich höre und sehe immer noch für Sie“, sagte Dominique und zog die dünne Broschüre heraus, die Mathieu bei ihm gelassen hatte. „Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.“ Er hielt Blenke die Broschüre mit ausgestrecktem Arm hin, so als fürchte er, dass das Raubtier nicht nur den Köder schlucken, sondern sich auch in der Hand festbeißen würde, die ihn hielt.
Blenke reagierte nicht. Seine Augen blickten in die Ferne, dann blinzelte er. „Wie war das?“, fragte er gereizt, bemerkte die Broschüre und riss sie Dominique aus der Hand. „Wo sind nun die Alliierten?“, las er. „Die kenne ich doch“, fügte er abfällig hinzu, doch dann fiel sein Blick auf Mathieus handschriftliche Notiz. Er las leise vor: „Vielleicht waren Sie in Fives.“ Er ließ die Broschüre sinken. „Vielleicht waren Sie in Fives? Vielleicht waren Sie in Fives?“ Er begann, mit der Broschüre zu wedeln und immer wieder Mathieus Notiz zu wiederholen.
Plötzlich bereute Dominique, ihm das Papier gegeben zu haben. Warum hatte er das getan? Er hatte beweisen wollen, dass er noch zu Mathieus engem Kreis gehörte. Dass er Informationen lieferte, kleine und große, bequeme und unbequeme. Aber anstatt Blenke zu besänftigen, hatte das Propagandablatt ihn nur noch mehr erzürnt.
„Was hat das zu bedeuten?“, zischte der Kommandeur, immer noch mit der Broschüre wedelnd. „Wer hat das draufgeschrieben?“
Dominique fürchtete seine Reaktion auf den Namen, wenn er ihn laut aussprach.
„Wer hat das geschrieben?“ Blenke zerknüllte die Broschüre und ließ sie in der Faust verschwinden, mit der er nun Dominique drohte.
„Mathieu Trudeau“, flüsterte Dominique mit gesenktem Blick.
„Ich wusste es!“ Blenke warf die Broschüre auf den Boden, holte mit dem Stock aus und ließ ihn auf Dominique niedersausen. Dieser zuckte reflexartig zurück, sodass der Stock nur seine Schulter streifte. Blenke schien es nicht zu kümmern. Er holte nicht erneut aus, sondern begann, wieder im Büro auf und ab zu gehen.
„Wo und wann hat er dir das gegeben?“, fragte Blenke.
„Letzte Nacht. Bei mir zu Hause.“
„Er war bei dir?“
„Ja.“
Blenke blieb stehen und knackte mit dem Kiefer. Er sah aus, als würde er gleich explodieren. „Kuhn!“
„Ja, Kommandeur.“
„Wenn Trudeau bei Silva war – warum zum Teufel haben wir ihn dann nicht gefasst? Wofür überwachen wir denn die Wohnung?“
„Ich weiß es nicht. Etwas muss schiefgelaufen sein. Ich werde es herausfinden!“
„Tun Sie das, Kuhn. Und lassen Sie die Belohnung für Hinweise auf die Täter sofort von vierhunderttausend Francs auf eine Million hochsetzen.“
„Zu Befehl, Kommandeur.“
„Jeder, der auch nur im entferntesten Verdacht steht, die Täter zu decken, wird in Kollektivhaftung genommen. Zivilisten, die sich in irgendeiner Form verdächtig gemacht haben, werden wir als Geiseln nehmen, die im Falle weiterer Anschläge zur Rechenschaft gezogen werden. Wollen wir doch mal sehen, wie Trudeau damit fertig wird, wenn für jede seiner Taten Unschuldige sterben. Machen Sie das bekannt, Kuhn! Nach jedem weiteren derartigen Vorfall wird eine Anzahl solcher Verdächtiger erschossen, wobei sich die Anzahl nach der Schwere des Verbrechens richtet.“
Kuhn schlug die Hacken zusammen und verschwand.
Blenke nickte. „Ja, das ist gut. So werden wir alle einschüchtern, die erwägen, sich Trudeau und seinen Verbrechern anzuschließen. Strafe und Abschreckung!“ Er blieb stehen und sah Dominique an. „Und aus irgendeinem Grund ist mir danach, mit deiner Frau und dir den Anfang zu machen.“
„Nein, bitte nicht, Kommandeur! Es ist nicht meine Schuld! Ich habe Ihnen doch geholfen! Ich habe Sie vor dem Luftangriff gewarnt und ...“
„Und was nützt mir das jetzt?“ Blenke hob den Stock ein paar Zentimeter hoch und ließ ihn hin und her pendeln. Er folgte der Bewegung der Stockspitze mit den Augen, als wolle er sich selbst in Hypnose versetzen. „Ich habe dir die Gelegenheit gegeben, deinen Wert zu beweisen. Aber dein Freund Trudeau war trotzdem erfolgreich – obwohl einer seiner engsten Vertrauten für mich arbeitet! Oder arbeiten sollte!“
„Ich wusste nicht ...“
„Pssst“, machte Blenke und hob den Zeigefinger der linken Hand. „Es sind noch immer nicht alle Brände gelöscht. Aber das freut dich wahrscheinlich. Vermutlich hast du dir nichts anderes gewünscht. Du hast mich verraten!“
„Nein ...“
„Anders ist es auch nicht zu erklären, dass du angeblich noch immer nicht weißt, wo sich Trudeaus neuer Unterschlupf befindet. Die Sache ist, dass es diesbezüglich nach meiner Einschätzung zwei Möglichkeiten gibt: Entweder du weißt das längst und willst es mir nicht sagen. Oder du weißt es wirklich nicht. In diesem Fall ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass du es nicht wissen willst. Weil du dich für besonders gerissen hältst und meinst, mich nur gerade so viel füttern zu müssen, dass ich lieber deinen Fraß schlucke, als dich mit Haut und Haaren zu verspeisen, wie du es verdient hättest. Aber dein Fraß schmeckt mir nicht mehr.“
„Ich ... so ist es nicht, Kommandeur Blenke.“
„Nun, welche der beiden Möglichkeiten ist die zutreffende?“
„Keine, Kommandeur. Ich schwöre Ihnen, ich ...“
„Das glaube ich dir nicht, Dominique. Und diese Tatsache führt zu einer Reihe von Fragen. Zum Beispiel zu dieser: Wie soll ich dir länger vertrauen? Oder dieser: Wenn ich dir nicht vertraue, wofür brauche ich dich dann? Oder dieser: Warum sollte ich das Miststück, das du deine Frau nennst, nicht sofort umbringen lassen?“
Blenke packte den Knauf fester, rammte den Stock auf den Boden und durchbohrte Dominique mit dem Blick.
„Ich habe neue Informationen!“, rief Dominique.
„Wie passend.“
„Mathieu hat London kontaktiert! Er hat neue Anweisungen erhalten!“
„Ich höre.“
Dominique holte Luft, um zu sprechen, presste dann aber die Lippen aufeinander und schwieg.
„Welche Anweisungen hat er bekommen? Spuck es aus!“
„Erst ...“ Dominique musste sich räuspern. „Erst will ich Josie sehen.“
„Hast du Sehnsucht?“, fragte Blenke gehässig.
„Ja. Und ich will sicherstellen, dass es ihr gut geht.“
„Aber selbstverständlich geht es ihr gut! Himmelbett, Croissants zum Frühstück, abends ein Glas Wein zum Einschlafen, dazu die Platte einer hervorragenden Violinistin – das entspannt die Nerven, hat man mir gesagt. Es fehlt ihr an nichts, wirklich. Deine Sorge ist unbegründet.“
„Ich will sie sehen.“
„Du willst also.“ Blenke musterte ihn von oben bis unten. „Du weißt, dass ich dich mit einem Fingerschnipsen dazu zwingen könnte, es mir zu erzählen. Ich habe dich – und ich habe deine Frau. Ich habe alles, was ich brauche.“
Dominique schluckte schwer. „Ich weiß. Aber ich helfe Ihnen. Ich verrate meine Freunde. Damit Sie Josie nichts tun. Ich erfülle meinen Teil der Abmachung. Nun bitte ich Sie, mir ein wenig entgegenzukommen.“
Blenke sah ihn ein paar Sekunden länger an, bis er schließlich lustlos mit den Schultern zuckte. „Was auch immer. Von mir aus. Ich habe noch andere Dinge zu tun, als mit dir zu schwatzen!“
Er gab den beiden Soldaten einen Wink. Sie führten Dominique aus dem Büro hinaus, einige Flure entlang und eine Treppe hinunter ins Kellergeschoss, wo die Schritte von den kahlen Wänden zurückhallten und das schwache, gelbliche Licht eine grausame Atmosphäre verbreitete. Dies war also Blenkes Kerker. Dies war der Ort, wo sie Josie festhielten.
Einer der Soldaten zückte einen Schlüssel und blickte kurz durch den Spion einer der großen, schweren Metalltüren. Dann drehte er den Schlüssel im Schloss und zog die Tür mit einem langen Quietschen auf, das wie ein verzweifeltes Heulen klang.
Der Soldat trat zur Seite und bedeutete Dominique, in die Zelle zu treten. Dieser machte einen vorsichtigen Schritt vorwärts, dann noch einen. Mit jedem Schritt sah er mehr von den gelblichen Wänden, vom Fußboden, von der Metallpritsche – und schließlich sah er sie.
Josie saß zusammengesunken auf dem hinteren Ende der Pritsche und schaute zwischen Haarsträhnen, die ihr ins Gesicht hingen, zur Tür. Zu Dominique.
„Josie!“, stieß er aus und machte einen Satz in die Zelle hinein. Er kniete vor ihr nieder und nahm ihre Hände in seine, nur um sie gleich wieder loszulassen und ihr die Haare aus dem Gesicht zu streichen. Dann umarmte er sie, und sie umarmte ihn. Dass sie auf ihn reagierte, dass sie ihren Lebenswillen zeigte – es war das beste Gefühl der Welt.
„Josie!“, flüsterte er. „Wie geht es dir?“
Er löste sich aus der Umarmung und betrachtete sie, erst das Gesicht, dann ihren Hals und ihre Arme.
„Was machst du hier?“, fragte Josie. Ihre Stimme war besorgniserregend schwach.
„Bist du verletzt? Fehlt dir etwas? Was haben Sie dir angetan?“
Sie schüttelte langsam den Kopf. „Nichts. Sie haben mir nichts angetan. Aber warum bist du hier?“
„Das fragst du noch? Deinetwegen natürlich! Es tut mir so leid.“
Er konnte nicht aufhören, sie anzusehen und zu untersuchen, ob sie wirklich unversehrt war. Mit zitternden Fingern tastete er über ihre Arme, huschte mit hastigen Augen über ihre Beine.
„Schon gut“, murmelte Josie.
„Nein, sag das nicht. Es ist alles meine Schuld. Sie wollen mich mit dir erpressen. Ich habe dich in Gefahr gebracht.“
„Du hättest trotzdem nicht herkommen sollen“, sagte Josie. Dominique merkte, dass sie weinte. „Jetzt haben sie uns beide.“
„Nein, sie werden mich laufen lassen. Und ich werde alles tun, um dich hier rauszuholen. Versprochen.“
„Nein. Nicht alles. Tue nichts, wofür ich mich schämen müsste.“
Die Worte überraschten Dominique. Ahnte sie etwas von seinem Deal mit Blenke? Hatte der ihr sogar davon erzählt? Oder war ihr nur klar, dass sie nicht ohne Grund hier festgehalten wurde – und dass er nicht ohne Grund noch am Leben war?
Sie flüsterte: „Was auch immer es ist, was die Deutschen durch mich erreichen wollen, du darfst es nicht zulassen. Ich will lieber sterben, als ihnen behilflich zu sein.“
Dominique schluckte schwer. Er dachte an das, was sie noch vor wenigen Tagen gesagt hatte: Ich bin nicht so kämpferisch wie du.
Sie hatte sich geirrt.
Aber egal, worum sie ihn bat, er war nicht bereit, sie sterben zu lassen. Unter keinen Umständen. Er beschloss, ihre Bitte zu übergehen. „Es ist bald vorbei“, flüsterte er und küsste sie sanft. Sie erwiderte den Kuss mit einer kaum merklichen Lippenbewegung. Es fühlte sich an wie ein Abschiedskuss. Dominiques Herz zog sich zusammen.
„Das reicht.“ Einer der beiden Soldaten war in die Zelle getreten. „Kommen Sie.“
„Es ist bald vorbei“, wiederholte Dominique. „Vertrau mir.“ Er stand langsam auf und folgte dem Soldaten aus der Zelle hinaus, ohne den Blick auch nur für eine Sekunde von Josie zu nehmen. Sie hielten Augenkontakt, bis die ins Schloss fallende Tür ihre unsichtbare Verbindung kappte.
„Und, war’s schön?“, fragte Blenke, als Dominique wieder in dessen Büro war.
Es kostete Dominique mehr Überwindung denn je, mit ihm zu sprechen. „Danke“, sagte er heiser.
„Freut mich. Was ist nun mit den neuen Anweisungen?“
„London hat Mathieu beauftragt, irgendwann in den nächsten Tagen Fotos zu machen.“
„Was für Fotos?“
„Beweisfotos. Von der Fabrik.“
Blenke gab ein verblüfftes „Pff!“ von sich. Ein Lächeln zuckte um seine Mundwinkel. „Du meinst, er wird tatsächlich in die Fabrik zurückkommen?“
„Ja. London besteht darauf.“
Blenke rieb sich die Hände. „Wann wird er kommen?“
Dominique überlegte, wie viel er sagen musste, damit Blenke Josie am Leben ließ. Er wollte Mathieu nicht ausliefern, nicht, wenn es sich vermeiden ließ.
Aber er begann zu begreifen, dass er nicht mehr lange beides haben konnte. Blenke würde sich nicht weiter mit vagen Informationen hinhalten lassen, die zu keinen Ergebnissen führten.
Dominique würde sich entscheiden müssen.
Er würde nicht Josies Leben riskieren.
Allerdings kannte er Mathieus konkreten Plan selbst nicht. Er wusste nur, dass London ihm eine Frist von zwei Tagen gesetzt hatte.
„Es soll innerhalb der nächsten vier Tagen so weit sein.“
„Vier Tage? Das ist mir zu ungenau. Wir wussten auch vor dem Anschlag, dass er wahrscheinlich irgendwann stattfinden würde. Und dann ist uns Trudeau gestern entwischt. Ich brauche exakte Informationen. Wann wird er in die Fabrik kommen? Finde es heraus!“
„Sie wissen, er ist sehr misstrauisch. Er hat mir auch die genauen Pläne für den Anschlag vorenthalten.“
Blenke packte ihn am Kragen. „Dann sorgst du besser dafür, dass er etwas zutraulicher wird, und zwar schnell. Dieses Mal schnappe ich ihn – und du wirst mir dabei helfen.“ Blenke ließ ihn los, setzte sich hinter den Schreibtisch, nahm einen Stift und beugte sich über irgendein Formular.
„Letzte Chance“, murmelte er gedankenverloren. „Wenn du wieder versagst, ist deine Frau tot. Und jetzt raus mit dir.“
ZWEI
Denises Tränen waren versiegt. Ob sie sich beruhigt hatte oder einfach nicht mehr weinen konnte, war schwer zu sagen. Schon als sie ihm die Tür geöffnet hatte, waren ihre Augen leer gewesen, so als hätten sie alle Emotionen hinausgeweint. Sie saß auf ihrer Couch, ein wenig in sich zusammengesunken, die schwarzen Haare zu einem lieblosen Knoten gebunden, und stellte Fragen, auf die es keine guten Antworten gab.
„Warum musstest du ausgerechnet meinen Vater opfern? Warum nicht irgendjemand anderen?“ Sie sah ihn traurig an, bis sie die Frage im selben ausdruckslosen Ton wiederholte: „Warum nicht irgendjemand anderen?“