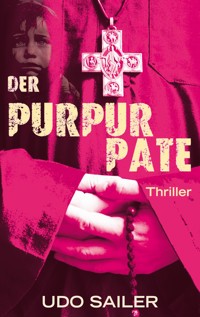
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Marco, einst in das düstere Waisenhaus Santa Lucia verschleppt und dort von Kirche und Mafia missbraucht, kehrt Jahre später als Pater Matteo zurück. Getarnt im Vatikan, führt er mit Unterstützung der mutigen Nonne Rosaria und des Informatikers Kaito einen riskanten Feldzug gegen Kardinal Folliero und dessen skrupelloses Netzwerk. Doch als sich Ariella ihnen anschließt, geraten alle Beteiligten in höchste Gefahr. Wird es Matteo gelingen, das dunkle System zu enttarnen, oder wird ihn die Vergangenheit endgültig verschlingen? Ein packender Thriller über Wahrheit, Verrat und die Suche nach Gerechtigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marco, einst in das düstere Waisenhaus Santa Lucia verschleppt und dort von Kirche und Mafia missbraucht, kehrt Jahre später als Pater Matteo zurück. Getarnt im Vatikan, führt er mit der Unterstützung der mutigen Nonne Rosaria und des Informatikers Kaito einen riskanten Feldzug gegen Kardinal Folliero und dessen skrupelloses Netzwerk. Doch als sich Ariella ihnen anschließt, geraten alle Beteiligten in höchste Gefahr. Wird es Matteo gelingen, das dunkle System zu enttarnen, oder wird ihn die Vergangenheit endgültig verschlingen?
Ein packender Thriller über Wahrheit, Verrat und die Suche nach Gerechtigkeit.
Udo Sailer, 1955 geboren, lebt in Speyer und ist Autor, Pianist, Komponist und Informatiker. www.udosailer.de
»Ein Strom aus Herzen wird die Zeit betrügen, und ein Meer von Tränen die Sünde tilgen, auf dass die kleine Seele im Atem Gottes weiterlebt.«
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Epilog
1
Schwester Rosaria hastete durch die dunklen, endlos erscheinenden Flure. Ihr Habit raschelte leise bei jedem Schritt, während ihre Gedanken schwer auf ihrer Seele lasteten. Eine Nachricht aus dem Vatikan hatte sie erreicht, ein Auftrag, der ihr Herz wie einen Stein in der Brust sinken ließ.
Kardinal Edoardo Folliero, dessen Einfluss und Macht im Vatikan unangefochten waren, duldete keine Widerrede. Seit Jahren diente sie ihm, gefangen zwischen Pflichtgefühl und den unausgesprochenen Schrecken, die sie miterlebte.
Die Dämmerung senkte sich über Rom, und ein gedämpftes Licht fiel durch die hohen Fenster des alten Waisenhauses Santa Lucia im Viertel Borgo, unweit des Vatikans. Die Glocken des Petersdoms hatten zur Vesper geläutet, und die Kinder waren bereits in ihren Schlafsälen.
Nur im Innenhof saß noch der kleine Marco, sechs Jahre alt, allein auf einer vom Wetter zerfressenen Holzbank. Seine Schuluniform aus dunkelblauen Hosen und einem weißen Hemd wirkte seltsam fehl am Platz. Nur das Plätschern des Brunnens durchbrach die Stille. Seine Hände umklammerten ein abgenutztes Stofftier, dem man seine Spezies nicht mehr ansah, das einzige Andenken an sein Zuhause. Vertieft in seine Gedanken, bemerkte er nicht, wie Schwester Rosaria sich näherte. Erst als ihr Schatten über ihn fiel, hob er langsam den Kopf.
»Marco«, sagte sie sanft, ihre Stimme leicht zitternd. »Komm mit mir, bitte.« Der Junge erhob sich zögernd, seine großen Augen suchten nach Antworten in ihrem Gesicht, doch die Ordensfrau vermied den Blick und legte behutsam eine Hand auf seine Schulter. Gemeinsam eilten sie durch die düsteren Flure. Vom Waisenhaus zum Vatikan waren es nur wenige Meter, aber der Weg erschien endlos, jeder Schritt schwerer als der letzte.
Kurz darauf erreichten sie das Vorzimmer des Kardinals, wo eine massive Tür, reich verziert mit kunstvollen Schnitzereien, vor ihnen emporragte. Rosaria hob zögerlich die Hand, und das leise Klopfen hallte in ihrer eigenen Brust wider. Ein blechernes, fistelndes »Herein« drang von der anderen Seite zu ihnen.
Mit einem sanften Druck öffnete sie die Tür und führte den Kleinen hinein. Pater Ricardo Costa, in schwarzer Soutane, der engste Vertraute und Sekretär des Kardinals, empfing sie mit einer verbindlichen Freundlichkeit, seine Aufmerksamkeit wohlwollend auf Marco gerichtet.
»Seine Eminenz erwartet sie bereits«, flüsterte er und wandte sich dann Schwester Rosaria zu. Mit einem prüfenden Blick auf den Jungen meinte er leiser: »Hübsches Kind.« Rosaria ignorierte die Bemerkung und schaute zu Boden. Dieses aalglatte Scheusal hatte ihr selbst schon öfter eindeutige Avancen gemacht, wobei er sie jedes Mal hemmungslos begrapschte. Sie konnte ihn gottlob immer davon abhalten, sie weiter zu bedrängen. Ricardo war auch als Leibwächter höchst effektiv und skrupellos. Der Pater schmachtete nach Marco, aber Rosaria hatte es ihm heute ebenso angetan. Beide waren für ihn Fleisch, gerade gut genug für seine Spielchen. Er entsprach jedem Klischee eines Filmbösewichts der alten Schule. Untypisch groß und hünenhaft für einen Sizilianer, drahtig und mit gleitenden Bewegungen wirkte er bedrohlich auf beide Besucher. Die Haare hatte er mit Gel glatt nach hinten gekämmt. So überspielte sein charakteristisch süditalienisches und kantiges Gesicht eindrucksvoll seine Bedeutungslosigkeit. Mit aufgeblähten Nüstern und glänzenden, halb geschlossenen Augen öffnete er die Tür zu seinem Vorgesetzten.
Das Amtszimmer des Kardinals wirkte beeindruckend und ehrwürdig. An den Wänden hingen Gemälde, die Szenen aus der Kirchengeschichte zeigten. Vergoldete Ornamente zierten die schweren Möbel. Die Buntglasfenster ließen farbiges Licht in den Raum fallen. Ein schlichtes Kruzifix aus poliertem Mahagoni hing über einem kleinen Altar. In der Mitte stand ein monströser Schreibtisch, der die eindrucksvolle Grenze zwischen Macht und Ergebenheit zeichnete. Schwere, ledergebundene Bücher warteten darauf, bewundert zu werden. Dahinter erhob sich ein hoher purpurgepolsterter Sessel. Der Geruch von altem Holz und Weihrauch durchzog die Luft.
Als Rosaria mit Marco eintrat, saß Kardinal Folliero erwartungsvoll, jedoch mit unbeweglichem Gesicht hinter dem Schreibtisch. Auf einer opulenten Polstergarnitur thronte Don Massimo Venturi, eine Hauptfigur der italienischen Mafia, gefürchtet und hoch angesehen. Neben ihm lümmelte sich Vincente Moretti, der Polizeichef von Rom, in die Kissen. Diese illustre Gesellschaft, einen edlen Tignanello von Marchesi Antinori in großzügigen Rotweingläsern schwenkend, musterte die Neuankömmlinge mit einer Mischung aus Neugier und Blasiertheit.
Auf einer kleinen Ottomane saßen zwei hellblonde Mädchen von sechs und acht Jahren und ein dunkelgelockter Junge in gleichem Alter. Die Kinder waren hübsch und adrett gekleidet, mit kurzen dunkelblauen Hosen oder Faltenröckchen und weißen Socken. Sie verharrten schweigend mit großen, weit geöffneten Augen.
Zwei Nonnen, die dem Kardinal unterwürfig, fast hündisch dienten, bereiteten Bruschetta an einem Vertiko vor. Das Szenario hatte den Anschein einer netten Party, doch die angstvollen Augen der Kinder und der unerträgliche Geruch der Heiligkeit erfüllten den Raum mit Beklemmung.
»Schwester Rosaria«, hob Folliero an – seine Stimme eine seltsame Mischung aus Freundlichkeit und Autorität – »ich danke Ihnen, dass sie Marco gebracht haben. Der Neue ist mir im Heim aufgefallen. Ich glaube, er hat großes Potenzial.« Rosaria nickte stumm und trat zurück, die Hände vor ihrem Schoß gefaltet und den Blick fest auf den kleinen Jungen gerichtet. Der Kardinal erhob sich bedächtig und stolzierte um den Schreibtisch herum. Seine Augen, die im Halbdunkel aufblitzten, musterten Marco kühl. Mit einem abfälligen Wink deutete er der Schwester an, den Raum zu verlassen. »Komm her, mein Sohn«, sagte er sanft. Marco gehorchte. Seine Hände zitterten, als ihm der Kardinal leicht über den Kopf strich und dann sein Kinn anhob. Rosaria wandte sich ab. Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals, wissend, was in diesem Raum geschehen würde, und doch fühlte sie sich machtlos.
Sie schaute ein letztes Mal zu Marco, dessen unschuldige Augen sie mit stummer Frage ansahen, und erfasste gerade noch aus den Augenwinkeln, wie Folliero an der kurzen Hose des Jungen herumnestelte.
2
Eine Woche zuvor.
Vom Kiosk hatte er sich eine Literflasche Freschello mitgenommen, die jetzt halb leer auf seinem verkratzten Wohnzimmertisch stand. Er hatte nur die Stehlampe an, weil die Große ihn blendete. Das Halbdunkel war ein Kokon seiner Verzweiflung und seines Selbstmitleids. Davide nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche. Dass der Fusel in der Kehle brannte, störte ihn nicht sonderlich. Ihm, der sich in guten Zeiten immer die sanften Barolos und Brunellos genüsslich einverleibt hatte, war inzwischen die Wirkung wichtiger als der Geschmack. Die dumpfe Taubheit, die mit jedem Schluck kam, war willkommen. Besser das, als sich dem Albtraum seines Lebens zu stellen.
Früher einmal hatte Dr. Davide Arcuri sich und den Menschen etwas bedeutet. Er war ein angesehener Arzt mit einer modernen Praxis und beschäftigte zwei Sprechstundenhilfen und zwei medizinische Fachangestellte. Er genoss hohes Ansehen in der Gemeinde und wurde von seinen Kollegen respektiert. Die Hände, die jetzt zitterten, hatten einst Leben gerettet. Doch die unaufhaltsame Spirale des Alkohols hatte alles zerstört. Anfangs trank er nur gelegentlich, um den Stress abzubauen, den das Leben als Arzt mit sich brachte. Doch nach und nach wurde die Flasche zu seinem ständigen Begleiter. Die Nächte wurden länger, die Tage kürzer, und irgendwann hatte er die Kontrolle verloren. Als die Sucht sichtbar wurde, blieb ihm nicht viel übrig. Sein Ruf war ruiniert, die Patienten hielten sich fern. Der Tag, an dem ihm die Approbation entzogen wurde, war der Tiefpunkt seines Lebens. Der Brief lag auf dem Tisch, seine Hände zitterten, als er ihn öffnete. Die Worte verschwammen vor seinen Augen, aber die Bedeutung war klar: Er durfte nie wieder als Arzt praktizieren. Sein Herz sank, und die Flasche Wodka, die immer in Reichweite war, wurde zu seinem ständigen Begleiter. Die Scham, die Hilflosigkeit – es war, als würde ihm die Welt den Boden unter den Füßen wegziehen. Die Abwärtsspirale war nicht mehr aufzuhalten, und jetzt war er nur noch ein Wrack, gefangen in einer Endlosschleife aus Seelenqual und bitterem Zynismus.
Davide wusste, dass er seine Frau Jolanda und ihren kleinen Sohn Marco im Stich ließ. Er sah es in Jolandas Augen – die Enttäuschung, die Wut, aber auch diese erschütternde Müdigkeit, die Menschen bekommen, wenn sie jahrelang kämpfen, ohne jemals zu gewinnen. Marco, der einst so fröhlich und voller Energie war, sprach kaum noch mit ihm. Der Junge wich seinem Vater aus, als ob er spürte, dass Davide ein Schatten seiner selbst geworden war, unfähig, sich um ihn zu kümmern oder ihn zu beschützen.
Davide nahm noch einen großen Schluck, und der vertraute Nebel begann, seinen Geist zu umhüllen. Die Schärfe der Realität verblasste, und genau das war es, was er wollte – dieses Gefühl von Nichts. Kein Elend, keine Schuld, keine Verantwortung. Aber auch keine Hoffnung. Es war ihm schmerzlich bewusst, dass Jolanda abends arbeitete, um die Familie über Wasser zu halten. Die Kneipe, in der sie sich abrackerte, war kein guter Ort, schon gar nicht für jemanden wie Marco, der oft mitkommen musste, wenn Davide zu betrunken war, um auf ihn aufzupassen. Tief im Inneren nagte die Schuld an ihm, doch er hatte nicht die Kraft, etwas zu ändern. Er hatte längst kapituliert.
Aus seinem alten, beigen Ohrensessel am Fenster, in dem er meistens saß, konnte er Jolanda beobachten, wenn sie abends mit dem kleinen Marco das Haus verließ. Dann hasste er sich. Er war mager geworden und sah mit seinen zweiundvierzig Jahren aus wie ein Mittfünfziger. Seine dunkelbraunen Haare waren oft fettig und unansehnlich, und einzelne Strähnen hingen ihm ins Gesicht. Es störte ihn nicht mal, dass seine Flasche auf dem kleinen Beistelltisch festklebte. Hinter seinem Vollbart war der einst gut aussehende Arzt noch zu erahnen, wenn man die traurige Mimik um seine geschwollenen Tränensäcke und die wässrigen Augen außer acht ließ. Nach jedem Schluck wurde das Leben leichter.
Jolanda war achtunddreißig und täuschte ihrer Umwelt Tag für Tag die wahre Lebensfreude vor. Eine quirlige, attraktive und zufriedene Frau könnte man meinen. Aber vor Jahren schon hatte sie die Hoffnung aufgegeben, dass sich etwas an ihrem Dasein ändern würde. Sie trug die Last der Familie auf ihren Schultern, arbeitete jede Nacht in der Kneipe La Caverna, die mehr einem Treffpunkt für zwielichtige Gestalten als einem echten Lokal glich. Jolanda wusste sich anzupassen. Ihre auffällige, blonde Pony-Frisur, die fast die ganzen Augen verdeckte, ihre immer engen, halblangen Röcke und die High Heels passten ins Milieu. Die Mafia hatte den Laden verpachtet und kontrollierte ihn. Das konnte man nicht übersehen. Doch sie hatte keine Wahl und freute sich über ihren Job. Das Geld war knapp, und Davide konnte nichts dazu beitragen.
An den Tagen, an denen ihr Mann zu tief ins Glas geschaut hatte – was praktisch immer der Fall war – nahm Jolanda ihren Sohn Marco mit in die Kneipe. Er wurde gerade erst sechs, zu klein, um alleine zu bleiben, aber aufgeweckt, stets neugierig und voller Fragen. Das Leben, in das er hineingeboren wurde, war alles andere als kindgerecht.
In der Kneipe verbrachte der Kleine die Zeit meist im Hinterzimmer. Es war schmutzig, mit abgewetzten Sofas und einem Fernseher, der kaum funktionierte. Marco spielte stumm mit ein paar kaputten Spielzeugen oder schaute auf den Bildschirm, solange seine Mutter zwischen den Tischen hin- und herlief, Getränke servierte und dabei den kruden Witzen der Männer auswich. Er verstand nicht viel von dem, was um ihn herum geschah, doch er merkte, dass die Gäste, die hier verkehrten, etwas Bedrohliches an sich hatten.
Eines Abends, als Jolanda ihn wieder mitgenommen hatte, fiel Marco einem der ranghöheren Mafiosi auf. »Wer is’n der Kleine?«, fragte er in die Runde, als er den Jungen im Flur stehen sah.
»Das ist Jolandas Racker«, murmelte einer der anderen und nahm einen tiefen Zug an seiner Zigarette. »Der hängt immer hier ab, wenn der Alte wieder besoffen ist.«
Rocco musterte das Kind mit einem abschätzigen Blick. »Hm. Sieht robust aus.« Er nickte und verließ den Raum. Später am Abend meldete er Marco seinem Chef Don Massimo Venturi.
»Ein Junge, sagst du? Und die Alte arbeitet für uns?«, fragte der Don, ohne den Blick von seinen Unterlagen zu heben.
»Ja, Boss. Der Kleine ist oft da. Vielleicht was Nützliches für uns.«
Venturi hob eine Augenbraue. »Interessant – ich hab gerade vorhin ’ne Anfrage von ganz oben bekommen. Für die heiligen Hallen. Du weißt, was das heißt.«
Rocco grinste kalt. »Fleischbeschaffung?«
»Genau. Wir liefern den Jungen. Der Rest geht seinen Weg.«
Innerhalb weniger Tage wurde der Plan in Gang gesetzt. Jolanda ahnte nichts, als zwei Männer in eleganten Anzügen eines Abends die Kneipe betraten und sich diskret im Hintergrund hielten. Einer von ihnen beobachtete Marco im Hinterzimmer, während der andere unauffällig mit Venturi sprach. Noch in derselben Nacht bekam der Auftraggeber die Nachricht: »Bestellung« ausgeführt.
An diesem Abend, gegen Mitternacht, als der größte Trubel in der Kneipe nachließ, ging Jolanda nach hinten zu Marco. Der Raum war leer. Zuerst dachte sie, er sei vielleicht eingeschlafen oder hätte sich irgendwo hingelegt. Sie durchsuchte das Zimmer, rief leise seinen Namen – doch die Antwort blieb aus. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Sie rannte zurück in den Schankraum, suchte mit den Augen jeden Winkel ab, aber von Marco keine Spur.
»Habt ihr meinen Jungen gesehen?«, fragte sie hektisch, ihre Stimme zitterte leicht. Die paar verbliebenen Gäste starrten sie nur gleichgültig an. Niemand reagierte. Sie fragte erneut – lauter dieses Mal, doch kein Mensch schien sich zu interessieren.
Panik breitete sich in ihrem Magen aus, als sie nach draußen stürmte. Die Straße war leer, die Nacht still bis auf das ferne Summen der Stadt. Sie rief Marcos Namen immer wieder, während sie durch die Gassen lief. Ihre Schritte hallten auf dem Pflaster, und mit jedem Moment, der verstrich, wuchs ihre Angst. Wo war ihr Junge?
Nach einer verzweifelten Suche, die endlos erschien, kehrte sie wieder zur Kneipe zurück. Ihre Hände zitterten, und ihr Gesicht war bleich vor Angst. Sie stürmte auf den Barbesitzer zu, Tränen schossen ihr in die Augen. »Mein Sohn–Marco – er ist weg! Du musst mir helfen!«
Der Mann hinter der Theke – ein breitgebauter Typ mit kaltem Blick – schaute sie nur an, als hätte sie ihm einen schlechten Witz erzählt. »Hör mal, Jolanda«, sagte er ruhig und nahm einen Schluck von seinem Drink, »niemand wird hier Ärger machen. Nicht für dich, nicht für deinen Jungen. Glaube mir, was hier abgeht, willst du nicht wissen. Es ist eine Nummer zu groß für dich.«
»Was – was meinst du damit?« Jolandas Stimme war kaum noch ein Flüstern, während die Bedeutung seiner Worte in ihr sickerte.
»Es ist besser, wenn du aufhörst zu fragen«, sagte der Mann und sah sie ernst an. »Dieser Laden gehört Don Massimo. Verstehst du? Nichts passiert hier, ohne dass er es will. Du solltest dich damit abfinden, dass – der Kleine jetzt – woanders ist.«
Jolanda spürte, wie ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Tränen liefen ihr über die Wangen, doch niemand im Schankraum nahm Notiz davon. Sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, zur Polizei zu gehen. In einer von der Mafia kontrollierten Kneipe wie dieser würde die nicht ermitteln. Es war, als hätte sich Marco in Luft aufgelöst – und niemand würde jemals nach ihm suchen.
Die Kälte kroch in ihre Knochen, als die Realität sie traf: Ihr Sohn war verloren, verschleppt von Menschen, gegen die sie machtlos war. Sie wollte schreien, weglaufen, irgendetwas tun – doch sie stand einfach nur da, wie gelähmt von der schieren Grausamkeit dessen, was passiert war.
Dann hörte sie plötzlich einen Laut aus dem Hinterzimmer. Jolandas Herz setzte einen Schlag aus. Könnte es sein? War Marco doch noch da? Sie rannte in die Richtung des Geräuschs – aber als sie die Tür aufriss, starrte sie in eine gähnende Dunkelheit. Nichts. Niemand. Und die Stille verschlang sie mit der kalten, bitteren Wahrheit im Raum. Die Katze schmiegte sich plötzlich an ihre Beine und verschwand wieder lautlos. Jolanda hasste das Tier für die enttäuschende Wunschprojektion.
3
Die Fahrt dauerte nicht sehr lange, aber für Marco fühlte sie sich endlos an. Auf der Rückbank sitzend sah er die Dunkelheit der Nacht vorbeirauschen und sie raubte ihm den Atem. Sein Herz klopfte wild, und die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Er hatte es gerade noch geschafft, seinen Teddy zu greifen, als die Männer ihn gepackt und ins Auto gezerrt hatten. Jetzt klammerte er sich verzweifelt an den weichen Plüsch, der ihm zumindest etwas Trost in dieser schrecklichen Situation bot.
Als der Wagen schließlich stoppte, sah Marco durch das Fenster die Silhouette eines großen Gebäudes, das im schwachen Mondlicht bedrohlich wirkte. Der Anblick ließ ihn schaudern. Pater Ricardo stand bereits am Eingang des Waisenhauses Santa Lucia und wartete. Sein Gesicht war reglos, kalt und unerbittlich.
»Habt ihr den Kleinen?«, fragte er knapp, ohne eine Spur von Mitgefühl.
»Yep, wie bestellt«, sagte der Beifahrer, als er die Tür öffnete und Marco unsanft nach draußen zog.
»Bringt ihn rein«, murmelte der Pater. »Wir sondieren ihn wie immer. Melde mich, wenn wir wissen, wo er hingehört.«
»Guter Mann, bring ihn selbst rein, ich muss weg«, sagte der Fahrer, gab ihm einen schiefen Gruß und fuhr davon, bevor das Tor sich hinter ihnen schloss. Die Lichter des Vans verschwanden in der Nacht und mit ihnen auch das letzte Stück der Welt, die Marco kannte.
Marco stand zitternd vor dem riesigen Waisenhaus. Die Hand des Paters auf seiner Schulter fühlte sich kalt und schwer an wie ein eiserner Griff, der ihn in diese neue, bedrohliche Realität zog. Jeder Schritt in Richtung des Gebäudes schien ihn weiter von seiner alten, vertrauten Welt zu entfernen.
»Komm mit«, sagte der Pater, seine Stimme klang wie das Knirschen alter Knochen. Er führte den Jungen durch die düsteren Flure des Waisenhauses. Die Wände schienen die Schreie und das Leid der vielen Kinder, die hier gelandet waren, in sich aufgesogen zu haben. Marco konnte förmlich die Verzweiflung spüren, die in der Luft hing.
Sie kamen schließlich in einen großen Schlafsaal, in dem die anderen Kinder bereits schliefen. Pater Ricardo zeigte auf ein leeres Bett in einer Ecke. »Ab jetzt ist das dein Zuhause«, sagte er ohne einen Hauch von Trost.
Marco legte sich hin und deckte sich mit der kratzigen Filzdecke zu, seinen Teddy dicht ans Gesicht gepresst. Die Stille des Raumes war erdrückend, und seine Gedanken rasten. Er wusste, dass nichts mehr so sein würde wie früher. Hinter den dicken Mauern dieses Ortes begann für ihn ein neues, schreckliches Leben – eines, das von der brutalen Realität beherrscht wurde, in der Kinder wie er als Ware galten, verschleppt für die Wünsche der Mächtigen.
In dieser ersten Nacht im Waisenhaus Santa Lucia fand Marco keinen Schlaf. Jede kleine Bewegung, jedes Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Die Schrecken des Tages verfolgten ihn in die Dunkelheit. Er konnte nicht ahnen, was ihn noch alles erwartete, aber er spürte tief in seinem Herzen, dass er kämpfen musste, um zu überleben.
4
Das Waisenhaus Santa Lucia, einst ein imposantes Anwesen und Schmuckstück, wirkte alt und heruntergekommen. Der Putz bröckelte an vielen Stellen, Efeu wuchs über die Mauern, und die Fenster ließen kaum Licht herein. Die hohen, knarrenden Türen öffneten sich in eine unprätentiöse Eingangshalle, wo Kinder oft still auf den Holzbänken saßen. Im Speisesaal standen lange Tische, beleuchtet von einem schwachen Kronleuchter, während Nonnen das Essen verteilten und Gebete murmelten.
Im Innenhof pflegten die Schwestern einen kleinen Garten, und ein Brunnen plätscherte leise. Die Kinder spielten dort oder saßen ruhig beisammen. Der Tag war von Routine geprägt: Morgengebet, einfache Mahlzeiten, Unterricht und Aufgaben. Den Nachmittag verbrachten sie oft im Hof, doch die bedrückende Atmosphäre war latent vorhanden. Abends gingen die Kinder in die Kapelle zum Gebet, bevor sie sich in ihre einsamen Betten schlafen legten.
Seit seiner Entführung lebte Marco in diesen tristen Mauern, die ihn täglich daran erinnerten, wie hoffnungslos seine Welt war. Trotz seiner jungen Jahre erzählten seine Augen Geschichten von Traurigkeit und Belastung, die weit über sein Alter hinausgingen. Hier erlebte er eine Kindheit, die kaum eine war.
Er war ein stiller Junge, oft für sich allein. Er versteckte sich gerne in den Ecken des Gebäudes, wo er ungestört nachdenken konnte. Manchmal saß er stundenlang dort und verlor sich in seiner Fantasiewelt, während die anderen Kinder spielten.
Es gab einen weiteren Ort, an den sich Marco oft zurückzog: den Innenhof. Dort, am alten Brunnen, fand er für kurze Zeit Frieden. Das Plätschern des Wassers brachte ihn immer zur Ruhe. Er spielte mit den Wellen, die er mit seinen Händen verursachte, und stellte sich vor, dass er darauf nach Hause reiten könnte. Hier träumte er von einer Zukunft, weit weg von diesen dunklen Mauern.
Immer wenn er vom Vatikan zurückgebracht wurde, versorgte Schwester Rosaria seinen gepeinigten Körper und hoffte, dass alles verheilt war, sollte der Kardinal wieder nach ihm rufen lassen. Seine Seele zu heilen aber überstieg ihre Kraft. Dennoch bemühte sie sich, durch aufmunternde Worte und Trost einen Funken Hoffnung zu spenden. So lange, bis sich der Teufel erneut sein kleines Opferlamm holte.
Im Waisenhaus wuchs Marco mit der festen Überzeugung auf, dass das Leben für ihn mehr bereithalten musste. Dieser Glaube gab ihm die Kraft, die Zeit im Heim zu überstehen. Er träumte davon, eines Tages seinen Platz in der Welt zu finden – einen Ort, an dem er nicht nur existierte, sondern wirklich lebte.
Seine Klugheit fiel auch den Nonnen auf. Doch anstatt ihn zu fördern, schienen sie eher bemüht, die Talente zu unterdrücken. Für sie war seine Intelligenz keine Stärke, sondern etwas, das Unruhe verursachen könnte. Sie hatten für die Waisen nur die unbedingt notwendige Schulbildung wie Lesen, Schreiben und die Grundrechenarten vorgesehen. Die Kinder sollten einfach funktionieren, wenn der Kardinal zu Besuch kam, sie in den Vatikan gerufen oder ins ›Ferienlager‹ gebracht wurden. Um Ärger zu vermeiden, lernte Marco schnell, sich zurückzuhalten und seine Fähigkeiten zu verstecken. Er verspürte ein diffuses Gefühl von Wut und Schmerz, das er nicht verstand, von einer tiefen, rohen Emotion getragen.
Nach seinen Eltern fragte er nicht mehr, aber das Fegefeuer fing an zu lodern.
5
Der Morgen nach Marcos Entführung war der traurigste ihres Lebens. Der Junge war verschwunden – entführt – entlaufen – sie wussten es nicht. Noch hatten sie keine Polizei eingeschaltet aus Angst vor ihrem Arbeitgeber. Jolanda und Davide saßen ratlos an ihrem Küchentisch, um zu frühstücken, aber sie empfanden beide das Essen als pietätlos in dieser Situation. Die Trauer war zu groß. Also aßen sie nichts und starrten ins Leere. Davide hatte sein altes weißes Golfshirt an, ein Relikt aus besseren Zeiten. Zusammen mit seiner gelben Jogginghose machte er fast einen sportlichen Eindruck. Er nahm einen Schluck Wodka. Die Flasche hatte er vorhin noch hinter dem Fernseher hervorgekramt. Es war ihm egal, was Jolanda darüber dachte, aber ihre Mimik schrie ihn förmlich an. Es war dieser schuldzuweisende Gesichtsausdruck mit weit geöffneten Augen und aufgeblähten Nüstern, den sie hatte, wann immer er trank. In diesen Augenblicken erinnerte sie ihn an Anna Magnani in Mamma Roma. Besonders wenn sie ihren schwarzen, langärmeligen Pulli trug, erweckte es den Anschein, als ob sich der Schmerz ganz Italiens im Gesicht manifestieren wollte.
Aber heute trauerten sie um Marco, den kleinen fröhlichen Jungen mit den großen braunen Augen – ihr kostbarstes Glück.
Beide gaben sich selbst die Schuld, die immer wieder der Ratlosigkeit wich.
Es klingelte an der Tür. Jolanda wischte sich ihre halbunterdrückten Tränen ab, während sie durch den Flur lief. Durch den Spion sah sie einen gut gekleideten, gepflegten Herrn mittleren Alters, vielleicht um die vierzig. Sie öffnete die Tür einen Spalt. »Guten Tag.«
»Hallo – sind sie Signora Jolanda Arcuri?«, fragte er.
»Ja, was kann ich für sie tun?«
»Es geht um ihren Sohn. Darf ich reinkommen?« Der Mann schaute sie ernst an.
Erschrocken riss sie die Tür auf und bat ihn herein. Ein winziger Funken Hoffnung keimte in ihr auf, als sie ihn zum Frühstückstisch bat, an dem Davide immer noch in der gleichen Haltung verharrte.
»Bitte setzen sie sich doch«, bat Jolanda.
Der Fremde nahm Platz und zog seine schwarzen Lederhandschuhe aus. Den Mantel hatte er anbehalten. »Ich will sie nicht lange aufhalten«, sagte er sofort und schaute zu Davide und seiner Wodkaflasche.
Jolanda hielt es nicht mehr aus: »Sind sie von der Polizei? Wo ist Marco? Wissen sie was?«, fragte sie ungeduldig.
»Entschuldigen sie bitte die Unhöflichkeit. Mein Name ist Venturi – Massimo Venturi.« Er machte eine Pause und kniff die Lippen zusammen. »Ihr Sohn ist in guten Händen – wir sind eine private, man kann sogar sagen, familiäre Institution und agieren weltweit in vielen öffentlichen Bereichen. Unter anderem kümmern wir uns um Kinder, denen ein stabiles Elternhaus nicht vergönnt ist. So leid es mir tut – das ist bei ihrem Marco der Fall«, bemerkte er, während er Davide provokativ anstarrte.
Jolanda wollte etwas sagen, aber der Mann hob den Zeigefinger vor seinen Mund und spitzte dabei die Lippen.
»Unsere Geschäftsleitung hat deshalb beschlossen, Marco ein sicheres Zuhause zu geben und ihm eine hoffnungsvolle Zukunft zu ermöglichen. Alle Kosten werden von der Kirche übernommen und sie brauchen sich um nichts zu kümmern.«
»Sie können uns doch nicht einfach unseren Sohn wegnehmen«, rief Davide mit brüchiger Stimme und musste dabei ein paar Mal husten.
Jolanda insistierte: »Haben sie dafür einen Gerichtsbeschluss?«
»Den brauchen wir nicht, wir sind autorisiert, Maßnahmen zu ergreifen, wenn es dem Kindeswohl hilft«, erwiderte der Fremde.
»Wer autorisiert sie und gibt Ihnen das Recht, meinen Sohn zu entführen? Ich werde die Polizei einschalten.« Jolanda war dabei, sich in Rage zu reden.
Venturi griff in seine Manteltasche. »Das ist unsere Vollmacht«, sagte er, holte mit stoischer Ruhe eine Pistole heraus und legte sie vor sich auf den Tisch.
Marcos Eltern erstarrten und waren stumm vor Schreck.
»Wie gesagt«, fuhr er fort, »dem Jungen geht es gut. Es ist nur wichtig, dass sie keinen Kontakt zu ihm haben, nicht heute und nicht in der Zukunft. Wenn sie das befolgen, wird ihm und Ihnen nichts zustoßen. Wir passen auf unsere Schützlinge auf. Gerne können sie die Polizei informieren. Bitte richten sie dort einen Gruß von mir aus – Massimo Venturi. Allerdings werden wir das als Vertrauensbruch werten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, die Ihnen nicht gefallen würden – sie arbeiten doch in meiner Gaststätte ›La Caverna‹, Signora Arcuri?«
Jolanda nickte unter Tränen. Venturi folgerte: »Ich nehme an, sie sind vernünftig genug, um meinen Rat zu befolgen: Lassen sie alles auf sich beruhen und vergessen sie Marco.« Er nahm die Pistole und steckte sie mit einer gravitätischen Bewegung weg.
»Leben sie wohl«, flüsterte er noch, während er aufstand und die Wohnung verließ.
Jolanda und Davide saßen da wie festgenagelt und bewegten sich erst wieder, nachdem die Haustür deutlich hörbar ins Schloss gefallen war.
Sollte das die Strafe für ihre kaputte Ehe sein? Oder war es eine gottgesandte Prüfung?
6
Schwester Rosaria strahlte eine natürliche Schönheit aus, die in scharfem Kontrast zu ihrer kargen Umgebung und ihrer Berufung stand. Obwohl sie keinerlei Schminke trug und ihre schwarze Ordenstracht schlicht war, hätte sie mühelos mit den Models konkurrieren können, die sich auf den Laufstegen der Modewelt zeigten. Ihre Gesichtszüge waren klar und harmonisch: hohe Wangenknochen, sanfte Augen und Lippen, die selbst in Zurückhaltung ihre Vollkommenheit nicht verbergen konnten.
Ihr Zimmer im Westflügel des Waisenhauses war ein Ort der Stille und des Rückzugs. Es war so bescheiden eingerichtet, dass es den Eindruck erweckte, als wären jegliche weltlichen Annehmlichkeiten bewusst ferngehalten worden. Ein rustikales Bett, das bei jedem Hinsetzen leicht knarrte, ein kleiner Schreibtisch aus dunklem Holz und ein passendes Bücherregal – nichts in diesem Raum hätte auf den ersten Blick ihre wahre Tiefe und Komplexität verraten. In den Regalen standen vor allem theologische Schriften und Gebetsbücher, allesamt abgegriffen vom wiederholten Lesen und Studieren. Aber bei genauerem Hinsehen entdeckte man auch ein paar Werke von Philosophen und Dichtern, die einen anderen Teil von Schwester Rosaria widerspiegelten – einen, der vielleicht nicht ganz so klar in den engen Rahmen ihrer religiösen Berufung passte.
Das große Fenster dominierte den Raum und eröffnete einen weiten Blick auf den Petersdom, der über der Stadt aufragte. Rosaria verbrachte oft Zeit dort, stumm, ihre Augen auf die Kuppel gerichtet, während sich ihre Gedanken zwischen Gebet und Reflexion bewegten. Es gab Momente, in denen sie sich fragte, ob ihre Berufung wirklich alles war, wonach sie sich sehnte. Ihre Augen verrieten manchmal eine innere Unruhe, die sie tief in sich begrub – zumindest nach außen hin.
Pater Antonio, einer der älteren Priester, klopfte sanft an ihrer Tür. Er trat ein. »Schwester Rosaria, ich sehe sie oft hier am Fenster. Wonach suchen sie in der Ferne?«, er zeigte mit ausgestrecktem Arm nach draußen.
Rosaria lächelte leicht, ohne den Blick vom Petersdom abzuwenden. »Manchmal mache ich mir Gedanken darüber, ob ich Antworten finde, wenn ich lange genug in die Weite schaue. Vielleicht sogar auf Fragen, die ich noch nicht gestellt habe.«
Pater Antonio nickte nachdenklich. »Die Kuppel der Basilika hat eine Art Magie, nicht wahr? Sie erinnert uns daran, wie klein wir sind – und doch, wie nahe wir dem Himmel sein können.«
Rosaria wandte sich ihm zu, ihre Augen suchten seine. »Oder sie zeigt uns, wie weit wir manchmal von uns selbst entfernt sind.«
Trotz ihrer bescheidenen Kleidung – der schwarzen, unscheinbaren Ordenstracht und der schlichten Haube, die ihre langen, welligen, brünetten Haare verbarg – blieb ihr graziler, beinahe majestätischer Gang unverkennbar. Sie bewegte sich mit einer mühelosen Eleganz, die wie ein stiller Protest gegen die Einschränkungen ihres Lebens in den Mauern des Klosters wirkte. Selbst ihre zurückhaltende Art konnte nicht verhindern, dass sie im Auge des männlichen Klerus zu einem Symbol unbewusster Anziehung wurde.
»Schwester Rosaria«, sagte ein junger Priester namens Paolo zögernd, als er sie im Flur traf. »Ihre Anwesenheit – ich meine – sie haben eine Aura, die uns an das Schönste im Leben erinnert.« Er stockte sichtlich verlegen.
Rosaria hob eine Augenbraue und sah ihn sanft an. »Die wahre Schönheit liegt nicht im Äußeren, Pater Paolo. Sie ruht in den Entscheidungen, die wir für unser Leben treffen.«
»Ja, natürlich«, stammelte er, »aber – bei Ihnen ist es schwer, das zu ignorieren.« Er senkte den Blick, offensichtlich bemüht, seine Gedanken zu ordnen.
Rosaria lächelte verhalten. »Unser Weg ist nicht immer einfach. Doch es ist der, den wir gewählt haben.«
Viele der Priester, die ihren Weg kreuzten, waren sichtlich von ihrer Anwesenheit berührt. Ihre Schönheit war für sie eine Prüfung, eine Herausforderung für ihre zölibatären Gelübde. Sie duftete nach Leben – eine Frische und Energie, die in den Korridoren von Santa Lucia selten war. Jeder Schritt, den sie machte, schien die Männer an die Welt jenseits der Mauern zu erinnern, an die Versuchungen, denen sie entsagen mussten.
Ein anderer Priester, Pater Giulio, sprach sie eines Abends an. »Schwester, wie bewahren sie sich diese Ruhe? Diese – innere Gelassenheit, trotz allem?«
Rosaria sah ihm in die Augen, einen Hauch von Melancholie in ihrem Blick. »Ich habe gelernt, meine Kämpfe im Stillen zu führen, Pater Giulio. Nicht alles, was ruhig aussieht, ist es auch.«
Pater Giulio seufzte. »Manchmal frage ich mich, ob es wirklich möglich ist, sich vollkommen von der Welt zu lösen.«
»Vielleicht liegt die Antwort darin, dass wir uns nicht lösen sollen«, antwortete sie, »sondern lernen müssen, in ihr zu leben, ohne uns zu sehr von ihr fesseln zu lassen.«
Doch Rosaria war sich der Wirkung, die sie auf andere hatte, schmerzlich bewusst. Sie spürte die Blicke, die sich auf sie legten, und die Spannung, die in ihrer Nähe oft entstand. Es war eine Last, die sie still mit sich trug – eine, die sie zu verdrängen versuchte, während sie ihre Gebete sprach und ihre tägliche Arbeit verrichtete. Aber tief in ihrem Inneren wusste sie, dass sie in gewisser Weise ein Rätsel war, ein Paradoxon, das sowohl für die Kirche als auch für sie selbst schwer zu ertragen war. Und sie betörte damit nicht nur die einfachen Priester.
7
Das Telefon klingelte im Amtszimmer von Kardinal Folliero. Er nahm ab und räusperte sich: »Ja?«
Pater Ricardo war am anderen Ende: »Signore Venturi möchte sie sprechen, es sei dringend.«
»Stellen sie durch.« Folliero war ungeduldig.
Es klickte in der Leitung. »Eminenz du alter Lüstling, wie ist das werte Befinden?«
»Es könnte besser sein nach der letzten Nacht.«
»Bei mir das Gleiche. Der neue Kleine war lebhaft gestern. Hat viel gezappelt – na ja, das legt sich mit der Zeit. Aber da könnten Deine Nonnen beim nächsten Mal ein bisschen nachhelfen, wenn du weißt, was ich meine.«
Der Kardinal grinste, »Du kannst aber auch nicht genug kriegen, du verwahrloster Hurenbock.«
»Den Hurenbock nehme ich Dir übel, mein Freund. Das kostet Dich mindestens eine Kiste Cohibas«, der Don war amüsiert.
»Ist notiert, Signore Venturi.«
»Warum ich anrufe«, der Mafioso wurde etwas seriöser in der Ansprache, »es gibt wieder ein paar Anfragen nach frischem Fleisch vom Russen und von unseren arabischen Freunden. Hast du was anzubieten?«
Folliero scherzte: »Du weißt doch – unser Kühlhaus ist immer gut gefüllt. Nächste Woche könnte ich einen Termin machen. Sind zehn Einheiten genug oder soll ich nachlegen?«
»Nicht notwendig« Venturi verabschiedete sich zynisch wie immer, »und mit deinem Geiste, Amen.«
Der Kardinal genoss die Geschäfte mit Massimo Venturi. Im Vergleich zu seinen weltfremden Kollegen war der Don erfrischend unkompliziert.
Mehr noch, diese beiden ungleichen Spielebenen beherrschte Folliero wie ein Schachgroßmeister.
Edoardo Folliero wurde mit neunundvierzig Jahren als einer der jüngsten Bischöfe zum Kardinal ernannt – eine Beförderung, die er mit gezielten Verbindungen sowohl in der Kirche als auch in weltlichen Kreisen geschickt vorbereitet hatte. Trotz seiner schlichten Erscheinung und seines sanften, weisen Auftretens verbarg sich hinter der Fassade ein manipulativer Narzisst.
Mit grauem, akkurat gekämmtem Haar und tiefblauen Augen, in denen etwas Unergründliches lag, strahlte er eine unaufdringliche Erhabenheit aus, die Menschen anzog. Er trug die purpurrote Soutane seines Amtes mit einer betonten Bescheidenheit, obwohl der goldene Kardinalsring seine Autorität unmissverständlich demonstrierte.
Folliero war bekannt für seine scharfsinnigen Reden, die spirituelle Weisheit mit menschlicher Wärme kombinierten. Doch nur wenige erkannten die dunkle Seite hinter seinem Charisma: Er war ein Meister der Manipulation, skrupellos im Streben nach Macht. Sein ultimatives Ziel war klar – der Papstthron. Unterstützt durch seinen Freund Don Massimo Venturi und dem Einfluss der Mafia würde Folliero alles daran setzen, die Kirche nach seinen Vorstellungen zu formen. Seine Eloquenz und sein strategisches Geschick waren seine schärfsten Waffen, doch er wusste, dass er ohne seine geheimen Verbündeten kaum eine Chance gegen die anderen ambitionierten Kandidaten hatte.
Die Freundschaft und umsichtige Vereinigung mit dem Don war nicht bloß zweckmäßig. Er wusste, dass die Autorität des Vatikans weit über die geistliche Kompetenz hinausreichte und in das weltliche, häufig korrupte Geflecht von Politik und Einflussnahme hineinreichte. Seine Verbindungen zur Mafia ermöglichten es, auf ein großes Netzwerk zuzugreifen. Dieses bot ihm nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch die Möglichkeit, Gegner auszuschalten und Verbündete zu gewinnen.
Im Gegenzug lieferte er junges, unverbrauchtes Fleisch zu Sonderkonditionen. Seine ›Schlachterei‹ hieß Santa Lucia.
In seinem Auftrag erstellten die Spürhunde der Mafia Dossiers über seine Konkurrenten. Jede Schwäche und noch so kleine Verfehlung wurde akribisch dokumentiert und für den richtigen Moment aufbewahrt. Er wusste, dass der Zeitpunkt kommen würde, an dem er diese Informationen nutzen musste, um die Machtverhältnisse im Konklave zu seinen Gunsten zu verschieben. Er hatte keinen Platz für Zufall gelassen.
In der Zwischenzeit arbeitete er an seiner öffentlichen Persona. Der Kardinal ließ sich häufiger in karitativen Projekten sehen, spendete großzügig an Hilfsorganisationen und predigte von der Kanzel über Vergebung, Barmherzigkeit und die Notwendigkeit eines neuen, gerechteren Zeitalters in der Kirche. Die Zahl seiner Sympathisanten wuchs beständig und mit ihnen sein Einfluss. Unter anderem hatte er die Stiftung »La grazia di Maria« ins Leben gerufen, deren primärer Auftrag die Schirmherrschaft über das Waisenhaus Santa Lucia war. So konnte er dort nach Belieben schalten und walten.
Doch Folliero ahnte, dass er nicht nur nach außen hin stark wirken musste, sondern auch nach innen. Im Vatikan formierte er ein Netzwerk von Anhängern, die ihm in der entscheidenden Phase ihre Stimmen geben würden.
Er war sich bewusst, dass er über Leichen gehen musste, um seine Ziele zu erreichen. Der narzisstische Hunger nach Bewunderung und Kontrolle kannte keine Grenzen, und er war bereit, jeden zu opfern, der ihm im Weg stand. Der Kardinal war nicht nur ein geistlicher Führer, sondern ebenso ein Virtuose der Intrige und des Verrats ohne Gnade. Seine eigene, obwohl clever kaschierte Arroganz war ein tragisches Symbol für die Verderbtheit, die sich hinter der Maske der Heiligkeit verbarg. Folliero hatte noch ein weiteres Laster, mit dem er seinem eigenen Untergang schrittweise näher kam.





























