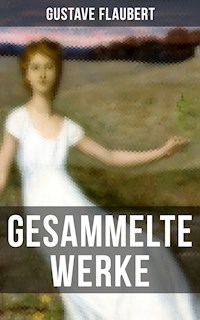Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Roman eines jungen Mannes ist der letzte vollendete Roman des französischen Schriftstellers Gustave Flaubert. Er erschien 1869 und gilt heute als einer der einflussreichsten Romane des 19. Jahrhunderts. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Provinzlers Frédéric Moreau, der nach Paris geht, wo er sich eine große Zukunft in Politik, Literatur und Liebe erhofft. Er verpasst jedoch die ihm sich durchaus bietenden realen Chancen zugunsten irrealer, idealer Ziele, und zwar vor allem aufgrund einer langen schwärmerisch-unerfüllten Liebe zu einer verheirateten Frau, die ihn absorbiert und paralysiert. Nachdem auch seine kurze Begeisterung für die politischen Ideale und Ziele der 48er Revolution verpufft ist, versinkt er in intellektueller Mittelmäßigkeit. Halbherzig studiert er Rechtswissenschaften und nach einem mittelmäßigen Abschluss kehrt er in seinen Geburtsort aufs Land zurück, wo er bei seiner Mutter lebt und unentschlossen die Zeit verbummelt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 720
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustave Flaubert
Der Roman eines jungen Mannes
Der Roman eines jungen Mannes
Gustave Flaubert
Impressum
Texte: © Copyright by Gustave Flaubert
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by A. Gold / A. Neumann
Verlag:Das historische Buch, 2024
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
Eine Vorrede
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Eine Vorrede
Venedig, den 16. September 1904.
Sehr geehrter Herr Gold!
Es war überaus freundlich von Ihnen, mir die Korrekturbogen Ihrer Übersetzung hierher schicken zu lassen, hierher, wo ich vor Jahren – ich weiß nicht, ob drei oder vier oder fünf Jahren – das Original mit so tiefem Eindruck gelesen habe: freilich auch damals nicht zum ersten Male, und wohl auch nicht zum letzten: für mich gehört die Education Sentimentale zu jenen Büchern – wie wenige gibt es ihrer, wie sehr wenige! – die uns durchs Leben begleiten. Eines jener seltenen Bücher scheint sie mir zu sein, die sich auf das Ganze des Lebens beziehen, und neben dieser zur durchsichtigsten Einheit zusammengeflochtenen Vielfalt scheint mir selbst die wundervoll aufgebaute Katastrophe eines Lebens und die wundervoll aufgebaute Katastrophe einer Stadt, scheinen mir die mächtigen Qualitäten der beiden Bücher, die Madame Bovary und Salammbô heißen, zu verblassen. Sie ist ein gefährliches Buch und ein heilsames; diese Seiten können eine grenzenlose Entmutigung ausatmen und wieder läßt sich aus ihnen eine so unendliche Belehrung schöpfen, so viel Einsicht in das wirre Kräftespiel unseres Lebens gewinnen! Unseres Lebens. Und doch ist dieses Buch nicht von heute; es malt eine Zeit, die weit hinter uns liegt, und es malt sie so treu, ist so sehr ein Dokument dieser Zeit vor 1848, daß ich Männer weiß, die heute sechzig alt sind und die nicht imstande sind, dieses Buch objektiv zu lesen, so sehr ergreift sie darin die Atmosphäre ihrer frühen Jugend und nimmt ihnen den Atem. So wird dieses Buch, das schon heute zweien getrennten Zeiten anzugehören scheint, wohl noch vielen Zeiten angehören. Sie müssen sich freuen zu denken, Ihre große Mühe einem Buche geopfert zu haben, das noch eine ferne Nachwelt so in Händen haben wird, wie wir heute die Geschichte von Manon Lescaut oder ich weiß nicht welches andere vereinzelte Werk einer versunkenen Zeit in Händen haben. Es ist schön, sich einem Werk hinzugeben, das bleiben wird. Aber es hat nicht meiner bedurft, Ihnen das zu sagen. Denn dieser Gedanke hat Sie ermutigt, eine Arbeit zu beginnen, von der ich Ihnen schwer sagen kann, wieviel Achtung und Sympathie sie mir einflößt. Dieser Gedanke und die leidenschaftliche Freude, das Vorzügliche zu erkennen und ihm zu dienen, hat Sie aufrecht gehalten, so oft Sie nahe daran waren, unter der übernommenen Last zusammenzubrechen. Und Sie müssen oft so weit gewesen sein. Wenn ich die Masse dieses Buches bedenke, und eine Masse von der größten Konzentration, der unheimlichsten geistigen Spannung – und ein Buch, in welchem jede Zeile geschrieben ist, dies Wort in seiner äußersten ehrfurchtgebietendsten Tragweite genommen – so denke ich, es muß Ihnen zuweilen gewesen sein wie einem Menschen, der allein, mit seiner kleinen Lampe und seinen Werkzeugen, einen Stollen durch das Innere eines Berges triebe, eines lebendigen Berges voll so furchtbaren inneren Druckes, daß er jeden Stein der kaum erbauten Wölbung über Nacht zu Staub zermalmte. Aber Sie müssen sich auch bewußt gewesen sein, eine jener Arbeiten zu verrichten, die voll Verzichtes und voll innern Stolzes sind, etwas, das der Arbeit des unermüdlichen Gelehrten und des glänzenden, sein Licht in einer Stunde vergeudenden Journalisten ebenbürtig ist. Es widerstrebt mir, denen, die es nicht schon wissen, zu sagen, daß Übersetzen, wirkliches Übersetzen, dasselbe ist wie Schreiben. Denn ich fürchte, sie würden auch nicht verstehen, was Schreiben ist, nicht begreifen, daß es Schreiben und Schreiben gibt, und sich nicht überzeugen lassen, daß ein Abgrund Schreiben und Schreiben trennt. Überlassen wir das Buch denen, die es genießen werden. Ihnen aber, sehr geehrter Herr, muß es die schönste Belohnung bleiben, sich zu sagen, daß Sie versucht haben, zu übersetzen wie ein Deutscher, das Wort in dem Sinn genommen, in dem man es um 1830 oder 1860 gebraucht hätte – und daß es Ihnen und Ihresgleichen zu danken sein wird, wenn man nicht ganz aufhört, es weiter in diesem Sinn zu gebrauchen.
Ihr ergebener
Hofmannsthal.
Erstes Buch
1.
Am fünfzehnten September 1840, gegen sechs Uhr Morgens, lag die »Ville-de-Montereau«, zur Abfahrt bereit, vor dem Quai Saint-Bernard und stieß pustend schwere Rauchwolken aus.
Atemlos kamen Reisende an; Tonnen, Taurollen und Wäschekörbe versperrten die Wege; die Matrosen antworteten keinem Menschen; man stieß sich im Gedränge; die Gepäckstücke türmten sich allmählich zwischen den beiden Radkasten hoch auf, und all der Lärm wurde zum Schluß vom Ausströmen des Dampfes verschlungen, der aus dem Maschinenraum durch Metallklappen hervordrang und eine weißliche Wolke weithin ausgoß; vorne klingelte mittlerweile die Glocke ohne Aufhören.
Endlich war der Dampfer in Bewegung; und die beiden Ufer, dicht besetzt mit Speichern, Bauplätzen und Maschinen, zogen vorbei wie zwei breite Bänder, die man langsam abrollt.
Ein junger Mann von achtzehn Jahren, mit langem Kopfhaar, ein Skizzenbuch unter dem Arm, stand dicht am Steuerrad, unbeweglich. Durch den Nebel sah er auf Türme und Gebäude, deren Namen er nicht kannte; mit einem letzten Blick klammerte er sich an die Insel St. Louis, die Altstadt, Notre-Dame; und als Paris bald darauf verschwand, stieß er einen tiefen Seufzer aus.
Frédéric Moreau hatte eben sein Abiturienten-Examen gemacht und war auf dem Rückwege nach Nogent-sur-Seine, wo er zwei Monate zuzubringen gezwungen war, ehe er mit dem Studium des Rechts beginnen sollte. Seine Mutter hatte ihn, mit den unumgänglich nötigsten Geldmitteln versehen, nach Havre zum Besuche eines Onkels geschickt, dessen Erbschaft sie für ihren Sohn erhoffte; gestern erst war er von dort zurückgekehrt; und da er sich nicht in Paris aufhalten konnte, suchte er eine Entschädigung in der Länge des Umwegs, auf dem er seinem heimatlichen Städtchen wieder zustrebte. Der Lärm legte sich; alle hatten ihre Plätze gefunden; einige standen, sich wärmend, ringsum an der Maschine, deren Schornstein mit rhythmischem und langsamem Stöhnen dicken, schwarzen Rauch ausstieß; auf den Kupferröhren saßen Wassertröpfchen; das Deck erzitterte unter einer leisen Erschütterung von unten her, und die beiden Räder peitschten das Wasser mit schnellen Umdrehungen.
Das Ufer war gesäumt mit Sanddünen. Man begegnete Holzflößen, die unter dem Anprall der Wellen zu schaukeln begannen, oder einem Ruderboot, in dem ein Mann saß und fischte; dann teilten sich die Nebel, die Sonne kam hervor, der Hügel, der zur rechten Seite dem Lauf der Seine folgte, flachte langsam ab, und es erhob sich ein anderer, näherer auf dem entgegengesetzten Ufer.
Den Gipfel krönten Bäume und niedrige Häuser mit flachen italienischen Giebeldächern. An diese schlossen sich Gärten, die zum Ufer abfielen und durch Mauern abgeteilt waren; auch Gitter aus Schmiedeeisen gehörten dazu, Rasenplätze, Treibhäuser, Blumenvasen mit Geranien und Terrassen, die zum Ausruhen lockten. Mehr als einer, der diese koketten und so ruhig gelegenen Siedelungen sah, mochte den neidischen Wunsch nach solchem Besitz empfinden, um da bis ans Ende seiner Tage zu leben, mit einem guten Billard, einem Segelboot, einer Frau oder mit einer anderen Liebhaberei. Das Vergnügen einer Wasserfahrt, einigen völlig neu, erleichterte die Vertraulichkeiten. Spaßvögel begannen Scherze zu treiben. Viele sangen. Man wurde lustig. Man bot sich was zum Trinken an.
Frédérics Gedanken weilten bei dem Zimmer, in das er nun zurückkehren sollte, bei dem Entwurf eines Dramas, bei Einfällen für Bilder, bei Leidenschaften, die noch kommen sollten. Er fand, daß das Glück, das er nach seiner Ansicht kraft der Vortrefflichkeit seiner Seele verdiente, lange auf sich warten ließ. Er sprach düstere Verse vor sich hin; dabei durchmaß er das Verdeck mit schnellen Schritten; er drang bis zum Bugspriet vor, wo die Schiffsglocke war; – und da sah er in einem Kreis von Passagieren und Matrosen einen Herrn, der mit einer Bäuerin schön tat und mit dem goldenen Kreuz spielte, das sie auf der Brust trug. Es war ein heiterer Mann, ungefähr vierzig Jahre alt, mit krausem Haar. Eine schwarze Samtjacke bekleidete seinen kräftigen Körper, zwei Smaragde glänzten auf seinem Vorhemd von Batist, und sein breites, weißes Beinkleid fiel auf sonderbare rote Juchtenstiefel, die mit blauen Mustern verziert waren.
Frédérics Gegenwart schien ihn nicht zu stören. Mehrmals wendete er sich zu ihm um und zwinkerte ihm mit den Augen zu; dann bot er allen Umstehenden Zigarren an. Aber schließlich schien diese Runde ihm doch lästig zu werden, und er ging weiter. Frédéric folgte ihm.
Ihre Unterhaltung galt vorerst den verschiedenen Tabaksorten, dann ging sie wie von selbst auf die Frauen über. Der Herr mit den roten Stiefeln gab dem jungen Manne gute Ratschläge; er entwickelte Theorien, erzählte Anekdoten, führte sich selbst als Beispiel an, alles mit einem väterlichen Tone, mit einer belustigenden naiven Verderbtheit.
Er war Republikaner; war weitgereist, kannte die Geheimnisse der Theater, der Restaurants, der Zeitungen und alle berühmten Künstler, die er in intimer Weise bei ihren Vornamen nannte; Frédéric vertraute ihm bald seine Pläne an; er ermutigte ihn darin.
Plötzlich unterbrach er sich, um den Schornstein zu beobachten, dann murmelte er rasch eine lange Berechnung vor sich hin, um herauszufinden, »wie viele Kolbenumdrehungen, wenn soundso viel in der Minute erfolgen, nötig wären und so weiter«. Nachdem die Endsumme gefunden war, bewunderte er verzückt die Landschaft. Er pries es als ein Glück, daß er dem Geschäft entronnen sei.
Frédéric begann, eine gewisse Hochachtung vor ihm zu empfinden, und konnte der Versuchung nicht widerstehen, ihn um seinen Namen zu bitten. Der Unbekannte antwortete in einem Atemzug:
»Jacques Arnoux, Eigentümer des ›Kunstgewerbe‹, Boulevard Montmartre.«
Ein Diener mit einer Goldborte an der Mütze kam und meldete:
»Möchte der gnädige Herr nicht herunterkommen? Das Fräulein weint.«
Arnoux entfernte sich. Das »Kunstgewerbe« war ein Zwitter-Unternehmen, bestehend aus einer Fachzeitung für Malerei und aus einer Bilderhandlung. Frédéric erinnerte sich, diesen Titel schon wiederholt in der Auslage des Bücherhändlers in seinem Heimatorte gesehen zu haben, auf riesigen Prospekten, wo der Name Jacques Arnoux sich auffallend bemerkbar machte.
Die Sonne sandte glühende Strahlen und ließ die Metallringe, die die Masten umgaben, die Messingplatten der Brüstung und die Oberfläche des Wassers aufleuchten; dieses teilte sich vom Bug an in zwei Streifen, die sich bis an den Rand der Ufer hinzogen. Bei jeder Flußkrümmung zeigten sich immer wieder dünne Pappeln. Die Gegend war öde und leer. Am Himmel standen unbewegliche kleine weiße Wolken, – und die Langeweile, die sich unmerklich niedersenkte, schien den Gang des Schiffes zu verlangsamen und ließ die Reisenden noch uninteressanter erscheinen als zuvor.
Abgesehen von der kleinen Gesellschaft auf dem ersten Platz waren es Arbeiter und kleinere Ladenbesitzer mit ihren Frauen und Kindern. Nach der Sitte jener Zeit, sich auf der Reise möglichst schäbig zu kleiden, trug fast alles alte Mützen oder verschossene Hüte, abgenutzte schwarze Anzüge und Überröcke, deren Knöpfe bereits das Metall sehen ließen; hier und da zeigte sich unter einer Tuchweste ein mit Kaffee beschmutztes baumwollenes Hemd oder eine Simili-Nadel auf einer zerfetzten Krawatte. Einige plauderten im Stehen oder auf ihre Gepäckstücke hingekauert; andere schliefen in den Ecken; mehrere aßen. Das Deck war mit Schalen von Nüssen und Birnen, Zigarren-Abfällen und Wurstüberresten besudelt. Drei Tischler in ihren Arbeitsblusen hielten sich vor der Schänke auf; ein in Lumpen gekleideter Harfenspieler ruhte sich, auf sein Instrument gelehnt, aus. Dann und wann hörte man Kohlen in den Kessel schaufeln, ein Lachen, laute Stimmen, während der Kapitän auf der Laufbrücke unaufhörlich von einem Radkasten zum andern eilte. Frédéric wollte seinen Sitz wieder aufsuchen und öffnete das Gitter zum ersten Platz; zwei Jäger mit ihren Hunden stieß er dabei unsanft an.
Da war es mit einem Male wie eine Vision.
Sie saß mitten auf der langen Bank, ganz allein; oder waren seine Augen so geblendet, daß er nichts anderes sehen konnte? In dem Augenblicke, wo er an ihr vorüberging, hob sie ihren Kopf; er zuckte unwillkürlich zusammen; und erst nachdem er auf derselben Seite des Verdecks weiter hinaufgegangen war, sah er sie an.
Sie trug einen großen Strohhut mit blaßroten Bändern, die hinter ihr im Winde flatterten. Ihr schwarzes Haar fiel vom Scheitel in glatten Streifen tief herab, als wollte es sich liebevoll an das Oval ihres Gesichtes schmiegen. Ihr weißes, mit kleinen Tupfen geflecktes Musselin-Kleid fiel in zahlreichen Falten. Sie war mit einer Stickarbeit beschäftigt; und ihre gerade Nase, ihr Kinn, die ganze Erscheinung zeichnete sich scharf auf dem Hintergrund aus blauer Luft ab.
Da sie unbeweglich blieb, machte er einige Schritte nach rechts und links, um seine Absicht zu maskieren; dann erst pflanzte er sich dicht neben ihrem Sonnenschirm auf, der an die Bank gelehnt war; und er tat, als beobachte er eifrig eine Schaluppe auf dem Fluß.
Nie zuvor hatte er einen glänzenden Teint wie den ihrer braunen Haut, den Zauber einer solchen Taille, nie diese Feinheit der Finger, die das Licht schimmernd durchließen, gesehen. Ihren Arbeitskorb betrachtete er wie ein Wunder. Wie hieß sie? Wo wohnte sie? Was war ihr Leben, ihre Vergangenheit? Er empfand eine Sehnsucht, die Möbel ihres Zimmers kennen zu lernen, alle Kleider, die sie getragen, und die Leute, mit denen sie verkehrte; und selbst die Begierde nach ihrem körperlichen Besitz trat gegen ein stärkeres, anderes Gefühl, eine Art schmerzlicher Neugierde, die grenzenlos war, in den Hintergrund.
Eine Negerin, deren Kopf von einem Tuch bedeckt war, erschien, an der Hand ein junges Mädchen, das schon halberwachsen war. Das Kind, in dessen Augen Tränen schwammen, war soeben erwacht; sie nahm es auf die Knie. »Das kleine Fräulein ist nicht brav, und ist doch bald sieben Jahre alt. Mama wird sie gar nicht mehr liebhaben; man läßt ihr ihre Launen zu sehr durchgehen.«
Frédéric hörte das mit Interesse an, als wäre darin eine Entdeckung, ein Gewinn für ihn enthalten.
Er vermutete, daß sie Spanierin, vielleicht Kreolin, sei; die Negerin hatte sie wohl aus den Kolonien mitgebracht?
Nun aber lag hinter ihrem Rücken auf dem Messingbort der Brüstung ein langer Schal mit violetten Streifen. Sie hatte ihn gewiß schon oft auf hoher See benutzt, an langen feuchten Abenden ihre Schultern damit bekleidet, die Füße darin gewärmt, oder darin geschlafen. Jetzt glitt das Tuch, von den Fransen abwärts gezogen, immer tiefer und war in Gefahr, ins Wasser zu fallen. Frédéric machte einen Sprung und hielt es zurück. Sie sagte zu ihm:
»Ich danke Ihnen.«
Ihre Blicke trafen sich.
»Frau, bist du fertig?« rief Arnoux, der soeben auf der Kajütentreppe erschien.
Die kleine Martha stürzte sich zu ihm, hängte sich an seinen Hals und zog an seinem Schnurrbart. Plötzlich hörte sie Harfenklänge, sie wollte nun die Musik auch sehen; und bald erschien der Mann mit dem Instrument, von der Negerin herbeigeholt, in der ersten Klasse. Arnoux erkannte in ihm ein früheres Modell und duzte ihn zur großen Verwunderung der Nebenstehenden. Schließlich warf der Harfner seine langen Haare über seine Schultern zurück, streckte die Arme vor sich hin und begann zu spielen.
Es war eine orientalische Romanze, in der von Dolchen, Blumen und Sternen die Rede war. Der zerlumpte Musikant sang das mit einer schneidend scharfen Stimme; das Stampfen der Maschine zerriß die Melodie in falschem Rhythmus; er griff stärker: die Saiten zitterten, und ihre metallischen Stimmen schienen aufzuschluchzen, als klagte ein stolzes, aber besiegtes Herz seine Liebe. Auf beiden Ufern neigten sich die Bäume bis ans Wasser nieder; ein frischer Luftzug strich vorbei; Madame Arnoux sah unbestimmt in die Ferne. Als die Musik aufhörte, zuckten ihre Lider, als erwachte sie aus einem Traum.
Bescheiden kam der Harfner heran. Während Arnoux nach kleiner Münze suchte, näherte Frédéric seine geschlossene Hand der hingehaltenen Mütze und warf einen Louisdor hinein. Nicht die Eitelkeit war es, die ihn dazu trieb, dieses Almosen vor ihren Augen zu geben, sondern eine Art Opferweihe, mit der er sie in Verbindung brachte, eine fast religiöse Herzensregung.
Arnoux lud ihn ein, mit ihm in die Kajüte hinabzusteigen, und ging voran. Frédéric gab vor, schon gefrühstückt zu haben, während er in Wirklichkeit ausgehungert war; er hatte keinen Pfennig mehr in der Tasche.
Dann sagte er sich, daß er dasselbe Recht wie jeder andere habe, sich unten aufzuhalten.
An runden Tischen aßen viele Gäste, von einem Kellner bedient. Herr und Frau Arnoux hatten im Hintergrunde rechts Platz genommen. Frédéric setzte sich auf eine lange Samtbank und ergriff eine Zeitung, die neben ihm lag.
Das Ehepaar hatte die Absicht, in Montereau die Post nach Châlons zu nehmen; ihre Schweizer Reise sollte einen Monat dauern. Frau Arnoux warf ihrem Manne seine Schwäche gegenüber dem Kinde vor. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, anscheinend eine Liebenswürdigkeit, denn sie lächelte. Dann erhob er sich, um den Fenstervorhang hinter ihr zu schließen.
Der niedrige weißgestrichene Plafond warf grell das Licht zurück. Frédéric, der ihr gegenübersaß, konnte den Schatten ihrer Wimpern deutlich sehen. Sie nippte ab und zu an ihrem Glas und zerbröckelte Brot zwischen ihren Fingern, das Medaillon aus Lapis Lazuli, das an einem Goldkettchen von ihrem Handgelenk herunterhing, schlug mehrmals klirrend an ihren Teller. Indessen, ihrer Umgebung schien sie überhaupt nicht weiter aufzufallen.
Dann und wann sah man durch die Kajütenfenster die Seite einer Barke, die am Schiff anlegte, um Passagiere abzuholen oder zu bringen. Die Leute in der Kajüte sahen zu den Fenstern hinaus und nannten sich die Gegend, wo man gerade war.
Arnoux schimpfte über die Küche, beschwerte sich über die Rechnung und strich von ihrem Betrag etwas ab. Dann schleppte er den jungen Mann in das Vorderteil des Schiffes, um ihn mit Grog zu bewirten. Frédéric kehrte jedoch bald unter das Zelt zurück, wo Madame Arnoux saß. Sie las in einem dünnen Heft mit grauem Umschlag. Ihre Mundwinkel hoben sich zeitweilig, und über ihr Gesicht huschte ein Schimmer von Heiterkeit. Ihn erfaßte eine heftige Eifersucht auf den, der es verstand, sie so zu fesseln. Je mehr er sie betrachtete, desto mehr fühlte er den Abgrund zwischen ihr und sich, und ihn erfüllte ein brennender Schmerz bei dem Gedanken, sie bald unwiderruflich verlassen zu müssen, ohne ein Wort von ihr erhascht zu haben und ohne etwas in ihrer Erinnerung zu sein. Rechts dehnte sich eine Ebene aus; auf der linken Seite ging eine Weide fast unmerklich in einen Hügel über, auf dem man Weinstöcke, Nußbäume und, im Grünen versteckt, eine Mühle sah; weiter entfernt konnte man kleine Pfade unterscheiden, die zickzackförmig auf einen weißen Felsen führten. Welches Glück mußte es sein, Seite an Seite mit ihr; den Arm um sie geschlungen, dort umherzuwandern, – ihre Schleppe würde über die welken Blätter streichen, ihre Stimme könnte er hören, ihre Augen strahlen sehen. Das Schiff brauchte nur anzulegen und sie mit ihm auszusteigen, und diese anscheinend so einfache Sache war doch ebenso unmöglich, wie die Sonne von ihrer Stelle zu bewegen.
In der Entfernung zeigte sich ein Schloß mit spitzen Dächern und eckigen Türmchen. Ein Blumenbeet dehnte sich vor der Front aus, und hohe Linden bildeten Alleen, die wie dunkle Wölbungen aussahen. Auf der Terrasse zwischen Orangekübeln sah man einen jungen Mann und eine Dame. Und dann verschwand alles.
An Frédérics Seite spielte das Kind. Er wollte es küssen, aber es versteckte sich hinter der Magd. Die Mutter schalt es wegen seiner Unliebenswürdigkeit gegen den Herrn, der ihren Schal gerettet hatte. Sollte das eine Annäherung sein?
»Wird sie endlich sprechen?« fragte er sich.
Die Zeit drängte. Wie konnte man eine Aufforderung zu einem Besuch von Arnoux bekommen? Es fiel ihm nichts Besseres ein, als eine Bemerkung über die herbstlichen Farben der Landschaft.
»Nun ist bald wieder Winter, die Saison der Bälle und der Diners.«
Arnoux war jedoch ganz mit seinem Gepäck beschäftigt. Man kam jetzt Surville nahe und seinen beiden Landungsbrücken, eine Seilerbahn wurde passiert, dann eine Reihe niedriger Häuser; am Strand sah man Teerkessel und Holzabfälle; über die Düne liefen Gassenjungen und schlugen Purzelbäume. Frédéric erkannte einen Mann in einer Ärmelweste und rief ihm zu:
»Beeile dich.«
Man legte an. Mit vieler Mühe erreichte er Arnoux wieder, um sich von ihm zu verabschieden; dieser antwortete ihm mit einem Händedruck:
»Viel Vergnügen, junger Mann.«
Auf dem Kai drehte Frédéric sich um. Sie stand nahe am Steuerrad, hochaufgerichtet. Er warf ihr einen Blick zu, in den er seine ganze Seele zu legen versuchte, doch sie blieb unbeweglich, als wenn sie nichts gesehen hätte. Dann herrschte er seinen Diener an, ohne dessen Gruß zu beachten:
»Warum hast du den Wagen nicht hier herangeführt?«
Der gute Mann stammelte eine Entschuldigung.
»Du bist ein Tölpel. Gib mir etwas Geld.«
Und er ging in ein Wirtshaus essen.
Eine Viertelstunde später erfaßte ihn die Lust, wie zufällig in den Abfahrtshof der Post einzutreten. Vielleicht könnte er sie noch einmal sehen.
»Aber wozu?« fragte er sich schließlich.
Und er ließ seinen Viersitzer sich in Bewegung setzen. Seiner Mutter gehörte nur eines der Pferde, das andere hatte sie sich von Chambrion, dem Steuereinnehmer, ausgeliehen. Der Diener Isidore, der am vorhergehenden Tage vom Hause abgefahren war, hatte in Bray bis zum Abend gewartet und in Montereau übernachtet, so daß die ausgeruhten Tiere kräftig ausholten.
In endloser Folge dehnten sich Felder, auf denen schon die Ernte lag. Längs der Straße zogen sich zwei Reihen Bäume, unterbrochen von Steinhaufen. Nach und nach kamen ihm Villeneuve-Saint-Georges, Ablon, Chatillon, Corbeil, kurz, seine ganze Reise wieder in Erinnerung, und zwar in so ausgeprägten Bildern, daß ihm neue Einzelheiten und intimere Züge einfielen. Unter dem Saum ihres Kleides sah ihr Fuß in einem schmalen Schuh aus kastanienbrauner Seide hervor; das Leinwanddach war ein breiter Himmel über ihrem Kopf, und die kleinen roten Quasten an der Borte des Daches zitterten im Winde, unaufhörlich.
Sie war wie die Heldinnen der Ritterromane. Von ihrer Person hätte er nichts hinwegwünschen, nichts ihr anfügen wollen. Die Welt schien sich plötzlich vor ihm auszudehnen, ihre Person aber war der Lichtpunkt, wo alle Dinge zusammenflossen; und mit halbgeschlossenen Lidern und den Blick zu den Wolken gerichtet, sanft gewiegt durch die Bewegung des Wagens, überließ er sich einer träumerischen und unbegrenzten Freude.
In Bray wartete er die Fütterung der Pferde nicht ab, er ging allein auf der Landstraße voran. Arnoux hatte sie »Marie« angeredet. Ganz laut rief er »Marie«. Seine Stimme verlor sich in der Luft.
Im Westen flammte der Himmel purpurfarben. Große Heuschober, die sich inmitten der Felder erhoben, warfen riesenhafte Schatten. Ein Hund schlug in einer Hütte an, in weiter Ferne. Er erschauerte, von einer unerklärlichen Unruhe erfaßt.
Als Isidore ihn eingeholt hatte, setzte sich Frédéric auf den Bock, um selbst zu kutschieren. Die Schwäche war überwunden, und er war fest entschlossen, unter irgendeinem Vorwande Zutritt bei den Arnoux zu suchen und sich mit ihnen enger zu befreunden. Ihr Haus mußte wohl unterhaltend sein, Arnoux gefiel ihm; und endlich, man konnte nicht wissen –! Das Blut stieg ihm ins Gesicht, seine Schläfen hämmerten, er knallte mit der Peitsche, zog heftig an den Zügeln und zwang die Pferde zu einem so schnellen Schritt, daß der alte Kutscher ängstlich rief:
»Sachte! Aber sachte! Sie werden Ihnen durchgehen!«
Nach und nach beruhigte sich Frédéric, und er ließ den Diener erzählen.
Man erwartete den gnädigen Herrn mit großer Ungeduld. Fräulein Luise hatte geweint, weil sie gern in dem Wagen mitgefahren wäre.
»Fräulein Luise? Wer ist denn das?«
»Wissen Sie nicht? Die Kleine des Herrn Roque.«
Zerstreut erwiderte Frédéric:
»Richtig. Das habe ich vergessen.«
Schließlich konnten die Pferde nicht mehr, beide hinkten schon; und es schlug neun Uhr vom Saint-Lorent-Turme, als er auf der Place d'Armes vor dem Hause seiner Mutter anlangte. Das Ansehen der Frau Moreau, die die geachtetste Dame der Gegend war, wurde durch das geräumige Haus, das seinen Garten bis an die Felder ausdehnte, noch gehoben.
Sie stammte aus einem alten, jetzt ausgestorbenen Adelsgeschlecht. Ihr Mann, ein Nichtadliger, mit dem ihre Eltern sie verheiratet hatten, war während ihrer Schwangerschaft im Duell gefallen und hatte ihr ein etwas zusammengeschmolzenes Vermögen hinterlassen. Dreimal in der Woche sah sie Gäste bei sich, und von Zeit zu Zeit gab sie ein elegantes Diner; aber alles bis auf die Anzahl der Kerzen war im voraus berechnet, und mit Ungeduld erwartete sie den Eingang der Pachtgelder. Dieser pekuniäre Druck, den sie ängstlich wie ein Laster verbarg, hatte sie vorzeitig ernst gemacht, ohne daß ihre Wohltätigkeit dadurch einen bitteren Beigeschmack bekam. Ihre kleinen Gefälligkeiten wurden wie große Almosen aufgenommen. Man zog sie bei der Anstellung neuer Dienstboten, beim Einkochen von Früchten, bei der Kindererziehung zu Rate, und wenn der Bischof auf seiner geistlichen Rundreise in ihre Stadt kam, stieg er bei ihr ab.
Für ihren Sohn hegte Madame Moreau einen starken Ehrgeiz, und bei ihrer Vorsicht war es ihr schon jetzt unangenehm, wenn jemand in ihrer Gegenwart über die Regierung schimpfte. Zuerst würde er ja natürlich Protektion brauchen, dann aber konnte er dank seiner Fähigkeiten Staatsrat, Gesandter, Minister werden. Seine Triumphe im Gymnasium zu Sens, wo er einen Ehrenpreis errungen hatte, berechtigten zu solchem Ehrgeiz.
Als er in den Salon trat, entstand eine allgemeine Bewegung, alles erhob sich, und man umarmte ihn; dann bildete sich ein großer Halbkreis vor dem Kamin. Herr Gamblin fragte ihn sofort um seine Meinung über Frau Lafarge. Dieser Prozeß, der damals die Sensation bildete, entfesselte sofort eine leidenschaftliche Diskussion, die aber Frau Moreau zum Bedauern des Herrn Gamblin abschnitt; der hätte ein solches Gespräch für den jungen Mann, in seiner Eigenschaft als zukünftiger Rechtsgelehrter, sehr angezeigt gefunden; er verließ beleidigt den Salon.
Von einem Freunde des alten Roque konnte schließlich nichts überraschen. Vom alten Roque kam man übrigens auf Herrn Dambreuse zu sprechen, welcher soeben das Gut La Fortelle erworben hatte. Aber der Steuereinnehmer hatte Frédéric in einen Winkel gezogen, um seine Meinung über das letzte Werk Guizots zu hören. Alle wünschten das Resultat seiner Reise zu erfahren, Madame Benoit machte es besonders geschickt, indem sie sich nach dem Onkel erkundigte. Wie ging es dem guten Mann? Man hörte gar nichts von ihm! Hatte er nicht noch einen Verwandten in Amerika?
Die Köchin meldete, daß das Diner des jungen Herrn serviert sei. Die Gesellschaft empfahl sich. Als sie dann allein waren, fragte die Mutter leise:
»Nun?«
Der Greis hatte ihn sehr herzlich aufgenommen, aber sich über seine Absichten nicht geäußert.
Frau Moreau seufzte.
Wo ist sie in diesem Augenblick? dachte er sinnend. Ihr Wagen rollt, und in den Schal gehüllt, stützt sie ihren schönen Kopf im Schlaf auf die Sitzlehne.
Sie waren im Begriffe, sich zurückzuziehen, als ein Kellner aus dem »Cygne de la Croix« einen Brief brachte.
»Was gibt es?«
»Deslauriers schickt nach mir, er muß mich sprechen.«
»Ah, dein Kamerad,« sagte Frau Moreau mit einem verächtlichen Lächeln. »Die Zeit ist wirklich gut gewählt.«
Frédéric zögerte, aber die Freundschaft siegte, und er nahm seinen Hut.
»Bleibe wenigstens nicht lange,« rief ihm die Mutter nach.
2.
Charles Deslauriers' Vater, der früher aktiver Hauptmann gewesen war und im Jahre 1818 seine Entlassung genommen hatte, war dann nach Nogent übersiedelt. Dort hatte er geheiratet und mit der Mitgift seiner Frau ein Gerichtsvollzieheramt gekauft, das ihn jedoch kaum ernährte.
Verbittert durch Ungerechtigkeiten, von seinen Kriegswunden nicht geheilt und immer noch den Kaiser betrauernd, ließ er seinen Zorn und seinen Kummer an seiner Umgebung aus. Es gibt wenig Kinder, die geschlagen wurden wie sein Sohn; aber trotz der Prügel gab der Kleine nicht nach. Bei solchen Szenen versuchte die Mutter, sich ins Mittel zu legen, erreichte jedoch nur, daß auch sie mißhandelt wurde. Schließlich setzte der Hauptmann den Knaben in sein Bureau, wo er ihn den ganzen Tag am Pulte festhielt und zwang, Akten abzuschreiben, was ihm für Lebenszeit eine schiefe Schulter eintrug.
Im Jahre 1833 verkaufte der Alte sein Amt. Seine Frau war an einem Krebsleiden gestorben, und er übersiedelte nach Dijon. Später errichtete er einen Laden in Troyes und brachte den kleinen Charles, nachdem er eine halbe Freistelle für ihn erreicht hatte, auf das Gymnasium in Sens, wo Frédéric ihn kennen lernte. Aber der Altersunterschied von drei Jahren und die Verschiedenheit der Charaktere hinderten anfangs eine Intimität zwischen den Kindern.
Frédéric hatte in seinem Schranke alle möglichen Leckereien, auch Luxussachen, zum Beispiel ein Toiletten-Necessaire. Er schlief morgens gern lange, sah den Schwalben nach und las Theaterstücke; das Leben im Gymnasium erschien ihm hart, verglichen mit den Annehmlichkeiten des mütterlichen Hauses.
Dem Sohn des Gerichtsvollziehers gefiel es in der Schule. Er machte solche Fortschritte, daß er nach zwei Jahren in die Tertia kam. War es nun seine Armut oder sein unverträgliches Temperament, jedenfalls hatte er unter der starken Böswilligkeit seiner Umgebung zu leiden. Eines Tages nannte ihn ein Schuldiener vor den Kameraden einen Betteljungen, worauf Charles wie ein wildes Tier auf ihn lossprang und ihn erwürgt hätte, wenn nicht mehrere Lehrer dies verhindert hätten. Frédéric war begeistert von dieser Energie, und von diesem Tage an wurden sie innig befreundet. Die Zuneigung eines älteren Kameraden schmeichelte der Eitelkeit des jüngeren, und der andere empfand dieses Freundschaftsverhältnis wie ein unverhofftes Glück.
Sein Vater ließ ihn auch während der Ferien im Gymnasium. Eine Übersetzung Platos, die ihm durch Zufall in die Hände fiel, begeisterte ihn aufs höchste. Von da an beschäftigte er sich mit metaphysischen Studien und machte darin schnelle Fortschritte, da er seine ganzen Kräfte daransetzte; Jouffroy, Cousin, Laromiguière, Malebranche, kurz alles, was die Bibliothek enthielt, wurde von ihm verschlungen. Um an die Bücher zu gelangen, hatte er die Schlüssel stehlen müssen.
Frédérics Zerstreuungen waren weniger ernster Natur. Er zeichnete viel, unter anderem den Stammbaum Christi, der an einem Portal der Rue des Trois-Rois in Holzschnitzerei angebracht war, sowie das Tor der Kathedrale. Nachdem er sich an mittelalterlichen Dramen satt gelesen hatte, verschlang er alle Memoiren, die ihm in die Hände fielen: Froissart, Comines, Brantôme, Pierre de l'Estoile.
Diese Lektüre machte einen so starken Eindruck auf ihn, daß er den mächtigen Drang empfand, Ähnliches zu produzieren. Der Ehrgeiz erfaßte ihn, eines Tages der französische Walter Scott zu werden. Deslauriers dagegen träumte von einer neuen Philosophie mit den weitestgehenden Folgerungen.
Diese unreifen Pläne beschäftigten sie unausgesetzt, während der Pausen im Schulhofe, in der Kirche, im Schlafsaale. Auf Spaziergängen blieben sie zusammen zurück und sprachen von nichts anderem.
Sie schmiedeten Projekte für die Zeit, wo sie die Schule verlassen sollten. Zuerst würden sie eine große Reise machen, und zwar mit dem Gelde, das Frédéric bei seiner Mündigkeit zufallen mußte. Dann wollten sie nach Paris zurückkehren, zusammen arbeiten und sich nie wieder trennen. Sie träumten von Liebschaften mit Prinzessinnen in luxuriösen Boudoirs oder von wahnsinnigen Orgien mit berüchtigten Halbweltlerinnen. Freilich kamen auch Augenblicke, wo sie am Erfolge zweifelten, und dann bemächtigte sich ihrer eine tiefe Niedergeschlagenheit.
An heißen Sommerabenden, nachdem sie lange umhergewandert waren, befiel sie häufig eine Art Rausch und sie warfen sich im Felde nieder, fast betäubt, während die Mitschüler in Hemdärmeln turnten oder Papierdrachen steigen ließen. Der begleitende Hilfslehrer war gezwungen, sie wiederholt zu rufen. Dann trat man den Heimweg an, an Gärten vorbei, die durch kleine Bäche durchschnitten wurden. Die leeren Straßen widerhallten von ihren Schritten, das Gitter öffnete sich, und man stieg die Treppen hinauf; eine seltsame Trauer, wie nach großen Ausschweifungen, lähmte sie.
Der Schulinspektor behauptete, daß sie sich gegenseitig zur Überspannung reizten. Indessen war es nur Charles' Einfluß zuzuschreiben, daß Frédéric in den oberen Klassen ordentlich arbeitete; in den Sommerferien 1837 nahm er dann seinen Freund mit zu sich nach Hause.
Der junge Mann mißfiel der Frau Moreau auf das entschiedenste. Er aß für drei, am Sonntag weigerte er sich, in die Kirche zu gehen, und er hielt republikanische Reden; außerdem glaubte sie, daß er ihren Sohn in unpassende Lokale geführt habe. Man überwachte ihren Umgang. Ihre Freundschaft wurde dadurch nicht getrübt; und ihr Abschied war schmerzlich, als Deslauriers im folgenden Jahre das Gymnasium verließ, um in Paris Jus zu studieren. Frédéric rechnete damit, ihm auch dahin als Kamerad zu folgen.
Nun hatten sie sich zwei Jahre lang nicht gesehen; nachdem sie sich umarmt hatten, gingen sie auf die Landungsbrücken, um ungestörter plaudern zu können.
Der Hauptmann, der zur Zeit ein kleines Café in Villenauxe bewirtschaftete, hatte vor Wut gerast, als sein Sohn seine Großjährigkeits-Abrechnung von ihm verlangte, und hatte ihm überhaupt jede Unterstützung entzogen. Charles aber, der sich später um einen Lehrstuhl am Seminar bewerben wollte und ohne Mittel war, nahm einen Posten als erster Schreiber bei einem Anwalt in Troyes an. Durch Entbehrungen hoffte er viertausend Franken zu ersparen; dann hatte er selbst ohne die mütterliche Erbschaft genug, um drei Jahre für sich arbeiten und auf eine passende Stelle warten zu können. So mußten sie ihren alten Plan, zusammen in Paris zu leben, aufgeben, wenigstens für den Augenblick.
Frédéric ließ den Kopf hängen. Von seinen Träumen stürzte der erste zusammen.
»Beruhige dich,« sagte der Sohn des Hauptmanns, »das Leben ist lang, und wir sind jung. Ich werde dir folgen. Denk' nicht weiter daran!« Er streichelte ihn zärtlich und fragte ihn nach seiner Reise, um ihn aufzuheitern.
Frédéric hatte nicht viel zu erzählen, aber als er an Frau Arnoux dachte, verflog sein Kummer. Von ihr sprach er nicht, in einem gewissen Schamgefühl, – um so mehr aber von Arnoux, dessen Manieren, Reden und Beziehungen er schilderte, wonach Deslauriers ihm riet, diese Bekanntschaft unbedingt fortzusetzen.
In der letzten Zeit hatte Frédéric nichts mehr geschrieben; seine literarischen Anschauungen hatten sich geändert. Jetzt schätzte er vor allem die Leidenschaft in der Literatur; Werther, René, Franck, Lara Lelia und andere weniger Bedeutende begeisterten ihn in gleichem Maße. Manches Mal hatte er das Gefühl, daß nur die Musik imstande sei, seine innere Unruhe auszudrücken, und er träumte dann von Sinfonien. Er hatte auch Verse gemacht, die Deslauriers sehr schön fand, ohne das Bedürfnis zu äußern, mehr davon zu hören.
Dieser hatte die Metaphysik an den Nagel gehängt, dafür beschäftigten ihn die Nationalökonomie und die Revolution. Äußerlich war er jetzt ein großer magerer Bursche von zweiundzwanzig Jahren mit einem sehr sicheren Ausdruck. Er trug einen schlechten Lasting-Paletot, und seine Stiefel waren dick mit Staub bedeckt, da er, um Frédéric zu treffen, den Weg von Villenauxe zu Fuß gemacht hatte.
Isidore näherte sich ihnen. Die gnädige Frau ließ den jungen Herrn bitten, nach Hause zu kommen, und schickte ihm einen Mantel; er könnte sich sonst erkälten. »Bleibe doch,« sagte Deslauriers, und sie gingen wieder von einem Ende der beiden Brücken, die von der kleinen Insel zu dem Kanal und dem Flusse führen, bis zum anderen und zurück.
Wenn sie auf die Nogenter Seite kamen, sahen sie ein Gewirr von kleinen auf abfallender Straße gelegenen Häusern: rechts erschien die Kirche hinter den Sägemühlen, deren Türen geschlossen waren, und links zogen sich den Fluß entlang Gebüsche, die kaum sichtbare Gärten vom Wasser trennten. Auf der Pariser Seite senkte sich die Landstraße in gerader Richtung, und in der Ferne sah man Felder, die sich im nächtlichen Nebel verloren. Alles war still, der Duft von feuchtem Laubwerk stieg bis zu ihnen auf, und nichts war zu hören, als etwa hundert Schritte weiter das monotone Geräusch der Schleuse und das Anschlagen der Wellen gegen das Ufer.
Deslauriers blieb stehen und sagte:
»Da liegen nun die guten Leute und schlafen sorglos und ahnen nicht, daß sich ein zweites Neunundachtzig vorbereitet. Das Volk hat genug von den Verfassungen, den Kompromissen und den Lügen. Ach, wenn ich eine Rednertribüne oder eine Zeitung zur Verfügung hätte, ich würde dazwischenfahren. Aber dazu gehört Geld. Es ist ein Fluch, der Sohn eines Schankwirtes zu sein und seine Jugend zu verlieren, weil man essen muß!«
Er senkte den Kopf, biß sich auf die Lippen und erschauerte unter seiner dünnen Bekleidung.
Frédéric warf ihm einen Teil seines Mantels über die Schultern, so daß sie beide eingehüllt waren; und so setzten sie, sich umschlingend, ihre Wanderung fort.
»Wie kann ich ohne dich in Paris leben?« sagte Frédéric, den die Bitterkeit seines Freundes gleichfalls in Trauer versetzte. »Mit einer Frau, die mich geliebt hätte, würde ich etwas Hervorragendes geleistet haben. Warum lachst du? Die Liebe ist die Nahrung des Genies und die Atmosphäre, in der sie gedeiht. Außergewöhnliche Erregungen erzeugen außergewöhnliche Werke. Aber ich habe es aufgegeben, die zu suchen, die ich brauche, und wenn ich sie trotzdem finde, wird sie mich nicht wollen. Ich gehöre zu den Enterbten des Glücks; am Schlusse meines Lebens werde ich nicht wissen, ob der Schatz, den ich besessen, aus falschen oder echten Steinen bestanden hat.«
Ein menschlicher Schatten fiel lang aufs Pflaster, und zugleich hörten sie die Worte:
»Ihr Diener, meine Herren!«
Der Sprecher war ein kleiner Mann, in einen weiten braunen Mantel gehüllt; unter seiner Mütze sah man eine Spitznase.
»Herr Roque?« fragte Frédéric.
»Er selbst,« antwortete die Stimme.
Er motivierte sein Erscheinen damit, daß er die Wolfsfallen in seinem Garten am Flußufer besichtige.
»Sie sind also wieder zurück? Ich hatte das übrigens schon von meiner Kleinen gehört! Hoffentlich geht es Ihnen gut, und Sie verlassen uns nicht gleich wieder?«
Damit ging er, anscheinend von Frédérics Zurückhaltung verletzt.
Frau Moreau mied den Verkehr mit dem alten Roque; er lebte in wilder Ehe mit seinem Dienstmädchen und wurde wenig geachtet, obgleich er Vorsteher bei den Wahlen und Verwalter des Herrn Dambreuse war.
»Dambreuse? Ist das der Bankier in der Rue d'Anjou?« fing Deslauriers wieder an. »Weißt du, was du tun solltest, mein Junge?«
Wieder unterbrach sie Isidore. Er hätte strengen Befehl, Frédéric mitzubringen. Die gnädige Frau würde sehr besorgt sein.
»Gut, gut, er kommt schon,« sagte Deslauriers; »er wird nicht im Freien übernachten.«
Als der Diener gegangen war, fuhr er fort:
»Du solltest den Alten bitten, dich bei den Dambreuse einzuführen; nichts kann so nützlich werden, wie der Zutritt zu einem reichen Hause. Du hast einen Frack und weiße Handschuhe; verwende das. Du mußt in diese Kreise kommen und mich später hineinlotsen. Denke nur, ein Millionär! Suche ihm zu gefallen und namentlich seiner Frau. Vielleicht kannst du ihr Geliebter werden!«
Frédéric wollte widersprechen.
»Aber denke doch an Rastignac in Balzacs › Comédie humaine‹! Du wirst sicher reüssieren!«
Frédérics Vertrauen zu Deslauriers war so groß, daß er schwankend wurde. Er vergaß Frau Arnoux, oder vielleicht bezog er sie in die Prophezeiung des Freundes mit ein; er mußte lächeln.
Der Schreiber fuhr fort:
»Noch einen letzten Rat; mache dein Examen. Ein Titel ist immer etwas wert; und quäle dich nicht mehr mit deinen katholischen oder ketzerischen Dichtern, die eben nur die Philosophie ihres Zeitalters gekannt haben. Deine Verzweiflung ist kindisch. Größere Männer als du haben viel kleiner angefangen, denke nur an Mirabeau! Übrigens werden wir nicht lange getrennt sein. Ich werde meinen Alten zwingen, mir mein Geld herauszugeben! Es ist Zeit, daß ich nach Hause gehe. Adieu! Hast du fünf Franken, daß ich mein Mittagessen bezahlen kann?«
Frédéric gab ihm zehn Franken, den Rest des Geldes, das er am Morgen von Isidore erhalten hatte.
Etwa zwanzig Meter von der Brücke, am linken Ufer des Flusses, glänzte ein Licht aus dem Dachfenster eines niedrigen Hauses.
Deslauriers erblickte es und sagte pathetisch, indem er seinen Hut zog:
»Venus, Königin des Himmels, meine Ehrerbietung! Aber die Armut ist die Mutter der Weisheit. Und man hat uns deinetwegen schon genug verlästert.«
Diese Anspielung auf ein gemeinsames Abenteuer versetzte sie in Heiterkeit. Sie lachten laut auf, während sie durch die Straßen gingen.
Nachdem Deslauriers seine Rechnung im Wirtshaus beglichen hatte, begleitete er Frédéric bis zum nächsten Kreuzweg; – und dort trennten sie sich nach einer langen Umarmung.
3.
Zwei Monate später war Frédéric eines Morgens in Paris eingetroffen, in der Rue Coq-Herin abgestiegen, und er dachte nun daran, sofort den Besuch zu machen, der ihm so am Herzen lag.
Der Zufall war ihm günstig; der alte Roque hatte ihm eine Rolle wichtiger Papiere mitgegeben mit der Bitte, sie persönlich Herrn Dambreuse zu überreichen, und zugleich einen geschlossenen Einführungsbrief, in dem er seinen jungen Landsmann vorstellte.
Frau Moreau war von diesem Schritt überrascht gewesen; Frédéric aber hatte das Vergnügen, welches er sich davon versprach, verheimlicht. Herr Dambreuse nannte sich in Wirklichkeit Graf D'Ambreuse. Seit 1825 hatte er sich der Industrie zugewendet und nach und nach auf seinen Adel und seine politischen Freunde verzichtet. Allenthalben seine Fühler ausstreckend, immer auf der Jagd nach Geschäften, gerieben wie ein Levantiner und fleißig wie ein Auvergnate, hatte er schließlich ein bedeutendes Vermögen angesammelt; überdies war er Offizier der Ehrenlegion, Generalrat seines Departements und Deputierter. Da er von Natur dienstfertig war, peinigte er die Minister unausgesetzt für andere mit Bitten um Hilfe, um Orden, um Tabakbureaus, und da er mit der Regierung schmollte, schloß er sich dem linken Zentrum an. Seine Frau, die hübsche Frau Dambreuse, die von den Modeblättern zitiert wurde, war immer an der Spitze von Wohltätigkeitsunternehmen. Sie entwaffnete die Feindseligkeit der adligen Kreise, indem sie den Herzoginnen den Hof machte und den Glauben erweckte, daß Herr Dambreuse doch noch eines Tages in seine frühere Sphäre zurückkehren und ihnen nützlich werden könne.
Auf dem Wege zu ihnen war Frédéric etwas beklommen. »Ich hätte doch vielleicht besser getan, meinen Frack anzuziehen. Sicher wird man mich zum nächsten Balle einladen.«
Schließlich verlieh ihm der Gedanke, daß Herr Dambreuse jetzt nichts weiter als ein Bürgerlicher war, eine gewisse Zuversicht, und heiter stieg er auf dem Trottoir der Rue d'Anjou aus dem Wagen.
Nachdem er eines der Portale passiert hatte, überschritt er den Hof, stieg eine Freitreppe hinauf und trat in eine Vorhalle, deren Boden mit farbigem Marmor belegt war.
Vor ihm befand sich eine Doppelstiege, bedeckt mit einem roten Teppich, der durch Messingstäbe gehalten war. Am Fuße der Stiege war ein Bananenbaum, dessen große Blätter auf den Samt des Geländers niederfielen. Zwei Bronzekandelaber trugen Porzellankuppeln, die an kleinen Ketten hingen; die Kaminöffnungen strömten eine schwüle Hitze aus; und nichts war zu hören als das Ticken einer großen Uhr, die am anderen Ende der Halle unter einer Waffengarnitur stand.
Eine Glocke schlug an; ein Diener erschien und führte Frédéric in ein Kabinett, in dem zwei Geldschränke und Fächer, die mit Mappen gefüllt waren, auffielen. In der Mitte des Zimmers stand ein Schreibtisch, an dem Herr Dambreuse saß und schrieb.
Er durchflog den Brief des alten Roque, öffnete mit seinem Federmesser den Umschlag, der die Papiere enthielt, und prüfte sie.
Aus der Ferne hätte man ihn wegen seiner schmächtigen Gestalt für jung halten können, aber seine spärlichen grauen Haare, seine schlaffen Gliedmaßen und vor allem die außerordentlich blasse Gesichtsfarbe zeigten eine starke Verlebtheit. Eine unerbittliche Energie sprach aus seinen graugrünen, kalten Augen. Er hatte hervortretende Backenknochen und knochige Fingergelenke.
Endlich erhob er sich, richtete an den jungen Mann mehrere Fragen über gemeinsame Bekannte, über Nogent, über seine Studien; dann verabschiedete er ihn mit einer Verbeugung. Frédéric entfernte sich durch einen andern Korridor und befand sich wieder auf dem Hofe, in der Nähe der Ställe.
Eine blaue Kutsche, mit einem Rappen bespannt, wartete vor der Freitreppe. Der Schlag wurde geöffnet, eine Dame stieg ein, und der Wagen rollte mit dumpfem Geräusch über den Sand.
Am Portal, das Frédéric von der andern Seite erreichte, holte er den Wagen ein, und da der Raum eng war, mußte er ihn vorbeilassen, ehe er seinen Weg fortsetzen konnte.
Die junge Dame lehnte sich aus dem Schiebefenster und sprach leise mit dem Portier. Frédéric konnte nur ihren Rücken sehen, der mit einem violetten Mantel bedeckt war; aber er überblickte das Innere des Wagens: ein mit blauem Rips und seidenen Schnüren ausgeschlagenes Schmuckkästchen. Die Kleider der Dame füllten es aus; Iris-Parfüm entströmte ihm, vermischt mit einem unbestimmten Duft von weiblicher Eleganz. Plötzlich zog der Kutscher die Zügel an, das Pferd machte eine scharfe Biegung, und alles verschwand.
Frédéric ging zu Fuß über die Boulevards zurück und bedauerte, Frau Dambreuse nicht gesehen zu haben. Auf der Höhe der Rue Montmartre ließ ihn ein Wagengewirr seinen Weg unterbrechen; er sah sich um und bemerkte auf der andern Seite der Straße, gerade gegenüber, ein Marmorschild mit der Aufschrift:
JACQUES ARNOUX.
Woher kam es, daß er nicht früher an sie gedacht hatte? Das war Deslauriers' Schuld. Er näherte sich dem Laden, aber er wagte nicht, einzutreten; er wartete, daß sie sich zeigen würde.
Durch die großen Scheiben sah man in einem geschickten Arrangement Statuetten, Zeichnungen, Stahlstiche, Kataloge und Nummern des »Kunstgewerbe«; auf der Ladentür prangten die Initialen des Herausgebers und die Abonnementspreise. An den Wänden bemerkte man große Ölgemälde, deren Firnis glänzte, im Hintergrunde zwei antike Schränke, die mit Porzellan, Bronzen und mit allen möglichen Altertümern bedeckt waren. Zwischen den Schränken war eine kleine Treppe, die oben durch eine Portiere abgeschlossen war; ein Kronleuchter aus. Meißner Porzellan, ein grüner Teppich am Boden und ein Tisch mit Marqueterien gaben dem Ganzen mehr das Ansehen eines Salons als eines Ladens.
Frédéric gab sich den Anschein, als wenn er die Zeichnungen betrachtete. Nach langem Zögern trat er endlich ein.
Ein Angestellter hob die Portiere in die Höhe und gab die Auskunft, daß Herr Arnoux nicht vor fünf Uhr im »Magazin« sei. Aber man könnte ihm vielleicht etwas bestellen.
»Nein, danke, ich werde wiederkommen,« antwortete Frédéric schüchtern.
Die folgenden Tage benutzte er dazu, sich eine Wohnung zu suchen; schließlich entschied er sich für ein Zimmer im zweiten Stock eines Hotel garni der Rue Saint-Hyacinthe.
Eine ganz neue Schreibmappe unter dem Arm, begab er sich zur Eröffnungsvorlesung der Universität. Dreihundert junge Leute mit bloßen Köpfen füllten einen Hörsaal, in dem ein Greis in einem roten Talar mit einförmiger Stimme vortrug, und wo man sonst nichts als das Kratzen der Federn auf dem Papier hörte. Er fand in diesem Saale die staubige Atmosphäre der Schule wieder, dieselbe Form der Bänke, dieselbe Langeweile! Vierzehn Tage lang besuchte er die Vorlesungen regelmäßig, man war aber noch nicht beim Artikel III, als er schon vom bürgerlichen Recht genug hatte.
Die Pariser Freuden, von denen er geträumt hatte, schienen auszubleiben; und als er den Inhalt eines Lesekabinetts erschöpft, die Sammlungen des Louvre durchlaufen und das Theater mehrere Male hintereinander besucht hatte, wurde er von einem unendlichen Überdruß befallen.
Unzählige Kleinigkeiten vermehrten seinen Mißmut. Er mußte seine Wäsche zählen und seinen Portier erdulden, eine Art Bauer, der jeden Morgen sein Bett machen kam, nach Alkohol roch und schimpfte. Sein Zimmer, dessen einziger Schmuck eine Alabaster-Standuhr war, mißfiel ihm. Die Wände waren dünn, und er hörte die Studenten ihren Punsch brauen, lachen und singen.
Schließlich bekam er die Einsamkeit satt, er suchte einen seiner früheren Schulkameraden, namens Baptiste Martinon; und er entdeckte ihn in einer sehr billigen Pension der Rue Saint-Jacques, wie er vor einem kleinen Ofen saß und Zivilprozeß büffelte.
An seiner Seite war ein Mädchen in einem Kattunkleid, das Strümpfe stopfte. Martinon war, was man einen schönen Mann nennt: groß, pausbäckig, mit regelmäßigen Zügen und blauen runden Augen; sein Vater, ein Grundbesitzer, hatte ihn zur Beamtenlaufbahn bestimmt, und da er älter erscheinen wollte, trug er einen rundgeschnittenen Vollbart.
Frédérics Klagen über seine Existenz, da er keinen positiven Grund anführen konnte, blieben Martinon unverständlich. Er seinerseits ging jeden Morgen in die Vorlesung, lief dann im Luxembourg-Garten spazieren, besuchte abends ein kleines Café, und so fühlte er sich, mit seinen fünfzehnhundert Franken im Jahr und der Liebe dieser Grisette, vollkommen glücklich.
»Was für ein Glück!« sagte Frédéric zu sich selbst.
Auf der Universität hatte er noch eine Bekanntschaft gemacht, die eines Herrn von Cisy, der aus vornehmer Familie stammte, und der so zierliche Manieren hatte wie ein junges Mädchen.
Cisy beschäftigte sich mit Zeichenkunst, insbesondere schwärmte er für den gotischen Stil. Häufig gingen sie zusammen die Sainte-Chapelle und Notre-Dame bewundern. Die natürliche Vornehmheit des jungen Patriziers war allerdings mit einer sehr schwachen Intelligenz gepaart. Alles überraschte ihn, über alles lachte er ohne Grund, mit einer solchen Naivität, daß Frédéric, der ihn zuerst für einen Spötter gehalten hatte, ihn schließlich als das erkannte, was er war, als einen Dummkopf.
Es war also niemand da, dem er sich anvertrauen konnte, und auf eine Einladung der Dambreuse wartete er immer noch. Zum Neujahr schickte er ihnen seine Karte, er blieb aber ohne jede Antwort.
Im »Kunstgewerbe« war er noch einmal gewesen.
Er ging noch ein drittes Mal hin und traf endlich Arnoux, der sich gerade mit mehreren Besuchern zankte und ihn kaum begrüßte; Frédéric war verletzt. Aber er sann deshalb nicht weniger auf Mittel und Wege, zu »ihr« zu gelangen.
Er hatte zuerst die Idee, häufiger in den Laden zu gehen und nach den Preisen von Bildern zu fragen. Dann dachte er daran, der Redaktion der Zeitung einige brillante Artikel einzusenden, was nähere Beziehungen herbeiführen könnte. Vielleicht wäre auch das Klügste, ihr seine Liebe zu erklären? Er verfaßte einen zwölf Seiten langen lyrischen Brief; aber er zerriß ihn wieder und blieb nun ganz untätig, weil er Furcht vor einem Mißerfolg hatte.
Über dem Laden Arnoux' befanden sich im ersten Stock drei Fenster, die jeden Abend hell erleuchtet waren. Man sah hinter ihnen Schatten sich bewegen, namentlich einen, den er schon kannte; das mußte ihr Schatten sein; und er kam häufig aus weiten Entfernungen vor das Haus, um diese Fenster und diesen Schatten zu betrachten.
Eine Negerin, die er eines Tages im Tuilerien-Garten mit einem kleinen Mädchen an der Hand sah, erinnerte ihn an die Negerin der Frau Arnoux. Es war anzunehmen, daß auch sie ab und zu hinkommen würde; jedesmal, wenn er durch den Garten ging, hatte er Herzklopfen, da er sie zu treffen hoffte. An sonnigen Tagen setzte er seinen Spaziergang bis zum Ende der Champs-Elysées fort.
Equipagen fuhren vorbei, in denen Damen, deren Schleier im Winde flatterten, nachlässig-vornehm saßen. Die Wagen wurden immer zahlreicher und nahmen bald die ganze Straße ein. Mähne stieß an Mähne, Laterne an Laterne; die metallenen Beschläge, die silbernen Kinnketten, die Messingknöpfe waren leuchtende Punkte inmitten der endlosen Reihe kurzer Beinkleider, weißer Handschuhe und pelzbesetzter Kutschermäntel, die über die Wagenschläge herabfielen. Er fühlte sich wie verloren, wie in einer fremden Welt. Er musterte die Frauenköpfe, und hier und da erinnerte ihn eine entfernte Ähnlichkeit an Frau Arnoux. Er stellte sie sich in dieser Umgebung vor, in einem kleinen Coupé, wie dem der Frau Dambreuse. – Allmählich sank die Sonne, und ein kühler Wind wirbelte Staubwolken auf. Die Kutscher vergruben das Kinn in ihren Krawatten, die Räder drehten sich schneller, das Makadam knirschte, und die Wagen fuhren im Trab die Avenue hinunter, sich berührend, sich überholend; dann, auf der Place de la Concorde, zerstreute sich alles. Hinter den Tuilerien nahm der Himmel eine schiefergraue Färbung an, die Bäume des Parks bildeten nur noch dunkle, unförmige Massen. Die Straßenlaternen flammten auf; und die grünlichen Wasser der Seine leuchteten wie Silberstreifen, die sich an den Brückenpfeilern brachen.
Er ging in ein billiges Restaurant der Rue de la Harpe speisen.
Mit Widerwillen betrachtete er das alte Holzbüfett, die schmutzigen Tischtücher, das unsaubere Besteck und die Hüte, die an der Wand hingen. Seine Umgebung bestand aus Studenten, wie er selbst. Sie unterhielten sich über ihre Lehrer, ihre Geliebten. Die Lehrer interessierten ihn nicht, und eine Geliebte hatte er nicht; um das nicht immer anhören zu müssen, kam er möglichst spät. Speisenüberreste bedeckten alle Tische, zwei müde Kellner schliefen in den Ecken, und ein Geruch von Essen, Öllampen und Tabak erfüllte den leeren Raum.
Dann ging er langsam nach Hause. Die Straßenlaternen schaukelten sich im Winde und warfen grelle längliche Lichter auf den Straßenkot. Schatten glitten mit Regenschirmen an den Häusern entlang, das Pflaster war schlüpfrig, ein Nebel senkte sich, und er hatte das Gefühl, daß die feuchte Finsternis, die ihn umhüllte, auch tief ins Herz eindrang.
Er machte sich Vorwürfe über seinen Müßiggang und ging wieder in die Vorlesungen. Aber da er viel versäumt hatte, machten ihm die einfachsten Dinge große Schwierigkeiten. Er begann einen Roman zu schreiben: »Sylvio, der Sohn des Fischers«, der in Venedig spielte. Der Held war er selbst, die Heldin Frau Arnoux. Sie hieß Antonia, und um sie zu erobern, legte er die halbe Stadt in Asche und brachte ihr Serenaden unter ihrem Balkon, wo sich rote Vorhänge, wie die auf dem Boulevard Montmartre im Winde bewegten. Aber die Reminiszenzen, die er einfließen sah, entmutigten ihn wieder; er brach ab, und seine Zerfahrenheit steigerte sich womöglich noch.
Schließlich bat er Deslauriers, zu ihm zu ziehen; sie würden zusammen mit einer Pension von zweitausend Franken auskommen; alles war diesem unerträglichen Leben vorzuziehen. Deslauriers konnte jedoch Troyes noch nicht verlassen; er riet ihm, sich zu zerstreuen und Sénécal aufzusuchen.
Sénécal war ein Hilfslehrer der Mathematik, ein intelligenter Kopf und enragierter Republikaner; ein zweiter Saint-Just, wie Deslauriers sagte. Frédéric stieg dreimal die fünf Treppen zu ihm hinauf, aber vergeblich, und er gab es dann auf.
Er wollte sich unterhalten und ging auf die Opernbälle, aber diese lärmende Lustigkeit widerte ihn an. Auch hatte er Angst vor den Geldausgaben; er malte sich aus, daß ein Souper mit einem Domino eine große Summe verschlingen würde.
Trotzdem schien es ihm, daß er Liebe müßte finden können. Ab und zu erwachte er morgens sehr hoffnungsvoll, kleidete sich sorgfältig wie zu einem Rendezvous an und lief dann stundenlang umher. Bei jeder Frau, der er folgte, oder die ihm entgegenkam, dachte er: »Vielleicht die!« Jedesmal war es eine neue Enttäuschung. Der Gedanke an Frau Arnoux blieb vorherrschend. Er hoffte immer, ihr zufällig zu begegnen; und um mit ihr zusammen zu kommen, wünschte er die abenteuerlichsten Verwicklungen herbei, außerordentliche Gefahren, aus denen er sie retten könnte.
So verging die Zeit in ewiger Wiederholung derselben gleichförmigen, langweiligen Gewohnheiten. Er war Stammgast bei den Buchhändlern der Odéon-Arkaden, las im Café die Revue des deux Mondes, besuchte auch dann und wann das Kolleg, um eine Stunde lang Chinesisch oder Politische Ökonomie zu hören. Jede Woche schrieb er einen langen Brief an Deslauriers, ab und zu speiste er mit Martinon oder ging zu Cisy.
Er mietete ein Klavier und komponierte deutsche Walzer.
Eines Abends ging er ins Theater Palais-Royal und bemerkte dort in einer Proszeniumsloge Arnoux mit einer Dame. War sie es? Das Gesicht konnte er nicht sehen, da der grüne Schirm es verdeckte. Endlich ging der Vorhang in die Höhe, und der Schirm in der Loge wurde beiseitegezogen. Er sah ein hochgewachsenes weibliches Wesen, etwa dreißig Jahre alt und schon stark verblüht, mit dicken Lippen, zwischen denen prachtvolle Zähne sichtbar wurden, wenn sie lachte. Sie plauderte in sehr intimer Weise mit Arnoux und schlug ihn mit dem Fächer auf die Finger. Dann erschien ein blondes junges Mädchen mit Augen, die anscheinend vom Weinen gerötet waren, und setzte sich zwischen sie. Von da an blieb Arnoux auf ihre Schulter hinabgebeugt und redete leise in sie hinein, ohne daß sie antwortete. Frédéric hätte viel darum gegeben, zu wissen, aus welcher Sphäre diese Mädchen, die bescheidene dunkle Kleider mit Umlegekragen trugen, waren.
Als die Vorstellung aus war, stürzte er in den überfüllten Logengang. Arnoux ging vor ihm langsam die Treppe hinab, an jedem Arm eines der Mädchen.
Plötzlich bemerkte er an Arnoux' Hut einen Flor.
War sie gestorben? Dieser Gedanke peinigte ihn so, daß er am nächsten Morgen in das »Kunstgewerbe« eilte. Er kaufte einen Stich und fragte den Angestellten, wie es Herrn Arnoux ginge.
Die Antwort war: »Sehr gut.«
Frédéric erbleichte.
»Und Frau Arnoux?«
»Auch sehr gut.«
Er verließ den Laden in einer solchen Verwirrung, daß er seinen Einkauf mitzunehmen vergaß.
Der Winter ging zu Ende. Im Frühling verlor sich seine Melancholie, er bereitete sich auf das Examen vor, bestand dasselbe leidlich und fuhr dann nach Nogent zurück.
Seinen Freund in Troyes besuchte er nicht, um keine Bemerkungen seiner Mutter zu provozieren. Nach Paris zurückgekehrt, kündigte er seine Wohnung und mietete auf dem Quai Napoleon zwei Zimmer, die er möblierte. Die Hoffnung auf eine Einladung bei den Dambreuse hatte er aufgegeben; seine große Leidenschaft für Frau Arnoux begann sich zu legen.
4.
Eines Morgens im Dezember, als er auf dem Wege zur Vorlesung war, glaubte er in der Rue Saint-Jacques mehr Bewegung als sonst zu bemerken. Die Studenten strömten aus den Cafés oder riefen sich aus den offenen Fenstern etwas zu, die Ladeninhaber standen unruhig mitten auf den Trottoirs, die Fensterläden wurden geschlossen, und als er in der Rue Soufflot ankam, sah er am Panthéon einen großen Menschenauflauf.
Junge Leute in kleinen Trupps spazierten Arm in Arm herum und sammelten sich dann zu größeren Gruppen, die sich an den verschiedensten Stellen postierten; im Hintergrunde des Platzes standen an den Gittern Blusenmänner, die heftig gestikulierten, während Polizisten, den Dreispitz auf dem Kopfe und die Hände auf dem Rücken, an den Mauern auf und ab gingen und das Pflaster unter ihren schweren Stiefeln erdröhnen ließen. Alle machten erstaunte, geheimnisvolle Gesichter; augenscheinlich wurde irgendein Ereignis erwartet, aber jeder hielt seine Neugierde zurück.
Frédéric geriet neben einen blonden jungen Mann mit offenen Zügen, der Schnurr- und Kinnbart wie ein Stutzer aus der Zeit Ludwigs des Dreizehnten trug, und fragte ihn nach dem Grunde der Aufregung.
Er erhielt die Antwort, die von Gelächter begleitet war: »Ich weiß es nicht, die anderen aber auch nicht. Das ist jetzt so Sitte! Ein netter Spaß.«
Die Petitionen wegen der Reformen, die in der Nationalgarde zur Unterschrift kursierten, und noch andere Ereignisse hatten nun schon seit Monaten in Paris Ansammlungen zur Folge gehabt, und zwar so häufig, daß die Zeitungen keine Notiz mehr davon nahmen. Frédéric drehte sich um, da ihn jemand auf die Schulter klopfte. Es war Martinon, der furchtbar blaß aussah und tief seufzend sagte: »Wieder ein Aufstand.«
Er lebte in der Angst, kompromittiert zu werden. Insbesondere beunruhigten ihn die Blusenmänner, die geheimen Gesellschaften anzugehören schienen.
»Gibt es das wirklich?« fragte der junge Mann mit dem merkwürdigen Bart.
»Das ist doch nur ein Ammenmärchen der Regierung, um die Bürger zu erschrecken.«
Martinon bat ihn aus Furcht vor der Polizei, leiser zu sprechen.
»Sie glauben noch an die Polizei? Übrigens, wer sagt Ihnen, daß ich nicht selbst ein Spitzel bin?«
Er sah Martinon dabei so sonderbar an, daß dieser den Scherz nicht sofort verstand. Die Menge drängte so stark, daß sie gezwungen wurden, sich auf die kleine Treppe zu flüchten, die zum neuen Hörsaal führte.
Plötzlich bildete sich eine Gasse, und mehrere junge Leute zogen den Hut; man begrüßte den berühmten Professor Samuel Rondelot, der, in seinen weiten Mantel gehüllt, durch seine silberne Brille aufblickend und mit asthmatischem Keuchen, ruhig durch die Menge in seine Vorlesung ging. Dieser Mann war eine der juristischen Berühmtheiten des neunzehnten Jahrhunderts, der Nebenbuhler Zacharias' und Ruhdorffs. Die ihm kürzlich verliehene Würde eines Pairs von Frankreich hatte nichts in seinen Gewohnheiten geändert. Man wußte, daß er arm war, und hatte große Ehrfurcht vor ihm.
Vom Platze her hörte man Rufe:
»Nieder mit Guizot!«
»Nieder mit Pritchard!«
»Nieder mit den Verrätern!«
»Nieder mit Louis Philippe!«
Die Menge stieß sich und drückte sich gegen die Türen, die geschlossen waren, was den Professor verhinderte, seinen Weg fortzusetzen. Vor der Treppe machte er halt, und man sah ihn dann auf der obersten der drei Stufen. Er versuchte, zu reden, aber das Gemurmel erstickte seine Stimme. Eben vorher noch sehr beliebt, wurde er jetzt gehaßt, denn er repräsentierte die Obrigkeit.
Sobald er sich vernehmbar machen wollte, fing das Geschrei wieder an. Mit Gebärden forderte er die Studenten auf, ihm zu folgen, aber ein allgemeines Gebrüll antwortete ihm. Er zuckte verächtlich mit den Achseln und verschwand im Korridor. Martinon hatte die Gelegenheit benutzt, sich gleichzeitig aus dem Staube zu machen.
»Der Feigling!« sagte Frédéric.
»Er ist eben vernünftig,« erwiderte der andere.
Die Menge jubelte, da sie den Rückzug des Professors als einen Sieg betrachtete. Aus allen Fenstern sahen Neugierige. Einige stimmten die Marseillaise an, andere schlugen vor, vor das Haus Bérangers zu ziehen.
»Zu Laffitte.«
»Zu Chateaubriand.«
»Zu Voltaire,« brüllte der junge Mann mit dem blonden Schnurrbart.
Die Schutzleute suchten die Menge zu zerstreuen, indem sie so sanft wie möglich sagten:
»Bitte, meine Herren, gehen Sie auseinander.«
Plötzlich ertönte der Ruf:
»Nieder mit den Totschlägern.«
Das war seit den September-Unruhen der ständige Schimpfname für die Polizei. Der Ruf pflanzte sich fort. Man pfiff die Polizisten aus; sie erbleichten; einer verlor die Geduld und stieß einen jungen Mann, der ihm zu nahe kam und ihm ins Gesicht lachte, so derb zurück, daß er umfiel. Alles wich zurück, aber im selben Augenblick rollte der Schutzmann zu Boden, niedergeschlagen von einem herkulischen Kerl, dessen Haarmassen wie ein Büschel Werg unter einer Wachstuchmütze hervorquollen.
Seit einigen Minuten an der Ecke der Rue Saint-Jacques stehend, hatte er soeben einen großen Karton, den er trug, hingeworfen und sich auf den Schutzmann gestürzt, der bald unter ihm lag, und auf dessen Gesicht er mit geballter Faust einhieb. Die anderen Polizisten kamen herbeigeeilt, aber der Bursche war so stark, daß mindestens vier nötig waren, um ihn zu bändigen. Zwei hielten ihn am Kragen fest, zwei zogen ihn an den Armen, und ein Fünfter stieß ihn mit dem Knie in die Seiten, wobei sie ihn»Mörder, Spitzbube, Aufrührer« titulierten. Die Kleider in Fetzen und halbnackt, beteuerte er seine Unschuld; er könne kein Kind erschlagen, wenn er nicht gereizt werde.
»Ich heiße Dussardier und bin bei den Herren Valinçart frères, Spitzenfabrikanten in der Rue de Cléry, angestellt. Wo ist mein Karton? Ich will meinen Karton haben.« Und immer wieder rief er: »Dussardier! ... Rue de Cléry. Ich will meinen Karton haben!«