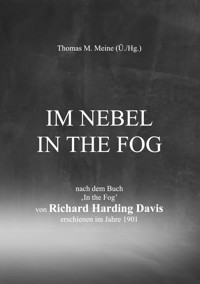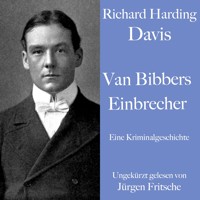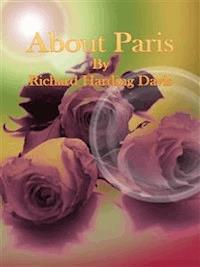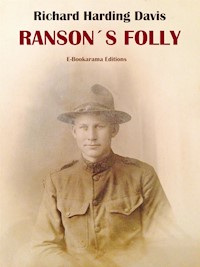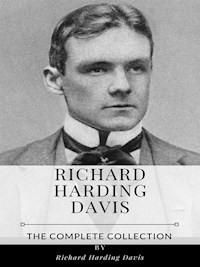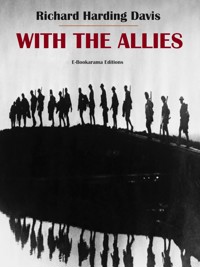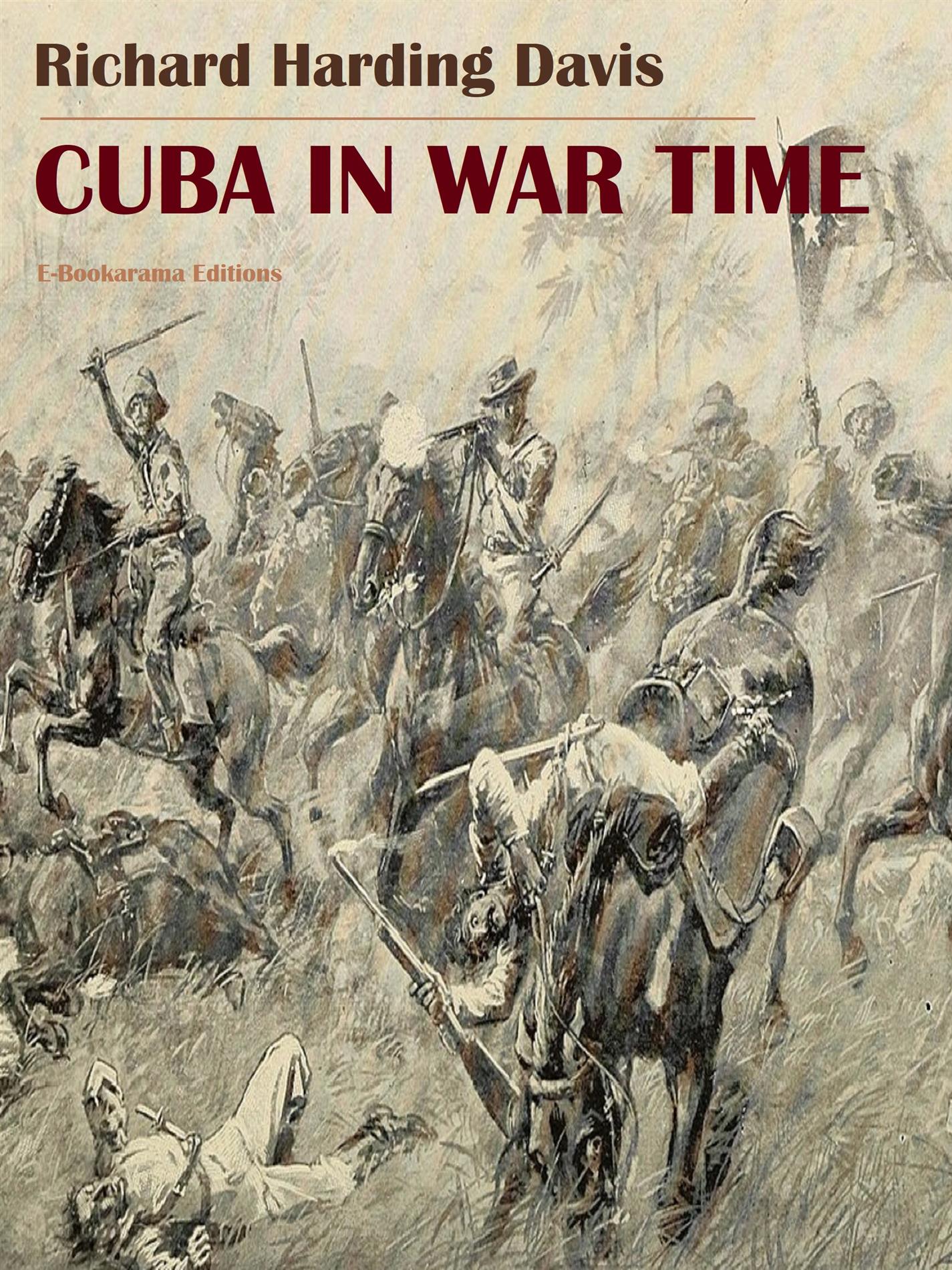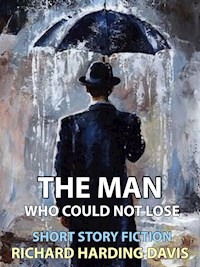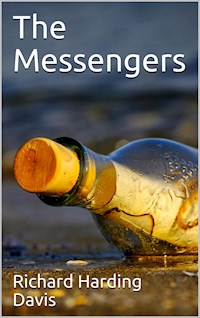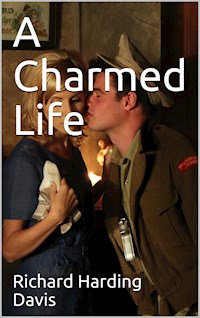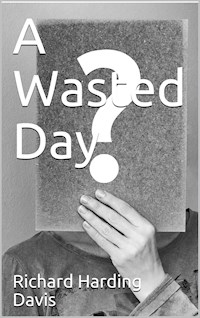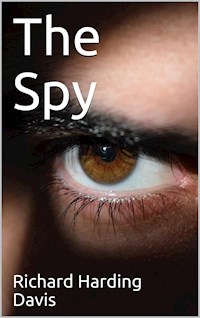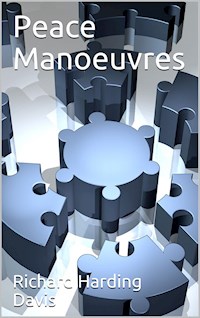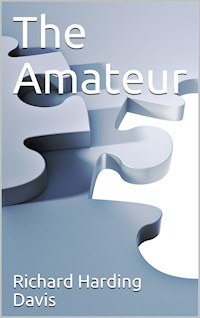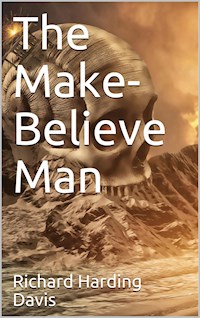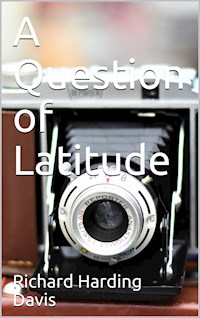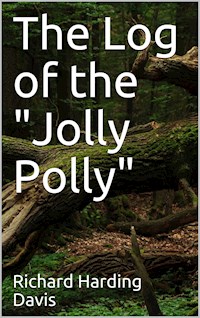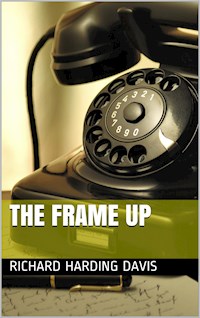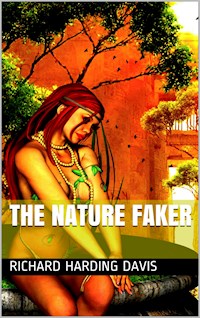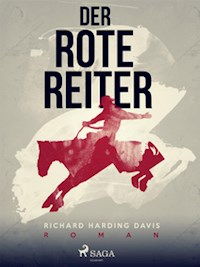
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fort Crocket nahe der Kiowa Reservation im Mittelwesten der USA unterscheidet sich kaum von anderen Forts des Landes. Wenn es da nicht Mary Cahill gäbe, die Tochter des Forthändlers, die schon seit ihrer Ankunft fünf Jahre zuvor das Offizierskasino beherrscht und verzaubert. Gleichmäßig verteilt sie ihre Zuneigung auf alle Besucher, bis zu dem Tag, als Leutnant Ranson im Fort eintrifft. Die Gespräche im Kasino kreisen immer wieder auch um den sagenumwobenen Roten Reiter, der bereits mehrfach erfolgreich die Postkutsche überfallen hat. Eines Abends wird es Leutnant Ranson zu bunt, und er verkündet lauthals, in dieser Nacht wie der Roter Reiter die Postkutsche überfallen zu wollen. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Harding Davis
Der Rote Reiter
Nebst zwei Erzählungen von L. Mott
Autorisierte Uebersetzung von Joachin Francke
Saga
Ebook-Kolophon
Richard Harding Davis: Der rote Reiter. © Richard Harding Davis. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711462157
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Der Rote Reiter
Von R. H. Davis
Erstes Kapitel.
Die Subalternoffiziere von Fort Crockett pflegten in der Kantine zu dinieren. Anfänglich, aber nur anfänglich, hatte Leutnant Ranson einen schlechten Witz nach dem andern über das merkwürdige Offizierskasino gemacht. Mit einer gewissen Berechtigung. Wie überall auf den einsamen Militärposten des amerikanischen Westens war auch in Fort Crockett die Kantine das einzige Bindeglied zwischen kaufendem Konsumenten und verkaufendem Produzenten — ein Restaurant, ein Klubraum, ein Warenhaus, vollgepfropft mit den Tausenden von Dingen, deren die Soldaten des Forts und die Indianer der Reservation bedurften. Und weil die Kantine so vielseitig war, haperte es mit dem Platz! Der Tisch der Offiziere war eingezwängt zwischen riesige Syrupfässer und die glühende Hitze eines offenen Kaminfeuers; der Ladentisch diente ihnen als Büfett; ein Billard, dessen grünes Tuch mit Flecken aller Farben gesprenkelt war wie eine Inselkarte der Grossen Seen, musste den Anrichtetisch ersetzen; Pete, der Indianer, fungierte als Haushofmeister und servierender Kellner. All’ diese unbequemen Kleinigkeiten jedoch schwanden zu einem Nichts zusammen gegenüber der allein wichtigen und allein massgebenden Tatsache, dass jeden Abend Mary Cahill der Tafel präsidierte und durch ihre blosse Gegenwart die einfache Mahlzeit in ein üppiges Bankett verwandelte. Mary Cahill war die Tochter des Fort-Händlers. (So wurde der Inhaber der Kantine nach alter Armeegewohnheit genannt). Von ihrem Stuhl hinter dem Ladentisch aus, zwischen Kasse und Wage sitzend, diktierte sie dem Kasino ihre Gesetze und schenkte Allen und Jedem ein liebenswürdiges Lächeln, unparteiisch, wie ein richtiger guter Kamerad.
Früher wenigstens war sie unparteiisch gewesen. Seit einiger Zeit freilich lächelte sie auf alle hernieder — nur nicht auf Leutnant Ranson. Wenn der sprach oder erzählte, wandte sie den Blick ab und starrte ins knisternde Feuer, mit heissen Wangen, mit Augen, so blitzend, als hätten sie Feuer gefangen am Flammenschein.
Seit fünf Jahren, seit dem Tage, an dem ihr Vater sie aus dem Kloster in St. Louis holte, hatte Mary Cahill fortwährend Offiziere kommen und Offiziere gehen sehen. Sie besass ausgedehnte und reichhaltige Kenntnisse über diese Offiziere, ihre militärischen und privaten Angelegenheiten. Sie kannte die Tradition jedes einzelnen Regiments der Armee, seine Kriegstaten, seine Politik in Friedenszeiten, seine Spitznamen, seine Skandale; ja sogar die Kantineneinnahmen der einzelnen Kompagnien. Von den Ereignissen des militärischen Lebens in Fort Crockett jedoch, das sich ja unter ihrer unmittelbaren Beobachtung abspielte, wusste sie mehr als der Regimentsadjutant, mehr noch als selbst des Obersts Frau! Wenn Trompeter Tyler beim Kirchensignal wieder einmal greulich falsch geblasen hatte, wenn Frau Stickney den Quartiermeister immer wieder um eine neue Ofenröhre plagte, wenn Leutnant Curtis zwei Tage Urlaub erhielt, um Wachteln zu schiessen, dann wusste es Mary Cahill; und wenn »Frau Kapitän« Stairs sich den Fort-Landauer für eine Fahrt nach Kiowa-City verschaffte, während »Frau Kapitän« Ross zu gleicher Zeit den gleichen Wagen für ein Picknick mit Beschlag zu belegen wünschte, so wusste Mary Cahill ganz genau, was die Damen zueinander gesagt hatten und welche von den beiden in Tränen ausgebrochen war. Sie wusste alle diese Dinge, denn sie wurden ihr jeden Abend von ihren »Kasinogästen« haarklein erzählt. Die Kasinogäste waren sehr loyal gegenüber Mary Cahill. Die Stellung des Mädchens war schwierig genug, und wenn die blutjungen Offiziere nicht ein so feines Verständnis gezeigt hätten, so wäre sie noch viel schwieriger gewesen. Denn das Leben auf einem Militärposten ist ebenso von Rangunterschieden eingeengt, wie das Leben auf einem Kriegsschiff; und so wenig des Schiffbarbiers Schultern mit den Epauletten des Admirals in Berührung kommen, so unmöglich ist es, dass einerseits die Tochter eines Forthändlers die Damen der »Offizierslinie« besucht oder andererseits Soldatenfrauen bei dem jungen Mädchen eingeladen werden, dessen Wäsche sie besorgen.
So befand sich Mary Cahill zwischen den oberen und den unteren Mühlsteinen, war der Gesellschaft ihres eigenen Geschlechts beraubt und musste wohl oder übel mit den Offizieren vorlieb nehmen. Und die Offiziere spielten ehrliches Spiel. Loyalität Mary Cahill gegenüber war eine Tradition von Fort Crockett, die ein jedes der ablösenden Regimenter pflichtgemäss aufrecht erhielt. Ausserdem wusste man von ihrem Vater, einem unheimlichen Gesellen, der nur fürs Geldverdienen lebte, dass er sich ausgezeichnet auf Revolverschiessen verstand ...
Seit dem Tage, an dem sie aus dem Kloster gekommen war, hatte Mary Cahill nur nach zwei Richtungen hin Liebe empfunden: Sie liebte ihren grimmigen, schweigsamen Vater, der mit der Eifersucht eines Liebhabers über sie wachte, und sie liebte die gesamte Armee der Vereinigten Staaten. Die Armee erwiderte ihre Liebe, ohne die Eifersucht ihres Vaters und mit weit grösserer Zärtlichkeit. Als jedoch Leutnant Ranson von den Philippinen nach Fort Crockett kam, verteilte Mary Cahill ihre Liebe nicht mehr auf die militärische Allgemeinheit, sondern ihr Herz schwankte stündlich zwischen Hangen und Bangen.
Zwei Räume bildeten das Erdgeschoss der Forthandlung — der grosse Raum, der nur von Offizieren und ihren Damen betreten werden durfte; der andere, kleinere, der für die Soldaten bestimmt war. Beide waren durch eine Bretterwand getrennt. Auf der Offiziersseite wie auf der Soldatenseite liefen Regale mit Kleiderstoffen und Konserven und Patentmedizinen die Wand entlang. Durch eine mit Büffelfellen verhängte Türe in der Scheidewand konnte Cahill von dem Ladentisch des einen Raumes zum Ladentisch des andern treten. Auf der einen Seite bediente Mary des Obersts Frau mit vielen Metern Seidenband zu Kotillongeschenken — auf der andern wog ihr Vater Bärenklauen ab (aus Truthahnknochen in Hartford, Staat Connecticut, fabriziert) zu einer Halskette für Rotschwinge, die Squaw des Häuptlings der Arrephaos. Cahill bediente einen jeden mit gleichem Ernst und in gleicher eigensinniger Schweigsamkeit. Noch niemand hatte ihn je lachen sehen. Er selbst scherzte dann und wann einmal mit anderen in seiner grimmigen, halb verlegenen Art. Noch niemals aber hatte jemand mit ihm gescherzt. Einmal wurde erzählt, nach Fort Crockett sei Cahill aus New York gekommen, wo er in der berüchtigtsten Gegend, in der Bowery, die erste Hand des nicht weniger berüchtigten Kneipenwirts McTurk gewesen sein sollte.
Dieses Gerücht stammte vom Sergeanten Clancey, von »G«-Schwadron. Als aber der Sergeant sich auf die New Yorker Zeiten berief und Cahill als Bekannten begrüsste, spreizte der Forthändler die Hände auf dem Ladentisch aus und starrte den Sergeanten aus kalten, drohenden Augen an.
„’war niemals in ’ner Wirtschaft,“ sagte er. „Bin noch nie auf der Bowery gewesen, niemals in New York, bin in meinem Leben nicht weiter östlich gekommen als Denver. Was wünscht Ihr sonst noch?“
„Schön, vielleicht irre ich mich,“ brummte der Sergeant.
Einen Monat später, als eines Abends unten beim Indianerdorf ein Coyote heulte, sagte der Sergeant hinterlistig:
„Klingt gerade wie das Signal der Whyos, nicht?“
Und Cahill, der dem Geheul des Wolfes lauschte, nickte gedankenlos mit dem Kopf.
Der Sergeant schnaubte vor Triumph. „Häh, hab ich’s doch gewusst!“ schrie er. „Ein Mann, der nie auf der Bowery gewesen sein will, und doch das Signal der Whyos kennt! Das kostet Euch eine Runde, Cahill!“
Das Argument des Sergeanten liess sich nicht gut widerlegen. Man musste wirklich die Tiefen des New Yorker Lebens recht genau kennen, um das Signal der Whyo-Jungens, der verbrecherischen Strassenbummler, der Einbrechergemeinschaft New Yorks im Gedächtnis zu haben. Cahill gab auch gar keine Antwort. Er sah den Sergeanten nicht einmal an, sondern putzte seinen Ladentisch mit einem feuchten Tuch ab, langsam, schwerfällig — so bedächtig, wie ein Mann ein Messer an einem Schleifstein schärft.
Als der Sergeant in der gleichen Nacht den Pfad zum Militärposten hinauf schritt, pfiff eine Kugel durch seinen Hut. Clancey war ein gewalttätiger Mann, und da gewalttätige Männer Feinde haben, so war er nicht ganz sicher, ob die Kugel von einem Rekruten stammte, den er in letzter Zeit schlecht behandelt hatte, oder ob er in der Dunkelheit für irgend einen Anderen gehalten worden war. In der nächsten Nacht krachte, gerade als er den Lichtschein aus den Fenstern der Forthandlung durchschritt, von dem Dunkel der Ställe her ein Schuss. Der Sergeant flüchtete schleunigst zu den Indianern, Cowboys und Soldaten in den Laden, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Cahill aus dem anderen Raum eintrat und sich ostentativ damit beschäftigte, eine Flasche Painkiller für Frau Stickneys Köchin einzuwickeln. Clancey liess sich jedoch nicht täuschen. Er bemerkte mit Genugtuung, dass die Sohlen und die Absätze von Cahills Stiefeln deutliche Spuren der schwarzen Schmutzpfütze bei den Ställen trugen.
Am nächsten Morgen, während der Laden gerade leer war, stellte der Forthändler eine neue Sendung von Büchsen kondensierter Milch auf einem Regal auf. Als er sich zufällig umwandte, sah er den Revolver des Sergeanten auf sich gerichtet.
Er warf die Hände in die Höhe, machte ein Gesicht, als geschähe ihm grosses Unrecht und wartete schweigend. Der Sergeant schritt vorwärts, bis er den Revolver auf den Ladentisch auflegen konnte — die Laufmündung präzise auf Cahills Magen gerichtet.
„Einer von uns, Ihr oder ich, hat Fort Crockett zu verlassen,“ sagte der Sergeant. „Und da ich nicht desertieren kann, so seid Ihr es, kalkulier’ ich.“
„Warum habt Ihr den Mund nicht gehalten?“ fragte Cahill. Er mimte noch immer ungläubiges, beleidigtes Erstaunen, aber seine ruhige Stimme drückte nicht nur volles Verständnis für die Situation aus, sondern vor allem den Wunsch, Zeit zu gewinnen.
„Zuerst dachte ich, der neue Rekrut in »F«-Schwadron könnt’ es gewesen sein,“ erklärte der Sergeant. „Beinahe hätt’ ich um Euretwillen den falschen Mann umgebracht. Was hab ich Euch denn dadurch geschadet, dass ich sagte, Ihr seiet Kneipenwirt für McTurk gewesen? Was ist denn dabei? Wie kann man darüber so wütend werden?“
„Ihr habt gesagt, ich gehörte zu den Whyos!“
„Was zum Teufel kümmere ich mich darum, was Ihr getan habt!“ brüllte der Sergeant. „Ich weiss überhaupt nichts von Euch. Aber ich denke nicht daran, mich hinterrücks erschiessen zu lassen. Ich werd’ die Geschichte meinem besten Freund erzählen, und wenn mir was passiert, dann weiss die Schwadron, wer’s getan hat, und Ihr werdet gehängt. Also — wie soll’s nun werden?“
Cahill kam nicht dazu, sich darüber zu äussern, denn vom andern Laden her rief Mary Cahills sanfte Stimme: „Vater! Oh, Vater!“
Die beiden Männer duckten sich und sahen einander schuldbewusst an. Der Sergeant starrte mit weit aufgerissenen Augen nach dem Vorhang aus Büffelfellen; Cahill liess seine Hände sinken und legte sie flach auf den Ladentisch.
Und als Miss Mary Cahill die Büffelfelle beiseite schob, war Sergeant Clancey, von »G«-Schwadron, eben dabei, ihrem Vater den Mechanismus des neuen Armeerevolvers zu zeigen. Anscheinend machte ihm das Einschieben des Patronenzylinders Schwierigkeiten, denn sein Gesicht war ganz rot und ärgerlich. Ihr Vater betrachtete die Schusswaffe mit dem kritischen Blick des Kenners.
„Vater,“ sagte Miss Cahill lächelnd, „weshalb hast du denn nicht geantwortet? Wo ist das blaue Briefpapier — die Sorte, die Major Ogden immer kauft? Er wartet.“
Der Forthändler verwandte kein Auge von dem Revolver vor ihm. „Bei den Notizbüchern liegt es, Kind,“ sagte er. „Auf dem zweiten Regal.“
Miss Cahill traktierte den riesigen Sergeanten mit einem bezaubernden Lächeln und flüsterte leise, so dass der Offizier im Nebenraum es nicht hören konnte:
„Will er dir ärarisches Eigentum verkaufen, Väterchen? Tu’s ja nicht! Sergeant, wie können Sie meinen armen Vater in Versuchung führen!“
Sie verschwand in den Falten der Büffelfellvorhänge, bis nur noch ihr Gesichtchen hervorguckte. Es war ein süsses, liebes Gesicht, mit den Augen eines kleinen Jungen.
„Wenn der Major fort ist, Sergeant,“ wisperte sie, „dann bringen Sie mir Ihren Revolver in den andern Laden herüber und ich werde ihn Ihnen abkaufen!“
Der Sergeant nickte heftig, in begeisterter Zustimmung, über das ganze Gesicht lachend. Dabei schlug er sich schallend aufs Knie, als könne er sich gar nicht mehr helfen vor Freude und Vergnügen.
Die Büffelfelle fielen nieder und das Gesichtchen verschwand.
Der Sergeant schob den Revolver hin und her, und Cahill verschränkte trotzig die Arme.
„Nun?“ sagte er.
„Na?“ fragte der Sergeant.
„Ihr könntet eigentlich selber sehen, wie die Sache liegt,“ sagte Cahill, „ohne dass ich’s Euch erklären muss.“
„Ihr meint, sie soll nichts davon wissen?“
„Mein Gott, nein! Nicht einmal, dass ich Kneipenwirt war!“
„Schön, ich weiss von nichts. Ich plaudere nichts aus. Hätt’ ich sowieso nicht getan. Wenn Ihr versprecht, gut zu sein und mich in Ruhe zu lassen, so ist die Geschichte erledigt.“
Da lächelte Cahill, zum erstenmal, seit er in Fort Crockett war.
„Kann ich jetzt mal unter den Ladentisch greifen?“ fragte er.
Der Sergeant schmunzelte verständnisvoll und balanzierte seinen Sechsschüssigen in der Rechten.
„Jawohl! Aber ich behalt’ das Ding hier noch in der Hand, bis ich sicher bin, dass es nur eine Flasche ist, nach der Ihr greift!“ sagte er und brach in ein lautes Gelächter aus.
Einen Augenblick lang, unter dem Schutz des Ladentisches, berührte Cahills Hand sehnsüchtig den Revolver, der dort lag, und glitt dann hinüber zu der daneben stehenden Flasche. Die Flasche kam zum Vorschein. Die Gläser klirrten zusammen ...
Und damit war die Angelegenheit erledigt. Sie wäre für immer erledigt geblieben, hätte nicht Leutnant Ranson eine Torheit begangen.
Vor einer Woche war in den Willow-Gründen, im Zeltlager einiger Kiowa-Indianer, ein Feuer ausgebrochen, und die Prärie lag verbrannt und schwarz da, so weit man nur sehen konnte. Als wäre Tinte vom Himmel herabgeregnet. Beim Ausbruch des Feuers befand sich das ganze Regiment, mit Ausnahme von zwei Schwadronen, auf einem Uebungsmarsch, um irgend eine neumodische Feldration auszuprobieren. Komprimierte Nahrung. Tabletten. Sobald das Regiment auf dem Rückweg zwischen den Hügeln hervorkam, sah es den Feuerschein am Himmel, und aus dem Uebungsmarsch wurde ein Rennen.
Im Fort waren die Männer, Leutnant Ranson an ihrer Spitze, mit nassen Pferdedecken nach dem Feuerherd geeilt, so schnell sie nur laufen konnten, und während »G«-Schwadron unter Ransons Führung mit den Flammen kämpfte, brannte »H«-Schwadron, von Major Stickney kommandiert, das dürre Gras in weitem Kreis um das Fort ab. Auf dieses vor dem Feuer gesicherte Gelände flüchteten die Männer von »G«-Schwadron, stolpernd vor Müdigkeit, Köpfe und Schultern in rauchende, angebrannte Decken gehüllt. Die Flammen verfolgten sie mit solcher Schnelligkeit, dass das brennende Gras ihnen die Schnürbänder versengte und die Gamaschen ihnen von den Füssen fielen.
Als das Regiment ankam, hörte es von jedermann in Fort Crockett, wie famos sich Ranson betragen hatte.
„Ich versichere Sie,“ sagte Frau Bolland zum Oberst, „wäre der junge Ranson nicht gewesen, so hätten wir in unseren Betten verbrennen müssen. Aber er war sehr unverschämt. Er betrachtete die ganze Affäre als ein Feuerwerk. Es war für ihn das einzige Vergnügen in Fort Crockett seit seiner Ankunft, das ihm wirklich Freude machte.“
Trotzdem gab man allgemein zu, dass Ranson den Militärposten gerettet hatte. Er war allgegenwärtig gewesen. Man hatte ihn in die vordringenden Flammen hineingaloppieren sehen, wie ein wildgewordenes Füllen; wie ein Irrwisch war er wieder aufgetaucht inmitten wirbelnder schwarzer Rauchsäulen, hin- und herjagend, Befehle erteilend an zwanzig verschiedenen Stellen. Einen Augenblick lang konnte man beobachten, wie er mit einer nassen Decke in die Flammen schlug und sie jubilierend um sein Haupt schwang, wie ein Kadett beim Armee-Marine-Fussballspiel mit dem Taschentuch winkt — im nächsten Moment kam er wankend aus dem feurigen Ofen zum Vorschein, einen betäubten Kavalleristen am Kragen schleppend und schreiend:
„Sanitätssergeant, Sanitätssergeant! Hier ist ’n brennender Mann! Löschen Sie ihn aus. Dann schicken Sie ihn wieder zu mir! Schnell!!“
Wer ihm in dem Wirbelwind von Rauch und zuckender Flamme begegnet war, erzählte, Leutnant Ranson habe ohne Unterlass vergnügt gekichert.
„Ist das nicht famos?“ hatte er jeden angeschrien. „Heh, ist das nicht wunderbar? Nicht um eine Reise nach New York würd’ ich dies Erlebnis hergeben!“
Als der Oberst dem Hospital einen Besuch abgestattet und den Männern sans Haaren, sans Augenbrauen, und mit bandagierten Händen und Armen aufmunternde Worte gesagt hatte, lobte er Leutnant Ranson auf der Parade vor versammeltem Regiment. Ranson aber lief nach der Parade unter erschrecklichem Fluchen schleunigst nach seiner Baracke.
Am Abend suchte er im Kasino sympathisches Verständnis bei Mary Cahill.
„Allmächtige Güte!“ rief er. „Haben Sie ihn gehört? War’s nicht schauderhaft? Wenn ich geahnt hätte, er würde mich so behandeln, so wäre ich desertiert. Warum muss man einem nun das einzige Vergnügen verderben, das man gehabt hat! Hoh! Hätt ich gewusst, dass man aus dieser langweiligen Prärie so viel nette Aufregung herausschinden kann, so würde ich sie selber angezündet haben! Schon vor drei Monaten! Es war mein erstes Vergnügen in Fort Crockett, und — der Oberst stellt sich hin und predigt mir die reine Leichenpredigt!“
Ranson war zur Zeit des spanisch-amerikanischen Krieges in die Armee getreten. Weil er sich von diesem Schritt eine neue Art von Aufregung versprach und weil alle seine Freunde das Gleiche taten. Als der Sohn seines Vaters wurde er zum Generaladjutanten bei der Freiwilligen-Truppe ernannt, mit dem Rang eines Kapitäns, und dem Stabe eines Brigadegenerals aus dem Süden aufgehalst, der von vornherein bestimmt war, Charleston niemals zu verlassen. Aber Ranson argwöhnte sofort, wie die Sache sich verhielt. Er telegraphierte seinem Vater drei Tage lang, erreichte durch dessen Einfluss beim Kriegsministerium auch wirklich, dass er nach den Philippinen kommandiert wurde, und segelte gerade noch zeitig genug von San Franzisko ab, um mit Befehlen und Depeschen durch die Brandung waten zu können, als die Freiwilligen Manila besetzten. Wieder spielte der Telegraph. Kabeltelegramme, die viele, viele Dollars kosteten, bewirkten, dass er von seinen Pflichten beim Stabe entbunden, und als Leutnant zu einem Freiwilligen-Regiment versetzt wurde. Zwei Jahre lang jagte er die kleinen, braunen Männer in den Reisfeldern, brannte Dörfer nieder, plünderte Kirchen, und sammelte Kugellassos und Altardecken. Dabei amüsierte er sich so ausgezeichnet, dass die Ueberzeugung in ihm wuchs, die Armee stelle den einzigen Beruf dar, bei dem immer Aufregung zu haben sei. Und da Ausregung ihm so wichtig erschien wie Licht und Luft, so suchte er um Anstellung in der regulären Armee nach. Auf Grund seiner Führungsliste als Freiwilligen-Offizier wurde er zum Leutnant im Zwanzigsten Kavallerieregiment ernannt und, als dieses Regiment nach den Vereinigten Staaten zurückkehrte, in Fort Crockett — lebendig begraben.
Nach sechs Monaten dieses Exils brach Ranson eines Abends im Kasino in offene Rebellion aus.
„Ich sage Ihnen, ich halte es nicht einen Tag länger aus!“ rief er. „Ich reiche meinen Abschied ein.“
Mary Cahill hörte hinter ihrem Ladentisch mit Entsetzen zu. Die Leutnants Crosby und Curtis erschauderten. Sie waren Söhne von Offizieren der regulären Armee. Erst vor sechs Monaten hatten sie die Kadettenakademie von West-Point verlassen, angetan in eleganten nagelneuen Uniformen. Die Traditionen der Akademie von Loyalität und Disziplin waren ihnen ins Rückgrat hinein geknetet worden. Ranson verkörperte für sie die schrecklichen Folgen des Ausstellens von Offizierspatenten an Zivilisten.
„Vielleicht wird jetzt, wo das Frühjahr kommt, mehr los sein,“ meinte Curtis, hoffnungsvoll zwar, aber doch mit zweifelndem Blick auf das Kaminfeuer.
„Ich würde nichts Unüberlegtes tun!“ mahnte Crosby.
Miss Cahill schüttelte ihren Kopf. „Aber — ich finde es sehr schön auf dem Militärposten,“ sagte sie. „Mir gefällt es sehr gut, und ich bin doch schon seit fünf Jahren hier — seit ich aus dem Kloster kam — und ich — —“
Ranson unterbrach sie mit höflicher Verbeugung.