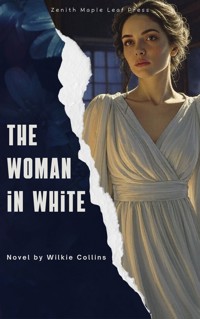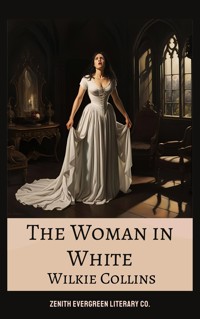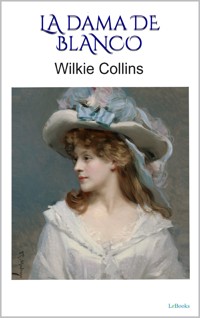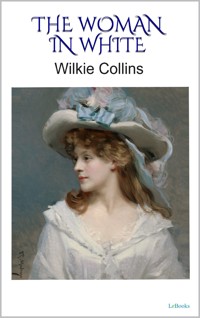8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Freunde, die beide den verhängnisvollen Namen Allan Armadale tragen, stehen unter dem Fluch ihrer Väter, Rivalen bis zum Mord. Die Szene ist Wildbad, das Jahr1832, und die Stadthonoratioren warten in festlichem Aufzug auf die ersten Kurgäste der Saison. Unter ihnen befindet sich der reiche, sterbenskranke Plantagenbesitzer Allan Armadale, dessen einziger Wunsch es ist, noch vor seinem Tod einen Brief für seinen Sohn zu beenden, in dem er die verhängnisvolle Geschichte seiner Familie erzählt und vor dem Namensvetter warnt: "Lege Gebirge und Meere zwischen Dich und jenen anderen Armadale. Nie dürfen sich die beiden auf dieser Welt begegnen - nie, nie, nie!" Doch ehe der Inhalt des Briefes dem Sohn enthüllt wird, kreuzen sich die Wege der beiden Armadales, und die schöne Unbekannte mit dem roten Schal löst eine Kette mysteriöser Verwicklungen aus, in die die Namensvettern bald verstrickt sind. Wilkie Collins hat nicht nur eine spannende, glänzend konstruierte Handlung erfunden, der Roman fasziniert auch durch seine gekonnte Milieuschilderung und die meisterhafte Personendarstellung: der grüblerische, sensible Midwinter, der fröhliche, optimistische Allan, die Intrigantin Lydia, die hübsche, verliebte Majorstochter, die es auf unschuldig-raffinierte Art versteht, Allan den Kopf zu verdrehen. Aber auch die Nebenfiguren - der schrullige Major, die alte Gaunerin Mutter Oldershaw, die Jammerfigur des alten Bashwood, die gewitzten Anwälte Pedgift und Sohn, die Witwe Pentecost und ihr geistlicher Sohn Sammy - sind mit sicherer Hand ausgeführt. Viele Spannungs- und Gruseleffekte, Liebe und Verstrickungen durchziehen die Handlung bis zur Lösung des Rätsels. Der rote Schal erschien 1866, lange erwartet, sechs Jahre nach Die Frau in Weiß und wurde, ebenso wie jener, ein Erfolgsroman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1082
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Wilkie Collins
Der rote Schal
Roman
Aus dem Englischen von Eva Schönfeld
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorwort
Der geneigte Leser, auf dessen Großherzigkeit ich nun schon aus Erfahrung vertrauen darf, wird, wie ich abermals zu hoffen wage, die etwa vorhandenen Qualitäten dieser Erzählung zu würdigen wissen, ohne daß ich im voraus um Nachsicht bitte. Er wird erkennen, daß alles wohlüberlegt und gewissenhaft ausgearbeitet ist und möge das Ergebnis demgemäß beurteilen – mehr verlange ich nicht.
Allerdings werden sich auch einige Leser finden, die es hier und da stört, vielleicht sogar ärgert, daß Der rote Schal in mehr als einer Richtung die engen Grenzen überschreitet, die sie der modernen Erzählkunst zubilligen. Solche Personen werde ich durch keine noch so glänzenden Argumente umstimmen können, wie es die Zeit selbst für mich tun wird, wenn sie mein Werk bestehen läßt. Ich fürchte nicht, daß meine Absichten fortwährend verkannt werden, vorausgesetzt, daß die Ausführung ihnen gerecht geworden ist.
Unsere gegenwärtigen Moralprediger und Scheinheiligen mögen dieses Buch höchst gewagt finden; doch gemessen an der wahrhaft christlichen Moral, die für alle Zeiten gilt, besteht seine Kühnheit nur darin, daß es die Dinge beim rechten Namen nennt.
London, im April 1866
Der Verfasser
Vorgeschichte
Die englischen Kurgäste
In Wildbad war soeben die Badesaison des Jahres 1832 eröffnet worden.
Schon senkten sich die ersten Abendschatten über das friedliche deutsche Kurstädtchen, und die Postkutsche war jeden Augenblick zu erwarten. Vor dem Tor des stattlichsten Gasthofes standen die Honoratioren von Wildbad nebst ihren Gattinnen zum Empfang der ersten ausländischen Kurgäste bereit: der Bürgermeister als Vertreter der gesamten Einwohnerschaft, der Doktor als Vertreter der berühmten Heilquellen und der Wirt als Vertreter seines eigenen, wohlrenommierten Hauses. In respektvollem Abstand von dieser erlesenen Gruppe drängte sich das schaulustige Volk, unter dem sich auch einige Bauern in der landesüblichen Tracht eingefunden hatten, die Männer in schwarzen Jäckchen, engen Kniehosen und Dreispitzen, die blondzopfigen Frauen mit silberverschnürtem Mieder und züchtigem Busentuch; dahinter verbarg sich die Blaskapelle des Ortes in einer etwas entfernteren Ecke, um die Gäste sofort beim Erscheinen mit dem ersten Ständchen des Jahres zu begrüßen. Die Waldgipfel rechts und links leuchteten noch in den letzten Strahlen der sinkenden Sonne, und das frische Abendlüftchen brachte den ganzen Duft der hohen Schwarzwaldtannen mit.
Die Frau des Bürgermeisters wandte sich mit ausgesuchter Höflichkeit an den Wirt und fragte: »Herr Wirt, haben sich für den ersten Tag der Saison bereits ausländische Gäste bei Ihnen angemeldet?«
»Jawohl, Frau Bürgermeisterin«, erwiderte der Angeredete nicht weniger höflich und titelbewußt als sie, »zwei Herren mitsamt Anhang. Der eine hat mir durch seinen Bedienten schreiben lassen; der andere hat augenscheinlich geruht, es eigenhändig zu tun. Beide sind, nach ihren Namen zu schließen, Engländer. Verzeihen Sie gütigst, Frau Bürgermeisterin, wenn ich zögere, diese Namen auszusprechen; ich werde sie, um Fehler zu vermeiden, lieber der Reihe nach buchstabieren. Gast Numero eins, ein hochgeborener Herr (er hat den Titel Mister), unterschreibt sich mit den acht Buchstaben A, R, M, A, D, A, L, E, ist krank und reist im eigenen Wagen. Gast Numero zwo, ebenfalls hochgeboren (auch er betitelt sich Mister), besitzt lediglich vier Buchstaben, nämlich N, E, A, L, und scheint nicht ganz so krank zu sein, denn er reist mit der Postkutsche. Seine Exzellenz mit den acht Buchstaben haben mir durch dero Diener auf französisch schreiben lassen; Seine Exzellenz mit den vier Buchstaben hingegen taten es auf deutsch. Wir haben die Zimmer für die Herrschaften aufs beste hergerichtet. Mehr wüßte ich vorläufig nicht zu sagen.«
»Vielleicht«, meinte die Bürgermeisterin und wandte sich nun an den Arzt, »haben Sie, Herr Doktor, schon mehr von diesen vornehmen Fremden gehört?«
»Nur von dem Erstgenannten, Frau Bürgermeisterin; genauer gesagt: nicht von ihm selbst, sondern von seinen bisherigen Ärzten, die mir einen Krankenbericht übersandt haben. Es muß sich um einen sehr schweren Fall handeln. Gott helfe ihm!«
»Die Postkutsche kommt!« ertönte in diesem Moment eine Kinderstimme aus dem Hintergrund.
Die Blaskapelle zückte augenblicklich die Instrumente, und die übrige Versammlung erstarrte in gespanntem Schweigen. Wirklich, aus der gewundenen Waldschlucht hörte man näher kommendes Räderrollen und Schellengeklingel – aber war es nun der Privatreisewagen mit Mr. Armadale oder die Postkutsche mit Mr. Neal?
»Blast, Freunde!« rief der Bürgermeister den Musikanten zu. »Postkutsche oder Privatwagen, was gilt’s – wir empfangen die ersten Kranken des Jahres. Bieten wir ihnen ein herzliches Willkommen!«
Die Kapelle schmetterte einen munteren Ländler, zu dem die Kinder sofort zu tanzen begannen, bis die Eltern sie hastig aus dem Weg zerrten, denn eben jetzt erschienen die ersten düsteren Schicksalsbotinnen auf der heiteren Szene, und zwar in Gestalt mehrerer draller Schwarzwaldmädel, deren jede einen leeren Rollstuhl vor sich herschob, um am Halteplatz Aufstellung zu nehmen und, parzengleich strickend, der hilflosen Gelähmten zu harren, die schon damals zu Hunderten (heute sind es Tausende) in den Heilquellen Wildbads Genesung zu finden hofften.
Die echt weibliche, unersättliche Neugier der Bürgermeisterin war noch nicht befriedigt. Sie zog jetzt die Frau des Gastwirts ein wenig beiseite und flüsterte ihr folgende dringliche Frage zu:
»Sagen Sie, Frau Wirtin, haben sich die beiden vornehmen Fremden aus England denn deutlich ausgedrückt? Zum Beispiel – werden sie von Damen begleitet?«
»Der, der mit der Postkutsche kommt, sicherlich nicht«, erwiderte die Wirtin. »Aber der im Privatwagen: ja. Er bringt ein Kind mit, er bringt seine eigene Pflegerin mit, und er bringt« – die Wirtin machte eine Kunstpause, um die Spannung genußvoll zu steigern –, »er bringt auch seine Frau Gemahlin mit.«
Die Frau Bürgermeisterin strahlte, die Frau Doktor strahlte, und die Frau Wirtin nickte beiden vielsagend zu, denn in allen drei Seelen herrschte nur noch ein und derselbe Gedanke: Sie würden die neuesten ausländischen Moden zu sehen bekommen!
Inzwischen war das sich nähernde Gefährt in Sicht gekommen, und sein leuchtendes Gelb behob jeden Zweifel. Es war die frisch gestrichene Postkutsche, deren Mittel- und Rückabteil zehn deutsche Reisende entstiegen, das heißt, drei mußten vorsichtig herausgehoben, in Rollstühle gesetzt und so zu ihren verschiedenen Quartieren im Ort weitertransportiert werden. Im Vorderabteil hatten nur zwei Passagiere gesessen, nämlich Mr. Neal und sein Diener, mit dessen Hilfe er ohne allzu große Beschwerden über das Trittbrett kam; offenbar beschränkte sich seine Lahmheit auf einen Fuß. Auf dem gepflasterten Platz angelangt, bediente er sich zur weiteren Stütze eines unauffälligen Spazierstocks. Die Bläser intonierten ihm zu Ehren den Walzer aus dem Freischütz, was er mit einem leicht gereizten Blick quittierte. Überhaupt dämpfte seine persönliche Erscheinung den Enthusiasmus des wohlmeinenden kleinen Kreises, der zu seiner Begrüßung bereitstand. Mr. Neal erwies sich als ein Herr in mittleren Jahren, hochgewachsen, hager, mit strengem Gesichtsausdruck und kalten grauen Augen unter buschigen Brauen, vorstehenden Backenknochen und schmalem, verkniffenem Mund – jeder Zoll ein Schotte.
»Wo ist der Besitzer dieses Hotels?« fragte er in mühelosem Deutsch und nahm dann mit eisiger Unnahbarkeit die dienstbeflissene Vorstellung des Wirtes zur Kenntnis. »Schicken Sie zum Arzt«, fügte er hinzu, »und sagen Sie ihm, daß ich ihn unverzüglich zu sehen wünsche.«
»Ich bin schon zur Stelle«, meldete sich der Doktor und trat vor, »und stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung.«
»Danke«, erwiderte Mr. Neal kurz. Er sah den Doktor ungefähr so an wie einen Hund, der auf den Pfiff seines Herrn selbstverständlich gekommen ist. »Wegen meines eigenen Falles werde ich Sie morgen vormittag um zehn konsultieren. Im Moment möchte ich Ihnen nur eine Botschaft ausrichten, die ich unterwegs übernommen habe. Auf der Straße hierher überholten wir einen Reisewagen mit einem offenbar schwerkranken Herrn; ich nehme an, er ist Engländer. Die ihn begleitende Dame hat mich gebeten, Sie gleich nach meiner Ankunft zu informieren, daß der Patient schon beim Verlassen des Wagens ärztliche Hilfe brauchen wird. Der Wagen ist durch einen Unfall leicht beschädigt und kann nur langsam fahren. Es wird daher genügen, wenn Sie sich in einer Stunde wieder hier vor dem Hotel einfinden. Soweit die Botschaft. – Wer ist dieser Herr, der mich augenscheinlich dringend zu sprechen wünscht? Der Bürgermeister? Aha. Mein Diener wird Ihnen meinen Paß vorlegen, Sir, falls es sich darum handelt. Nicht? Sie heißen mich lediglich willkommen und bieten mir Ihre Dienste an? Sie sehen mich unsäglich geschmeichelt. Sollte Ihre Autorität ausreichen, das Programm Ihrer Blaskapelle abzukürzen, so täten Sie mir damit gleich den ersten Gefallen. Musik ist meinen Nerven nicht zuträglich. Wo ist der Wirt? Ich wünsche jetzt die Zimmer zu sehen. Nein, ich brauche Ihren Arm nicht; mein Stock genügt mir auch zum Treppensteigen. Herr Bürgermeister, Herr Doktor – halten wir einander nicht mit weiteren Formalitäten auf. Guten Abend.«
Die beiden wackeren Männer, solchermaßen abgefertigt, sahen dem davonhinkenden Schotten mißbilligend nach und schüttelten stumm die Köpfe. Die Damen gingen jedoch, wie üblich, einen Schritt weiter und machten ihren aufgestauten Gefühlen in unmißverständlichen Worten Luft. Dieser Mann benahm sich skandalös – er hatte nicht die geringste Notiz von ihnen genommen! Die Frau Bürgermeisterin konnte soviel Flegelei nur der natürlichen Grobheit eines Wilden zuschreiben, während die Frau Doktor geradezu von der angeborenen Brutalität eines Schweins sprach …
Die weitere Wartestunde zog sich in die Länge. Verstohlen kroch das Dunkel an den waldigen Hängen höher und höher empor, ein Stern nach dem andern erschien am Himmel, und einige Fenster des Gasthofs erhellten sich. Schließlich zerstreuten sich auch die letzten müßigen Gaffer, und der ruhelos auf und ab schreitende Doktor blieb als einzige lebende Seele auf dem Platz zurück. Noch fünf Minuten, noch zehn, noch zwanzig las er von seiner Taschenuhr ab, ehe das erste schwache Geräusch durch die abendliche Stille an sein Ohr drang und ihm das Nahen des erwarteten Wagens ankündigte. In schleppendem Schritt, wie ein Leichenwagen, fuhr er endlich auf den Platz und hielt vor dem Tor des Gasthauses.
»Ist der Doktor da?« ließ sich eine französisch sprechende weibliche Stimme aus dem Dunkel des Wageninnern vernehmen.
»Ja, Madame, hier bin ich«, erwiderte der Doktor, nahm die Laterne aus der Hand des herbeieilenden Wirtes und öffnete den Schlag.
Das erste, was er im Strahl der Laterne sah, war das Gesicht der Dame, die zu der Stimme gehörte – einer jungen, dunklen Schönheit, deren ausdrucksvolle schwarze Augen voller Tränen standen. Dann zeigte sich auch das verschrumpelte Gesicht einer alten Negerin, die der Dame gegenüber im Rücksitz saß. Das dritte Gesicht war das eines kleinen schlafenden Kindes auf dem Schoß der Negerin, der von der Dame mit einer raschen, ungeduldigen Handbewegung bedeutet wurde, zuerst auszusteigen. »Bitte schaffen Sie die beiden aus dem Weg«, sagte sie zu der Wirtin, »schaffen Sie sie in ihr Zimmer – bitte!« Erst nachdem dies geschehen war, stieg sie selbst aus.
Der Schein der Laterne fiel nun ungehindert bis zur anderen Wagenseite und beleuchtete den vierten Reisenden, der bisher unsichtbar geblieben war.
Er lag hilflos auf einer gepolsterten Tragbahre. Sein langes Haar quoll wirr unter einer schwarzen Kappe hervor, seine weitoffenen Augen bewegten sich unruhig hin und her; doch im übrigen war sein Gesicht so ausdrucks- und gedankenlos wie das einer Leiche. Jeder Versuch, aus dem Mienenspiel Rückschlüsse auf das einstige Wesen des Patienten zu ziehen, auf seinen Charakter, sein Alter, seine Lebensstellung, mußte an dieser bleifarbenen Leere scheitern. Nichts sprach aus ihm als der schleichende Tod, dessen wissenschaftlicher Name Paralyse ist. Der kundige Blick des Doktors glitt über die untere Körperhälfte des Kranken, und der schleichende Tod erwiderte auf die stumme Frage: Hier bin ich schon. Der Blick des Doktors glitt weiter hinauf, über Hände und Arme bis zur Mundpartie, und der schleichende Tod flüsterte hämisch: Dahin komme ich auch noch!
Angesichts eines so gnadenlosen Schicksals hätte jedes Wort hohl und überflüssig geklungen. Man konnte nur noch der Frau, die weinend neben dem Wagenschlag stand, mit praktischen Hilfeleistungen sein Mitgefühl beweisen.
Während die Trage in den Gasthof getragen wurde, blieben die umherirrenden Augen des Kranken sekundenlang auf dem Gesicht der Frau haften, und zugleich öffnete er die Lippen.
»Das Kind?« brachte er mühsam auf Englisch hervor, als kostete ihn schon diese kurze Lautfolge eine ungeheure Anstrengung.
»Es ist gut untergebracht«, antwortete sie leise.
»Und … meine Schatulle?«
»Die trage ich selbst. Hier, sieh! Ich gebe sie nicht aus den Händen; sei unbesorgt.«
Hierauf schloß der Kranke zum erstenmal die Lider und sagte nichts mehr. Man trug ihn behutsam die Stiegen empor. Der Wirt und das Hausgesinde sahen aus achtungsvollem Abstand zu, wie sich eine Tür hinter der Trage, der Frau und dem Doktor schloß, hörten, wie die Frau drinnen sofort in lautes Schluchzen ausbrach, sahen den Doktor nach einer guten halben Stunde wieder herauskommen, merklich bleich gegen seine sonstige gesunde Gesichtsfarbe, bestürmten ihn um nähere Auskunft und erhielten nichts als die magere Vertröstung: »Wartet bis nach der Untersuchung morgen. Heute kann ich noch nichts sagen.« Aber sie alle kannten ihren Doktor gut genug, um gerade aus seiner Eile und Wortkargheit auf das Schlimmste zu schließen.
Das also war der Einzug der ersten englischen Kurgäste in Wildbad, im Mai des Jahres 1832.
Von der Festigkeit des schottischen Charakters
Am nächsten Morgen, pünktlich um zehn, sah Mr. Neal auf seine Uhr und stellte zu seinem Befremden fest, daß der zu dieser Stunde bestellte Arzt ihn warten ließ. Er wartete noch längere Zeit vergebens. Als der Doktor endlich in sein Zimmer trat, war es beinahe elf.
»Ich habe Ihren Besuch um zehn Uhr erbeten«, lautete Mr. Neals Begrüßung. »In meinem Land pflegen Ärzte pünktlich zu sein.«
»In meinem Land«, entgegnete der Doktor prompt, aber ohne jede Bosheit, »gleichen die Ärzte allen anderen Leuten – mit anderen Worten, auch sie sind machtlos gegen Zwischenfälle. Ich bitte sehr um Verzeihung, Sir, daß ich so spät komme, aber ich bin durch einen überaus traurigen Fall aufgehalten worden. Es handelt sich um Mr. Armadale, dessen Wagen Sie gestern überholt und dessen Botschaft Sie freundlicherweise ausgerichtet haben.«
Mr. Neal betrachtete seinen ärztlichen Berater mit grämlichem Staunen, denn einen so spürbaren Grad von Teilnahme und Besorgnis konnte er sich nicht erklären.
»Darf ich Sie daran erinnern«, sagte er, »daß Sie sich jetzt mit meinem Fall zu befassen haben und nicht mehr mit Mr. Armadales?«
»Gewiß«, versicherte der Doktor eilig und versuchte seine Gedanken gewaltsam von dem Patienten loszureißen, den er soeben verlassen hatte. »Ich habe schon bemerkt, daß Sie ein wenig hinken. Lassen Sie mich bitte den lahmen Fuß sehen.«
Mr. Neals Leiden mochte in seinen eigenen Augen ernsthaft genug sein, aber vom medizinischen Standpunkt aus waren die Symptome unbedeutend. Er litt an einer rheumatischen Versteifung des einen Knöchelgelenks. Nach dem üblichen Frage- und Antwortspiel, das knapp zehn Minuten dauerte, verschrieb der Arzt die nötigen Bäder, die Konsultation war damit beendet, und der Patient legte seinem Berater mit betontem Schweigen nahe, sich zu verabschieden.
Dieser stand auf, zögerte jedoch und sagte plötzlich: »Es ist mir klar, daß ich Ihre Zeit und Ihre Geduld über Gebühr in Anspruch nehme, aber … Verzeihen Sie, ich muß noch einmal auf Mr. Armadales Fall zurückkommen.«
»Darf ich fragen, wer oder was Sie dazu zwingt?«
»Die einfache Christenpflicht gegenüber einem Sterbenden«, erwiderte der Doktor.
Mr. Neal zuckte etwas zusammen, denn das Wort »Christenpflicht« hatte einen verborgenen, aber hochempfindsamen Nerv in ihm berührt. »Wenn es so ist, haben Sie Anspruch auf meine volle Aufmerksamkeit«, sagte er ernst. »Meine Zeit gehört Ihnen.«
»Fürchten Sie nicht, daß ich Ihre Güte mißbrauche«, sagte der Doktor und nahm noch einmal Platz. »Ich werde mich möglichst kurz fassen. Mr. Armadales Krankengeschichte ist in Stichworten folgende: Er hat den größten Teil seines Lebens auf der Insel Barbados verbracht und sich nach seinem eigenen Geständnis dort mancherlei Extravaganzen und Lastern hingegeben. Vor drei Jahren hat er geheiratet, und bald danach zeigten sich die ersten Symptome einer beginnenden Paralyse. Die Ärzte empfahlen ihm vor allem die Rückkehr ins europäische Klima, und er hat seitdem vorwiegend in Italien gelebt, ohne das Fortschreiten der Krankheit dadurch im mindesten aufhalten zu können. Nach einem besonders heftigen Anfall hat er es mit der Schweiz versucht, und aus der Schweiz ist er hierher nach Wildbad geschickt worden. Soweit hat mich sein letzter Arzt brieflich informiert; der neueste Befund ist das Resultat meiner eigenen Untersuchung. Mr. Armadale ist viel zu spät zu uns geschickt worden – sein Fall ist hoffnungslos. Die Lähmung breitet sich vom Rückenmark mit beängstigender Schnelligkeit auch in der oberen Körperhälfte aus. Er kann die Finger noch ein wenig bewegen, aber er kann schon nichts mehr halten. Was die Sprache betrifft, so kann er sich gerade noch zur Not verständlich machen, aber heute oder morgen ist er vielleicht nicht einmal dazu mehr imstande. Ich gebe ihm äußerstenfalls noch eine Woche zu leben. Das alles habe ich ihm, natürlich so schonend wie möglich, auf sein eigenes Verlangen gesagt. Trotzdem war die Wirkung entsetzlich. Der Kranke geriet in eine Erregung, die sich mit Worten nicht beschreiben läßt. Ich nahm mir daraufhin die Freiheit, ihn zu fragen, ob seine irdischen Angelegenheiten nicht genügend geordnet seien. Nein, daran lag es nicht. Sein Testament liegt bei seinem Rechtsanwalt in London; er ist vermögend und hinterläßt Frau und Kind wohlversorgt. Daher stellte ich noch eine Frage, und diesmal traf ich offenbar den Nagel auf den Kopf: ›Haben Sie sonst etwas auf dem Herzen, was Sie vor Ihrem Tode unbedingt noch erledigen möchten?‹ Der tiefe Erleichterungsseufzer, den er von sich gab, bejahte die Frage deutlicher als die wortreichste Erklärung. ›Kann ich Ihnen helfen?‹ fragte ich. ›Ja‹, brachte er mit langen Pausen hervor, ›ich habe noch etwas zu schreiben – ich muß es schreiben – wissen Sie ein Mittel, daß ich noch einmal eine Feder halten kann?‹ Er hätte mich ebensogut fragen können, ob ich Wunder wirken könne. Ehrlicherweise mußte ich verneinen. ›Kann ich Ihnen dann nicht diktieren?‹ fuhr er fort, und leider mußte ich ihm auch dies abschlagen. Ich verstehe zwar ein paar Brocken Englisch, kann es aber weder sprechen noch schreiben. Mr. Armadale hingegen versteht Französisch, wenn langsam gesprochen wird – wir verständigen uns auf diese Weise –, kann aber nicht einen fertigen Satz auf Französisch bilden, und von der deutschen Sprache versteht er kein Wort. In dieser Verlegenheit sagte ich nun, was wohl jeder an meiner Stelle gesagt hätte: ›Warum wenden Sie sich überhaupt an mich? Ihre Gattin steht Ihnen doch jederzeit zur Verfügung; soviel ich weiß, ist sie eben jetzt im Nebenzimmer –, und damit wollte ich aufstehen, um sie zu holen. Mr. Armadale hielt mich jedoch zurück, selbstverständlich weder mit Worten noch Bewegungen, aber mit einem Blick, in dem ein solches Entsetzen, ja Grauen stand, daß ich vor Staunen wie angewurzelt sitzen blieb. ›Aber ist Ihre Gattin nicht der geeignetste Mensch für ein privates Diktat?‹ wagte ich einzuwenden. ›Der letzte auf Erden!‹ erwiderte er. ›Wie soll ich das verstehen?‹ sagte ich. ›Wollen Sie wirklich mir, einem völlig Fremden, Dinge anvertrauen, die Sie sogar vor Ihrer Frau geheimhalten?‹ Sie können sich mein Erstaunen vorstellen, als er darauf, ohne einen Moment zu zögern, nur ein heftiges Ja hervorstieß. Ich saß in Verwirrung und Verlegenheit da und schwieg. ›Wenn Sie einem englischen Diktat nicht folgen können‹, fing er wieder an, ›bringen Sie mir jemand anderen.‹ Ich versuchte mich dieser Zumutung zu erwehren, aber er begann so furchtbar zu stöhnen – aus seiner halbgelähmten Kehle klang es fast wie das flehentliche Winseln eines Hundes –, daß ich ihm eiligst, nur um ihn zu beruhigen, versprach, mein möglichstes zu tun. ›Heute noch!‹ brach er aus. ›Heute, eh mich die Sprache ebenso im Stich läßt wie meine Hand!‹ ›Ja, heute‹, versprach ich. ›Geben Sie mir nur eine Stunde Zeit.‹ Er schloß beruhigt die Augen und murmelte nur noch: ›Schicken Sie mir solange meinen kleinen Jungen herein.‹ Für seine Frau hatte er offenbar wenig übrig, aber als er jetzt das Kind erwähnte, quollen ihm Tränen unter den geschlossenen Lidern hervor. Leider hat mich mein Beruf nicht so hart gemacht, Sir, wie es manchmal vielleicht notwendig und wünschenswert wäre, und als ich das Kind hereinholte, geschah es so schweren Herzens, als wäre ich gar kein Arzt, sondern irgendein mitfühlender Mensch. Muß ich befürchten, daß Sie diese meine Schwäche verurteilen?«
Der bittende Blick des Doktors prallte an Mr. Neals steinerner Miene ab wie an einem Felsen des Schwarzwalds. Mr. Neal lehnte es eindeutig ab, sich in eine Diskussion einzulassen, die nicht im Bereich nüchterner Tatsachen fest verankert blieb.
»Fahren Sie fort«, sagte er kühl. »Ich vermute doch wohl richtig, daß Sie noch nicht am Ende sind?«
»Ist der Zweck meiner Erzählung nicht schon klar?« fragte der Doktor dagegen.
»Allerdings – endlich. Sie fordern mich auf, mich in Dinge einzumischen, gegen die ich bis jetzt einen berechtigten Argwohn hege. Ich kann mich zu diesem Ansinnen nicht näher äußern, ehe ich Genaueres weiß. Haben Sie es nicht für nötig befunden, die Gattin dieses Herrn über das seltsame Gespräch zu unterrichten und ihre Ansicht zu erbitten?«
»Natürlich habe ich das getan!« verwahrte sich der Doktor gekränkt gegen den unausgesprochenen Zweifel an seiner Redlichkeit, der in Mr. Neals Frage lag. »Und ich muß sagen, ich habe noch nie eine so zärtlich ergebene und verzweifelte Ehefrau gesehen wie diese arme Mrs. Armadale. Sobald wir allein waren, setzte ich mich zu ihr und nahm ihre Hand … Warum nicht? Ich bin ein unscheinbarer alter Mann, der sich solche Freiheiten herausnehmen darf, ohne daß –«
»Darf ich Sie bitten, Ihre Erzählung auf das Notwendigste zu beschränken?« unterbrach Mr. Neal und zog ungeduldig die buschigen Brauen zusammen. »Mir ist wichtiger zu wissen, ob Mrs. Armadale Ihnen Auskunft darüber erteilen konnte, was ihr Gatte mir diktieren will, und warum er sie nicht an diese Aufgabe läßt!«
»Das kann ich Ihnen sogar mit ihren eigenen Worten wiedergeben«, entgegnete der Doktor. »›Der Grund, warum er mir jetzt sein Vertrauen verweigert‹, sagte sie, ›ist, glaube ich, derselbe, der mir von Anfang an den Zugang zu seinem Herzen verwehrt hat. Ich bin nämlich nur die Frau, die er geheiratet hat, aber nicht diejenige, die er liebt. Die ist ihm von einem Nebenbuhler entrissen worden. Ich wußte es schon vor unserer Eheschließung, aber damals habe ich mir eingebildet, ihn allmählich über die Vergangenheit hinwegtrösten und für mich gewinnen zu können. Ich habe es so innig gehofft – bei der Trauung und dann noch einmal, als ich die Mutter seines Sohnes wurde. Was aus meinen Hoffnungen geworden ist, brauche ich Ihnen nicht zu sagen – Sie haben es ja mit eigenen Augen gesehen.‹ ›Ist das alles, was Sie über seine Vergangenheit wissen?‹ fragte ich. ›Bis vor kurzem war es alles‹, erwiderte sie. ›Aber neulich in der Schweiz, als es fast schon so schlimm um ihn stand wie jetzt, erfuhr er durch puren Zufall, daß jene andere Frau, die mein Leben zerstört und vergiftet hat … kurz, daß jene andere Frau ihrem Mann ebenfalls einen Sohn geboren habe. Von Stund an zeigte sich mein Mann von einer mir unbegreiflichen Todesangst besessen; mir war nur deutlich, daß er weder für sich noch für mich etwas fürchtete, sondern nur seinen eigenen Sohn bedroht sah. Noch am gleichen Tag ließ er (ohne ein Wort zu mir) seinen Arzt zu sich bitten. Halten Sie mich für ehrlos, für gemein, wie Sie wollen – ich lauschte an der Tür. Und da hörte ich ihn sagen: ›Ich muß meinem Sohn etwas beichten, sobald er alt genug ist, solche Dinge zu verstehen. Werde ich das noch erleben?‹ Der Arzt drückte sich um eine klare Antwort herum, und in der folgenden Nacht (immer noch ohne ein Wort zu mir) schloß mein Mann sich in seinem Zimmer ein; er hatte damals noch genügend Gewalt über seine Gliedmaßen. Was tut eine Frau, wenn sie so behandelt wird wie ich? Sie lauscht wiederum an der Tür. Ich hörte ihn vor sich hinmurmeln: ›Ich erlebe sein Heranwachsen nicht mehr … Ich muß ihm vor meinem Tode alles schreiben.‹ Dann kratzte seine Feder auf dem Papier, kratzte, kratzte, kratzte stundenlang, und dazwischen hörte ich ihn immer wieder stöhnen und schluchzen. Ich rief ihn, ich flehte ihn an, mich hereinzulassen; umsonst. Die grausame Feder kratzte, kratzte, kratzte – das war die einzige Antwort, die ich bekam. Wie lange das dauerte, weiß ich nicht. Jedenfalls hörte plötzlich das Kratzen auf, und drinnen herrschte Totenstille. Ich bettelte flüsternd durchs Schlüsselloch, ich beschwor ihn mit den zärtlichsten Namen, aber nun antwortete nicht einmal die grausame Feder mehr; Todesschweigen antwortete. In meiner Angst schlug ich mit meinen Fäusten verzweifelt auf die Tür los, bis die Dienstboten heraufkamen und die Tür mit Gewalt aufbrachen. Es war zu spät, das Unheil war geschehen. Mein Mann hatte über diesem unseligen Brief einen Schlaganfall erlitten, und wir fanden ihn so weit gelähmt vor, wie er seitdem geblieben ist. Der Brief ist unvollständig, und sein einziger Gedanke dreht sich darum, wie er ihn vor seinem Tode noch beenden kann. Das ist die Bitte, die er an Sie gerichtet hat.‹ Soweit Mrs. Armadales eigene Worte, Sir. Sind Sie nun von der Notwendigkeit überzeugt, die mich zwingt, Sie an das Sterbelager Ihres Landsmannes zu bitten?«
»Vorläufig«, erwiderte Mr. Neal, »sehe ich nur, daß Sie sich allzusehr von Ihren Gefühlen mitreißen lassen. Dafür ist die Sache jedoch zu schwerwiegend, und ich wünsche nicht hineingezogen zu werden, bevor die letzten Unklarheiten beseitigt sind. Erheben Sie nicht so flehend die Hände; Ihre Hände beantworten keine Frage. Wenn ich diesen mysteriösen Brief zu Ende schreiben soll, halte ich mich schon aus reinen Vernunftgründen für berechtigt, nach dem bisherigen Inhalt zu fragen. Mrs. Armadale scheint Ihnen ja zahlreiche eheliche Intimitäten anvertraut zu haben, zweifellos zum Dank für Ihr rührendes Händchenhalten. – Hat sie dabei zufällig auch eine Andeutung über diese unfertige briefliche Beichte fallen lassen?«
»Das konnte sie gar nicht«, erwiderte der Doktor, plötzlich ebenfalls sehr kühl und formell, womit er zeigte, daß selbst seine Langmut Grenzen hatte, »denn ehe sie sich genug gefaßt hatte, um wieder an den Brief zu denken, war ihr Mann halbwegs zu sich gekommen und hatte veranlaßt, daß die Blätter in seiner Schatulle eingeschlossen wurden. Sie weiß, daß er in der Folgezeit immer wieder versucht hat, den Brief zu vollenden, und daß ihm die Feder jedesmal aus den Fingern gefallen ist. Die Ärzte rieten ihm dann, als letztes Mittel die Heilquellen Wildbads zu versuchen, aber nach dem heutigen Untersuchungsresultat wissen sowohl Mr. Armadale als auch seine Frau, daß es keine Hoffnung mehr gibt.«
Mr. Neals Gesicht hatte sich mehr und mehr verfinstert, und er sah den Arzt an, als hätte dieser ihn persönlich beleidigt.
»Je länger ich Ihr Ansinnen überlege«, sagte er, »desto weniger gefällt es mir. Können Sie nach bestem Wissen und Gewissen versichern, daß Mr. Armadale noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist?«
»Ja, das steht zweifelsfrei fest.«
»Billigt seine Frau Ihre Vermittlung und meine etwaige Einmischung?«
»Sie billigt sie nicht nur, sondern sie hat ausdrücklich darum gebeten! Sie sind der einzige Engländer in Wildbad außer Mr. Armadale; Sie sind der einzige, der einem sterbenden Landsmann diesen letzten Dienst erweisen kann!«
Dieses Argument trieb Mr. Neal weit hinter die Kampflinie zurück, aber der Schotte in ihm verteidigte das bißchen Boden, auf dem er noch stand, bis zum äußersten.
»Einen Moment«, sagte er. »Ihre Worte klingen sehr verpflichtend, aber sind sie auch korrekt? Bin ich wirklich der einzige hier, der diese Verantwortung übernehmen kann? Wildbad hat schließlich einen Bürgermeister, einen Mann, dessen Amt sein Eingreifen eher rechtfertigt –«
»Einen prächtigen Mann«, unterbrach der Doktor, »der nur einen entscheidenden Fehler hat: Er versteht keine Sprache außer Deutsch.«
»Meines Wissens hat Stuttgart eine englische Gesandtschaft«, beharrte Mr. Neal.
»Zwischen hier und Stuttgart erstreckt sich noch meilenweit der Schwarzwald. Selbst wenn wir sofort einen Boten abschickten, könnte die Gesandtschaft uns vor morgen nicht helfen, und bis dahin ist Mr. Armadale möglicherweise völlig sprachunfähig. Ich weiß nicht, welche Folgen die Erfüllung seines letzten Wunsches für seinen Sohn oder andere Leute haben kann; ich weiß nur, daß es bezüglich der Erfüllung heißt: jetzt oder nie, und daß Sie der einzige sind, bei dem die Entscheidung liegt.«
Diese kurze und bündige Erklärung gab den Ausschlag. Mr. Neal saß in der Zwickmühle. Mit einem Ja setzte er sich dem Vorwurf der Leichtfertigkeit, mit einem Nein dem der Unmenschlichkeit aus. Er dachte minutenlang schweigend nach, während der deutsche Arzt ihn unverwandt ansah.
Endlich entschloß sich Mr. Neal zu der endgültigen, schicksalsschweren Antwort, die von ihm verlangt wurde, ohne zu verhehlen, wie unangenehm ihm das Ganze war.
»Sie setzen mir die Pistole auf die Brust«, sagte er und stand auf.
»Unter diesen Umständen bleibt mir keine Wahl, als Ihnen meine Hilfe zuzusagen.«
Die warmherzige Natur des Doktors bäumte sich gegen die trockene Kälte dieser Zusage auf. »Wollte Gott«, brach er inbrünstig aus, »ich könnte genügend Englisch, um Ihre Stelle an Mr. Armadales Sterbebett einzunehmen!«
»Abgesehen davon, daß Sie den Namen des Herrn unnützlich führen«, erwiderte der Schotte, »bin ich hierin ganz Ihrer Meinung. Ich wünschte es auch.«
Damit verließen sie gemeinsam das Zimmer, ohne ein weiteres Wort zu wechseln.
Der Schiffbruch
Der Doktor klopfte am Vorzimmer von Mr. Armadales Appartement, aber niemand meldete sich. Daraufhin traten sie einfach ein und fanden sowohl das Vorzimmer als auch das kleine anschließende Wohnzimmer leer.
Mr. Neal brach sein Schweigen. »Ich muß erst Mrs. Armadale sprechen«, sagte er bestimmt. »Ich weigere mich, irgendwelche weiteren Schritte zu tun, ehe sie mich in eigener Person dazu ermächtigt hat.«
»Sie ist wahrscheinlich bei ihrem Mann«, meinte der Doktor und ging auf die nächste Tür zu. Die Hand schon auf der Klinke, zögerte er jedoch, drehte sich noch einmal um und sah seinen mürrischen Begleiter bittend an. »Wenn ich vorhin ein bißchen heftig geworden bin, Sir, möchte ich mich jetzt von ganzem Herzen entschuldigen. Und eins noch … verzeihen Sie, wenn ich Sie bitte, dieser bedauernswerten Dame nur mit der rücksichtsvollsten Schonung zu begegnen …«
»Nein, das verzeihe ich nicht«, versetzte Mr. Neal barsch. »Mit welchem Recht unterstellen Sie mir, daß ich es an Rücksicht und Schonung gegen eine Dame fehlen lassen könnte?«
Der Doktor sah ein, daß jede Diskussion zwecklos war, bat gottergeben noch einmal um Verzeihung und ließ den unzugänglichen Menschen für einige Minuten allein. Mr. Neal starrte aus dem Fenster, ohne daß die anmutige Frühlingslandschaft, die sich draußen ausbreitete, den geringsten Eindruck auf ihn machte, und legte sich Wort für Wort zurecht, was er Mrs. Armadale zu sagen beabsichtigte, bis er die Stimme des Doktors hinter sich hörte:
»Mrs. Armadale ist hier.«
Er drehte sich rasch um und sah im hellen Mittagslicht eine Frau von unverkennbar europäisch-afrikanischer Blutsmischung; der europäische Einschlag zeigte sich in der Feinheit des Gesichtsschnitts, der afrikanische im warmen Goldbraun der Haut – eine Frau auf dem Höhepunkt ihrer Jugendschönheit, die sich mit angeborener Grazie bewegte, mit faszinierenden dunklen Gazellenaugen voller Dankbarkeit zu ihm aufsah und ihm stumm die kleine braune Hand hinstreckte, wie man einen langersehnten Freund begrüßt. Der Gesamteindruck brachte Mr. Neal zum erstenmal in seinem Leben völlig aus dem Konzept. Alle Vorbehalte, alle Worte, die er sich so klug zurechtgelegt hatte, verflüchtigten sich spurlos aus seinem Hirn. Der dreifache Panzer von Mißtrauen, Selbstbeherrschung und Reserve, mit dem er sich in allen Lebenslagen zu wappnen pflegte und den noch keine Frau durchbrochen hatte, fiel in Gegenwart dieser Frau von selbst. Mit dem ersten Blick hatte sie ihn in die Knie gezwungen und besiegt. Er beugte sich schweigend über die dargereichte Hand, und dieser Handkuß war seine erste aufrichtige Huldigung an das weibliche Geschlecht überhaupt.
Mrs. Armadale ihrerseits war unsicher und verlegen. In glücklicheren Zeiten hätte ihr weiblicher Scharfblick sicherlich erkannt, worauf Mr. Neals Stummheit zurückzuführen war, aber unter den obwaltenden Umständen dachte sie an alles andere als an die Wirkung ihrer Schönheit. Sie glaubte in der sonderbaren Haltung des Fremden Hochmut und Widerwillen zu erkennen und mußte ihren ganzen Mut aufbieten, um das notwendige Gespräch zu beginnen.
»Unser gütiger Doktor hat mir gesagt, Sir, daß Sie nur meinetwegen zögern, sich meinem Mann zur Verfügung zu stellen«, sagte sie leise und ließ, merklich erbleichend, den Kopf sinken. »Bitte denken Sie nicht weiter an mich … Ich bin Ihnen so dankbar, denn die Wünsche meines Mannes …« Ihre Stimme schwankte, aber sie nahm sich zusammen und vollendete den Satz tapfer: »… die Wünsche meines Mannes sind auch die meinen.«
Mr. Neal hatte sich inzwischen so weit gefaßt, daß er ihr antworten konnte. Er bat sie leise und ernst, sich alle weiteren Erklärungen zu ersparen. »Ich wollte nur jede mögliche Rücksicht auf Sie nehmen und alles vermeiden, was Sie verletzen könnte«, sagte er, wobei fast etwas wie Röte in seine fahlen Wangen stieg, während ihre sanften Augen in seinem Gesicht forschten und er schuldbewußt der vielen Einwände gedachte, die er vor kurzem noch erhoben hatte.
Der Doktor nutzte den günstigen Augenblick, öffnete die Tür zum Krankenzimmer, und wenige Sekunden später sah sich Mr. Neal unwiderruflich in die Verantwortung verstrickt, die ihm nun einmal aufgezwungen worden war.
Das Zimmer war in prunkvollem deutschen Geschmack ausgestattet, mit gemalten Blumengirlanden und Amoretten an der Decke, auf denen fröhliche Sonnenkringel spielten; eine goldene Stutzuhr tickte auf dem Kaminsims, Spiegel glänzten an den Wänden, und der geblümte Teppich hatte alle Farben des Regenbogens. Und inmitten dieser lichten, glitzernden, bunten Staffage lag der Gelähmte mit seinen rastlos umherirrenden Augen und den erstarrten Zügen, den Oberkörper an viele aufeinandergetürmte Kissen gestützt, die hilflosen Hände leichenhaft reglos vor sich auf der Bettdecke. Am Kopfende stand mit grimmigem Gesichtsausdruck die runzlige schwarze Pflegerin, und mitten auf dem Bett spielte das weißgekleidete Kind mit einem Zinnsoldaten, einem kleinen Reiter, den es über die steifen Hände des Vaters springen ließ, immer abwechselnd über die rechte und die linke, und die Augen des Vaters folgten diesem ewigen Gehüpfe mit gebannter Aufmerksamkeit, einmal rechts, einmal links, wie die Augen eines wilden Tieres seine Beute belauern – ein entsetzlicher Anblick.
Doch als Mr. Neal auf der Schwelle erschien, ließen die rastlosen Augen von dem Spielzeug ab und hefteten sich inständig fragend auf den Fremden. Die starren Lippen begannen mühselig zu arbeiten und formten endlich mit gaumiger, behinderter Aussprache die Worte:
»Sind Sie … der Mann, der …«
Mr. Neal trat bis zum Bett vor, während Mrs. Armadale und der Doktor sich in den Hintergrund des Zimmers zurückzogen.
»Man hat mir Ihre traurige Lage geschildert, Sir«, sagte er, »und ich stehe Ihnen gern zu Diensten. Mein Name ist Neal, Sekretär des Wappenamtes in Edinburgh, woraus Sie schon entnehmen mögen, daß Sie bei etwaigen vertraulichen Mitteilungen meiner absoluten Diskretion sicher sein dürfen.«
Da die schönen Augen der Frau ihn im Moment nicht mehr verwirrten, konnte er sich dem Gelähmten gegenüber von seiner besten Seite zeigen. Er sprach ruhig und ernst und traf genau den richtigen Ton zwischen Sachlichkeit und Mitgefühl. Der Anblick des Totenbettes hatte ihm Haltung gegeben.
Nach einer kurzen Pause, in der er vergeblich auf Antwort wartete, fügte er hinzu: »Wie ich gehört habe, möchten Sie mir etwas diktieren?«
»Ja!« stieß der Sterbende hervor, und der ohnmächtige Zorn über seine Hilflosigkeit, den er mit Worten nicht mehr ausdrücken konnte, funkelte aus seinen Augen. »Meine Hand ist gelähmt … die Sprache versagt immer mehr … fangen wir an!«
Fast gleichzeitig hörte Mr. Neal hinter sich das Rascheln von Frauenkleidern und das leise Quietschen von Laufrollen auf dem Teppich: Mrs. Armadale schob den Schreibtisch quer durchs Zimmer ans Fußende des Bettes. Es war höchste Zeit für Mr. Neal, sich noch einmal gegen immerhin mögliche unangenehme Folgen seiner Hilfsbereitschaft abzusichern. Ohne sich nach Mrs. Armadale umzusehen, stellte er daher die unumwundene Frage:
»Darf ich mich zuvor noch erkundigen, Sir, um was für ein Schriftstück es sich handelt?«
Das zornige Glitzern in den Augen des Kranken verstärkte sich. Seine Lippen arbeiteten, aber er brachte keine Antwort zustande. Mr. Neal versuchte es mit einer anderen Frage:
»Was soll mit dem Schriftstück geschehen, wenn es fertig ist?«
Diesmal reichte es wenigstens zu ein paar verständlichen Worten:
»Sie versiegeln es in meiner Gegenwart und schicken es an meinen Tes … Testa …« Mr. Armadale stockte und sah gequält zu Mr. Neal auf.
»An Ihren Testamentsvollstrecker, wollten Sie sagen?«
»Ja.«
»Es ist also ein Brief, den ich dann zur Post geben soll? Handelt es sich um eine Änderung Ihres Testaments?«
»Nein.«
Mr. Neal überlegte. Die Sache wurde immer geheimnisvoller. Bisher hatte er als einzigen Hinweis auf den Inhalt des Briefes nur die verworrenen Andeutungen des Doktors, die ihm die Situation nicht behaglicher machten. Sollte er sich dieser höchst bedenklichen Verantwortung nicht doch noch im letzten Moment entziehen? Aber bevor er seinen Zweifeln Ausdruck verleihen konnte, fühlte er sich von Mrs. Armadales Seidenkleid gestreift, ihre zartgliedrige, dunkle Hand legte sich auf seinen Arm, und ihre nachtschwarzen, sanften Augen flehten ihn demütig an.
»Mein Mann fürchtet, es könnte zu spät werden«, flüsterte sie. »Würden Sie die Güte haben, ihn zu beruhigen, indem Sie jetzt am Schreibtisch Platz nehmen?«
Sie bat ihn darum – sie, die übergangene Ehefrau, die das erste Recht zu Mißtrauen und Verzögerungstaktik gehabt hätte! Angesichts dieser Selbstverleugnung hätten wohl die meisten Männer augenblicklich kapituliert. Nicht so Mr. Neal, der Schotte genug war, um wenigstens eine einzige, allerletzte Einschränkung zu machen.
»Ich werde schreiben, was Sie mir diktieren«, sagte er, nun wieder zu Mr. Armadale gewandt. »Ich werde das Schreiben dann in Ihrer Gegenwart siegeln und persönlich an Ihren Testamentsvollstrecker schicken. Dazu bemerke ich jedoch ausdrücklich und bitte Sie, sich gegebenenfalls daran zu erinnern, daß ich bis jetzt völlig im dunkeln tappe und mir daher meine eigene Handlungsfreiheit vorbehalten muß, sobald die Dienstleistung, die ich Ihnen zugesagt habe, abgeschlossen ist.«
»Sie versprechen mir, zunächst den Brief zu schreiben?«
»Ich habe es Ihnen bereits versprochen, Sir, unter der soeben genannten Bedingung.«
»Jede Bedingung ist mir recht, wenn Sie nur Ihr Versprechen halten. Meine Schatulle«, fügte er kurz und befehlend hinzu, wobei er seine Frau zum erstenmal ansah.
Sie gehorchte eilfertig und brachte den verlangten Gegenstand von einem Stuhl in der Ecke. Beim Zurückkommen gab sie der grimmig schweigenden Negerin, die noch immer wie eine Bildsäule am Kopfende des Bettes stand, einen flüchtigen Wink, das Kind zu nehmen und sich mit ihm zu entfernen. Aber kaum hatte sich die Negerin angeschickt, den wortlosen Befehl auszuführen, als Mr. Armadale sie katzenhaft anfunkelte und »Nein!« sagte. »Nein!« wiederholte das frische Stimmchen des Kleinen, der keineswegs gesonnen schien, den wunderschönen Spielplatz auf der Steppdecke aufzugeben. Die Negerin ging allein hinaus, und der Junge ließ seinen Zinnsoldaten triumphierend in verdoppeltem Tempo auf dem gelähmten Leib seines Vaters hin und her galoppieren. Das liebliche Gesicht der Mutter verzerrte sich einen Moment vor Eifersucht.
»Soll ich die Schatulle aufschließen?« fragte sie, indem sie den Zinnsoldaten ziemlich brüsk beiseite schob. Ihr Gatte bedeutete ihr mit den Augen, unter das Kopfkissen zu greifen, wo er den Schlüssel versteckt hatte. Sie schloß auf und brachte eine Anzahl beschriebener, zusammengehefteter Blätter zum Vorschein. »Sind es diese?«
»Ja«, erwiderte er. »Geh jetzt.«
Mr. Neal, der am Schreibtisch Platz genommen hatte, und der Doktor, der im Hintergrund ein Belebungsmittel zusammenrührte, tauschten unwillkürlich einen Blick. Es war beiden unsäglich peinlich, Augen- und Ohrenzeugen sein zu müssen, wie die Frau hinausgewiesen wurde.
»Geh jetzt!« wiederholte Mr. Armadale unerbittlich.
Sie sah auf das glücklich spielende Kind, gegen dessen Anwesenheit er nichts einzuwenden hatte, und eine aschenfarbene Blässe trat langsam in ihr exotisches Gesicht. Sie sah auf den Schicksalsbrief, der für sie ein Geheimnis mit sieben Siegeln war, und der eifersüchtige Argwohn gegenüber jener anderen Frau zerriß ihr das Herz. Sie tat einige Schritte zur Tür – und kehrte um. Mit dem Mut der Liebe und Verzweiflung drückte sie die Lippen auf die Wange ihres sterbenden Gatten und flehte ihn unter heißen Tränen zum letzten Mal an: »Allan! Bedeutet dir meine Liebe denn gar nichts? Habe ich nicht alles versucht, dich glücklich zu machen? Nun soll ich dich so bald ganz verlieren – und du schickst mich hinaus! Bitte, bitte, tu es nicht, Liebster! Laß mich bei dir bleiben!«
Ihr tonloses Stammeln, ihr schüchterner Kuß, die Erinnerung an die Fülle der Liebe, die er empfangen und nie erwidert hatte – alles das rührte das Herz des Sterbenden, wie ihn seit dem Tage seiner Heirat nichts mehr berührt hatte. Er stieß einen tiefen Seufzer aus, und sein Blick wurde weicher.
»Laß mich bleiben«, flüsterte sie noch einmal.
»Es wird dich nur quälen«, murmelte er.
»Nichts ist so qualvoll, wie von dir weggeschickt zu werden!«
Er zögerte, und sie hielt in banger Erwartung den Atem an.
»Ein Weilchen vielleicht«, brachte er endlich heraus.
»Ja! Ja!«
»Wirst du gehen, wenn ich es dir sage – ohne Widerrede?«
»Ich werde gehen.«
»Schwöre es mir!«
Die letzte, ungeheure Erregung, in der er sich befand, schien seine Zunge gelöst zu haben. Er sprach die schweren, feierlichen Worte: »Schwöre es mir!« mit einer Deutlichkeit, die ihm bisher bei keinem anderen Wort gelungen war.
»Ich schwöre es dir!« sagte sie ebenso feierlich, worauf sie neben dem Bett in die Knie sank und einen leidenschaftlichen Kuß auf seine leblose Hand drückte. Mr. Neal und der Doktor hatten in stillschweigender Übereinkunft die Gesichter von der Szene abgewandt. Die kurze Stille, die folgte, wurde nur von den kleinen Geräuschen des spielenden Kindes unterbrochen.
Der Doktor war der erste, der den Bann, der die Erwachsenen gefangenhielt, zu brechen wagte, indem er sich dem Patienten näherte und besorgt Puls und Atmung prüfte. Mrs. Armadale erhob sich von den Knien und brachte, mit Genehmigung ihres Gatten, das unfertige Manuskript zu Mr. Neal an den Schreibtisch. Mit dunkel geröteten Wangen, schöner denn je in ihrer tiefen Erregung, beugte sie sich dicht an sein Ohr, während sie ihm die Blätter übergab, und flüsterte ihm zu: »Lesen Sie alles von Anfang an vor. Ich will und muß es hören!« Ihre Augen glühten; ihr Atem streifte seine Wange; aber ehe Mr. Neal eine Antwort fand, war sie schon wieder bei ihrem Gatten. Wiederum hatte ein Moment genügt, den nüchternen Schotten völlig unter ihren Willen zu zwingen.
Er erkannte es selbst, runzelte die Stirn über seine Schwäche und blätterte unschlüssig in den Papieren.
»Falls Sie noch irgendwelche Korrekturen zu machen wünschen, Sir«, begann er in kurzangebundenem, geschäftsmäßigem Ton, »ist es vielleicht am besten, ich lese Ihnen das bisher geschriebene laut vor.«
Mr. Armadales Augen richteten sich forschend von seinem Kind auf die Frau.
»Willst du es wirklich hören?« fragte er. Sie senkte stumm bejahend den Kopf und griff verstohlen nach seiner Hand. Er bedachte sich noch eine Zeitlang und sagte dann mit plötzlichem Entschluß: »Also fangen Sie an. Aber hören Sie sofort auf, wenn ich halt sage.«
Es war gegen ein Uhr mittags, und unten erklang gerade die Glocke, die die Gäste zum Essen rief. Das Geräusch von Schritten und vergnügten Stimmen drang in das stille Krankenzimmer, während Mr. Neal das Manuskript vor sich glattstrich und zu lesen begann:
»Dieser Brief ist für meinen Sohn bestimmt und soll ihm übergeben werden, sobald er alt genug ist, seinen Inhalt zu verstehen. Da für mich keine Hoffnung mehr besteht, sein Heranreifen zu erleben, bleibt mir nichts übrig, als alles das, was ich ihm lieber einmal unter vier Augen gesagt hätte, dem Papier anzuvertrauen.
Mein Schreiben hat drei Gründe. Erstens soll mein Sohn die Begleitumstände der Heirat erfahren, die eine englische Dame meiner Bekanntschaft vor einigen Jahren auf Madeira schloß. Zweitens muß er die Wahrheit über den bald darauf erfolgten Tod des Gatten besagter Dame an Bord des französischen Frachtschiffs La Grâce de Dieu wissen. Drittens will ich meinen Sohn vor künftigen Gefahren warnen – Gefahren, die sich gespenstisch aus dem Grabe seines Vaters erheben können, wenn sich die Erde schon längst über seiner Asche geschlossen hat.
Der Teil der Geschichte, der zur Heirat besagter englischer Dame führte, begann, als ich die Besitztümer der Armadales und damit auch den unseligen Namen erbte.
Ich war der einzige überlebende Sohn des früh verblichenen Mathew Wrentmore und wurde auf dem Besitz unserer Familie auf der britischen Insel Barbados geboren. Mein Vater starb, als ich noch ein Kind war. Meine Mutter verzog mich in blinder Liebe; nie schlug sie mir etwas ab, ich konnte tun, was ich wollte. Kein Wunder, daß ich meine Kindheit und Jugend in Müßiggang und Genußsucht verbrachte, worin ich durch meine Umgebung – Sklaven und Halbfreie, für die mein Wille Gesetz war – noch bestärkt wurde. Ich bezweifle, daß es in England je einen jungen Mann meiner Kreise gegeben hat, der so ungebildet war wie ich; ja, in der ganzen Welt dürfte es kaum einen Menschen gegeben haben, der so zuchtlos und ungestraft seinen Leidenschaften frönen durfte.
Meine Mutter war eine romantische Seele und hatte etwas gegen den schlichten Namen meines Vaters. Ich wurde deshalb nach einem reichen Vetter Allan Armadale getauft, der ausgedehnte Ländereien in unserer Nachbarschaft besaß – seine Plantagen waren die ertragreichsten der ganzen Insel – und sich bereit erklärte, mein Pate zu werden, obgleich er selbst in England lebte und seinen karibischen Besitz nie gesehen hatte. Nachdem er das übliche Patengeschenk zu meiner Taufe geschickt hatte, schlief die Korrespondenz zwischen ihm und meinen Eltern vollständig ein. Ich war schon ein junger Mann von einundzwanzig Jahren, als meine Mutter zum erstenmal wieder einen Brief von Mr. Armadale erhielt, in dem er sich erkundigte, ob ich noch am Leben sei, und mir bejahendenfalls die Erbschaft seiner karibischen Güter in Aussicht stellte.
Dieses unverhoffte Glück fiel mir nur deshalb in den Schoß, weil Mr. Armadales eigener und einziger Sohn sich offenbar noch schlechter aufgeführt hatte als ich. Er war mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, und sein Vater hatte ihn für immer verstoßen. Da sonst kein naher männlicher Verwandter vorhanden war, hatte Mr. Armadale sich auf sein Patenkind besonnen und mir die Erbschaft angeboten, unter der einzigen Bedingung, daß ich und meine männlichen Erben den Namen Armadale annähmen. Der Vorschlag wurde von uns dankbar akzeptiert, die notwendigen Formalitäten sofort eingeleitet und ohne besondere Schwierigkeiten erfüllt, und wenige Wochen später erhielt ich über Mr. Armadales Rechtsanwälte die Nachricht, daß der Tod meines Wohltäters mich zum reichsten Großgrundbesitzer auf Barbados gemacht hatte.
Dies war das erste Glied in der Kette der Ereignisse, die sich daran schloß. Das zweite folgte etwa anderthalb Monate danach.
In unserem Verwaltungsbüro war gerade eine Stelle frei, und unter den Anwärtern, die sich meldeten, war ein junger Mann meines Alters, der erst kürzlich auf die Insel gekommen war und sich als Fergus Ingleby vorstellte. Er gefiel mir auf den ersten Blick. In meinen Augen war er der vollendetste Gentleman, den man sich vorstellen konnte, und verfügte über einen gesellschaftlichen Schliff und persönlichen Charme, wie er mir unerfahrenem Inselbewohner noch nie vorgekommen war. Gewohnt, meinen Impulsen und Launen jederzeit nachzugeben, bestand ich auf seiner Anstellung, obwohl seine Zeugnisse lückenhaft waren.
Mein Wille war Gesetz, wie schon gesagt, und ich setzte ihn auch diesmal durch.
Meine Mutter mißtraute Ingleby von Anfang an. Als sie sah, wie die Freundschaft mit diesem Untergebenen von Tag zu Tag enger wurde und ich ihm ein Vertrauen schenkte wie niemandem sonst (ich hatte immer gern mit Untergebenen verkehrt, schon weil die Auswahl an gleichrangigen Gefährten gering war), und nachdem sie alle Mittel erschöpft hatte, uns auseinanderzubringen, versuchte sie als letzten Ausweg, mich zu einer Reise nach England zu überreden, mit der ich selbst schon lange geliebäugelt hatte. Um ihren Zweck nicht zu deutlich durchblicken zu lassen, fing sie es sehr klug an, mein oberflächliches Interesse an einer solchen Reise anzufeuern. Sie schrieb an einen alten Freund und Verehrer, den inzwischen verstorbenen Stephen Blanchard von Thorpe-Ambrose in Norfolk, einen sehr begüterten Witwer mit erwachsenen Kindern. (Später entdeckte ich, daß meine Mutter in diesem Brief auf frühere zarte Bande anspielte, die zwischen ihr und Mr. Blanchard bestanden hatten, aber am Widerstand der beiderseitigen Eltern zerbrochen waren, und daß sie die Möglichkeit andeutete, ihr Sohn und seine Tochter könnten vielleicht zusammen das Eheglück finden, das ihnen versagt geblieben war – eine Vorstellung, die ganz dem romantischen Gemüt meiner Mutter entsprach.) Ich wußte von alledem nichts, bis meine Mutter mir den Antwortbrief Mr. Blanchards zeigte, der mich von meinem Busenfreund Fergus Ingleby weglocken sollte.
Allerdings war Mr. Blanchard im Moment nicht in England, sondern auf Madeira, weil die Ärzte ihm aus Gesundheitsgründen einen Klimawechsel verordnet hatten. Seine Tochter hatte ihn dorthin begleitet. Er dankte meiner Mutter herzlich für ihren Brief und schlug vor, daß ich ihm, falls ich mich bald zur Abreise entschlösse, doch auf dem Wege nach England einen Besuch auf Madeira abstatten könnte. Sollte sich dies nicht machen lassen, so sei er zu einem bestimmten Termin von seinem Erholungsaufenthalt zurück und würde mich jederzeit auf seinem englischen Landgut Thorpe-Ambrose mit offenen Armen empfangen. Im übrigen entschuldigte er sich, daß er nicht länger schreiben könne, weil seine Sehkraft leider sehr nachgelassen habe, und daß er schon mit diesem kurzen Handschreiben gegen die strenge Vorschrift des Arztes verstoße; doch sei die Versuchung, einer so lieben alten Freundin selbst zu schreiben, allzu groß gewesen.
So reizend dieser Brief abgefaßt war, hätte er an sich wahrscheinlich keinen besonderen Eindruck auf mich gemacht, wenn der Absender nicht ein Miniaturporträt von Miß Blanchard beigefügt hätte, auf dessen Rückseite die halb scherzhaften, halb zärtlichen Worte gekritzelt standen: ›Meine Tochter würde zu sehr erröten, wenn ich ihr von Ihren Erkundigungen erzählte; darum möge dies gemalte Abbild (ohne ihr Wissen) Ihre Fragen beantworten. Das Konterfei ist wohlgelungen (wie die junge Dame selbst). Sollten unsere Kinder einander mögen, liebe Freundin, so erleben wir vielleicht in ihnen noch ein spätes Glück.‹
Ich weiß nicht, wie ich es schildern soll: Der Anblick dieses Bildes fuhr mir wie ein Blitzstrahl in die Seele. Scharfsinnigere Leute als ich hätten diesen außerordentlichen Eindruck wahrscheinlich auf meinen damaligen unausgeglichenen Gemütszustand zurückgeführt, auf den Überdruß, den ich unbewußt gegen die bisherigen seichten Vergnügungen empfand, und das Verlangen nach neuen, reineren Lebenszielen. Ich war weit entfernt von so nüchterner Selbstbeurteilung; ich nannte alles, was mir widerfuhr, Schicksal, und ich nenne es jetzt noch so. Es genügte mir zu wissen, und ich wußte es sofort mit unfehlbarer Sicherheit, daß der bloße Anblick dieses Mädchenantlitzes mein besseres Ich in mir erweckte und mich über alle Niedrigkeit erhob, wie es noch keine Frau in meinem Leben vermocht hatte. In diesen sanften Augen las ich mein Schicksal. Ich wünschte mir nichts mehr, als dieses Mädchen zur Gattin zu gewinnen. Beim Schlafengehen legte ich die Miniatur unter mein Kopfkissen; mein erster Blick am nächsten Morgen galt ihr: Die feste Überzeugung (nenne es Aberglauben, wenn Du willst), einen Wink von oben erhalten zu haben, bestand unvermindert fort und wies mir den Weg, den ich zu gehen hatte. Ein Schiff, das in vierzehn Tagen nach England absegeln sollte, lag im Hafen. Seine Route führte über Madeira, und ich sicherte mir unverzüglich einen Platz.«
An dieser Stelle wurde Mr. Neal von einer leisen, kläglichen Frage unterbrochen: »War es eine Weiße? Oder ein Mischblut wie ich?« Er blickte auf und sah, daß Mrs. Armadale die Hand ihres Gatten losgelassen hatte und mit abgewandtem Gesicht dasaß. Das heiße afrikanische Blut brannte in ihren dunklen Wangen, als sie wiederholte: »War sie eine Weiße?«
»Ja«, sagte Mr. Armadale kurz, ohne sie anzusehen.
Ihre Hände verknoteten sich krampfhaft im Schoß, aber sie sagte nichts mehr. Mr. Neal nahm mit zusammengezogenen Brauen die unterbrochene Vorlesung wieder auf.
»Der einzige, von dem mir der Abschied schwerfiel, war mein vertrautester Freund Ingleby. Seine Überraschung, als er von meinem plötzlichen Reiseentschluß hörte, und seine Niedergeschlagenheit gingen mir so nahe, daß ich ihm zu meiner Rechtfertigung Mr. Blanchards Brief und das Porträt seiner Tochter zeigte. Sein Interesse an beidem stand dem meinen kaum nach. Als treuer Freund nahm er an allem lebhaftesten Anteil, und er erkundigte sich nach der Familie und den Vermögensverhältnissen von Miß Blanchard. Und nachdem ich ihm erzählt hatte, was ich wußte, rührte er mich durch die Großherzigkeit und Selbstlosigkeit, mit der er mich zu meinem Vorhaben ermutigte. Wir gingen an diesem Tage in strahlender Laune auseinander. Aber über Nacht wurde ich plötzlich von einer rätselhaften Krankheit befallen, die sowohl mein Leben als auch meinen Verstand bedrohte.
Ich habe keinen Beweis, daß Ingleby etwas damit zu tun hatte. Auf Barbados gab es mehr als eine Frau, der ich schweres Unrecht angetan hatte. Vielleicht war es einer gerade an diesem Tage gelungen, sich auf die landesübliche Weise an mir zu rächen. Ich kann niemanden direkt beschuldigen. Ich kann nur sagen, daß meine alte schwarze Kinderfrau mein Leben rettete, indem sie, wie sie später erklärte, sofort ein bekanntes Gegenmittel gegen ein ebenso bekanntes Gift anwandte, das von Eingeborenen mit Vorliebe benutzt wurde. Als ich zum erstenmal wieder meine Umwelt erkannte, war das Schiff, mit dem ich hatte fahren wollen, längst unterwegs.
Ich fragte nach Ingleby: Er war nicht mehr da. Man legte mir Beweise für Betrügereien vor, die ich trotz aller Parteilichkeit nicht aus der Welt reden konnte. Man hatte ihn während meiner Krankheit hinausgeworfen und seitdem nichts mehr von ihm gehört, außer daß er die Insel verlassen hatte.
Während der ganzen qualvollen Krankheitszeit war das Miniaturporträt Miß Blanchards nicht von meiner Seite gekommen; während der Genesung war es mein einziger Trost, wenn ich an die verpaßte Gelegenheit dachte, und zugleich meine einzige Ermutigung für die Zukunft. Es ist nicht mit Worten zu beschreiben, wie die Zeit, die Einsamkeit und das Leiden meine Gefühle verstärkten. Meine Mutter hatte Mr. Blanchard von meiner Erkrankung benachrichtigt, aber keine Antwort erhalten. Sie erklärte sich bereit, ihm noch einmal zu schreiben, wenn ich ihr dafür verspräche, nicht abzufahren, bevor ich vollständig genesen sei. Aber meine Ungeduld ertrug keinen Aufschub mehr. Soeben lag wieder ein Schiff nach Madeira im Hafen. Ich prüfte noch einmal die Daten in Mr. Blanchards Brief, entnahm daraus, daß ich ihn noch auf der Insel vorfinden würde, und ließ mich auf der Stelle in die Passagierliste eintragen. Und diesmal war ich, ungeachtet der Vorstellungen meiner Mutter, bei Ausfahrt des Schiffes an Bord.
Die frische Seeluft brachte mich rasch zu Kräften, und als ich mich nach einer ungewöhnlich schnellen Reise am Ziel sah, war ich wieder ich selbst. An einem zauberhaft stillen Abend, den ich nie vergessen werde, stand ich, ihr Bildnis auf dem Herzen und im Herzen, vor dem weißen Hause, in dem sie wohnte. Ich wagte mich nicht gleich hinein, sondern stahl mich durch ein Seitenpförtchen in den Park, um mich erst ein wenig zu sammeln. Dort erblickte ich jedoch eine Dame, die sich allein auf dem Rasen erging. Sie wandte mir zufällig das Gesicht zu, ohne mich zu sehen – und wer beschreibt meine Gefühle, als ich das Modell meines Porträts, die Erfüllung all meiner Träume in ihr erkannte!
Mein innerer Aufruhr war zu heftig, als daß ich ihr jetzt gleich hätte vor Augen treten können. Ich zog mich unbemerkt zurück, begab mich zum Haupteingang des Hauses und fragte den öffnenden Diener zunächst nach Mr. Blanchard. Doch Mr. Blanchard war bereits zur Ruhe gegangen und durfte heute nicht mehr gestört werden. Hierauf faßte ich Mut und fragte nach Miß Blanchard. Der Diener lächelte. ›Die junge Dame heißt nicht mehr Miß Blanchard, Sir‹, sagte er, ›sie ist jetzt verheiratet.‹ Manch einer wäre an meiner Stelle wohl wie vom Donner gerührt zu Boden gestürzt, aber ich hatte heißeres Blut, ich sah buchstäblich rot und packte den Mann wie rasend am Kragen. ›Das ist gelogen!‹ brüllte ich und schüttelte ihn, als hätte ich einen meiner eigenen Sklaven vor mir. ›Es ist wahr!‹ keuchte der Mann und bemühte sich vergebens, von mir loszukommen. ›Ihr Gatte ist drinnen im Hause!‹
›Wie heißt er, du Schurke?‹
Und darauf nannte der Diener keinen anderen Namen als meinen eigenen, mir ins Gesicht hinein: ›Allan Armadale.‹
Du, mein Sohn, wirst ohne weiteres die Wahrheit erraten. Fergus Ingleby war der verstoßene Sohn meines Paten, dessen Name und Erbschaft mir zugefallen waren. Ich hatte ihn seines Geburtsrechtes beraubt – und er hatte sich an mir gerächt.
Ich muß auf die Art, wie er seinen Betrug durchführte, etwas näher eingehen, um die späteren Ereignisse zu erklären (ich vermeide absichtlich das Wort ›rechtfertigen‹).
Ingleby hat selbst eingestanden, nach dem Tode seines Vaters mit dem Vorsatz nach Barbados gekommen zu sein, mich nach besten Kräften auszuplündern und mir auch sonst zu schaden, soweit er nur konnte. Meine Vertrauensseligkeit gab ihm dazu mehr Gelegenheit, als er je zu hoffen gewagt hätte. Er hatte den Brief unterschlagen, in dem meine Mutter Mr. Blanchard von meiner Erkrankung benachrichtigte, und dann schleunigst seine fristlose Entlassung provoziert, um mit demselben Schiff, das eigentlich ich hatte benutzen wollen, nach Madeira zu reisen. Nach seiner Ankunft war er zu Mr. Blanchard gegangen und hatte sich ihm vorgestellt – nicht unter dem Decknamen Ingleby, dessen ich mich hier der Klarheit halber weiter bedienen werde, sondern unter dem Namen Allan Armadale, der ihm von Geburts wegen allerdings ebensogut zustand wie mir. Seine betrügerischen Pläne stießen kaum auf Hindernisse. Er hatte es ja nur mit einem kränklichen, halbblinden alten Herrn zu tun, der meine Mutter seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte, und mit einem arglosen, unschuldigen jungen Mädchen. Nach allem, was ich ihm erzählt hatte, war es ihm ein leichtes, jede Frage zufriedenstellend zu beantworten. Sein Aussehen, seine weltmännischen Manieren, die auch mich so für ihn eingenommen hatten, und vor allem seine gewandte Art, mit Frauen umzugehen, taten ein übriges – er gewann im Handumdrehen Miß Blanchards Zuneigung, während ich noch auf dem Krankenbett lag. Als ich langsam genas und ihr Bildnis anschwärmte, hatte Ingleby Mr. Blanchard bereits um die Hand seiner Tochter gebeten und die Erlaubnis erhalten, sich noch vor Verlassen Madeiras mit ihr trauen zu lassen.
Soweit war dank der Sehschwäche des alten Herrn alles gutgegangen. Er hatte sich damit begnügt, dem ›Sohn‹ Grüße an die Mutter aufzutragen und ihre von Ingleby erfundenen Gegengrüße zu hören. Aber als der Hochzeitstag festgesetzt war, fühlte Mr. Blanchard sich verpflichtet, ein förmliches Schreiben aufzusetzen, in dem er seine alte Freundin feierlich um ihre Genehmigung bat und sie zur Hochzeit einlud. Diesen Brief diktierte er seiner Tochter, und Ingleby, der keine Möglichkeit mehr sah, die Absendung zu verhindern, entschloß sich, seiner Braut, deren er jetzt völlig sicher war, unter vier Augen die Wahrheit zu sagen. Da sie noch nicht volljährig war, brachte er sie dadurch in eine besonders schwierige Lage. Schickte sie den Brief ihres Vaters ab, so war das Resultat ein baldiger Skandal und Trennung für immer, es sei denn, sie brannten vorher miteinander durch, wobei sie jedoch kaum hoffen durften, nicht binnen kurzem wieder aufgespürt zu werden. Das Ziel jedes Schiffes, das die Insel verließ, war bekannt, und Mr. Blanchards schnelle Privatjacht, die im Hafen lag, hätte jedes mit Leichtigkeit eingeholt. Es blieb ihnen nur der Ausweg, den Brief an meine Mutter zu unterdrücken und die Wahrheit erst einzugestehen, wenn sie sicher verheiratet waren. Welche Verführungs- und Überredungskünste Ingleby anwandte, um Miß Blanchards Liebe zu mißbrauchen und sie zu seiner eigenen Niedrigkeit herabzuziehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zog er sie herab. Der Brief kam nie an sein Ziel, und Mr. Blanchard wurde – mit Wissen und Willen seiner Tochter – aufs schändlichste hintergangen.
Nur eine Vorsichtsmaßnahme war noch zu treffen: Sie mußten einen Antwortbrief meiner Mutter fabrizieren, denn diesmal erwartete Mr. Blanchard natürlich ein persönliches Schreiben, und zwar noch vor der Heirat. Ingleby hatte den unterschlagenen Brief meiner Mutter als Muster bei sich, verfügte jedoch nicht über die Geschicklichkeit, ihre Handschrift glaubwürdig zu fälschen, und Miß Blanchard weigerte sich entschieden, es auch nur zu versuchen – sie litt schon genug unter ihrer passiven Teilnahme an dem scheußlichen Betrug, dessen Opfer ihr eigener Vater war. Doch auch in dieser schwierigen Lage fand Ingleby ein williges Werkzeug, und zwar in Gestalt einer zwölfjährigen Waise, einem wahren Wunderkind, was frühreife Anstelligkeit und Gerissenheit betraf, das Miß Blanchard aus romantischem Mitleid ins Herz geschlossen und als Zofe aus England mitgebracht hatte. Das Nachahmungstalent dieses fragwürdigen Geschöpfes beseitigte alle Schwierigkeiten. Ich habe den gefälschten Brief, den sie nach Inglebys Anweisungen und – leider! – mit Einwilligung ihrer jungen Herrin schrieb, mit eigenen Augen gesehen und muß gestehen, daß ich selbst mich hätte täuschen lassen. Später sah ich auch das Mädchen, und mein Blut erstarrte bei ihrem Anblick. Wehe jedem, der sich mit ihr einläßt, falls sie heute noch am Leben ist! Nie kann es auf Erden ein Weib gegeben haben, das von Grund auf verdorbener, lügnerischer, gleisnerischer war als sie!