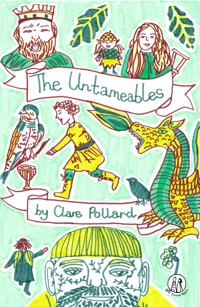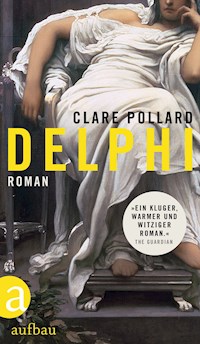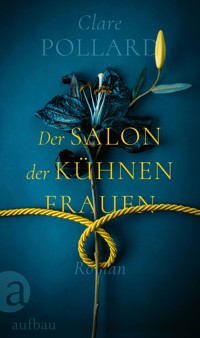
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frauen widersetzen sich der Übermacht der Männer am Hof des Sonnenkönigs.
Versailles zu Zeiten Ludwig XIV. Am Hof des Sonnenkönigs herrschen Pomp und Verschwendungssucht. Wer einen Blick hinter die Kulissen wagt, findet Intrigen, Missgunst Klatsch und Tratsch. Das wissen vor allem die Frauen, die sich regelmäßig in Marie d'Aulnoys Kaminzimmer in Paris treffen und dort zusammen flirten, lachen, Champagner trinken und sich Märchen erzählen. Doch das Geschichtenerzählen ist riskant und droht die Frauen eine nach der anderen in große Gefahr zu bringen …
Sexy, scharfsinnig, zeitgemäß: ein schillernder historischer Roman, der von wahren Begebenheiten inspiriert ist und von der Kraft des Geschichtenerzählens unter mutigen Frauen handelt.
»Elegant und dekadent, vulgär und klug, bezaubernd und dunkel. Das Buch, das ich dringend gebraucht habe.« Sarah Perry
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Jeden Monat lädt Marie d’Aulnoy in ihren Salon an der Rue Saint-Benoît in Paris ein, es gibt Sorbet und Macarons, Champagner und Geschichten. Der Literatursalon bietet den Frauen nicht nur eine willkommene Abwechslung von dem bösartigen Klatsch und den Intrigen am Hof des Sonnenkönigs, sondern auch Austausch und Trost; durch die Märchen, die sie sich gegenseitig erzählen, kommentieren sie ihr Leben. Märchen, die wir heute unter den Namen Rapunzel, Blaubart und Aschenputtel kennen, und das über hundert Jahre vor den Gebrüdern Grimm. Doch schon bald müssen die Frauen feststellen, dass das Geschichtenerzählen sehr reale Risiken mit sich bringt.
Clare Pollards Roman über den Zusammenhalt einer Gruppe von Frauen, die sich am Hof der Übermacht der Männer widersetzt, ist üppig, zärtlich und hinreißend modern erzählt.
»Eine köstliche Mischung aus vielschichtigen Freuden. Ich habe es verschlungen!« Joanna Quinn
Über Clare Pollard
Clare Pollard ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin, Lyrikerin und Dramatikerin aus London. Sie hat fünf Gedichtbände verfasst und ist Herausgeberin der Zeitschrift Modern Poetry in Translation. 2023 erschien bei Aufbau ihr Roman »Delphi«, der von der Kritik gefeiert wurde. »Der Salon der kühnen Frauen« ist ihr zweiter Roman.
Anke Caroline Burger lebt in Berlin und Zürich. Sie ist die Übersetzerin von Ottessa Moshfegh, Jon McGregor, Naoise Dolan, Te-Ping Chen, Sharlene Teo und vielen weiteren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Clare Pollard
Der Salon der kühnen Frauen
Roman
Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Auftretende Personen
1.: Das Märchen von der Eselshaut — erster Teil
2.: Das Märchen vom guten Mädchen
3.: Das Märchen von der Eselshaut — zweiter Teil
4.: Das Märchen vom Gift
5.: Die Märchen von Anguillette und Rotkäppchen
6.: Das Märchen vom schönen Prinzen
7.: Das Märchen vom gläsernen Pantöffelchen
8.: Das Märchen vom Widder
9.: Das Märchen von der Insel der friedvollen Freuden
10.: Das Märchen von der Birne
11.: Das Märchen vom grünen Fröschlein
12.: Das Märchen von der geschickten Prinzessin oder: Abenteuer der Finette
13.: Das Märchen von der Bärenhaut
14.: Das Märchen von der Hexe
15.: Das Märchen von Blaubart
16.: Das Märchen von Persinette
17.: Das Märchen von der Rose
18.: Das Märchen von der Gänsemagd
19.: Die Märchen von Ricdin-Ricdon und den drei lächerlichen Wünschen
20.: Das Märchen vom Spieglein
21.: Das Märchen vom Ballkleid
22.: Das Märchen vom gestiefelten Kater
23.: Das Märchen von der weißen Katze
24.: Das Märchen von den Töchtern
25.: Das Märchen vom verzauberten Brief
Anmerkungen der Autorin
Danksagungen
Quellen
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meinen Mann
Ich glaube, dass die Historien, so man nach unseren Zeiten von diesem Hof schreiben wird, artiger und zeitvertreiblicher als kein Roman sein werden; ich fürchte, unsere Nachkommen werden es nicht glauben können und nur für Märchen halten …
Liselotte von der Pfalz, Herzogin von Orléans
Auftretende Personen
In der Herrschaftszeit von Ludwig dem XIV. von Frankreich (1638–1715) trugen viele Menschen dieselben Vornamen. Insofern setze ich die Namen, mit denen ich die Personen in diesem Roman bezeichne, in Großbuchstaben.
MADAME MARIE-Catherine D’AULNOY
JUDITH, ihre Mutter
NICOLAS, ihr Vater
BARON D’AULNOY, ihr Mann, getrennt lebend
Charles BONENFANT, ihr Geliebter, verstorben
JUDITH, Tochter
THÉRÈSE, Tochter
FRANÇOISE, Tochter
BELLE-BELLE, Seidenäffchen
MIMI, Amme
ANNE, Köchin
BERTHE, Dienstmädchen
Im Salon
CHARLES PERRAULT
Marie Perrault, seine Frau, verstorben
Charles, Sohn
Pierre, Sohn
Madame Marie-Jeanne L’Héritier de Villandon, bekannt als TÉLÉSILLE, Perraults Cousine
MADAME HENRIETTE-Julie DE MURAT
COMTE DE MURAT, ihr Mann
MADAME ANGÉLIQUE TIQUET
CLAUDE, ihr Mann
MOURA, ihr Diener
MADAME MIAOU, ihre Katze
Charles BRIOU
CHARLOTTE-ROSE Caumont de La Force, Zofe der Dauphine, der Kronprinzessin
Prinzessin Marie Anne de Bourbon, genannt FÜRSTIN VON CONTI, die offiziell anerkannte Tochter Ludwigs des XIV. mit Athénaïs
ABBÉ Charles COTIN, Geistlicher
Charles de SAINT-ÉVREMOND
Am Hof
KÖNIG LUDWIG XIV. von Frankreich (Louis XIV)
Madame de Montespan, bekannt als ATHéNAÏS, die offizielle Mätresse des Königs
MADAME DE MAINTENON, die neue Mätresse des Königs
Jean-Baptiste COLBERT, Finanzminister
Maria Anna Christina Victoria von Bayern, bekannt als DAUPHINE, Gemahlin des französischen Thronfolgers
FAGON, Leibarzt
LA VOISIN, Weissagerin
Gabriel Nicolas de La REYNIE, Polizeichef
1.
Das Märchen von der Eselshaut
erster Teil
Es war einmal ein großer König. Manche sagten, vielleicht sei er sogar der mächtigste Herrscher, der je gelebt hatte. Außerdem sagte man – natürlich –, er habe in Friedenszeiten gerecht regiert und in Kriegszeiten großen Schrecken verbreitet. Seine Untertanen lebten in vollkommener Zufriedenheit, und seine Feinde bebten vor Furcht. Dieser König hatte – natürlich – die tugendhafteste und schönste Gemahlin, die man sich nur vorstellen kann. Aus ihrer Ehe erwuchs eine mit vielen Reizen und Tugenden gezierte Prinzessin. Das glückliche Paar der Landeseltern lebte in schönster Eintracht.«
So beginnt Charles Perrault sein Märchen von der »Eselshaut«. Und so wollen auch wir unsere Geschichte beginnen.
Im Salon der Madame d’Aulnoy beugt sich Perraults kleine Schar von Zuhörerinnen gespannt auf den Polsterstühlen vor, um zu hören, welche Katastrophe über diese perfekte Familie hereinbrechen wird. Denn die Kraft, die hinter allen Geschichten steckt, ist eine zerstörerische Kraft – das Verlangen, das, was ist, für das, was sein könnte, niederzubrennen. Es ist Spätherbst im ausgehenden siebzehnten Jahrhundert, während der Regierungszeit von Ludwig dem XIV. Man sitzt versammelt in einem luxuriösen Zimmer an der Rue Saint-Benoît in Paris, hat es gemütlich zwischen schwerem, besticktem, korallenrotem Brokat; Kerzenflammen tanzen dicht an jedem Ärmelsaum.
Kurz zuvor ist Charles Perrault den Mitgliedern dieses elitären, intellektuellen Zirkels vorgestellt worden, der regelmäßig in dem Salon zusammenkommt und sich Geschichten erzählt, die zu dieser Zeit meist noch »Geschichten von Mutter Gans« genannt werden; manche bezeichnen sie als Erzählungen vom Storch oder von der Eselshaut. Uns sind sie vielleicht unter ihrem moderneren Namen bekannt: contes de fées, die Märchen. Ja, es war Madame d’Aulnoy selbst, die diesen Begriff geprägt und damit für ein wahres Märchenfieber gesorgt hat.
Normalerweise kann Charles sich Namen gut merken, aber als er jetzt den Blick über die Gesichter schweifen lässt, merkt er, dass er etliche schon wieder vergessen hat. Da sitzt seine Cousine, Marie-Jeanne L’Héritier de Villandon, temperamentvoll und ein wenig frömmelnd – er muss sie einfach mögen, auch wenn er sich von ihrem wohlwollend glänzenden, gewöhnlichen Gesicht ein wenig abgestoßen fühlt. Seine Cousine hat ihn in diese Runde eingeführt, weil sie hofft, ihn damit etwas aus seiner Melancholie zu reißen. Hier möchte sie Télésille genannt werden – die Mode verlangt einen Salonnamen, und sie hat sich nach der griechischen Dichterin Telesilla benannt, die die Frauen von Argos im antiken Hellas in den Kampf führte. Charles empfindet das Ganze als ein wenig absurd, versucht aber aus Höflichkeit mitzuspielen.
Während er sich umsieht, bemerkt er auch eine der außerehelichen Töchter des Königs, die Fürstin von Conti, die mit der Selbstverständlichkeit einer mächtigen Frau dasitzt, als habe sie unter den Röcken die Beine weit gespreizt. Die Prinzessin, eine Blondine mit reiner Haut und starkem Kinn, trägt weder Perücke noch Make-up. Sie ist attraktiv, aber mehr in der Art eines schneidigen jungen Prinzen als einer Prinzessin – verwegen raucht sie eine Tabakspfeife.
Die reiche Erbin Madame Angélique Tiquet erkennt er sofort – dekadent lümmelt sie sich auf dem Sessel zu seiner Linken in einem rosa Schäferinnenkleid, das sie aus der Kostümkiste des Salons geborgt hat (für die Darstellung in einem vorherigen Märchen an diesem Abend), ihren Hirtenstab hält sie immer noch wie ein Zepter in der Hand. Angélique Tiquet ist die Art Frau, die trotz fortschreitenden Alters aus jedem Kleid zu platzen droht; Zuckerkristalle kleben in den Winkeln ihres üppigen Mundes mit dem fauligen Schneidezahn. Begleitet wird sie von einer weißen Katze mit juwelenbesetztem Halsband, die sie oft unter dem Arm mit sich herumträgt.
Daneben sitzt einer der wenigen Männer, die in diesem Zirkel zugelassen worden sind – Abbé Cotin, ein mittelmäßiger Geistlicher, der gähnend langweilige Sonette verfasst. Und er sieht die scharfzüngige Madame Henriette de Murat, deren Nasenflügel sich über die reine Anwesenheit des Abtes empört blähen. Dann ist da noch die hübsche, in der allerneuesten Mode gekleidete, aber schrecklich eitle Charlotte-Rose Caumont … de La Irgendwas – ach ja, richtig, Force –, die er als Zofe vom Hof her kennt. Und die anderen? Niederer Adel. Wer ist der hochgewachsene junge Mann mit den langen Wimpern?
Dickflüssige heiße Schokolade wird in sehr schönem, hellgrün glasiertem Porzellan serviert. Nach jedem Kakaoschlückchen lecken sich die Damen über Zähne und Oberlippe, weil sie braune Rückstände fürchten.
Es ist Perraults erster Besuch im Salon, und er will die Herzen für sich gewinnen, um seiner Cousine und seiner selbst willen. Das Märchen von der »Eselshaut« – Peau d’Âne – hat ihn schon immer entzückt, seit sein Kindermädchen es ihm am glimmenden Kaminfeuer erzählt hat. Als eines der vierzig hoch geachteten Mitglieder der Académie française, der Institution zur Pflege der französischen Sprache, bekannt als les immortels, nach dem Motto der Akademie, À l’immortalité (»Zur Unsterblichkeit!«), glaubt er, eine kleine, literarisch interessierte Zuhörerschaft wie diese leicht für sich gewinnen zu können – die Geschichte muss nur kurz und spritzig sein: ein Glas Champagner, ausgetrunken, bevor man es in der Hand bemerkt hat.
Wer sich einen Augenblick Zeit nimmt, Perrault näher zu betrachten, sieht einen Mann Anfang sechzig vor sich, mit einer braunen Perücke, die an einen wohlfrisierten Cockerspaniel erinnert. Man sagt, er sei in sein Gesicht hineingewachsen, das offen ist, mit glänzenden Augen, die nicht anders können, als vergnügt in die Welt zu schauen. Er ist ein weltgewandter Mann mit echtem Charisma, der über die große Gabe verfügt, an jedem interessiert zu sein, vom Kronprinzen bis zur Köchin. Ein paar funkelnde Momente lang seine Aufmerksamkeit zu genießen, bedeutet für gewöhnlich, ihn zu mögen, ein Effekt, der ihm insgeheim sehr wohl bewusst ist.
»Man stelle sich nur den prächtigen Palast des Königs vor!«, fährt er jetzt fort. »Höflinge kommen aus aller Welt, um die Gemälde von Rubens und Leonardo zu bewundern, die Statuen von Bernini, den verschwenderischen Spiegelsaal …« Das sorgt für Gelächter, sein Publikum versteht, dass er sich auf den Spiegelsaal Ludwigs des XIV. im hinreißenden Schloss von Versailles bezieht, eines der Wunder des Abendlandes – den Saal, den Charles Perrault persönlich mit über dreihundert großen Spiegeln ausstatten ließ. Es ist der vermutlich berühmteste Raum in ganz Frankreich, eine Aladinshöhle voll vorteilhaft beleuchteter Schönheiten, die auf unendliche Spiegelungen ihrer Selbst blicken. Damit, dass Perrault Versailles anspricht, bekennt er sich zu dem, was in dieser Runde sowieso allgemein bekannt ist: dass er seit dem Tod seines Freundes Colbert bei Ludwig dem XIV. in Ungnade gefallen ist. Niemand soll glauben, das Thema Versailles dürfe seinetwegen nicht erwähnt werden. Immerhin bezieht er nach wie vor seine Pension und ist stolz auf das, was er dort erreicht hat. Einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, ist keine Schande.
Perrault blickt Madame d’Aulnoy beim Erzählen direkt in die Augen, weil er vor allem seiner Gastgeberin eine Freude machen will. Marie d’Aulnoys vor Kurzem veröffentlichter Roman »Historie des Hipolytus, Grafen von Duglas« war eine Sensation in der Pariser Gesellschaft, und er möchte die Verfasserin sehr gern kennenlernen – aber in ihrem Blick ist etwas Kühles, Zurückweisendes. Kurz hat Perrault einen Turm mit gläsernen Wänden vor Augen und sich selbst als fahrenden Ritter, der verzweifelt an dem glatten Turm hochzuklettern versucht. Das ist kein ihm vertrautes Gefühl. Er versucht, einen verspielten Tonfall anzuschlagen, merkt aber, dass es neu und beunruhigend für ihn ist, so leichthin über Könige und Paläste zu sprechen. Ist das der Grund, warum die Damen sich hier Märchen erzählen? Um rebellische Gedanken unter dem Deckmantel von Kindergeschichten am Zensor vorbeizuschmuggeln?
Wenn man anderen eine Geschichte erzählt, improvisiert man bis zu einem gewissen Grad immer aus dem Augenblick heraus, und sein Instinkt sagt Perrault, dass er die Handlung vorantreiben muss. »In den Stallungen des Königs gab es prächtige Pferde aller Arten«, fährt er schnell fort. »Doch alle, die den Stall betraten, sahen mit großem Staunen – zu reden wagten sie kaum darüber –, dass der Ehrenplatz von einem abscheulichen Esel mit riesengroßen Ohren eingenommen wurde. Diesen Platz hatte sich der Esel damit verdient, dass er morgens nicht Eselsmist kackte, sondern Goldtaler.«
Es wird gelacht – ein einfacher Lacher, das weiß er. Die Augen seiner Cousine Télésille leuchten ihm mit einer seltsamen Mischung widerstreitender Gefühle entgegen – er vermutet, dass sie ihre persönliche Abneigung gegen diese Art von Humor herunterschluckt –, zugleich vertraut er aber seiner Fähigkeit, den Raum in seinen Bann zu ziehen.
»Gott aber, der uns Gutes und Böses schickt, damit wir nicht träge werden, ließ die Königin erkranken. Sie wurde blass und dünn, ihre Augen glasig. Weder erfahrene Ärzte noch Scharlatane konnten etwas gegen ihr Fieber ausrichten. Wie die Königin ihr letztes Stündlein herannahen fühlte, sprach sie zu ihrem Gatten wie folgt: ›Versprecht mir, dass Ihr nicht eher zum zweiten Mal heiraten werdet, bis Ihr eine Dame gefunden habt, die klüger und schöner ist als ich.‹ Man muss nämlich wissen, dass die Königin in ihrer Eitelkeit sicher war, dass es ihrem Mann unmöglich sein würde, eine solche Frau zu finden, und ihr letzter Wunsch würde dem König eine erneute Verehelichung unmöglich machen. Es soll nicht verschwiegen werden, dass ein Gefühl der Befriedigung sie erfüllte, als sie ihren letzten Atemzug tat. Sie ahnte nichts von den schrecklichen Ereignissen, die sie damit in Bewegung setzte. ›Natürlich, meine liebe Königin, ich will Euch jeden Wunsch erfüllen‹, schluchzte der König, als sie in seinen Armen starb.«
(Charles schluckt den Speichel hinunter, der sich auf seiner Zunge sammelt. Er wird nicht daran denken, nicht hier in der Öffentlichkeit. Er wird nicht daran denken.)
»Mehrere Monate lang war der König untröstlich, aber dann bedrängten ihn die Höflinge, er müsse für einen männlichen Erben sorgen, und er willigte in eine zweite Ehe ein. Das war jedoch leichter gesagt als getan, da er seinen Schwur auf keinen Fall brechen wollte. Wer konnte seiner seligen Königin in Intelligenz und Schönheit gleichen? Nur seine eigene Tochter, die ihn mit ihrer anmutigen Gestalt und ihren himmelblauen Augen täglich mehr betörte. Nur seine Tochter.
Der Gedanke nistete sich in seinem Kopf ein und verzehrte seine Eingeweide. Er begann, von ihm Besitz zu ergreifen. Nur seine Tochter. Sie war seine Gattin in Miniaturausgabe, die Wiedergeburt seiner Frau. Die Antwort auf das Rätsel. Nur durch die Verehelichung mit seiner eigenen Tochter konnte er halten, was er seiner Königin auf dem Sterbebett geschworen hatte! Und so gestand er der Prinzessin eines Tages, als sie vor seinen Füßen spielte, dass er sie, nur sie, heiraten wolle. Seine Tochter lachte, als handle es sich um einen Witz, aber dann wurde ihr klar, dass es kein Witz war. ›Bitte macht mir keine Angst, Vater.‹
›Deine Mutter wollte es so. Es war ihr letzter Wunsch.‹
›Bitte sprecht nicht so seltsam mit mir‹, erwiderte die Prinzessin und zitterte, als habe sich ein Schatten über sie gelegt.
In dieser verzweifelten Lage blieb der armen Prinzessin nichts übrig, als sich an ihre gute Fee zu wenden, die in einer Höhle aus« – Perrault lässt den Blick durch das Zimmer mit den schweren, korallenroten Stoffen und schimmernden Kerzenleuchtern schweifen und improvisiert – »Korallen und Perlen lebte.«
Perraults vorwiegend weibliches Publikum nickt zustimmend, die weißen Perücken bewegen sich im Gleichtakt wie ein Schwarm Tauben, dem man Körner hinwirft. Seine Zuhörerinnen scheinen sich einig zu sein, dass dies der Ort ist, an dem gute Feen zu finden wären. Das Schlürfen von Getränken ist zu hören, das Klirren einer Tasse auf einer Untertasse, das beständige Knistern des Feuers. Der Kamin ist ein wenig zu gut angeheizt, Perrault ist schweißgebadet – Lampenfieber kann es ja nicht sein. Bei öffentlichen Auftritten bekämpft er seine Nervosität oft damit, dass er sich das Publikum nackt vorstellt, aber in diesem Fall – inmitten so vieler Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts – befürchtet er, dass diese Technik seine Transpiration nur noch verstärken würde.
Er öffnet wieder den Mund. »›Ich weiß, warum Ihr da seid‹, sprach die gute Fee. ›Euer Herz ist schwer. Aber wir guten Feen besitzen Listen und Schliche. Sicherlich wird Euch kein Leid zustoßen, wenn Ihr Euch an meinen Rat haltet. Sagt Eurem Vater, er müsse Euch ein Kleid von der Farbe des Himmels verschaffen, bevor Ihr ihn heiraten könnt. Das wird ihm nicht gelingen.‹ Und so trat die Prinzessin zitternd vor ihren Vater. Doch als er ihren Wunsch vernahm, ließ er sogleich die besten Schneider des ganzen Reichs kommen. Sie sollten auf der Stelle ein Kleid von der Farbe des Himmels anfertigen, sonst würde er sie allesamt hängen. Schon am nächsten Tag bekam die Prinzessin ihr Kleid. Es strahlte im changierenden Blau des Himmels.
Als Nächstes riet ihr die gute Fee: ›Bittet ihn um ein Kleid von der Farbe des Mondes. Das wird ihm sicherlich nicht gelingen.‹ Doch dem mächtigsten König, der je über die Welt geherrscht hat, war fast nichts unmöglich. Der König ließ seine Stickerinnen kommen, drohte ihnen, und schon vier Tage später war das Kleid von der Farbe des Mondes fertig – selbst im dunklen Kleiderschrank verströmte es ein gespenstisches Licht.
›Na gut‹, sagte die Fee, diesmal mit einem schon etwas besorgteren Gesicht. ›Wir versuchen es noch einmal – ein Kleid, so leuchtend wie die Sonne. Wie soll man so etwas zustande bringen? Es in Brand setzen?‹ Diesmal ließ der König seinen Goldschmied kommen und befahl ihm, ein Tuch aus Gold und Juwelen anzufertigen; wenn es ihm misslinge, würde ihm der Kopf abgehackt. In nicht einmal einer Woche hatte der Juwelier ein Kleid vollendet, das die Augen so blendete, dass es kleine, schwebende Punkte auf der Netzhaut hinterließ.«
Diesen Teil des Märchens erzählt Perrault gern – die klare Struktur. Der Rhythmus. Er mag es, wenn Dinge Gestalt annehmen. Und Perrault mag schöne, erlesene Dinge: Fresken, Hyazinthen, Uhrmacher, Marzipan, Schmetterlingsflügel, goldenes Tafelgeschirr, Springbrunnen, gute Schuhe, den Gesang der Nachtigall. Er ist ein Ästhet. Trotz aller Enttäuschungen, die er am Ende am Hof von Versailles erlebt hat, versucht er, stolz auf das zu sein, was er dort miterschaffen hat: Zivilisation.
Im Raum ist es mucksmäuschenstill – er hat seine Zuhörerinnen in den Bann gezogen –, als er sein Märchen weitererzählt: »Die Prinzessin wusste, dass sie sich eigentlich beim König bedanken müsste, aber das Wort blieb ihr in der Kehle stecken. Da zischte ihr die gute Fee den nächsten Rat ins Ohr: ›Ich hab’s! Bittet ihn um einen Mantel aus der Haut des Esels, der im königlichen Stall steht. Er liebt diesen Esel. Wenn ich mich nicht gänzlich irre, wird er ihn auf keinen Fall umbringen.‹
Das war die bis dahin beste Idee, aber der Fee war nicht klar, dass das Begehren des Königs nach seiner Tochter mittlerweile alles andere übertrumpfte. Die Begierde nach ihr quälte ihn, ein Gefühl, das er – in seiner Stellung – noch nie empfunden hatte. Fast augenblicklich brüllte er den Befehl. Minuten später wurde die noch warme Haut seines Goldesels vor der Prinzessin ausgebreitet: blutig, mit den lustigen Ohren, den vorstehenden Zähnen und feuchten Augen. ›Jetzt reicht es mir, Kind‹, sagte er. ›Morgen heiraten wir.‹
Nun bekamen es die Prinzessin und ihre Fee wahrhaft mit der Angst zu tun. Die gute Fee sagte der Prinzessin, ihr bleibe keine andere Wahl mehr, sie müsse unter der Eselshaut versteckt fliehen. Die Fee füllte eine Truhe mit den Kleidern der Prinzessin, mit Spiegel, Puder und Juwelen, und gab ihr einen Zauberstab, mit dem sie nur den Boden zu berühren brauche, dann würde die Truhe erscheinen. Doch davon abgesehen war das Mädchen auf sich selbst gestellt. Und so schaffte es die Prinzessin, am selben Morgen, an dem sie ihren Vater heiraten sollte, unerkannt zu verschwinden.«
Als Perrault diese Worte ausspricht, überkommt ihn mit einem Mal ein Gefühl der Beklemmung. Er merkt, dass er nicht in der Lage ist, Madame d’Aulnoy ins Gesicht zu blicken, weil es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt – wie hatte er nur so dumm sein können, gerade dieses Märchen für sein Debüt auszuwählen? Dies ist, zumindest zum Teil, Marie d’Aulnoys Geschichte. Siedend heiß fällt ihm wieder ein, wie aufgeregt in den Sälen von Versailles gewispert wurde, als sie vor ein paar Jahren wieder in der Stadt auftauchte und einen Salon eröffnete.
Den Gerüchten zufolge war Madame d’Aulnoy aus finanziellen Gründen schon als kleines Mädchen von ihrem Vater an den Baron d’Aulnoy verheiratet worden. Der Baron war natürlich kein echter Baron, sondern ein trunksüchtiger Frauenheld, der sich den Titel gekauft hatte. Und nachdem jahrelang darüber geredet wurde, wie er seine blutjunge Ehefrau missbraucht und entwürdigt hatte (und sie zwei von drei Kindern verloren hatte, das arme Ding), wurde er wegen Hochverrats in die Bastille gesperrt, weil er sich zu laut über das Steuersystem des Königs beschwert hatte.
Aber dann – und hier kam die interessante Wendung der Geschichte – wurde der Baron wieder freigelassen. Der Gerüchteküche zufolge, weil ihm das Verbrechen nur in die Schuhe geschoben worden war und er seine Unschuld beweisen konnte. Das Ganze sei eine Verschwörung von Madame d’Aulnoy, ihrer Mutter und zwei Männern gewesen (vermutlich ihren Liebhabern), um ihn fälschlicherweise anzuschwärzen! Den beiden Männern wurde der Kopf abgehackt, und Madame d’Aulnoy selbst wurde zusammen mit ihrem dritten, neugeborenen Baby in einen Turm gesperrt, sprang jedoch aus dem Fenster und floh.
Ob Madame d’Aulnoy in einer Verkleidung entkam wie Eselshaut? Und die Frage, von der man am Hof, natürlich, besessen ist, geht auch Perrault jetzt durch den Kopf: Wie kann es sein, dass Madame d’Aulnoy wieder hier sein darf, viele Jahre später, im Herzen von Paris, als Mittelpunkt ihres Salons?
2.
Das Märchen vom guten Mädchen
Bitte entschuldigt – es war falsch, nicht am Anfang anzufangen, also mit der Geburt. Geschichten handeln von Menschen und ihren Eigenschaften – ihrer Entwicklung, ihren Lebensumständen, dem komplexen Netz aus Beziehungen, ihrem Verhalten und den sich daraus ergebenden Konsequenzen, ihren Begegnungen mit dem Schicksal – und der wahre Beginn eines Menschen ist die Geburt, das wahre Ende der Tod. Aber falls es euch später lieber ist, können wir uns natürlich entscheiden, nicht mit dem Tod zu enden. Dann müssen wir, als Erwachsene, allerdings zumindest anerkennen, dass wir mit einem solchen Ende die Augen vor der Wahrheit verschließen. Und ich muss euch gleich warnen: Das hier ist eindeutig ein Märchen für Erwachsene.
Dann lasst uns also mit der Geburt beginnen. Wir sprechen hier von einer Zeit, in der Kindsgeburten ganz generell nicht einfach verlaufen und viele Frauen sterben, wenn sie ein Kind gebären. Manche sind noch zu jung, weil sie schon mit zwölf oder dreizehn verheiratet worden sind; manche pressen noch mit Ende vierzig ein kränkliches vierzehntes Kind heraus, andere haben schlicht und einfach Pech. Oft verbluten sie, das Leben fließt aus ihnen heraus und sammelt sich in Pfützen, bis nicht mehr genug Flüssigkeit in ihren Adern ist, um bis zum Herz zu gelangen; andere sterben an Infektionen, oder an den Ärzten, die in dieser Ära praktisch keinerlei Wissen vorweisen können, aber gut bezahlt werden – zum größten Teil, um die anderen Männer davon zu überzeugen, dass man nichts weiter für die Frau im Kindbett hätte tun können. Insofern ist es brandgefährlich, einen Arzt im schwarzen Umhang ins Zimmer rauschen zu sehen.
Madame d’Aulnoy kommt natürlich nicht als Madame auf die Welt – wie absurd solche Titel scheinen, wenn man von blinden, ständig in die Windeln kackenden, winzigen Menschenwesen spricht –, sondern als kleine Marie-Catherine, die 1650 stoßweise auf ein Bett in der Normandie gepresst wird: ihr indigoblaues Köpfchen, bedeckt mit schleimiger Käseschmiere, scharlachrote Tropfen, die wegen eines Dammrisses schnell auf die Laken fallen, das gotteslästerliche Gebrüll ihrer Mutter, das die Glocken der mittelalterlichen Kirche, den rauschenden Fluss und die sich im Wind wiegenden Apfelbäume übertönt.
Marie ist das erste Kind von Nicolas und Judith, und die Geburt verläuft langwierig und schwer, weil der Lauf der Zeit den jungen Körper ihrer Mutter noch nicht hat erschlaffen lassen. Für Judith, eine ehrgeizige Frau, die sich fürs Flirten, Politik, Sprachen und die Oper interessiert, ist es der schrecklichste Tag ihres Lebens – eine ungerechte Strafe, die sie über Monate hinweg launisch und mürrisch werden lässt –, aber zum Glück treten keine Komplikationen auf, und es erscheinen keine Ärzte mit ihren unreinen Instrumenten und Gläsern voller Blutegel. Nicolas wird mitgeteilt, es sei ein Mädchen, und er tritt gegen den Waschtisch und verflucht sein Schicksal, wie damals üblich.
Judith hat keinerlei Interesse daran, einem Kind die Brust zu geben – allein die Vorstellung erinnert sie an verdreckte Milchkühe –, deswegen wird das Neugeborene direkt an eine Amme weitergereicht, wie zu der Zeit üblich: Mimi (deren eigener Sohn tot auf die Welt kam, zum Glück für fast alle Beteiligten). Marie tastet blind nach der großen, rosabraunen Brustwarze und entlockt ihr eine Perle süßer Muttermilch. »So ist’s brav«, lobt Mimi sie zärtlich, schmerzliche Erinnerungen sammeln sich in ihrem Kopf, ihren Brüsten und Augen. Mimi sieht aus wie das Idealbild einer Amme: schwerfällig und sanftmütig. »Oh! Was bist du für ein gutes kleines Mädchen.«
Marie wird älter und ist weiterhin ein gutes Mädchen. Sie weiß zum Beispiel, dass sie ihrem Vater besser aus dem Weg geht, wenn er Rotwein trinkt, weil er dann im Selbstmitleid ersäuft. Zu seinen vielen Kümmernissen zählt, dass er nicht zum Billardspiel taugt und an äußerst schmerzhaften Gichtschüben leidet, kleinen Kristallen, die sich in seinen Gelenken ablagern, und dann neigt er dazu, in seiner Tochter ein hüpfendes, kleines Memento mori zu sehen, ein Skelett im Kinderkleid, das ihn an der Hand zum Abgrund führen will. Sie weiß, wann sie ihrer Mutter während eines Weinkrampfs beruhigend den Rücken streicheln und ihr gut zureden muss, aber auch, dass sie ihr nie mit Spielsachen oder naiven Kinderfragen auf die Nerven gehen darf, denn Judith ist davon überzeugt, dass es nichts Langweiligeres für eine intelligente Frau gibt als ihr eigenes Kind.
Ihre Amme Mimi, warm und mütterlich in ihrem Wesen, erweist sich als Rettung des kleinen Mädchens; ständig krault sie der Katze den Bauch oder lässt sie an ihrem Knöchel nagen, wischt Marie das Gesicht mit Spucke sauber oder flicht ihr die Haare. Manchmal wird Marie bei ihren Umarmungen ein wenig klaustrophobisch zumute, aber das ist allemal besser als ihre distanzierte Mutter. Mimi nennt Marie ma puce – »mein Floh« –, mon coco – »mein Sonnenschein« – oder ma petite crotte – »mein kleines Scheißerchen«.
Wenn sie abends vor dem Feuer Maries Locken kämmt, erzählt sie ihr Volkssagen wie die vom Däumling, einem zarten, stillen Jungen, der nicht größer als ein Daumen ist und für dumm gehalten wird. Mimi erzählt von einer großen Hungersnot, in der die Eltern des Däumlings beschließen, dass sie nicht mitansehen können, wie ihre Kinder verhungern, und sie deswegen im Wald aussetzen. Davon, wie der Däumling beim ersten Mal eine Spur aus Kieselsteinen auslegt und zurück zu seinen Eltern findet, und dann, als diese zum zweiten Mal versuchen, ihn auszusetzen, Brotkrumen verstreut, die aber von den Vögeln weggepickt werden. »Der Wald«, flüstert Mimi mit grässlicher Stimme, »ist voller Wölfe und Menschenfresser, und die können Kinder riechen!« Sie tut so, als würde sie Maries kleine Zehen abbeißen, und beide quietschen und kichern. Es ist ein schönes Gefühl.
Bloß dass Mimi natürlich keine Verwandte ist, sondern für ihre Umarmungen mit barer Münze bezahlt wird. Eines Tages teilt Nicolas der Amme einfach mit, dass sie entlassen ist und Marie auf die Klosterschule geschickt wird. Als Marie von diesen schrecklichen Neuigkeiten erfährt, kauert sie sich auf dem Dachboden zu einer kleinen, zitternden Kugel zusammen, wie eine Nuss in der Schale, und hofft, dass das Gebrüll der zornigen Erwachsenen unten aufhört. Mimi ist fuchsteufelswild und ihr Mundwerk dreckig wie ein Nachttopf. »Das soll meine Belohnung sein, nach allem, was ich für euch getan habe? Wie soll ich jetzt meine Familie ernähren? Egoistisches, gefühlsduseliges, arrogantes Pack!« Mimi kommt nicht die Treppe hoch, um Marie einen Abschiedskuss zu geben.
Zu jener Zeit werden Mädchen im Kloster erzogen, und Marie lernt ihre Lektion: Ihre wahre Aufgabe – im irdischen Leben – ist es, ein gutes Mädchen zu sein. Sie darf sich nicht nach ihrer Familie sehnen, nach Mimi oder ihrer Katze. Sie darf nicht jammern. Sie darf nicht erwarten, dass ihr jemand übers Haar streicht oder sie an den Füßen kitzelt. Stattdessen erwarten sie Französisch, Latein und Mathematik; die Kamine müssen in einem Kleid aus grobem Sackleinen ausgekehrt werden. Stundenlang muss sie zum Beten in der eiskalten Kapelle knien, immer neue Wege der Buße sind dafür zu finden, dass sie bis ins Innerste verderbt geboren worden ist. In gewisser Weise glaubt Marie in jungen Jahren daran und findet heraus, dass ihr ein bestimmtes Maß an Selbstkasteiung Freude bereitet – kalte Duschen, viel zu wenig Nahrung, sich selbst abscheuliche Sünden vorwerfen, ihre Bedürfnisse immer weiter zurückschrauben, bis fast keine mehr übrig sind und Marie sich rein und leicht fühlt. Wie sie feststellt, ist sie gut darin, sich selbst zu kontrollieren. Sogar die strenge Schwester Ruth sagt manchmal: »Aber wenigstens bist du ein gutes Mädchen, Marie«, und das erfüllt sie mit Glück. Bald schon eilt ihr der Ruf voraus, besonders still und gehorsam zu sein, obwohl sie die anderen Mädchen manchmal mit einer scharfsinnigen oder schneidenden Beobachtung schockiert, wenn sie ganz kurz die Intelligenz durchblitzen lässt, die sie geduldig sogar vor sich selbst verbirgt.
Abends im Bett erzählen die Mädchen sich manchmal Mutter-Gans-Geschichten. Marie ist sich ziemlich sicher, dass das nicht erlaubt sein kann, auch wenn es nie ausdrücklich verboten worden ist; die Geschichten sind heidnisch und wüst und machen einfach zu viel Spaß, als dass sie gottesfürchtig sein könnten. Einige der Geschichten kennt sie von Mimi, aber die kleinen Mädchen erzählen sie nicht gut und vergessen entscheidende Wendungen in der Handlung. Trotzdem hört Marie gern zu – insgeheim zu wissen, wie viel besser sie es erzählen könnte, macht ihr Freude – und hinterher liegt sie im Dunkeln und erzählt sich die Märchen in Gedanken immer wieder neu, schmückt sie aus, suhlt sich im Leid, in den Juwelen und Küssen und dem grotesken Gefühl, vor lauter Geschichten ganz aufgedunsen zu sein, und bittet Gott dann inständig um Vergebung, den Gott, der selbst den kleinsten Gedanken kennt, der durch ihren unwürdigen Kopf flackert.
Bald – erstaunlich bald – wird sie dreizehn, Geburtstage werden im Kloster allerdings nicht gefeiert. Nach dem Gebet huscht sie durch den Regen zum Nebengebäude, als eine schwere Hand auf ihrer Schulter landet. Es ist ihr nervöser, reizbarer Vater, mit tropfender Perücke und so aus dem Leim gegangen, dass er aussieht wie eine Kröte. Schweigend hält er seiner Tochter eine Rose hin, die er im Klostergarten gepflückt hat: ein warmes Weiß, an den Rändern ein wenig zerdrückt und braun. Es ist einer der unwirklichsten Augenblicke ihres Lebens – das nasse Prasseln, der durchdringende Geruch, das so völlig aus dem Nichts auftauchende Gesicht ihres Vaters – einen Augenblick muss sie nach seinem Namen suchen. Vater. Mon père.
»Ich habe daran gedacht«, erklärt er. »Es ist soweit. Du musst mitkommen.«
Was ist soweit? Marie hat das Gefühl, von einem Fluss mitgerissen zu werden, oder von der Geschichte, oder Gottes Willen, etwas, das sie gewaltsam fortträgt. Sie versucht, an nichts zu denken, als der Kutscher nach ihren Sachen greift – wie es scheint, müssen sie eine dringende Reise antreten.
»Weiß Maman, dass du mich mitnimmst?«
»Wir sind uns einig.«
»Und die Schwestern?«
»Die werden es bald genug mitkriegen.«
»Wohin fahren wir?«
»Das siehst du gleich. An einen wunderschönen Ort.«
»Zu meinem Geburtstag?«, fragt sie hoffnungsvoll.
»Na ja – etwas länger.«
In der Kutsche hält sie immer noch vorsichtig, damit die Dornen kein Loch in ihr Kleid reißen, die Rose in der Hand und versenkt ihre Nase darin, schließt die Augen und versucht, sich in dem Duft zu verlieren: erster und einziger Liebesbeweis ihres Vaters. Der Regen trommelt aufs Wagendach, und die nasse, schlaglochübersäte Straße wird dunkler und immer holpriger; Bäume biegen sich wie Arme. Das Hufgetrappel der Pferde ist so laut wie ihr pochendes Herz. Die Hufe scheinen eine Nachricht zu klopfen: o Gott, o Gott, o Gott.
Es wird Abend. Ihr Vater, der immer eine leise, bettelnde Stimme gehabt hat, spricht während der einstündigen Fahrt kaum ein Wort, als wisse er, dass er gerade etwas für immer zwischen ihnen zerstört. Tief gebeugt vor Scham sitzt er neben seinem krummen Schatten, nach einer Weile schlägt er die Hände vors Gesicht, wie ein Mann, der gerade am Spieltisch hoch gepokert und verloren hat. »Es ist besser so«, sagt er schließlich mit grässlich schwimmenden Augen, als sie vor dem prächtigen Gebäude anhalten. »Das Kloster ist nicht das echte Leben, das weißt du selbst. Und Geld ist Geld, also. Es war ein schwieriges Jahr, sogar für den Adel, deine Mutter musste etwas von ihrem Schmuck opfern. Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Kopf hoch, meine Rose.«
»Aber was wird Schwester Ruth von mir denken, wenn ich nicht zurückkomme?«, fragt Marie. Die Vorstellung, die Nonne zu verärgern, erfüllt sie mit Grauen. Die Vorstellung, sie könne das böse Mädchen in der Geschichte sein.
»Was spielt das für eine Rolle?«
»Sie wird meinen, ich hätte meinen Glauben verraten!«
»Sei nicht albern, Kind. Gott allein ist unser Richter.«
Als sie am Schloss des Herzogs von Vendôme halten, drückt der Vater ihr einen letzten, schroffen Kuss ins Haar und riecht noch einmal daran wie an einer Blume. Dann führt er seine Tochter die hohen Marmorstufen hinauf, über die vergoldete Schwelle, durch einen langen Korridor und in einen großen, überfüllten Saal – der kocht vor Hunderten von Kerzen, Musik, lauten, trunkenen Stimmen – und stellt sie ihrem zukünftigen Ehemann vor.
Der Baron d’Aulnoy hat seinen Titel erst vor Kurzem von seinem Freund, dem Herzog, gekauft. Ihm geht es gut, und wenn der Herzog zwischendurch abwesend ist, dann ist er gewissermaßen sein Stellvertreter und hält die Party am Laufen. Das Erste, das Marie sieht, als sie zu ihm hochblickt, sind lange, gelbe, feuchte Zähne, die aus seinem angegrauten Bart ragen. »Ach, du sollst also meine kleine Frau werden«, sagt Baron d’Aulnoy und legt leise, hingebungsvoll den Fächer Karten hin, den er in der Hand hält. »Herzlich willkommen!« Er breitet die Arme aus, als wolle er ihr alles schenken, insbesondere das in der Mitte zwischen seinen Beinen. Der Mann ist sehr groß und untersetzt und macht ausladende Gesten wie ein Baron in einem Theaterstück. Andere Details kommen in den Blick: das mit Reispuder bestäubte Haar, eine schmale Nase, Lachfältchen um die Augen, kleine Schönheitspflaster überall im Gesicht, unter denen die Pockennarben versteckt werden.
»Meine liebe Marie-Catherine. Mon poussin. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, du kannst mich François nennen.« Er ergreift ihre Hand, führt sie zum Mund und kratzt leicht mit seinen nassen Zähnen darüber, als wolle er ihre Haut probieren. Die kichernden Höflinge, die hunderttausend Kerzenflammen. Ihre kleinen Finger in seiner Pranke.
Und sie leben vergnügt bis an ihr Ende.
So würden es zumindest die behaupten, deren Interessen es – politisch wie finanziell – dient, dass Frauen schon als Kinder verheiratet werden, die aber lieber nicht darüber nachdenken, was als Nächstes passiert. Sogar Marie selbst erinnert sich kaum daran, was in den Jahren danach geschah. Sie hat die Ereignisse so tief in ihr Inneres verdrängt, dass es fast ist, als seien sie nie geschehen. Nur manchmal, wenn sie rote Beeren im Schnee leuchten sieht oder ein Mädchen mit blutroten Lippen und einer Haut weiß wie ein Bettlaken, überkommt sie ein Schwindelgefühl, als würde sie über den Rand der Welt fallen.
Auch Jahre später wird sie sich weigern, an den dicken, lauernden Penis des Barons zu denken. An seinen speichelglänzenden Mund, der »Du gehörst mir« in ihre Haare zischt, während er sie vergewaltigt. An das Gefühl, von innen zerstört zu werden, als würden scharfe Glassplitter in ihre weichsten Teile getrieben.
Oder an ihre erste Periode, an den Fluch, den sie nicht versteht: Sie sitzt auf dem edel vergoldeten, cremefarben gepolsterten Stuhl und sieht, wie etwas Rotes aus der Falte ihres Rocks heraustropft, und bebt vor Scham und Grauen. Das verschlagene Grinsen des Barons, als er es schließlich auch sieht, wie er mit den Lippen schmatzt, »lecker, schmecker« sagt, seine Cousins lachen.
Sie wird den Gedanken an das rote Bett verweigern, in dem sie um Gnade fleht, wo sie wie auf der Folterbank gequält wird; ihr Kind, das endlich, Gott sei Dank, aus ihr herauskommt und losquäkt. Ihr kleines Lämmchen. Oder daran, wie sie ihren Säugling tot in seinem Bettchen findet, wie eine Puppe liegt er da, die Puppe, für die sie eigentlich zu alt ist. Eiskalt und grau angelaufen wie alter Schnee. Wie sie heult und mit dem Kopf gegen die Wand rennt, als wolle sie sich den Schädel einschlagen.
Rosenrot. Schneeweiß. Rosenrot. Schneeweiß.
Rosenrot,
Schneeweiß,
Rosenrot,
Schneeweiß,
rosenrotschneeweißrosenrotschneeweiß
rosenrotschneeweißrosenrotschneeweiß.
Alles ist voller Geschichten. Marie beginnt zu verstehen, dass die Welt von Erzählungen betäubt, betrunken von Geschichten ist und keinen Respekt vor der Wahrheit hat: Geschichten wie die, die Ehe sei ein Bund vor Gott; dass es bedeutet, du bist eine Frau, wenn zwischen deinen Beinen Blut herauskommt; dass ein Mann seine Ehefrau nicht vergewaltigen kann; dass die Ehe Ende gut, alles gut bedeutet. Die Geschichte, dass ein Baron besser sei als ein Diener. Dass ein Neugeborenes, das stirbt, zu seinem Schöpfer in den Himmel gerufen worden sei. Dass gute Mädchen belohnt werden. Geschichten, die den Menschen das wahre Antlitz der Welt nur ganz verschwommen zeigen, wie durch ein Buntglasfenster.
Aber Marie kann auch Geschichten erzählen. Marie wird vielleicht nicht geliebt, aber sie ist klug und mutig, und sie wird ihre eigene Geschichte schreiben, in der sie die Heldin ist und einfach alles weglässt, was sie nicht ertragen kann. An den vielen langen, leeren Tagen, die der Baron damit verbringt, sich mit seinen Freunden volllaufen zu lassen, flüchtet sie sich in die Bücher. Sie liest alles aus der Bibliothek des Fürsten und sorgt selbst für ihre Bildung. Sie fängt an, ihren Eltern jeden Tag einen Brief über ihr wunderbares neues Leben als Baronin d’Aulnoy zu schreiben – an ihnen probiert sie ihre wissende literarische Stimme aus –, aber als die Eltern kaum noch zurückschreiben, füllt sie die Stunden damit, selbst Geschichten zu erfinden. Märchen von der Mutter Gans. Die Schreibfeder ist ein Zauberstab, den sie bloß zu erheben braucht, und eine Tür woandershin öffnet sich.
Hier haben wir ein Buch, das sie schon kurz nach ihrer Verheiratung zu schreiben begann – auf der ersten Seite steht sehr ordentlich zu lesen:
Dies wurde verfasst von Marie-Catherine Le Jumel de Barneville-la-Bertran, Madame d’Aulnoy, im Alter von vierzehn Jahren und acht Monaten. Der Finder dieses Buchs soll wissen, dass es mir gehört. Adieu, Leser – wenn du dieses Buch öffnest und ich dich nicht kenne, wünsche ich dir Krätze, Räude, Fieber, Pest, Masern und Knochenbruch an den Hals. Möge Gott dich vor meinem Fluch schützen.
Unglaublich, was für scharfe Zähne sie an sich entdeckt, wenn sie schreibt! Darunter folgt ein kurzes Märchen. Sie hat es »Das gute Mädchen« genannt:
Als es ihre Eltern flüstern hört: »Wir können nicht einfach zusehen, wie sie verhungert«, füllt das gute Mädchen sich die Taschen mit weißen Kieselsteinen. Später am selben Tag führen die Eltern ihre Tochter tief in den Wald, aber sie lässt die Kiesel aus der Tasche fallen. Als sie im finsteren Dickicht zurückgelassen worden ist, wartet das gute Mädchen höflich ein wenig ab, dann folgt sie den Kieseln zurück nach Hause. Sie zeigen ihr leuchtend den Rückweg zu dem Haus, in dem es nichts zu essen gibt, wo sie unerwünscht ist.
3.
Das Märchen von der Eselshaut
zweiter Teil
I