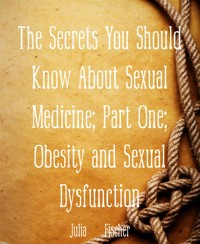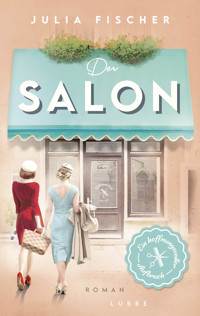
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Salon-Saga
- Sprache: Deutsch
Zwei junge Frauen
Die Swinging Sixties
Ein Gefühl von Freiheit
München, 1963. Für die junge Leni wird ein Traum wahr: Sie wurde für einen der begehrten Praktikumsplätze bei Starfriseur Vidal Sassoon in London ausgewählt. Das erste Mal in ihrem Leben verlässt sie ihre Heimat und entdeckt in der pulsierenden Metropole das Lebensgefühl der Swinging Sixties - bis ein Versprechen, das Leni ihrer Mutter gab, ihre neu gewonnene Freiheit überschattet. Ihre Schwägerin Charlotte tritt unterdessen eine Stelle im Münchner Modehaus Bogner an, wo sie den charismatischen Fotografen Walter kennenlernt. Sein leidenschaftliches Temperament fasziniert sie, doch ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit führt schon bald zu Konflikten ...
Zwei junge Frauen und ihre Suche nach dem Glück im Aufbruchsgeist der Wirtschaftswunderjahre - der zweite Band der berührenden Familiensaga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Band 2 der Reihe »Salon-Saga«
München, 1963. Für Leni wird ein Traum wahr, als sie einen der begehrten Praktikumsplätze bei Vidal Sassoon in London bekommt. Das erste Mal in ihrem Leben steigt sie in ein Flugzeug und landet in der pulsierenden Metropole, wo sie das Lebensgefühl der »Swinging Sixties« mitreißt. Doch kaum nach München zurückgekehrt, überrascht ihre Mutter sie mit einem Plan, der Leni vor eine schwere Entscheidung stellt. Ihre Schwägerin Charlotte tritt unterdessen eine Stelle als Sekretärin bei der Mode-Ikone Bogner an, wo sie den charismatischen Fotografen Walter kennenlernt. Doch Walters impulsive Art und ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit führen schon bald zu Konflikten …
Über die Autorin
Julia Fischer ist eine deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Schriftstellerin. Die Mutter dreier Kinder und Tochter des Komödienstadel-Regisseurs Olf Fischer und der Schauspielerin Ursula Herion lebt mit ihrer Familie in München und hat schon als Kind auf Pumuckel-Schallplatten und im Kinderfunk mitgewirkt, später den Beruf der Schauspielerin ergriffen sowie verschiedene Magazine im Bayerischen Fernsehen moderiert.
In den letzten Jahren kamen unzählige Hörbuchproduktionen hinzu (unter anderem als deutsche Stimme von Agatha Raisin). Außerdem hat Julia Fischer seit einigen Jahren das Schreiben für sich entdeckt und seit 2014 bereits vier eigene Romane veröffentlicht, für die sie zahlreiche begeisterte Feedbacks erhalten hat.
J U L I A F I S C H E R
Der
S A L O N
EinhoffnungsvollerAufbruch
R O M A N
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
Umschlagmotiv: © Dmytro Fomenko / shutterstock; NataVilman / shutterstock; Gemenacom / shutterstock; DihandraPinheiro / shutterstock; Vitaly Korovin / shutterstock; Guilherme Penha / shutterstock; Zerbor / shutterstock; Roman Samborskyi/shutterstock; © Elisabeth Ansley / Trevillion Images; © Lee Avison / Arcangel Images
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2809-6
luebbe.de
lesejury.de
Prolog
März 1963
Leni schwelgte noch in Blütendüften, als sie am späten Nachmittag am Hebertshausener Kindergarten ankam. Sie hatte heute einen der zwei freien Tage im Monat, an denen sie im Salon Keller am Hofgarten in München, wo sie als Friseuse arbeitete, ihre Überstunden abbaute, und war deshalb im Labor der Landmanns Kosmetik gewesen. Das war ihre und Max Albrechts kleine Firma, die in den Räumen der Dachauer Maximilian-Apotheke Naturkosmetik und Haarpflegeprodukte nach alten Rezepturen ihrer Großmutter produzierte. Max und sie experimentierten aber auch mit neuen Inhaltsstoffen. Heute hatten sie an einem milden Malvenshampoo gearbeitet, dessen zarter Duft Leni an sonnige Sommerwiesen denken ließ, und dann durch die Zugabe von Mandelöl die Viskosität ihrer Leichten-Leinsamen-Lotion verbessert, einem Klassiker im Sortiment.
»Tante Leni!«
Hans-Peter, den alle nur Peter nannten, winkte Leni zu. Der Blondschopf saß auf der Schaukel und holte mit seinen kurzen Beinen, die in einer alten Lederhose von Lenis Bruder steckten, Schwung. Sein Freund Manfred, der wie er gerade fünf geworden war, schaute ihm staunend zu und passte auf Peters Kuscheltier auf, das ihn überallhin begleitete: einen aus braunem Garn gehäkelten Bären mit schwarzen Knopfaugen, der Bobbi-Bär hieß.
»Schau mal, wie ich flieg!«
»Nicht zu hoch, Peter!«, rief Leni ihrem Neffen zu und lief zu den beiden hinüber.
Die anderen Kinder spielten Fangen oder Fußball, und zwei der Großen, die in diesem Jahr in die Schule kamen, versteckten sich im Gebüsch. »Peng! Peng! Du bist tot!«, schrie der eine, und der andere beschwerte sich, weil er doch gar nicht getroffen worden war. Räuber und Gendarm, das hatten der Wegner Rudi und Lenis Bruder Hans auch oft gespielt, oder Cowboy und Indianer, denn seit Bonanza im Fernsehen lief, wollten immer mehr Buben wie Little Joe auf der Ponderosa-Ranch sein. Auch Peter, der die Serie gar nicht kannte, weil es in Lenis Elternhaus, in dem er und seine Mama mit ihr und ihrer Mutter zusammenlebten, noch keinen Fernseher gab. Der Antennenwald, der auf den Münchner Dächern immer dichter wurde, war in der kleinen Dachauer Gemeinde vor den Toren der Stadt nur ein lichtes Wäldchen.
Charlotte müsste gleich aus der Gemeindekanzlei kommen, in der sie seit drei Jahren als Sekretärin arbeitete, und Lenis Mutter aus ihrem Friseursalon. Das Putzen überließ sie Vevi, die bereits ihre Gesellenprüfung abgelegt hatte, und nun wie Leni früher den altmodischen kleinen Salon mit Werbeanzeigen dekorierte. Zu der dringend notwendigen Renovierung hatte Lenis Mutter sich noch immer nicht durchgerungen.
»Des braucht’s net«, war seit jeher ihre Devise. »Wer weiß, was kommt, Kinder, des san unsichere Zeiten. Da hält ma sein Sach besser zamm.« Dabei war der Aufschwung im Land grenzenlos, es gab kaum Arbeitslose, und die Löhne stiegen.
Leni beschloss, schon mal das Abendessen herzurichten und noch ein paar Dinge im Haushalt zu erledigen, ehe die beiden nach Hause kamen. Sie hatten jetzt eine Waschmaschine und einen Elektroherd, kleine Ölöfen in Charlottes und Peters Schlafkammern und ein Telefon in der guten Stube, gleich neben dem Radioapparat.
Bevor Peter abends ins Bett musste, durfte er sich noch das Betthupferl, die Gutenachtgeschichte im Radio, anhören, und später las Leni ihm noch etwas vor: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, die Abenteuer eines kleinen schwarzen Jungen, der in einem Postpaket auf die Insel Lummerland geschickt worden war und mit Lukas, dem Lokomotivführer, eine halsbrecherische Seereise in das ferne Königreich Mandala unternahm. Peter lauschte mit großen Augen, während er sich in die Kissen kuschelte und Frank den Bauch kraulte. Den weißen Kater mit den roten Flecken, der Leni zugelaufen war, hatte sie nach Frank Sinatra benannt, weil er so schöne blaue Augen hatte.
»Bis zum Himmel, Tante Leni!«, rief Peter jetzt, und sie versuchte, nach der Schaukel zu greifen.
»Wir müssen gehen. Deine Mama kommt doch gleich heim.«
»Darf der Manni mit?«
Peter sprang im hohen Bogen von der Schaukel und setzte sich zu seinem Freund.
»Heute nicht, aber ihr seht euch ja morgen schon wieder.«
»Bitte!«
»Der Manni darf am Sonntag zu uns kommen, nach der Kirche. Sagst du Frau Geisberger auf Wiedersehen?«
Peter sauste los, gab seiner Kindergärtnerin artig die Hand – »Die schöne, Peterl!« –, brachte seinem Freund Manfred noch etwas, das er aus seiner Hosentasche gezaubert hatte, und schnappte sich seinen Bobbi-Bären.
»Was war das?«, fragte Leni, auf ihrem Weg den Weinberg hinauf.
»Ein Schatz. Den hab ich gefunden.«
»Ach ja? Wo?«
»Im Sandkasten.«
»Und was für ein Schatz ist das?«
»Ein Stein, der ganz rund ist und funkelt.«
Leni musste lächeln. Ihr Neffe fand ständig solche »Schätze«. Blank polierte Kieselsteine, die er in dem alten Murmelsäckchen ihres Bruders Hans verwahrte, Wildblumen, die sie für ihn zwischen Buchseiten trocknete, so wie es ihre Großmutter, die Landmann-Oma, früher für sie gemacht hatte, und schillernde Käfer, die er mit Erde und Gras in Einmachgläser steckte. Für ihn war die Welt voller Wunder, und wer es wissen wollte, dem erzählte er, dass sein Vater ein paar Tage, bevor er auf die Welt gekommen war, zum lieben Gott in den Himmel gegangen war, so als wären sie nur in zwei Zügen aneinander vorbeigefahren. »Ich hab den Papa ganz knapp verpasst!«
Um diese Unversehrtheit seiner Seele beneidete Leni ihren Neffen und dafür, dass er noch nichts von der Willkür des Lebens wusste. »Schuhe ausziehen und Hände waschen!«, sagte sie, als sie ins Haus kamen und Peter gleich losstürzen wollte, um Frank zu suchen. Ihre Mutter und Charlotte waren noch nicht da.
»Machst du heute Pfannkuchen?«, fragte er.
»Nein, aber wenn du mir hilfst, gibt es Dampfnudeln.«
»Mit Soße?«
»Ja, mit Vanillesoße«, versprach Leni, wobei sie dafür ein Päckchen Soßenpulver anrühren würde, damit es schneller ging. Zwar würde ihre Mutter ihr dann wieder einen Vortrag über »des neumodische Sach« halten, das nach nichts schmecke, aber Leni fand viele der neuen Produkte praktisch, auch die Dosen- und Tiefkühlkost, und kaufte gerne in einem der modernen Supermärkte anstatt beim Kramer ein.
Mrs. Randall, eine amerikanische Offiziersgattin, die jeden Samstag in den Salon am Hofgarten kam, hatte sie einmal in das Einkaufszentrum an der MacGraw-Kaserne mitgenommen, in das normalerweise nur Militärangehörige und ihre Familien hineindurften, und Leni hatte über die vielen Knabbereien in knallbunten Tüten und Fertiggerichte in Aluminium- und Plastikschalen gestaunt, die es dort zu kaufen gab. Die schnelle Küche für die moderne, berufstätige Frau.
Sie stäubte Mehl auf den Hefeteig und legte ein Geschirrtuch über die Schüssel. Jetzt musste der Teig nur noch gehen. Peter war über die Bank auf das tiefe Fensterbrett geklettert und schaute mit seinem Bobbi-Bären im Arm zum alten Baumhaus hinaus, das Lenis Vater, der nicht aus dem Krieg zurückgekommen war, einst für sie und ihren Bruder in die große Kastanie gebaut hatte. »Darf ich da mit dem Manni rauf?«, fragte er sehnsüchtig.
»Nein.«
»Warum?«
»Weil du noch zu klein bist, das weißt du doch. Das Baumhaus ist nur was für Schulkinder, und vorher muss dein Patenonkel noch ein paar Bretter austauschen und prüfen, ob es sicher ist.«
»Aber Frank ist auch oben«, sagte Peter und deutete hinaus.
»Frank ist ja auch viel leichter als du und eine Katze, die hat sieben Leben, aber du nur eins.«
Ein einziges, dachte Leni, und es ist so zerbrechlich.
Peter entdeckte Charlotte am Gartentor, sprang auf und riss kurz darauf die Haustür auf. »Mama!«, rief er.
»Hallo, mein Schatz, wie war es im Kindergarten?«
»Ich hab dem Manni einen Zauberstein geschenkt. Und die Tante Leni sagt, dass er mich am Sonntag besuchen darf, und dann klettern wir aufs Baumhaus«, sprudelte es so laut aus ihm heraus, dass Leni ihn noch in der Küche verstand.
»Ich glaube nicht, dass deine Tante euch das erlaubt hat«, entgegnete Charlotte.
»Doch. Der Onkel Schorsch muss nur neue Bretter machen«, sagte Peter voller Überzeugung und zog seine Mutter ins Haus.
»Kann ich dir helfen?«, fragte Charlotte, als sie in die Küche kam, ihre Kelly Bag abstellte, die Ziegenlederhandschuhe auszog und ihren Hut abnahm. Charlottes Sachen waren viel zu fein für das Leben auf dem Land, aber sie wollte sich keine anderen kaufen. Sie suchte deshalb nur die einfachsten Kleider aus, wenn sie zur Arbeit ging, schminkte sich wenig und trug kaum noch Schmuck.
Dass sie vor ihrer Heirat mit einem erfolgreichen Prokuristen und Teilhaber einer Fabrik für Miederwaren Mannequin und Fotomodell gewesen war, sah man ihr kaum noch an. Doch an diese Zeit hätte Charlotte nach Peters Geburt ohnehin nicht mehr anknüpfen können, denn Fotomodelle mussten ständig reisen und Mannequins ledig und »unbescholten« sein. Bekannte Modehäuser stellten keine geschiedenen Frauen oder ledige Mütter ein, um ihre Kollektionen vorzuführen.
»Gibst du mir die Schüssel?«, bat Leni ihre Freundin und deutete zum Küchentisch.
»Was machst du?«
»Dampfnudeln.«
»Mit Soße!«, rief Peter, der es sich wieder mit seinem Bären auf dem Fensterbrett gemütlich gemacht hatte, wo er auf seine Großmutter wartete.
»Wir nehmen Soßenpulver«, erklärte Leni und setzte Milch auf.
»Ich rühre es an«, sagte Charlotte, und Leni stellte die Kanne in die Speisekammer zurück. Sie brauchten unbedingt einen Kühlschrank, überlegte sie, damit sie nicht mehr so oft einkaufen mussten, obwohl Peter es liebte, mit der Milchkanne zum Kramer hinunterzulaufen.
»Nächstes Jahr darfst allein runter«, hatte Lenis Mutter zu ihm gesagt. »Aber nur, wennst versprichst, dass du gut achtgibst.«
Der Verkehr in Hebertshausen nahm immer mehr zu, seit die Straßen geteert waren, auch wenn es kein Vergleich mit München war, das im Smog erstickte.
»Wie war’s im Büro?«, fragte Leni.
»Die üblichen Anträge für Baugenehmigungen, die Abfallgebühren sollen erhöht werden, und der Schützenverein hat dem Bürgermeister heute seine neue Fahne präsentiert«, erzählte Charlotte, während Leni die Dampfnudeln in eine Reine setzte, sie mit warmer Milch angoss und Butter und Zucker dazugab, der später im Ofen karamellisieren würde.
»Wie aufregend.«
»Ja, nicht wahr?«
»Joseph hat die Post gebracht, als du schon weg warst. Ich glaube, Eva hat dir geschrieben«, sagte Leni und deutete auf eine Ansichtskarte mit der Westminster Abbey, die auf dem Küchenbuffet lag. »Ich fürchte, er war enttäuscht, dass nicht wenigstens eine karibische Insel drauf ist«, fügte sie hinzu, weil Joseph Mittermayer, ein verwitweter Postbeamter, der ein Auge auf Lenis Mutter geworfen hatte, seit seine Tochter Vevi ihre Ausbildung in ihrem Salon gemacht hatte, jede Karte überflog, ehe er sie zustellte. Über Evas Grüße aus aller Welt freute er sich besonders, denn etwas derart Exotisches bekam er sonst nicht zu sehen.
»Sie kommt auf das Titelblatt der britischen VOGUE«, sagte Charlotte, nachdem sie die Karte gelesen hatte. »In der Mai-Ausgabe.«
»Dann besorge ich sie uns am Bahnhof«, versprach Leni.
Sie dachte an den Tag, an dem sie Eva, die früher bei Gehringer und Glupp in Berlin Hausmannequin gewesen war und jetzt in London lebte, an Charlottes Seite kennengelernt hatte. Bei einem Kinobesuch, zu dem Leni ihren Bruder Hans und seine Kommilitonen begleitet hatte: Frieda, die Überfliegerin, die gerade ihren Facharzt als Herzchirurgin im Schwabinger Krankenhaus machte, und Karl, in den Leni verliebt gewesen war, bis er ihr das Herz gebrochen hatte. Nur Schorsch war damals nicht dabei gewesen, Peters Taufpate, der jetzt ebenfalls im Schwabinger Krankenhaus arbeitete und sich als Hausarzt niederlassen wollte.
»Deine Mutter wird mit uns schimpfen, weil die Zeitschrift so teuer ist«, meinte Charlotte, doch Leni fand, dass es das wert war – Eva auf dem Titelblatt der VOGUE!
Charlotte seufzte.
»Denkst du an früher?«, fragte Leni, weil sie ahnte, dass ihre Freundin sich nach ihrem alten Leben sehnte. »An deine Arbeit als Fotomodell?«
»Ja«, gab sie zu und sah Peter an.
»Die Oma kommt, die Oma!«, rief er, sprang auf und sauste hinaus. Leni beobachtete, wie er ihre Mutter am Gartentor umarmte und sie über das ganze Gesicht strahlte.
»Da bist ja, Bub«, hörte sie sie sagen, als sie das Küchenfenster öffnete, »du hast mir schon g’fehlt.«
»Die Tante Leni macht Dampfnudeln.«
»Dann sag ihr, ich komm gleich, ich schau nur noch schnell im G’wächshaus nach meinem Salat. Is deine Mama auch schon daheim?«
»Sie hat die Soße gemacht!«, erklärte Peter, kam dann wie ein Blitz in die Küche geschossen und tauchte seine Finger in die Vanillesoße, die schon auf dem Tisch stand.
»Peter, du Lump!«, rief Leni, »nimm sofort die Finger da raus!«, und der Kleine lachte herzerfrischend.
»Ich schaff zwei!«, krähte er, als sie die Dampfnudeln auf den Tellern verteilte.
»Du willst wohl so dick werden wie die Frau Waas«, zog Charlotte ihn auf, »oder Pi Pa Po«, und kitzelte ihn, bis er lauthals quietsche.
»Mama!«, rief Leni aus dem Fenster, »wenn du dich nicht schickst, isst Peter dir alles weg.«
»Dann kriegt die Oma nur noch Soße!«
Lenis Mutter sprach kurz darauf das Tischgebet, und Peter griff noch vor dem »Amen« zum Löffel. Mit der freien Hand zerrte er an seinem Latz.
»Habt’s wieder a Packerl aufg’macht?«, fragte die Mutter skeptisch.
»Es geht halt schneller.«
»Geh, die paar Handgriff! Was gibt’s Neues im Amt?«
»Der Schützenverein hat eine neue Fahne«, sagte Charlotte.
»Die alte ham’s nimmer g’funden, nachdem’s die Schützenkette im Krieg im Altar versteckt ham, damit’s net eing’schmolzen wird«, erklärte Lenis Mutter, denn als »Zugezogene« kannte Charlotte die Geschichte der Gemeinde nicht.
»War das nicht die Idee von der Oma?«, fragte Leni.
»Die einen sagen so, die anderen so, aber der Pfarrer und der Kassier ham schon auch ihren Teil beigetragen.«
»Der Bürgermeister war vor dem Krieg der Vorsitzende des Schützenvereins«, wusste Leni.
»Und der Leni ihr Vater und ihr Opa waren beide Mitglieder. Mein Otto is ein guter Schütze g’wesen.«
»Und Hans?«, fragte Charlotte.
»Der hat’s net so mit die Waffen g’habt. Der wollt immer nur Trompete spielen.«
»Ich will auch Trompete spielen!«, rief Peter, der auf den alten Kräuterbüchern der Landmann-Oma saß, damit er über den Tisch schauen konnte, und schob sich ein großes Stück Dampfnudel in den Mund.
»Du schaust ja jetzt schon aus wie ein Blasengerl«, sagte Lenis Mutter beim Anblick seiner Pausbacken, und alle mussten lachen – ihre ganze zusammengewürfelte Familie, für die Leni aus tiefstem Herzen dankbar war.
1
Ein paar Wochen später.
Der Samstag war zwar immer der arbeitsreichste Tag im direkt am Münchner Odeonsplatz gelegenen Salon Keller am Hofgarten, aber es war auch Lenis Lieblingstag, denn da erschienen ihre Stammkundinnen: die Majorsgattin Mrs. Randall und Sasa Sorell, ein ehemaliges Revuegirl, das heute eine eigene Tanztruppe leitete. Sasa war schon lange vor Leni mit Charlotte befreundet gewesen und hatte sich früher gemeinsam mit ihr die Haare richten lassen, doch seit Charlotte bei Leni und ihrer Mutter in Hebertshausen wohnte, frisierte Leni sie dort.
»Was für eine Kälte«, seufzte Irmi, die soeben mit Christl in den Salon trat. Mit den beiden Friseusen hatte Leni hier von Anfang an zusammengearbeitet. Kurz darauf trafen Helga und Benny ein, die sie noch als Lehrlinge kennengelernt hatte. Die rundliche Helga, ein verträumtes Mädchen, dem anfangs öfter einmal kleine Missgeschicke passiert waren, hatte sich zu einer guten Kraft entwickelt, aber die eigentliche Überraschung war Benny. Er hatte seine Gesellenprüfung zusammen mit Fritz abgelegt, der an der Seite von Anton Riedmüller und Fred Lingen die Kunden im Herrensalon bediente, und sich dann für das Damenfach entschieden. Jetzt war Benny zweiundzwanzig Jahre alt, hoch aufgeschossen und während seines Wehrdienstes so unglaublich hübsch geworden, dass die Kundinnen gar nicht mehr dazu kamen, in ihren Zeitschriften zu blättern, wenn er sie frisierte, da sie jede seiner Bewegungen im Spiegel verfolgten.
Manchmal erinnerte Benny Leni an Rock Hudson, von dem letzten Monat in der CONSTANZE gestanden hatte, dass er ein blendend aussehender Liebhaber sei und ein Typ, mit dem jede Frau flirten und jeder Mann befreundet sein möchte. Von seinem Bettgeflüster hatten die Damen im Salon wochenlang geschwärmt, einem Film, in dem er an der Seite von Doris Day zu sehen gewesen war.
Modebewusste Frauen trugen ihr Haar heute wie sie: hoch aufgetürmt, kräftig toupiert und mit reichlich Haarspray fixiert. Wem es an Fülle fehlte, der half mit Haarteilen nach, und Eilige griffen gleich zu Straßenperücken. Jacky Kennedy, die seit der Wahl ihres Mannes zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ein Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt geworden war, hatte sich für ihre Weltreise im letzten Jahr ganze sechzehn Stück anfertigen lassen. Sie sollen vierundzwanzigtausend Mark gekostet haben, aber natürlich bekam man Zweitfrisuren in Kaufhäusern auch schon für weniger Geld.
»Hey, Chefin, man munkelt, dass Sie heute eine neue Kundin haben«, sagte Benny, der eine Schwäche für Leni hatte und sie seit ihrem Aufstieg zur leitenden Angestellten siezte. Sie schlüpfte gerade im Lager hinter dem Herrensalon in ihren weißen Kittel und kontrollierte den Sitz ihrer neuen Frisur – ein schulterlanger Schnitt mit einem dichten Pony, der ihr kupferrotes Haar gut zur Geltung brachte, die Spitzen nach außen gedreht.
»Soll eine echte Berühmtheit sein«, gab Benny sich geheimnisvoll.
»Dann hoffe ich, dass du dich von deiner besten Seite zeigst«, erwiderte sie gelassen und schmunzelte über den Heftroman – Perry Rhodan, Der Erbe des Universums –, den Benny soeben in seine Manteltasche steckte. Er kaufte ihn jeden Samstag für siebzig Pfennig an einem Kiosk neben dem Eingang zum Hofgarten und las die erste Seite noch im Gehen. Einmal war er dabei gegen einen Laternenpfahl gelaufen und hatte sich heftig den Kopf gestoßen, aber es hatte keine Minute gedauert, und drei Passantinnen hatten sich hingebungsvoll um ihn gekümmert.
»Ist gebongt, Sie bekommen mein schönstes Blendax-Lächeln, Chefin«, versprach Benny.
»Und nenn mich nicht dauernd Chefin, unser Chef ist Herr Keller.«
»Logo, Chefin.«
Wie aufs Stichwort erschien Alexander Keller im Lager, wie immer tadellos gekleidet, heute mit einem dunkelroten Jackett zur lindgrün geblümten Fliege und einem weißen Hemd mit goldenen Manschettenknöpfen. Sein schwarzes Haar und das schmale Bärtchen auf der Oberlippe waren, wie Leni vermutete, gefärbt, denn ihr Chef musste im gleichen Alter wie ihre Mutter sein, und war noch immer nicht ergraut.
»Guten Morgen, Herr Keller«, sagten alle im Chor und machten sich unter seinem strengen Blick an die Arbeit.
»Marlene, heute kommt Maria Bogner zu uns, ich habe sie um acht bei Ihnen eintragen lassen.«
»Die Maria Bogner?«
»So ist es.«
»Warum bedienen Sie sie nicht selbst?«, fragte Leni verwundert, denn eine Gelegenheit wie diese ließ sich ihr Chef normalerweise nicht entgehen.
»Sie hat explizit nach einer jungen Kraft gefragt. Ich übernehme deshalb Mrs. Randall und Irmi Frau Sorell.«
Eine junge Kraft, wie schmeichelhaft, dachte Leni, die im Mai siebenundzwanzig wurde und sich manchmal schon wie ihre eigene Mutter fühlte.
Sie sah in das Auftragsbuch, um das sich Maria kümmerte – Maria Pauly, von der Leni glaubte, dass sie heimlich mit dem Chef liiert war –, und war plötzlich aufgeregt. Etwas, das ihr schon lange nicht mehr passiert war. Schließlich bediente Leni im Salon am Hofgarten öfter Prominente, daran war sie gewöhnt, aber die Frau des ehemaligen Skiprofis Willy Bogner senior, des Chefs des Münchner Sportmoden-Unternehmens Bogner, bei dem Charlotte früher als Hausmannequin gearbeitet hatte, war schon fast eine Legende. Sie hatte mit ihren schmalen elastischen Keilhosen, die ihren Siegeszug bis nach Amerika angetreten hatten, die Skibekleidung revolutioniert und Farbe auf die Pisten gebracht. Stars wie Liz Taylor, die Callas oder Soraya, die zweite Frau des Schahs von Persien, trugen sie in Mauve, Fuchsia und Chartreuse und dazu kurze Anoraks mit Taillenzug für die sportlich-elegante Silhouette.
Leni wusste, dass Maria Bogners Sohn Willy, der ein ebenso erfolgreicher Wintersportler wie sein gleichnamiger Vater war, vor drei Jahren das Lauberhorn-Rennen gewonnen hatte – sein Foto war in allen Zeitungen gewesen – und dass er nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Innsbruck dabei sein würde.
Peters Patenonkel Schorsch, der selbst ein leidenschaftlicher Tourengeher und Skifahrer war, freute sich jetzt schon darauf. Er hatte Leni und ihrem Neffen vor zwei Jahren auf dem Dünaberg in Murnau, einem Hügel unweit des Volksfestplatzes, die ersten Schwünge beigebracht und beförderte Peters Sportbegeisterung.
Herr Keller begrüßte die neue Kundin an diesem Morgen mit dem gewohnten Überschwang – »Frau Bogner, it’s a pleasure! Darf ich Ihnen das Cape abnehmen und Sie an Ihren Platz führen?« –, während sämtliche Friseure und Friseusen, einschließlich Leni, Maria Bogner mit ihren Blicken verfolgten, bis sie Platz genommen hatte.
»Bilderbuchfigur«, flüsterte Benny seinem Kollegen Anton hinter dem Philodendron im Durchgang zum Damensalon zu, und auch Leni fand, dass man Frau Bogner ihr Alter wirklich nicht ansah. Sie musste um die vierzig sein, hatte drei erwachsene Kinder, strahlend blaue Augen, die Leni an Gletschereis erinnerten, und kurzes weißblondes Haar. Seit Frau Bogner vor dreizehn Jahren auf dem Titelblatt der GRAZIA zu sehen gewesen war, hatte sie sich kaum verändert.
Leni stellte sich ihr vor und fragte, was sie für sie tun könne.
»Wir reisen viel«, erklärte Maria Bogner, eine gebürtige Rheinländerin, »und ich brauche einen einfachen, guten Schnitt, damit ich meine Haare unterwegs selbst waschen und legen kann.«
Leni sah, wie ihr Chef aufhorchte. Dass Frauen ihr Haar selbst wuschen, es färbten und sogar Heimwellen legten, griff immer mehr um sich und verdarb den Salons das Geschäft. »Wie wäre es denn mit einem Lady-Twist, gnädige Frau?«, fragte er Frau Bogner und zeigte ihr ein Foto der neuen Modefrisur, die auf einem rhythmisch-fülligen Rundschnitt basierte, in der Lockenden Linie. »Die Damen tragen den Twist bevorzugt in Bernsteinblond«, schwärmte er.
»Ich habe an etwas Natürlicheres gedacht«, erwiderte Frau Bogner und blickte skeptisch auf die aufwendig drapierte Frisur, »und bevorzugt in meiner eigenen Haarfarbe.«
»Of course.«
»Mir hat er Altgold vorgeschlagen«, mischte Sasa sich ein, die Kellers Farbempfehlungen seit Jahren ignorierte, und Mrs. Randall, die mit ihr zusammen in den Salon gekommen war, lächelte amüsiert, denn Sasa trug ihr Haar roséfarben und scherte sich nicht um Moden. Ihre wallende Garderobe, die sie als Fortführung der korsettfreien Reformkleider bezeichnete, und der üppige Schmuck waren stets farbenfroh. »Altgold, wie das schon klingt!«, echauffierte sie sich und blätterte in ihrer Illustrierten.
»Ich werde mir gleich ansehen, wie Ihre Haare fallen, wenn sie feucht sind«, übernahm Leni wieder die Beratung. »Benny, kannst du Frau Bogner noch waschen, bevor deine erste Kundin kommt?«
»Klar, Chefin.«
»Und richte mir bitte das Bonafix her.«
Die neue Sofort-Fixierung von Schwarzkopf war dem Haar kaum anzumerken und hielt Frisuren tagelang in Form. Leni arbeitete gerne damit, auch wenn es ähnliche Produkte natürlich auch von WELLA, Kadus, L’OREAL und anderen Firmen gab. Die großen Labore der Marktführer überboten sich förmlich mit Innovationen, da konnte die Haarpflegeserie ihrer Landmanns Kosmetik kaum mithalten.
»Kann ich sonst noch etwas für die Damen tun?«, fragte Benny.
»Da würde mir einiges einfallen, mein Hübscher«, raunte Sasa ihm mit ihrem unverwechselbar tiefen Timbre zu und holte ihre Zigaretten aus der Handtasche – Nil, der Marke blieb sie treu. Benny gab ihr, ganz Gentleman, Feuer, und die Kundinnen, die ihnen gegenüber von Helga und Christel bedient wurden, seufzten selig.
Mrs. Randall, die Herr Keller bereits zum Lady-Twist überredet hatte, begutachtete die Neue auf Charlottes angestammtem Platz, und auch Sasa nahm sie in Augenschein. Bisher hatte es keine Frau geschafft, in ihre kleine verschworene Samstagsgemeinschaft aufgenommen zu werden, da es den meisten an Schlagfertigkeit fehlte oder Sasa sie mit ihrer unverblümten Art schockierte. Den derben Witzen und schlüpfrigen Anekdoten über ihre freizügigen Auftritte anno 1920 im Moulin Rouge zum Beispiel.
Während im Herrensalon Rasierschaum aufgeschlagen und das Münchner Tagesgeschehen kommentiert wurde – der geplante Bau der U-Bahn und dass am Hauptbahnhof nun ein Treffbuch auflag, in dem Leute sich Nachrichten hinterlassen konnten –, stellte Leni die Damen einander vor.
»Wieso kommen neuerdings auf drei Seiten, die über Mode berichten, acht mit Kochrezepten und vier Spalten Haushaltsratgeber?«, fragte Sasa in die Runde. »Wen interessiert, wie Uschi B. ihre Alpenveilchen zum Blühen bringt oder ob man Teppichflusen abschneiden darf?«
»Also, ich finde die Tipps sehr hilfreich«, meinte Irmi, die ihr gerade die Haare frottierte.
»Und dann diese Werbung!«, überging Sasa ihren Einwurf und gestikulierte so aufgebracht mit ihren Händen, dass ihre Armreife klimperten.
Maria Bogner warf einen Blick auf die Anzeigen.
»Dosenmilch neben DIOR«, ereiferte sich Sasa, »hat denn niemand mehr Sinn für Ästhetik?«
»You are a snob, my dear«, stellte Mrs. Randall trocken fest.
»Keineswegs. Ich bin ein Schöngeist und offensichtlich das letzte Bollwerk zwischen den Tütensuppen und der Haute Couture.«
Dass die üppige Sasa sich selbst als Bollwerk bezeichnete, ließ sogar Leni schmunzeln.
»Abgesehen davon sind das da Prêt-à-porter-Modelle«, sagte Mrs. Randall, die ebenfalls in Sasas Zeitschrift sah.
»Was ist das?«, fragte Irmi.
»Entwürfe von bekannten Modeschöpfern, die in größerer Stückzahl gefertigt werden als die Haute Couture«, erklärte Maria Bogner, »aber im Gegensatz zur Konfektion sind sie limitiert. Das machen jetzt immer mehr Modehäuser, um zu überleben.«
»HERTIE führt Modelle von Pierre Cardin«, wusste Leni.
»Genau das meine ich!«, schimpfte Sasa.
»Darf ich fragen, wo Sie Ihre Kleider kaufen?«, fragte Frau Bogner interessiert.
»Bei Glück.«
»Den kenne ich gar nicht.«
»Ein Campingausstatter, der schneidert Zelte nach Maß.«
Maria Bogner sah Sasa perplex an und lachte dann herzlich. »Fast hätten Sie mich drangekriegt!«
»Me too!«, sagte Mrs. Randall konsterniert.
»Aber so abwegig ist das gar nicht«, fuhr Frau Bogner fort. »Ich habe meine erste Kollektion aus ausrangierten Bettlaken und alten Tischdecken genäht.«
»Wirklich? Aus alten Tischdecken?«, staunte Leni. Zwar hatte ihre Mutter früher auch aus allen möglichen Stoffresten etwas geschneidert, aber gleich eine ganze Kollektion, das brauchte schon Mut.
»Wir haben nach dem Krieg in einer zugigen Baracke auf schrottreifen Nähmaschinen sogar Dirndl genäht«, erzählte Lenis neue Kundin. »Mein Mann war damals noch in Gefangenschaft, aber als er zurückkam, hatten wir schon einen Laufsteg und haben sie vorgeführt.«
Ja, sicher, damals war so etwas noch möglich, dachte Leni nicht ohne Neid. Aus dem Nichts etwas aufzubauen, ohne nennenswerte Konkurrenz, war eine kalkulierbare Sache, aber neben den vielen etablierten Friseursalons Münchens noch einen weiteren zu eröffnen, was jahrelang ihr Traum gewesen war, wäre glatter Selbstmord.
Manchmal fragte sie sich, wie sie sich das überhaupt vorgestellt hatte. Aber das war ja auch vor dem Tod ihres Bruders gewesen. Vor dem schrecklichen Flugzeugabsturz an der Paulskirche, nur zwei Kilometer vom Salon am Hofgarten entfernt, der die ganze Stadt erschüttert hatte, und vor dem Bau der Berliner Mauer und der Zuspitzung des Kalten Krieges, als die Russen vor der Haustür der Amerikaner auf Kuba Atomraketen stationiert hatten. Lenis Mutter hatte daraufhin Notreserven angelegt – Seifen, Speiseöl und Mehl, dabei hatten sie rund um Hebertshausen nicht einmal einen Atomschutzbunker –, und im Herrensalon war der Ruf nach Aufrüstung laut geworden.
Leni fuhr Maria Bogner durchs Haar und prüfte, wie es fiel. »Meine Freundin trägt es ähnlich, und ich stufe es ihr immer«, wechselte sie das Thema, um nicht an Dinge denken zu müssen, die sie sowieso nicht beeinflussen konnte.
»Sag, wie geht es Lotte?«, fragte Sasa.
»Gut, obwohl ich glaube, dass die Arbeit in der Gemeindekanzlei nicht das Richtige für sie ist.«
»Sie hat früher bei Ihnen als Hausmannequin gearbeitet«, erklärte Sasa Frau Bogner stolz.
»Wann?«
»Vor acht oder neun Jahren, bevor sie diesen Tyrannen geheiratet hat.«
Womit Sasa Kurt Lembke meinte, der Charlotte misshandelt und in seine düstere Villa in Bogenhausen eingesperrt hatte, bis sie es endlich geschafft hatte, ihn zu verlassen, was einem echten Krimi gleichgekommen war.
»Und sie heißt Lotte?«, fragte Maria Bogner.
»Charlotte«, sagte Leni, »Charlotte Bach.«
»Ja, natürlich! Sie hat auch im Büro ausgeholfen und war sehr zuverlässig«, erinnerte sie sich. »Und jetzt arbeitet sie also bei einer Behörde?«
Irmi und Herr Keller verfolgten das Gespräch. Sie wussten von Charlottes Scheidung, dass sie ein Kind von Lenis Bruder bekommen hatte und auch, dass Hans verunglückt war, ehe die beiden heiraten konnten. Weshalb Peter nun nicht wie sein Vater Landmann hieß, sondern Bach wie seine Mutter, Charlottes Mädchenname, den sie nach der Scheidung wieder angenommen hatte. Kurze Zeit war das das Thema im Salon gewesen, und alle Angestellten hatten getuschelt.
»Sie ist jetzt Mutter und geschieden«, erzählte Leni, ohne die komplizierte Familiensituation näher auszuführen, »da hat sie beruflich nicht mehr so viele Möglichkeiten. Aber sie war auf der Wirtschaftsschule und hat auch schon in einer großen Firma für Miederwaren in der Buchhaltung gearbeitet.«
Als Maria Bogner wieder unter der Trockenhaube hervorkam und Leni ihr Haar ausfrisierte, verzichtete ihr Chef ausnahmsweise auf seinen gewohnten Auftritt, seinen kostbaren Stielkamm zu zücken, um eine einzelne Strähne ihrer Kundin anzuheben, ihre Frisur mit reichlich Haarspray zu fixieren und begeistert »Marvelous!« auszurufen – sein Markenzeichen. Stattdessen half er Frau Bogner formvollendet in ihr Lodencape, das Leni letzten Herbst in der CONSTANZE gesehen hatte, und begleitete sie persönlich zur Kasse.
»Darf es noch eine Pflegepackung für zu Hause sein?«
»Warum nicht, Alexander.«
Auch Maria Bogner sprach Herrn Kellers Vornamen Englisch aus, wie alle Kundinnen des Salons, da Lenis Chef das Gerücht gestreut hatte, er hätte sein Fach in London an der Seite des Starfriseurs »Mr. Teasy-Weasy« Raymond Bessone gelernt, dem er auch optisch nacheiferte. Wobei Bessones exaltierte Garderobe, mit der er immer wieder in Illustrierten zu sehen war, kaum zu überbieten war. Jüngst hatte Leni ein Foto von ihm gesehen, auf dem er bei einem Pferderennen in Ascot einen rosaroten Cut mit farblich passendem Zylinder getragen hatte.
»Schreiben Sie sie gerne dazu. Vielen Dank«, erklärte Frau Bogner.
»You’re welcome, madam.«
»Ach, Marlene«, sagte sie, nachdem sie bezahlt hatte, »falls Ihre Freundin an einen Wechsel denkt, ich suche ab Juni eine neue Sekretärin, die hin und wieder auch ein paar meiner Aufgaben in der Firma übernimmt. Vielleicht ist sie interessiert?«
»Ganz bestimmt!«, erwiderte Leni erfreut und ahnte, dass das einer dieser Momente im Leben war, in denen etwas Entscheidendes passierte. Weichenstellend, wie der, als sie Herrn Kellers Anzeige in der Zeitung entdeckt oder als sie Max das erste Mal von den Rezepturen ihrer Großmutter erzählt hatte.
»Hier ist meine Karte. Sie soll mich anrufen, dann machen wir etwas aus.«
»Danke.«
»Ich danke Ihnen«, sagte Frau Bogner und gab Leni stolze zwei Mark Trinkgeld. »Wir sehen uns dann nächsten Samstag um acht.«
»Sie behalten den Termin bei?«
»Unbedingt, die Gesellschaft ist erfrischend.«
2
Schon wenige Tage nach Maria Bogners Besuch im Salon Keller hatte Charlotte ein Vorstellungsgespräch bei Bogner am Firmensitz in Trudering. Sie verließ die Gemeindekanzlei in der neuen Schule an der Bergerwiese, ging nach Hause und suchte ihr Abschlusszeugnis von der Wirtschaftsschule und das Empfehlungsschreiben ihres letzten Chefs bei der Mang KG heraus. Dann zog sie sich um, schminkte sich, legte Schmuck an und schlang ein Tuch um den Kopf. Die schwere, fließende Seide und der Ausdruck ihres Gesichts, sobald sie Lippenstift auftrug, das kühle Gold auf ihrer Haut und der Duft des CHANEL N°5, das sie seit Jahren nur noch auf ihr Kopfkissen sprühte, ließen die Sehnsucht nach den Kreationen großer Designer wieder in ihr aufsteigen, nach dem Pariser und Berliner Chic und der Alta Moda Italiana. Dem Rausch von edlen Stoffen und Farben, raffinierten Schnitten und Metamorphosen. Diese Welt, in der aus einem Stück Stoff Träume entstanden, fehlte ihr – und ein Badezimmer mit Heißwasserboiler nebst einem Schrank, in den mehr als eine Handvoll praktischer Kleider passten. Auch wenn der der Landmann-Oma noch immer den zarten Duft von Lavendel verströmte.
Als sie gerade in ihr Auto steigen wollte, kam ihre Nachbarin aus dem Haus und sah sie an, als wäre sie eine der Frauen, die sich rund um den Münchner Hauptbahnhof zahlungskräftigen Männern anboten. Dies war einer der Gründe, warum Charlotte das Gefühl hatte, in der Enge dieser dörflichen Gemeinschaft zu ersticken. Sie grüßte sie freundlich und lächelte kühl.
Als sie eine knappe Stunde später auf das Firmengelände von Bogner in der Truderingerstraße fuhr, stellte sie fest, dass es sich, seit sie zuletzt hier gewesen war, fast um das Doppelte vergrößert hatte. Kein Wunder – heute arbeiteten über sechshundert Angestellte für das Unternehmen, und der Jahresumsatz lag im zweistelligen Millionenbereich. Das Skifahren war zum Massensport geworden, und Maria Bogners Entwürfe waren ein Must-have auf den Pisten von Cortina d’Ampezzo bis Colorado. Wobei Bogner längst nicht mehr nur Sportbekleidung produzierte.
Charlotte parkte ihre rote Borgward Isabella vor dem hohen Backsteinkamin, der noch ein Relikt der alten Sauerkrautfabrik war, in die die Bogners 1950 eingezogen waren, stieg aus und sah an der vierstöckigen Fassade des modernen Hauptgebäudes hoch. Jeder Schritt war wie ein Nachhausekommen, und trotzdem war sie aufgeregt.
»Darf ich?« Ein Mann Ende dreißig, leger gekleidet und mit einem schmalen Menjou-Schnurrbärtchen, hielt ihr die Tür auf. »Oder wollen Sie es sich noch mal überlegen?«
»Bitte?«
Seine Frage war im Lärm der Maschinen des nahen Flughafens München-Riem untergegangen, deren Abgase es den Bewohnern der neuen Gartenstadt und der betagten Bauernhöfe nicht erlaubten, ihre Wäsche draußen zu trocknen.
»Sie sehen unentschlossen aus«, meinte er und sah sie forsch an. Er hatte etwas von einem Abenteurer, einem, der Wüsten durchquerte und Ozeane überwand. Ein Mann ohne Unsicherheiten.
»Ich habe nur ein wenig in Erinnerungen geschwelgt«, erwiderte sie, »und ich bin nervös.«
»Ein Vorstellungsgespräch?«
»Ja.«
»Mannequin?«
»Bürokraft.«
»Verschwendung!«, sagte er und lächelte. Seine Augen schienen sie zu vermessen, was sie verlegen machte.
»Vielen Dank. Und Sie?«
»Öffentlichkeitsarbeit.«
Er hielt ihr noch immer die Tür auf.
»Wollen wir?«, fragte er, und Charlotte ging voraus. Sie kannte Maria Bogners neues Büro noch nicht, aber sie hatte ihr am Telefon gesagt, dass es im zweiten Stock lag.
Charlotte stieg die Treppe hoch, der Mann folgte ihr.
»Ich muss zu Frau Bogner«, erklärte sie ihm.
»Und ich zu ihrem Mann«, sagte er und deutete auf eine Tür, neben der auf einem schlichten Schild der Name Willy Bogner stand. »Viel Glück«, rief er ihr nach.
»Danke.«
Es war, als wäre keine Zeit vergangen. Maria bat Charlotte, sie wie früher beim Vornamen zu nennen, und ließ sich von ihr ihren Werdegang erzählen, von dem Moment an, als Charlotte bei Bogner aufgehört und sich wenig später verlobt hatte, bis heute.
Sie saßen auf kleinen Sesseln an einem Couchtisch, auf dem sich Stoffmuster und Entwürfe der neuen Herbst-Winter-Kollektion 1963/64 stapelten, mit denen die Firma auch die west- und ostdeutschen Athletinnen und Athleten für die Winter-Olympiade ausstattete. Auf dem Schreibtisch sah Charlotte Farbstifte in der Ablage des Posteingangs liegen, eine leere Kaffeetasse stand auf einem aufgeschlagenen Zeichenblock. Auf einem langen Kleiderständer neben der Tür reihten sich Anoraks mit dem bekannten B am Reißverschluss aneinander.
»Paris setzt gerade auf Lagunenblau und Sonnentöne«, sagte Maria, die Charlottes Blick gefolgt war. »Ich kombiniere die Farben in dieser Saison mit klassischen Norwegermustern und lasse Anregungen einfließen, die ich letztes Jahr aus dem Hunza-Tal im Himalaja mitgebracht habe. Unser Willy hat dort seinen ersten Film gedreht.«
»Ich habe in der Zeitung gesehen, wie groß er geworden ist. Und Michael und Rosemarie sind auch schon erwachsen. Wie haben Sie das nur geschafft, drei Kinder und die Arbeit unter einen Hut zu bringen?«
»Mit etwas Tatkraft und viel Unterstützung.« Maria deutete zu dem Kleiderständer hinüber. »Was halten Sie von den neuen Entwürfen, Charlotte?«
»Darf ich die denn überhaupt schon sehen?«
»Nein, aber ich hoffe, dass Sie heute noch Ihren Arbeitsvertrag bei mir unterschreiben. Dann gehören Sie wieder zur Familie, und Ihre Verschwiegenheit ist uns gewiss.«
»Sie haben am Telefon gesagt, dass Sie eine Sekretärin suchen, die Sie auch außerhalb des Büros unterstützt?«
»Richtig. Ich brauche jemanden, der das Büro im Griff hat und mir bei den Vorbereitungen der Modenschauen zur Hand geht, wenn die Einkäufer kommen. Hotels und Restaurants bucht und zur Not auch mal eine Kollektion ins Fotostudio bringt oder mich auf eine Reise begleitet.«
»Ich verstehe.«
»Mein Mann kümmert sich nach wie vor um den kaufmännischen Bereich, aber oft genug überschneiden sich unsere Aufgabenfelder auch. Dann werde ich aus einer Besprechung für den neuen Katalog in die Näherei gerufen und habe gleichzeitig unseren US-Vertreter am Telefon.«
»Das klingt nach Überstunden«, meinte Charlotte.
»Ist das ein Problem? Wegen Ihres Sohnes?«
»Ich müsste mit seiner Großmutter sprechen, ob sie ihn vom Kindergarten abholen kann, wenn ich später nach Hause komme.«
Charlotte hatte ihre Pläne, wieder in der Modebranche zu arbeiten, bereits mit Käthe besprochen, aber da hatte sie noch gedacht, dass sie feste Bürozeiten haben würde, und von Reisen war nicht die Rede gewesen. Es klang wunderbar – und schien unmöglich.
»Dann würde ich sagen, ich führe Sie noch ein wenig herum und mache Ihnen die Sache schmackhaft. Es reicht mir, wenn Sie mich in den nächsten Tagen anrufen und mir Ihre Entscheidung mitteilen.«
»Ja, sehr gern.«
Kurz darauf schritt Charlotte fast traumwandlerisch an Marias Seite durch die Ateliers, das gewaltige Stofflager, den Zuschnitt und die Näherei, in der in Schichten gearbeitet wurde. Die ganze Firma war ein einziger summender Bienenstock, selbst jetzt am frühen Abend noch.
»Wir könnten doppelt so viel verkaufen«, erklärte Maria, »aber den Ausbau überlassen wir der nächsten Generation. Mein Mann und ich wollen uns vom Erfolg nicht auffressen lassen, es ist gut so, wie es ist.«
Als Charlotte später wieder zu ihrem Wagen zurückging, nahm sie sich vor, in Hebertshausen noch auf dem Friedhof vorbeizuschauen. Wann immer sich in ihrem Leben etwas Besonderes ereignete – Peters erstes Wort, seine ersten Schritte oder sein erster Tag im Kindergarten –, erzählte sie es Hans und suchte nach einem Zeichen, dass er sie hörte und bei ihr war. Im Wind, der über ihr Gesicht streifte, einem Schneeglöckchen, das gerade aufblühte, oder dem letzten Abendlicht.
Stay, little valentine, stay. Each day is Valentines day.
Leni fand ihren Bruder in ihrem Baumhaus wieder, in der alten Schule auf dem Weinberg, am Herzogweiher und entlang der Amper. Überall dort, wo sie als Kinder gemeinsam gewesen waren, doch der Mann, in den Charlotte sich verliebt hatte, hatte sich längst woanders zu Hause gefühlt. In den geselligen Runden seiner Münchner Vermieter, im Kreis der Schwabinger Bohème, in den Jazzclubs und ihren Armen.
Wenn Leni und ihre Mutter die Weihnachtslieder hörten, die Hans für sie auf seiner Trompete gespielt hatte, war er bei ihnen, aber Charlotte sah nur seinen leeren Trompetenkoffer auf dem Buffet der guten Stube stehen, weil Käthe ihm seine Trompete in den Sarg gelegt hatte. Ihre Erinnerungen wohnten an anderen Orten: im Club Cubana, in dem sie sich zum ersten Mal begegnet waren, an der alten Sternwarte, wo er sie geküsst hatte, oder mehr noch in Sasas Wohnung, ihrem heimlichen Liebesnest hinter den grünen Türen.
Eine Angestellte, die Charlotte noch von früher kannte, brachte den Kleiderständer aus Marias Büro in die Schneiderei hinüber; sie musste den Lastenaufzug genommen haben. Über den Anoraks hing jetzt ein Nesseltuch, wie Fotomodelle es über den Kleidern neuer Kollektionen trugen, wenn sie aus ihren Kabinen kamen, in denen sie sich schminkten, und auf dem Weg zu ihrem Fototermin eine Straße oder einen öffentlichen Platz überqueren mussten. Die Angst, kopiert zu werden, war bei den französischen Modeschöpfern so groß, dass ihre Kreationen in den ersten drei Wochen nach den Schauen nur in Ateliers, versteckten Hinterhöfen oder Privathäusern fotografiert werden durften und die Bilder erst erschienen, wenn die Einkäufer ihre Bestellungen aufgegeben hatten. Redakteure, die gegen diese Sperrfrist verstießen, wurden aus der Chambre Syndicale de la Couture Parisienne ausgeschlossen und für die nächste Saison gesperrt. Eine Katastrophe für jedes Blatt und ein absoluter Ehrverlust. Doch auch hier im beschaulichen München achteten die Modehäuser darauf, dass keine Details durchsickerten. Die Farben und Stoffauswahl, die Rocklängen oder auf welcher Höhe in diesem Herbst die Taille saß, all das blieb ein wohl gehütetes Geheimnis.
Lagunenblau und Sonnentöne, dachte Charlotte und fühlte sich privilegiert, einen Blick in die Zukunft erhascht zu haben.
Der Mann, der ihr vorhin die Tür aufgehalten hatte, kam aus dem Gebäude, eine Zigarette zwischen den Lippen. Charlotte stieg in ihren Wagen. Sie drehte den Zündschlüssel um, als der Fremde gerade seine Limousine aufsperrte – ein weißes BMW V8 Cabrio – und das Leiern ihrer Zündung ihn auf sie aufmerksam machte. Sie versuchte noch einmal, ihren Wagen zu starten, aber er sprang nicht mehr an. Der Mann klopfte an ihr Seitenfenster, und sie kurbelte es herunter. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
»Sind Sie auch Mechaniker?«
»Entriegeln Sie Ihre Motorhaube, dann finden wir es heraus.«
Was soll ich nur tun, wenn der Wagen kaputt ist, fragte sie sich. Ihn abschleppen lassen? Aber wie würde sie denn dann nach Hause kommen? Sie sah auf ihre Uhr, es war schon nach sieben. Käthe hatte Peter längst vom Kindergarten abgeholt, und Leni kam auch jeden Moment heim.
»Versuchen Sie es noch einmal«, sagte der Mann, und Charlotte drehte den Zündschlüssel erneut um. Diesmal sprang ihr Wagen an. Er ließ die Motorhaube zufallen und kam zu ihr.
»Woran hat es denn gelegen?«, fragte sie.
»Ein loser Draht am Zündverteiler.«
»Danke, Sie haben mir das Leben gerettet.«
»Wie erfreulich, das steigert meine Aussicht auf ein hohes Alter.«
»Inwiefern?«
»Sagt nicht ein chinesisches Sprichwort: Wer ein Leben rettet, fügt seinem zehn Jahre hinzu?«
Hans hat zwei gerettet, dachte Charlotte bitter, und nichts dafür bekommen, nicht einen einzigen Tag! Denn als er am fünfundfünfzigsten Geburtstag seiner Mutter, kurz vor Peters Geburt, mit dem Tourbus verunglückt war, hatte er zwei seiner Bandkollegen noch an Ort und Stelle medizinisch versorgt und war dann seinen Verletzungen erlegen. Ein unerträglicher Gedanke, der sie an Stellen berührte, die immer noch wund waren.
»Habe ich etwas Falsches gesagt?«, fragte ihr Gegenüber erschrocken. »Sie sehen auf einmal so ernst aus.«
»Das ist nicht Ihre Schuld.«
»Wie ist Ihr Vorstellungsgespräch gelaufen?«
Der Motor ihres Wagens lief noch. Charlotte stellte ihn ab. »Gut«, sagte sie, »ich bekomme die Stelle. Ich weiß nur noch nicht, ob ich zusagen kann.«
»Eine andere Verpflichtung?«
»Ja, eine familiäre.« Charlotte bemerkte, dass er nach einem Ehering an ihrem Finger suchte, doch sie trug Handschuhe.
»Ich verstehe. Das ist schade. Zumindest für mich.«
Sie bedankte sich noch einmal und verabschiedete sich. sie startete ihren Wagen erneut und fuhr vom Parkplatz. Im Rückspiegel sah sie, wie der Mann ihr nachsah. Öffentlichkeitsarbeit, überlegte sie. Hatte die Firma jetzt eine eigene Presseabteilung?
*
Warum hatte er sich ihr nicht vorgestellt? Und sie nicht nach ihrem Namen gefragt? War sie verheiratet? Und was hatte er gesagt, dass sie plötzlich so ernst geworden war, ja, fast traurig? Was?
Walter versuchte, sich zu erinnern und zu verstehen, was bei dieser Begegnung auf dem Parkplatz mit ihm passiert war. Warum er beim Anblick der jungen Frau das Gefühl gehabt hatte, ein Fotoalbum aufzuschlagen, in dem Bilder klebten, die ihm seltsam vertraut vorkamen, so als hätte er sie selbst gemacht. Auf dem Weg in sein Atelier, das er sich unter dem Dach eines Jahrhundertwendebaus mit schmucken Türmchen in der Münchner Altstadt eingerichtet hatte, überquerte er den nächtlichen Viktualienmarkt und sprach in Gedanken wieder mit ihr.
Ein Vorstellungsgespräch? – Ja. – Mannequin? – Bürokraft. – Verschwendung!
Dort, wo den ganzen Tag über zwischen den festen Marktständen und gestreiften Schirmen der mobilen Händler, die Obst, Gemüse und Fisch, Blumen, Käse und Wildspezialitäten feilboten, hektische Betriebsamkeit herrschte, war jetzt Stille und nur noch das Plätschern der Brunnen zu hören. Walter umrundete die Fischhalle, sperrte die Haustür auf und nahm die Treppe. Der Aufzug mit den schwergängigen Scherengittern hätte sämtliche Bewohner aus dem Schlaf aufgeschreckt. Oben angekommen ging er direkt zu seinem Leuchttisch hinüber und sah sich dort die Farbdias von Suzy Parker an, die sein Assistent heute noch kurz vor Feierabend für ihn entwickelt hatte.
Das höchstbezahlte Fotomodell der Welt, das fünfhundert Mark in der Stunde verdiente, hatte letzte Woche auf Vulcano in der schwarzen, schwefelgeschwängerten Vulkanlandschaft vor Walters Kamera Kreationen eines Mailänder Modeschöpfers präsentiert, die Diana Vreeland, frischgebackene Chefredakteurin der amerikanischen VOGUE, in ihrer Juni-Ausgabe auf zwölf Seiten zeigen wollte. Eine überraschend innovative Frühjahrskollektion mit gewagten Farbkombinationen und ein Auftrag, der Walter in den Olymp der internationalen Modefotografen katapultieren könnte. In eine Reihe mit Richard Avedon, der als einer der Ersten die Haute Couture nicht mehr im Studio, sondern an den ungewöhnlichsten Orten in Paris fotografiert hatte. Sein Bild im Cirque d’Hiver, auf dem das zarte Modell in einer DIOR-Kreation zwischen zwei Elefanten posierte, war legendär! Doch um mit einem wie ihm gleichzuziehen, musste Walter Diana erst mit seiner ganz persönlichen Handschrift überzeugen, seinem Einsatz von Farbfiltern, langen Brennweiten und seiner kreativen Lichtgestaltung.
Er betrachtete die Dias durch ein Vergrößerungsglas und machte sich Notizen. Kleinste Retuschen würden nötig sein, ehe er die Fotos über den großen Teich schickte, das war ihm schon auf den Kontaktbögen aufgefallen, aber nicht an ihr. Suzys zarte weiße Haut war makellos und ihr rotes Haar vor dem dunklen Hintergrund atemberaubend. Mit einem Meter siebenundsiebzig hatte sie ein Gardemaß, und Walter wusste, wie streng sie auf ihre Figur achtete, weil die Kamera immer zehn Pfund mehr aufs Bild mogelte.
Fotomodelle hatten groß und überschlank zu sein, wohingegen die Pariser Couturiers zurzeit kleine Mannequins bevorzugten: winzige, grazile Japanerinnen, gertenschlanke Nordländerinnen oder exotische Eurasierinnen. Die jungen Damen kamen heute aus den besten Kreisen, der Beruf war gesellschaftsfähig geworden.
Das hier, das mit der Andeutung eines Lächelns, werde ich nehmen, beschloss er. Da hatte er irgendetwas über Suzys bevorstehende Hochzeit gesagt, und ihre blauen Augen hatten wie ein Schwarm Sternschnuppen aufgeleuchtet. Und das mit der Sonnenreflexion kam auch in die engere Wahl. Was für ein Licht!
Das Wetter hatte ihnen drei perfekte Tage beschert, aber es war noch ziemlich kalt auf der Insel gewesen. Die ganze Crew hatte sich in Mäntel gehüllt, während Suzy die luftigen Kleider mit der ihr eigenen Extravaganz ohne das kleinste Zittern präsentiert hatte.
Bei ihr stimmt einfach jede Pose, dachte Walter und glaubte, die giftigen Dämpfe, die ihnen in dieser bizarren Welt malerischer Einsamkeit die Sinne benebelt hatten, noch immer zu riechen und das Brodeln des Meeres zu hören, das an manchen Stellen regelrecht kochte. Wasserdampf, beißender Qualm und grüngelbe Schwefelakzente auf archaisch rauem Gestein.
Als er Diana die Insel für die Aufnahmen vorgeschlagen hatte, war sie sofort begeistert gewesen, denn sie liebte Kontraste und lebte sie selbst. Walter kannte keine Frau, die mehr Schönheit erschuf und Eleganz verströmte als sie, obwohl sie optisch von der Natur nicht eben bevorzugt worden war.
Seine Augen brannten, er hatte die letzten Nächte kaum geschlafen, aber das hatte nichts mit diesem Auftrag zu tun, vielmehr mit dem gestrigen Datum, dem dritten April. Sein Vater hatte Geburtstag gehabt, es war sein fünfundsiebzigster gewesen, doch Walter war nicht nach Hause gefahren. Er hatte sich mit seiner Arbeit entschuldigt und nur ein kurzes Telefonat mit ihm geführt, in dem er ihm von den Aufnahmen auf den Liparischen Inseln erzählt und über Bewegungsunschärfen gefachsimpelt hatte.
Seit Walter nach dem Krieg von Berlin nach München gezogen war und dort an der Bayerischen Staatslehranstalt für Lichtbildwesen studiert hatte, entfremdeten sie sich immer mehr, auch wenn sie ihre gemeinsame Zeit in Goebbels’ Propagandakompanie für immer verband. Die zwei Jahre, sieben Monate und drei Tage, in denen Walter das Abzeichen der SS am Kragen getragen und Hitler persönlich auf Zelluloid gebannt hatte – die kleinen Gesten des Führers, wenn er Bormanns Kindern die Köpfe getätschelt oder mit seinen Hunden gespielt hatte, so menschlich und nahbar, wie kaum ein anderer Fotograf ihn je gezeigt hatte.
Walter war mit seinem Vater während des Krieges quer durch Europa gereist. Er hatte mit ihm den Zustand von Wehr- und Befestigungsanlagen dokumentiert und als Kriegsberichter für die Wochenschau den Vorstoß am Westwall gefilmt. Hatte dezimierte Verbände zu Kolonnen anwachsen lassen und den Endsieg heraufbeschworen. Allerdings konnte niemand das deutsche Heldentum besser verkaufen als der Wochenschausprecher Harry Giese mit seiner markanten Stimme, die heute keiner mehr hören wollte. Der Mann lebte jetzt von den Einkünften seiner Frau.
»Wir haben deine Fotos gesehen, die du in Longchamp gemacht hast«, hatte seine Mutter zu ihm gesagt, als sein Vater ihr den Hörer weitergereicht hatte, »in der CONSTANZE.«
Und darunter hatte wie immer Walters Pseudonym gestanden, sein Künstlername, unter dem er in der Modebranche bekannt war – Walter Marquart –, der Mädchenname seiner Mutter.
»Wann warst du in Paris, Schatz?«
»Im Januar, als die Frühjahrskollektionen vorgestellt worden sind, wie immer.«
Die neuesten Modelle der Haute Couture, edelste Schneiderkunst, die er nur in der französischen Hauptstadt vor die Linse bekam, weil er sonst vor allem Markenmode fotografierte, bei der es auf die »Knopfloch-Schärfe« ankam, auf das schnöde Abbilden von Details.
»Ja, wie immer«, hatte seine Mutter wiederholt, und er hätte so gerne in die Stille hinein, die jedes Mal entstand, wenn sie miteinander telefonierten, gesagt, dass er sie liebe und sie ihm fehle.
»Ich muss weitermachen, Mutter, wir hören uns.«
»Ja, natürlich, Schatz.«
»Und sehen uns im Sommer.«
»Ich weiß.«
Zweimal im Jahr, im ausgehenden Winter und im Sommer, kam Walter auf der »Großen Durchreise« anlässlich der Verkaufsschauen der Berliner Textilindustrie in die Stadt, in der er vor neununddreißig Jahren geboren worden war – im heutigen britischen Sektor. Und bei der Gelegenheit besuchte er dann seine Eltern, die dort nach wie vor lebten. Ein gemeinsames Essen, oberflächliche Gespräche, aber nichts, was an der Vergangenheit rührte. Kein Wort über die Zeit im Internierungslager, die Walter nach seiner Entlassung veranlasst hatte, seinen Namen zu ändern, oder das Berufsverbot, mit dem sein Vater belegt worden war.
In dem kleinen Fotoladen am Tiergarten, den dieser daraufhin aufgemacht hatte, kauften noch immer die alten Parteigenossen ein, und die schillernde Leni Riefenstahl hatte auch vorbeigeschaut.
Damals hatte sie Walters Vater ein Foto geschenkt, das ihn mit ihr bei den Dreharbeiten zu Olympia zeigte, dem opulenten Werk über die elften Olympischen Sommerspiele in Berlin – »Zur Ehre und zum Ruhme der Jugend der Welt«. Die Riefenstahl in heroischer Pose und sein Vater mit der Bolex im Anschlag. Mein lieber Fritz, das waren noch Zeiten – wunderschön hatte sie an den Rand geschrieben, und sein Vater hatte das Foto gerahmt.
Walter sah ihn noch vor sich, wie er sich mit dem Geld, das er mit dieser Produktion verdient hatte, ein Hanomag Sturm Cabriolet gekauft hatte, in dem er stolz durch Berlin kutschiert war. In Uniform, im Rang eines Sonderführers, und später als Leutnant der Luftwaffe.
Die Turmuhren der Peterskirche und Heilig-Geist-Kirche schlugen zur vollen Stunde, es war Mitternacht. Walter würde noch ein paar Stunden dranhängen, die Ruhe im Atelier ausnutzen und sich später hinlegen, bis Rita für die Aufnahmen der Taschenkollektion ins Atelier kam. Er hatte die Präsentation bereits mit seinen Leuten besprochen, Wilhelm, sein Kamera-Assistent, konnte das Set für ihn einleuchten – neutraler Hintergrund, das Modell statisch.
Es würde für Rita keine große Herausforderung sein, die Posen zu halten, denn wie alle Fotomodelle verfügte auch sie über die Disziplin einer Zirkusartistin. Sie war zäh wie ein alter Kutterkapitän und hatte trotz ihrer grazilen Gestalt die Konstitution eines Maultiers, das nur hin und wieder mit ein paar Salatblättern und etwas Lob gefüttert werden musste. Seinem Lob und seiner Zuwendung, die über das Berufliche hinausgingen.
Walter sah durch sein Vergrößerungsglas und setzte einen weiteren Haken an den Bildrand eines Dias. Bisher hatte er nur für deutsche und italienische Magazine gearbeitet – doch jetzt würden seine Fotos auch in einer internationalen Illustrierten erscheinen, der Schnittstelle von Modefotografie und Fotokunst. Unter seinen deutschen Kollegen hatte höchstens eine Handvoll diesen Quantensprung der Ästhetik geschafft.
Er betrachtete Suzy, und ihm kam die junge Frau wieder in den Sinn, die er bei Bogner getroffen hatte, wo er mit Willy über die Aufnahmen des neuen Herbst-Winter-Katalogs gesprochen hatte. Ihr scheuer, fast schon verlorener Blick ging ihm nicht mehr aus dem Kopf.
Danke, Sie haben mir das Leben gerettet.
Wer ein Leben rettet, fügt seinem zehn Jahre hinzu.
Richtig, das war es gewesen, mit diesem Satz hatte er ihr Lächeln ausgeknipst wie eine seiner Studiolampen. Sie hatte ihn in dem Moment an Eva Braun erinnert, wenn sie ihre selbst gewählte Rolle als lebensfrohe Geliebte des Führers für einen Augenblick vergessen und mit leerem Blick auf der Sonnenterrasse des Berghofs gesessen hatte. Einsam, aber niemals allein. Ihre Begeisterung für das Filmen und die Fotografie hatte sie einander nähergebracht, aber mehr war da nicht gewesen. Wie auch?
Walter legte das Vergrößerungsglas zur Seite, ging zum Fenster und sah auf den schlafenden Viktualienmarkt hinunter. Das Licht der Straßenlaternen warf geometrische Schatten. Er mochte diese Stadt, ihre Lebendigkeit und das südliche Flair, die Parks und Cafés und das Nachtleben. München war wie gemacht für einen Junggesellen wie ihn, wenngleich er, seit er auf die vierzig zuging, immer öfter darüber nachdachte, eine Familie zu gründen.
»Die Ehe tötet jegliche Romantik«, hatte Suzy in diesem Hotel auf Vulcano zu ihm gesagt, das eigentlich noch geschlossen gewesen war, da um diese Jahreszeit noch keine Touristen auf die Insel kamen. Und dann hatte sie ihm Fotos von ihrer kleinen Tochter gezeigt – Giorgia, ein blond gelockter Engel – und gemeint: »Trotzdem versuche ich es immer wieder. Die Kleine braucht doch einen Vater.«
In dieser Nacht hatte er mit ihrem Make-up-Mädchen geschlafen, einer biegsamen Britin, an deren Namen er sich nicht mehr erinnerte, und davon geträumt, ein anderes Leben zu führen. Aber das ständige Reisen war nicht gerade die beste Voraussetzung für eine Ehe und dass er für ein gutes Bild alles riskierte. Da lehnte er sich schon mal ungesichert aus einem Hubschrauber mit ausgebauter Tür oder wagte sich gefährlich nah an Lavaströme. Und wenn er in seinem Wagen mit hundertsechzig Sachen über die Autobahn fegte, genoss er den Adrenalinrausch.
Walter lächelte, wenn er an seinen V8 dachte. Zwanzigtausend Mark hatte er gekostet, aber das war er wert, denn der V8 war sein Hanomag Sturm, das Zeichen seines Erfolgs.
Vielleicht hätte er seiner Mutter davon erzählen sollen, von seinem Wunsch, die richtige Frau zu finden, eine, die ihm etwas bedeutete. Sicher hätte sie sich darüber gefreut. Aber wie konnte er eine Zukunft planen, solange er seine Vergangenheit in einem Koffer versteckte und sich selbst hinter dem Namen seiner Mutter?
3
Leni und Charlotte kamen an diesem Sonntagmorgen gleichzeitig über die knarzende Treppe herunter, um das Frühstück herzurichten, aber der Tisch war schon gedeckt. Im Brotkorb lagen frische Semmeln und Brezen, und Kaffeeduft zog durchs Haus.
»Wann bist du denn aufgestanden?«, fragte Leni ihre Mutter, die Peter gerade eine Tasse Kaba hinstellte. Er saß mit seinem Bobbi-Bären, der sich vor lauter Liebe schon auflöste, auf der Bank unter dem Fenster auf den Kräuterbüchern der Landmann-Oma und zupfte an seinem Hemdkragen herum, als seine Großmutter ihm seinen Latz umband.
»Um halb sechs«, sagte sie und strich sich die Kittelschürze über ihrem Sonntagsgwand glatt.
»Hast du die Oma wieder geweckt?«, wollte Charlotte von Peter wissen und drückte ihm einen Kuss auf.
Er roch nach Lenis Rosenseife, gestern war Badetag gewesen, und Leni hatte ihn in der Zinkwanne ordentlich abgeschrubbt. Seine wilden blonden Haare waren jetzt gescheitelt und mit der selbst gemachten Frisiercreme ihrer Mutter gebändigt.
»Er wollt unbedingt der Erste beim Schaller sein«, erklärte diese und setzte sich zu ihrer Familie an den Tisch. In einer Vase neben dem Brotkorb standen Osterglocken.
»Sind die aus unserem Garten?«, fragte Leni und sah aus dem Fenster. Es würde ein milder Frühlingstag werden.
»Ja«, erwiderte ihre Mutter, »und die Primerl blühen auch schon. Ich setz heut den Salat ins Beet raus.«
»Mama, streichst du mir den Honig?«
Peter legte Charlotte eine Semmel auf den Teller, und sie griff nach dem Buttermesser.
»Das sieht heute alles so festlich aus«, staunte sie. »Ostern ist doch erst nächste Woche.«
»Wir ham aber heut schon was zum Feiern«, entgegnete Lenis Mutter. »Etwas, des ich euch erzählen will, bevor wir in d’Kirch gehen und der Schorsch nachher kommt.«
Dass Schorsch sich seit fast zwanzig Jahren immer am ersten Sonntag im Monat in den Zug nach Murnau setzte, wo seine Tante, die Schwester seines Vaters, lebte, hatte Leni lange nicht gewusst, doch seit er Peters Patenonkel war, begleiteten Charlotte, Peter und sie ihn öfter dorthin. Schorsch streifte dann mit ihrem Neffen durchs Murnauer Moos und spürte Smaragdlibellen, Feuerfalter und seltene Käfer mit ihm auf, Kreuzottern, Eidechsen und schnarrende Kröten. Die weiten Streuwiesen und abgelegenen Hochmoore, in denen Schwertlilien und Wollgras wuchsen, das Peter »Sommerschnee« nannte, waren wie gemacht für ihre Expeditionen und die vielen kleinen Badebuchten des Staffelsees das reinste Sommerparadies.
»Mehr!«, rief Peter jetzt und deutete auf das Honigglas.
»Du Schleckermaul!« Charlotte tauchte den Löffel erneut ein.
»Noch mehr, Mama, bitte!«
»Na gut. Aber dann lässt du die Oma ausreden. Sie will uns nämlich etwas erzählen.«
»Ich weiß es schon«, sagte Peter, grinste und biss in seine Semmel. Der Honig lief ihm über die Hand und tropfte auf seinen Latz. Lenis Mutter griff nach einem Spültuch, beugte sich über den Tisch und wischte seine Hand ab. Seit Peter auf der Welt war, hatte Leni das Gefühl, sie nur noch mit Servietten, Geschirr- und Taschentüchern hantieren zu sehen, im vergeblichen Versuch, ihren Enkel und seine Kleider länger als eine halbe Stunde sauber zu halten.
»Du weißt es also schon?«, fragte Leni ihren Neffen, und der nickte heftig.
»Ich hab noch amal über deine neue Stell nachgedacht, Charlotte«, erklärte ihre Mutter, »und mit der Vevi drüber g’sprochen.«
Als Charlotte am Donnerstag von ihrem Vorstellungsgespräch zurückgekommen war und von den Überstunden erzählt hatte, die sie bei Bogner würde machen müssen, hatte Lenis Mutter ihr zugeredet, die Stelle trotzdem anzunehmen.
»Wennst’ as net rechtzeitig zum Kindergarten schaffst, rufst mich halt im Salon an«, hatte sie ihr angeboten, denn auch dort gab es mittlerweile ein Telefon, »dann spring ich schnell rüber und nehm den Peter mit ins G’schäft.«
»Und was ist mit deinen Kunden? Du kannst doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen«, hatte Charlotte zu bedenken gegeben.
»Geh, die paar Minuten, und die Vevi is ja auch noch da.«
»Aber stört euch Peter denn nicht bei der Arbeit?«
»Die Leni und der Hans sind früher auch oft bei mir im Salon g’wesen.«
»Und wenn er krank wird? In seinem Alter haben Kinder ständig irgendwas.«
Husten und Schnupfen, Windpocken, Masern und Mumps oder, Gott bewahre, Schlimmeres, hatte Leni gedacht und Charlottes Bedenken geteilt, aber ihre Mutter hatte sie schnell zerstreut: »Des find sich scho alles, da helf ma halt zamm.«
»Und ich hab beschlossen«, fuhr sie jetzt feierlich fort, »dass ich im Juni, wenn die Charlotte beim Bogner anfängt, den Salon übergeb und mich nur noch um den Haushalt und die Familie kümmer.«
Endlich, dachte Leni erleichtert, endlich ist es so weit, denn sie redete nun schon seit Jahren auf ihre Mutter ein, sie möge kürzertreten. Erst recht, seit sie den Herzanfall gehabt hatte. Trotzdem schien Leni die Sache nicht ganz so einfach zu sein.
»Darf Vevi den Salon denn überhaupt führen?«, fragte sie. »Sie hat ja ihren Meistertitel noch gar nicht.«
»Nein, die Vevi nicht, aber du.«
»Was? Ich?« Leni war wie vom Donner gerührt.
»Du wolltest dich doch schon immer selbstständig machen«, sagte ihre Mutter.
»Aber nicht hier. Ich wollte einen Salon in München!«, protestierte sie.
»Es is net verkehrt, wenn ma klein anfängt.«
Leni wäre am liebsten vom Tisch aufgesprungen. Wie konnte ihre Mutter sie nur mit einer solchen Ankündigung überfallen?
»Schon, aber nicht so