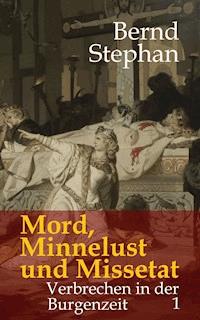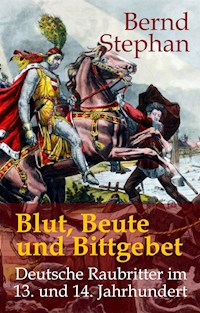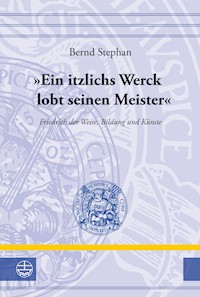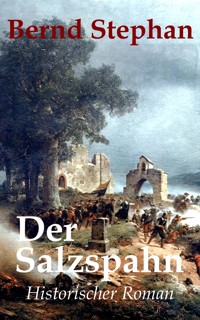
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Salzspahn-Saga
- Sprache: Deutsch
Anno Domini 1626. Gewalt, Grausamkeit und Raffgier herrschen im Erzstift Magdeburg. Das Land erstickt im Würgegriff der kaiserlichen Soldateska. Wer in diesen Zeiten unterwegs ist, lebt gefährlich. An den Landwegen lauert Raubgesindel auf Beute. Dennoch begibt sich Berthold Stahm auf den Weg nach Calbe, um zwei Wagenladungen Staßfurter Salz in die Saalestadt zu schaffen und Brennholz in seinen Herkunftsort zurückzubringen. Beides ist für den heimischen Salinenbetrieb lebensnotwendig. Auf dem Rückweg geschieht es: Räuber überfallen die Frachtwagen. Doch die Wegelagerer überschätzen ihr Drohgehabe. Denn der Salzspahn verfügt über eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass die Strauchdiebe in Panik davonstieben. Weder seine besondere Gabe noch der vorgewiesene Schutzbrief helfen dem Salzspahn hingegen, als er bald darauf in die Fänge eines kaiserlichen Dragonertrupps gerät. Willkürlich requiriert deren Anführer seinen vierspännigen Frachtwagen mit dem Geheimversteck. Letzthin dreht Berthold dem Leutnant doch eine Nase. Noch ahnt er allerdings nicht, wie schicksalhaft diese Begegnung für ihn sein wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Personen
Historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet.
DIE PFÄNNER
Bernhard von Werdensleben*: Pfänner, zeitweise Bürgermeister von Staßfurt
Erhard von Legat*: ebenso
Valentin von Halcke*: ebenso
Hans Heinrich von Schladen*: Pfänner, Oberhaupt der Schladen-Familie
Wilke von Schladen*: sein älterer Sohn, Kämmerer
Albrecht von Schladen*: sein jüngerer Sohn, Ratsherr
Wolf Christoph von der Tanne*: Pfänner, Stadtvogt
Margarethe von der Tanne*: seine Ehefrau
Agnes Marie von der Tanne*: ihre Tochter
Christian von der Tanne: ihr Sohn
Reichard von Zink*: Pfänner, Ratsherr
Werner von Biedersee*: Pfänner, Ratsherr
Joachim von Angern*: Pfänner, ehemals Ratsherr
Sidonia von Maltitz: Pfännerwitwe
Gesa: ihre Zofe
Augustin: Diener der Pfännerwitwe
DER KLERUS
Jakob Möser*: Pfarrer in Staßfurt
Ottilia Möser: seine Ehefrau
Petrus Wilhelmi*: Pfarrer in Altstaßfurt
OBRIGKEIT UND KRIEGSVOLK
Johann von Aldringen*: Obrist im kaiserlichen Heer
Wolf Leonhard Föckler*: Offizier im Regiment Aldringen
Wolf Friedrich von Trotha*: Gutsherr auf Hecklingen, Schkopau und Teutschenthal
Martha von Trotha*: seine Ehefrau
Hans Caspar von Trotha*: sein jüngerer Bruder, kaiserlicher Offizier
Nikolaus (Niklas) Bock*: kaiserlicher Offizier
Daniel Knorre*: ebenso
Wolf Stoltze*: ebenso
Johann Schulze*: ebenso
Sebald Rallinger: Aldringens Adjutant
Petko Wolinsky: Wachtmeister
Rudwin Fernau: Korporal
Wenzel Ladvo: Dragoner
Pipo Hludek: Dragoner
Arbo von Griesheim: Offizier im Regiment Maschwitz
Nikodemus Uthsam: Profos im Regiment Aldringen
SALZSPAHNE UND SALZGÄSTE
Berwald Stahm: Salzspahn in Staßfurt
Irmgard Stahm:seine Ehefrau
Berthold Stahm: ihr älterer Sohn, Salzspahn
Bernward Stahm:ihr jüngerer Sohn
Bertha (Beke) Stahm:ihre Tochter
Wilm Pollner: Fuhrmann
Gernot Winscheffel: Fuhrknecht
Hatto Kessbrink: Stallknecht
Tilde: Hofmagd
Diebold Hollberg: Salzspahn in Staßfurt
Hedwig Hollberg: seine Ehefrau
Vinz Hollberg: ihr Sohn
Rochus Emmen: Salzspahn in Staßfurt
Linhard Pfoell: Salzgast aus Calbe an der Saale
Gerlind Pfoell: seine Tochter
ANDERE
Ambrosius (Ambros) Queslaub: Wirt in Staßfurt
Klara: Schankmagd
Jeremias Dühlbach: Stadtschreiber
Elslin Braunwerg: Kötgerwitwe
Rutger Leinbogen: Stadtknecht
Meta: Wirtin in Altstaßfurt
Gabriel Hormuth: Mühleninhaber, genannt Bodemüller
Kilian: Mühlbursche
Tile Quast*: Schwager des Bodemüllers
Agnes*: Kräuterfrau
Hans Wefeling*: Halbspänner
Heinrich Glockmann*: Spannbauer
Jochen Grüttge*: Flussfischer
Hermo Purath: Kossat
Utz Lohagen: Pfannenschmied
Henning Walther: Schmied
Utz Riecke: Spitzspänner
Prolog
Elbbrücke Dessau, April 1626
Im Morgengrauen ging es los.
Plötzlich erfüllte ein ohrenbetäubendes Krachen, Wummern und Fauchen die Luft, als sei ein Unwetter über die Elblandschaft hereingebrochen. Die in den Feldschanzen aufgestellten Geschützbatterien, die der kaiserlichen Redoute gegenüberlagen, eröffneten das Gefecht.
Pulverqualm trieb in dunklen Schwaden nach allen Seiten und vermischte sich mit dem Frühdunst, der von den Uferbereichen aufstieg. Vierundzwanzigpfündige Eisenkugeln heulten auf die Redoute zu, erste Treffer hieben in das Schanzwerk.
In der Verteidigungsanlage durchschnitt der gellende Ton einer Trompete den Geschützlärm und signalisierte Alarm. Einen Augenblick später glich die Redoute einem Hexenkessel, über dem Kanonendonner grollte. Flüche, Schreie, Befehle, Waffenklirren, aufgeschreckte Pikeniere und Musketiere hasteten durcheinander.
Niklas Bock, Hauptmann im Regiment Scherffenberg des habsburgischen Heeres, schwang sich von seinem behelfsmäßigen Lager. Halb schläfrig, halb wach, legte er das Lederbandelier über die Schulter, woran Pulverhorn, Kugelbeutel und das Rapier hingen. Anschließend schnallte er den Leibgurt mit den beiden Lederhalftern um, in denen langläufige Radschlosspistolen steckten, und stülpte sich den Federhut auf den Kopf. Dann stürzte er aus dem Wachzelt.
Draußen kroch ihm die Kälte des Aprilmorgens jäh in die Glieder und vertrieb die letzte Schläfrigkeit. Nun war er hellwach.
Niklas warf einen Blick in die Runde. Landsknechtsgruppen strömten durch den Innenraum der Redoute und besetzten ihre Alarmstellungen. Erleichtert stellte er fest, dass die Leutnants Stoltze und Schulze die Leute der Pikenierkompanie des Regiments Scherffenberg sammelten und dabei waren, die Lanzenträger rottenweise aufzustellen. Daneben formierten Offiziere vom Regiment ihre Pikeniere.
Aus den gegnerischen Feldschanzen setzten die Halbkartaunen und zwölfpfündigen Feldstücke des dänisch-niedersächsischen Heerhaufens den Beschuss der Redoute fort. Kugelladung um Kugelladung spien die Kanonen herüber.
Der Hauptmann sog scharf den Atem ein und ging weiter. Erneut zerschnitt grauenhaftes Fauchen die Luft. Es klang, als ob ein Rudel tollwütiger Wildkatzen vorschnellte. Gewohnheitsmäßig brüllt er ein paar Kommandos.
Niklas konnte die Geräusche der heranheulenden Geschosse inzwischen gut unterscheiden. Die Treffsicherheit der feindlichen Kanonen nahm zu. Einige Geschützkugeln bohrten sich in einer Fontäne aus Holztrümmern und Erde ins Schanzwerk, um eine Bresche für den Angriff der Fußtruppen zu schlagen. Andere schienen den Weg über die Brustwehr der Umwallung gefunden zu haben.
Schlimmer noch: Die widerlichen Geräusche bewiesen, dass es sich bei den Geschossen nicht um Vollkugeln handelte. Es waren Hohlkugeln, gefüllt mit einer Sprengladung. Die Wucht der Explosion würde jeden menschlichen Körper zerfetzen wie fadenscheiniges Leinen, der sich Umkreis von zwanzig Fuß aufhielt.
Sein Kopf ruckte herum. Eine Hohlkugel sauste über ihn hinweg, fegte mit irrem Gekreisch in eine Pikenierkompanie Aldringens und zerriss in feuriger Detonation. Es war, als hätte der Faustschlag eines Giganten die sich formierenden Lanzenträger getroffen und mit Urgewalt zu Boden gestoßen. Eisenstücke flogen in alle Richtungen, Schmerzensschreie ertönen.
Was Niklas sah, erfüllte ihn mit Entsetzen. Mehrere Pikeniere lagen tot oder verwundet auf dem Boden. Ein weiterer Söldner stand in unmittelbarer Nähe der Einschlagsstelle, sein Gesicht war eine grässliche Masse aus Blut, Hirn und Knochensplitter. So verharrte er zwei, drei Atemzüge lang, dann kippte er steif wie ein Brett hintenüber. Anderen Pikenieren floss das Blut aus klaffenden Wunden.
Niklas lief mit verkniffener Miene weiter. Sein Ziel waren die Außenwerke der Befestigungsanlage. Eine zweite Detonation folgte. Wieder gellten die Schreie sterbender und verwundeter Söldner in seinen Ohren.
Als er die Stufen zur Wallkrone hinaufsteigen wollte, schrie Leutnant Knorre ihm von oben zu: „In Deckung, Capitain!“
Niklas fluchte und duckte sich. Fast gleichzeitig schlugen mehrere Eisenkugel mit dumpfem Grollen ins Schanzwerk ein. Trümmerteile wirbelten wie Wurfgeschosse durch die Luft und stürzten wenige Schritte von ihm entfernt zu Boden.
Als die Einschläge etwas abebbten, klomm der Hauptmann den Wall hinauf, wo Daniel Knorre ihn empfing. Unterdessen befanden sich mehrere Rotten der beiden Musketierkompanien des Regiments auf dem Wall.
Trotz der heiklen Lage grinste der Leutnant. „Die Mansfelder hecken wieder irgendwas gegen uns aus, Niklas“, berichtete er. „Wenn der Beschuss so weitergeht, zerhacken sie die Brustwehr zu Kleinholz.“
Daniel Knorre durfte sich eine laxe Haltung gegenüber seinem Hauptmann erlauben. Beide stammten gebürtig aus der Saalestadt Halle und kannten sich seit den Knabenjahren.
„Ich sehe selbst, dass sich etwas zusammenbraut, Daniel“, knurrte Niklas zwischen den Zähnen hindurch. „Also steh mir nicht im Weg, sondern positioniere die Musketenschützen, ja?“ Er trat auf die Bankette vor der Brustwehr, um darüber hinwegzuspähen.
Der Leutnant ging zwei, drei Schritte weiter, blieb stehen und drehte sich noch einmal um. „Sei dennoch vorsichtig, Niklas“, riet er. „Das Schanzwerk ist alles andere als vertrauenswürdig. Wenn die Brustwehr nicht hält, könnte sie eine brauchbare Grabplatte abgegeben.“
Niklas hörte nicht auf ihn, sondern blickte über die Brustwehr hinweg auf die Erdschanzen der dänisch-niedersächsischen Truppen im Vorfeld der Redoute. Die feindliche Streitmacht kommandierte Graf Ernst von Mansfeld, ein illegitimer Spross aus der vorderortischen Linie des verzweigten Adelsgeschlechts.
Wie ein Riesenreptil umschlangen die aufgeworfenen Feldbefestigungen die kaiserliche Redoute, die bei Roßlau am rechten Elbufer einen Brückenkopf bildete. Das vorgeschobene Bollwerk war Teil einer umfassenden Verteidigungsanlage, die Albrecht von Wallenstein, der Generalissimus des kaiserlichen Heeres, zwei Monate zuvor hatte errichten lassen. Hunderte von Sappeuren und Tausende zur Schanzarbeit gezwungene Bauern mussten dafür schuften.
Die Anlage sollte die Passage über Elbe und Mulde sichern. Außer dem Brückenkopf auf dem rechten Elbufer gehörten zwei Redouten am linkselbischen Brückenzugang mitsamt Feldlager und Schanzen an beiden Muldeufern zu den Fortifikationen.
Mit dem Kommando über die Verschanzungen an Elbe und Mulde hatte Wallenstein den Obristen Johann von Aldringen betraut. Als der habsburgische Offizier die Befestigungsanlage bezog, standen ihm zu dessen Verteidigung nur vier Kompanien seines Leibregiments zur Verfügung. Und währenddessen rückte Mansfeld mit einem zwanzigtausendköpfigen Heer am rechten Elbufer gegen den Rosslauer Brückenkopf vor, an Kriegsvolk zu Fuß und zu Ross dem kaiserlichen Detachement zahlenmäßig weit überlegen.
Wenn Johann von Aldringen überhaupt Grund zur Zuversicht hatte, einen massierten Sturmangriff gegen die Elbschanzen abwehren zu können, so beruhte dieser auf die Feuerkraft seiner Arkeley. Denn was die Zahl seiner Geschütze als auch deren Kaliber, Reichweite und Durchschlagskraft betraf, war er dem Feind keineswegs unterlegen. Jedenfalls besaß er nicht nur Halbkartaunen und Feldstücke, sondern verfügte auch über mehrere Batterien schwerer Vollkartaunen.
Was Aldringen im kaiserlichen Heer dagegen fehlte, war die Anerkennung als Offizier. Er galt als Federfuchser und Tributeintreiber. Kaum jemand hielt ihn zu einem Unternehmen wie die Sicherung der Elbschanzen für fähig. Doch er sollte alle schwarzseherischen Zweifler an seiner Eignung Lügen strafen.
Der Versuch Mansfelds, den Elbbrückenkopf im Handstreich zu nehmen, wehrte die Besatzung des Obristen mit Bravour ab. Die Angreifer erschraken geradezu vor der Feuerkraft der gegnerischen Arkeley. Solchen Beschuss hatte sie noch nie erlebt.
Drei Wochen lang behauptete Aldringen schon erfolgreich die Stellung am rechtselbischen Stromufer, verbunden mit täglichem Geschützfeuer und nächtlichen Ausfällen ...
Der Blick des Hauptmanns wanderte von einer mansfeldischen Geschützbatterie zur anderen. Feuerzungen leckten aus den Erdschanzen hervor, anhaltendes Krachen und Grollen, Pulverdampf hüllte die Stellungen der Halbkartaunen und Feldstücke ein.
Zehn Schritte von ihm entfernt orgelten Geschützkugeln ins Schanzwerk der Redoute. Dennoch zog er den Kopf nicht ein.
Während Niklas sich umschaute, ging er in Gedanken noch einmal die Geschehnisse durch, bevor das Regiment Scherffenberg ins Fürstentum Anhalt-Dessau verlegt worden war. Davor hatte die Einheit für die Dauer von vier Monaten in Staßfurt an der Bode ihr Quartier aufgeschlagen.
Wenn es nach ihm, Niklas Bock gegangen wäre, hätte er es dort noch länger ausgehalten. Ja, sowohl er als auch die Leutnants Knorre, Stoltze und Schulze, die im Stadthaus des Ratsherrn von der Tanne einquartiert worden waren, hatten sich in der Salzstadt eigentlich recht wohl gefühlt. Mehr noch: Durch den regen Austausch mit dem Salzpfänner war sogar eine gewisse Vertrautheit zwischen ihnen entstanden, sodass dieser sie zur anstehenden Taufe seines Erbsohns eingeladen hatte.
Mit Johann Ernst Freiherr von Scherffenberg verhielt es sich indes anders. Ihr Regimentsobrist, der beim Bürgermeister von Werdensleben Logis genommen hatte, empfand den Aufenthalt dortselbst schon nach wenigen Tagen alles andere als lohnenswert, weil der Stadtmagistrat seine übermäßige Kontributionsforderung nicht anerkennen wollte. Bald lag er mit den Ratsherren der Bodestadt derart über Kreuz, dass die schmutzigen Redensarten zwischen beiden Seiten beinahe in handfeste Raufereien ausgeartet wären.
So kam dem Österreicher denn Wallensteins Befehl, der Mitte April das Regiment Scherffenberg zur Verstärkung der Elbschanzen nach Dessau beorderte, durchaus gelegen. Aus den Winterquartieren an der Bode rückte er jedoch erst ab, nachdem er den verhassten Ratsherren mit harter Hand zuvor eine Lektion erteilt hatte. Die ergriffenen Maßnahmen gipfelten darin, dass er das Wohnhaus des Salzjunkers von Angern verwüsten sowie die Magistratsmitglieder von Halcke, von Werdensleben und von Legat im Rathaus arretieren ließ, wo sie zwei Wochen lang ausharren mussten.
Niklas Bocks Kompanie stieß gerade rechtzeitig zur kaiserlichen Besatzung am Elbübergang, um mit anzusehen, wie sich Mansfelds Truppen zu einem weiteren Ansturm auf den Brückenkopf formierten. Sofort unterstützten sie Aldringens Leute nach Kräften und halfen mit, den Angriff abzuwehren. Das war vor vier Tagen gewesen.
Der Hauptmann presste die Zähne aufeinander. Trotz des Erfolges über die Truppen des Dänenkönigs und des Niedersächsischen Kreises dachte er an das Gefecht mit Unbehagen zurück. Habe ich durch die Teilnahme an diesem Kampf, grübelte er, all das verraten,was mich mit meinen Wurzeln und meiner Herkunft verbindet? Habe ich gemeinen Landesverrat begangen?
Nicht nur er selbst, sondern alle aus dem Erzstift Magdeburg stammenden Angehörigen der kaiserlichen Regimenter wussten, dass sie bei zu erwartenden Gefechten auf Landsleute treffen würden. Denn dass in Mansfelds Heerhaufen sich auch ein neu angeworbenes Regiment aus ihrer Heimat befand, war jedem bekannt.
Kommandeur dieses Truppenteils war Christian Wilhelm aus dem Haus Kurbrandenburg, postulierter Administrator des Erzstifts Magdeburg und Generalleutnant des Niedersächsischen Kreises. Dazu huschten nicht erbende Söhne des einheimischen Adels als Offiziere um ihn herum wie Libellen übers Wasser – ein von Krosigk, ein von Trotha, ein von Veltheim, ein von Rauchhaupt, ein von Herda, ein Aus dem Winkel und andere mehr. Auch Angehörige des halleschen Salzpatriziats, die einige Bekanntheit im Erzstift erlang hatten, gehörten zur Suite des Administrators. Allen voran die Ratsherren Johann Stützing und Samuel Österling.
Niklas holte tief Atem. Nun, es war eine Sache, aus sicherer Distanz den Fall zu erwägen, womöglich im Feldzug auf eigene Landsleute zu treffen. Im Vergleich dazu jedoch eine ganz andere, dieselben in der Bataille mit einer feuerbereiten Muskete in der Hand aufhalten zu müssen.
Seine Augen wanderten zur dreiecksförmigen Bastion hinüber, die wie eine Pfeilspitze aus der Mitte des Schanzwerks ragte. Der vorspringende Teil des Walls war von seinem Standort aus nicht einzusehen. Doch er wusste, dass sich dort der Obrist Johann von Aldringen befand, der seit drei Wochen mit nur wenigen Kompanien den überlegenen Truppen des Mansfelders standgehalten hatte. Auch sein Regimentsinhaber Scherffenberg war in der Bastion anzutreffen.
Die Befehlsgewalt über die Elbschanzen hatte Aldringen freilich nun einem anderen überlassen müssen, und zwar dem Generalissimus des kaiserlichen Heeres selbst. Denn untätig geblieben war Albrecht von Wallenstein derweil nicht.
Im Gegenteil, inzwischen war er mit dem Gros seiner Truppen einem dänischen Heerhaufen unter dem Befehl des Generals Fuchs von Bimbach entgegengerückt, der linkselbisch vorstieß, um die Dessauer Brücke abzuriegeln. Bei Wolmirstedt zerstampften Wallensteins Kürassiere den Widerstand des dänischen Fußvolks unter den Hufen ihrer Pferde, woraufhin Fuchs von Bimbach in höchster Eile die Flucht ergriffen hatte. Nach Wallensteins Überraschungsangriff bei Wolmirstedt stand fest, dass Fuchs sich am Kampf um die Dessauer Elbbrücke nicht würde beteiligen können.
Nun kam Wallenstein auch den Ersuchen der täglich bei ihm eintreffenden Boten Aldringens nach. Die Kuriere baten inständig um Verstärkungen, um Mansfelds Angriffen weiterhin abwehren zu können. Zunächst schickte der Generalissimus den Grafen Schlick mit zwei Reiterregimentern ans rechte Elbufer, kurz darauf traf in Person mit seinem Leibregiment und dem Regiment Tiefenbach dort ein.
Damit hatte Wallenstein das Gleichgewicht der Kräfte gegenüber dem dänisch-niedersächsischen Heer hergestellt. Außerdem waren seine Geschütze starkkalibriger und dem Gegner der Zahl nach um fast zwei Drittel überlegen ...
Niklas zuckte zusammen, als ganz in der Nähe ein Geschoss einschlug. Er zog den Kopf zwischen die Schultern und ging schnell hinter der Brustwehr in Deckung. Keinen Augenblick zu früh.
Ein Treffer riss das Schanzwerk unweit der Stelle auf, an der er eben noch gestanden hatte. Der Geschosshagel wurde noch heftiger. Salven von Eisenkugeln prasselten heran und schlugen in den Teil der Umwallung ein, hinter deren Brustwehr sich der Hauptmann und die Musketiere duckten.
Niklas schaute nach beiden Seiten. Die Mehrheit seiner Leute hatte die vorher festgelegten Stellplätze bezogen, die zu dem ihm zugeteilten Verteidigungsabschnitt gehörten. Am Ende des linken Abschnitts wies Daniel Knorre noch einige Musketiere an, wo sie sich aufstellen sollten.
Jeder Söldner hielt eine schussbereite Muskete in den Fäusten. An der Brustwehr lehnten Dutzende Stützgabeln, die beim Feuern durch die Schießscharten in den Boden gerammt wurden. Nun warteten die Musketiere des Regiments Scherffenberg voller Ungeduld auf den Feuerbefehl.
Wann zum Teufel setzt Wallenstein endlich die weittragenden Kartaunen ein?, sinnierte der Hauptmann. Warum gibt er nicht den entsprechenden Befehl?
Niklas schüttelte den Kopf. Sechsundachtzig Kartaunen standen dem Generalissimus zur Verfügung. Und die für Verteidigung und Angriff gleichermaßen nutzbaren Geschütze besaßen eine solche Feuerkraft, dass sie die gegnerischen Feldschanzen mit ihren dreißig Kanonen in Trümmer legen konnten.
Doch sowohl die Arkeley der Redoute als auch die alarmierten Verbände hatten Order, ihre Kompanien und Esquadrons zu formieren und Einsatzbereitschaft herzustellen, mehr nicht. Unternehmen sollten sie nichts, bevor ihnen nicht der Feuerbefehl erteilt worden war. So lautete Wallenstein Befehl, unmissverständlich und eindeutig. Und dem galt es Folge zu leisten.
Niklas lauschte und fragte sich, ob der Geschützdonner seine Ohren betäubte. Etwas war schlagartig anders geworden.
Es herrschte Stille, die Kanonen schwiegen. Wie ein Vorhang sank sie herab, die Stille. Sie hatte etwas Schmerzliches, schien trügerisch und gefährlich.
Langsam schob er seinen Kopf über die Brustwehr. Was er sah, ließ ihn durchatmen. Mansfelds Heerhaufen stellte sich im Vorfeld der Redoute zum Sturmangriff auf, seine Reiterei und Regimenter zu Fuß umfassten den Brückenkopf im weiten Halbkreis.
Vom rechtselbischen Uferwald bis zur Rossel traten die dänisch-niedersächsischen Reiteresquadrons und Fußeinheiten in geschlossenen Karrees an. Wiederum erhob sich Lärm. Feldpauken dröhnten, Trommelgerassel erklang, Fanfarenstöße gellten, Pferde schnaubten, Rosshufe stampften, Waffen klirrten, Befehlsgebrüll und Männergeschrei ertönte.
Am rechten Flügel der feindlichen Gefechtsordnung, der sich an den Uferwald anlehnte, stand die niederländische Reiterei unter dem Kommando des Grafen Hatzfeld. Neben der Kavallerie hatte sich das erzstiftische Aufgebot unter dem Administrator Christian Wilhelm eingereiht. Den Kern des lang gezogenen Halbrunds bildeten die Regimenter Ferenz, von Nienhofen und Colli, an denen sich die Fußeinheit des Obristen von Knyphausen anschloss. Mansfelds linken Flügel bis hin zur Rossel deckten schottische und französische Reiter.
Über den Köpfen der Pikenierregimenter zu Fuß erhob sich ein Wald von fast neunzehn Fuß langen Lanzen. Fähnriche reckten wappengeschmückte Standarten und Banner in die Luft.
Fanfaren gellten auf, Pauken rumorten. Im nächsten Moment setzte sich die dänisch-niedersächsische Gefechtsordnung in Bewegung. Wie riesige Stacheltiere strebten die lanzenstarrenden Pikenierblöcke, flankiert von Musketierrotten, dem Brückenkopf entgegen. Mansfelds Sturmangriff begann.
Schritt um Schritt rückten die Karrees vor, langsam und schwerfällig. Wieder Fanfarensignale. Die Lanzenträger senkten die Piken. Nun betrug die Entfernung zwischen ihnen und dem Brückenkopf kaum noch zweihundertfünfzig Schritte.
Herrgott, warum lässt Wallenstein denn nicht schießen?, stöhnte Niklas insgeheim. Die Mansfelder sind längst auf Schussweite heran ...
Gebannt blickte er auf den Söldnerblock, der auf dem rechten Flügel platziert worden war und seinem Verteidigungsabschnitt in gerader Richtung gegenüberlag. Ein Fahnenträger streckte das halbierte Banner des Regiments empor, die eine Hälfte rot, die andere weiß. Der rote Grund zeigte die Magdeburger Jungfrau mit einem Kranz in der Hand zwischen zwei Türmen, der weiße den roten kurbrandenburgischen Adler – das Wappen des Administrators Christian Wilhelm.
„Dieser Flecken Erde wird für einige von uns zum Grab werden“, stichelte Daniel Knorre, der unvermittelt neben ihm aufgetaucht war und seinem Blick folgte. „Tröstlich zu wissen, wenigstens durch die Hand der eigenen Landsleute gestorben zu sein.“
Der Hauptmann zog die Augenbrauen nach oben. „Warum erzählst du mir das, Daniel?“, fragte er steif.
„Ach, ich finde nur, wenn wir uns auf eine Sache einlassen, die uns Kopf und Kragen kosten kann, darf man wohl darüber nachdenken, wofür wir unsere Haut zu Markte tragen.“ Der Leutnant grinste. „Und ich habe den Eindruck, dass du ähnliche Gedanken hegst.“
Gewaltige Donnerschläge enthoben Niklas einer Antwort. Es waren jedoch nicht die Kanonen der Redoute, die losbrüllten, sondern die Geschütze auf dem linken Stromufer rechts der Elbbrücke. Dort hatte Wallenstein am Vortag eine Batterie schwerer Kartaunen aufstellen lassen. Eisenkugeln fegten über den Strom hinweg und rasten in Mansfelds linken Flügel.
Pausenlos grollten die Abschüsse der Kartaunenbatterie. Die achtundvierzigpfündigen Geschosse mähten Schneisen in die dicht gestaffelten Söldnerreihen wie der Schnitter durchs wogende Kornfeld. Über den Landsknechtskompanien auf dem linken Flügel spritzten Blutfontänen in die Höhe, abgerissene Körperteile, Knochensplitter, zerbrochene Waffen, Rüstungsteile und Kleidungsfetzen wirbelten durch die Luft.
Das Kanonenfeuer traf vornehmlich das Regiment Knyphausen und die schottische Kavallerie. Schutzlos, wehrlos, hoffnungslos waren die Pikeniere, Musketiere und Reiter den Kugeleinschlägen ausgeliefert.
Während der Beschuss Mansfelds linken Flügel zurückwarf, setzten die rechte Flanke und die Mitte seiner Gefechtslinie in völliger Ordnung den Sturmangriff fort. Inzwischen währte die Bataille bereit die dritte Stunde.
Jetzt krachten auch die Kartaunen der Redoute. Aus allen Rohren stachen grelle Flammenblumen hervor, schwarzgraue Rauchwolken stiegen auf. Hohlkugeln und Kettengeschosse flogen in die Karrees der Angreifer und sorgten für Tod und Verderben unter Mansfelds Landsknechten.
„Das Signal!“ Hinter der Brustwehr des rechtselbischen Schanzwerks schrie Daniel Knorre gegen den Geschützlärm an. „Der Befehl zum Feuern!“
Sofort hielt Niklas nach dem Signal Ausschau. Aber die Bastion hüllte Pulverdampf ein wie dichter Nebel. Nichts war zu erkennen, gar nichts – weder die Holzstange mit dem Hisstau noch der Signalwimpel. Trotzdem zögerte er keinen Augenblick, den entsprechenden Befehl zu geben.
„Feuer nach eigenem Ermessen!“, brüllte er.
Gleich darauf spien die Handschusswaffen mit lautem Knall Feuer und Rauch. Musketensalven deckten die Reihen der Mansfelder ein. Jeweils drei Schützen besetzten eine Schießscharte in der Brustwehr, andere schossen von der Bankette aus darüber hinweg. Unablässig luden die kaiserlichen Söldner die Handfeuerwaffen und zündeten die Lunten.
Wieder und wieder jagten Bleihagel in die heranrückenden Formationen. Die Musketenschüsse zerfurchten die gegnerischen Landsknechtsrotten nicht weniger schrecklich als die Kartaunen. Feindliche Söldner wälzten sich blutüberströmt am Boden, viele Männer hielten sich die zerfetzten Glieder und schrien vor Qualen.
Das Abwehrfeuer der kaiserlichen Söldner richtete unter den Angreifern ein furchtbares Gemetzel an. Die ständigen Kanonenkugeleinschläge wirbelten braune Staubschleier auf, die wie Leichentücher über Mansfelds Heerhaufen hingen. In seinen Karrees herrschte blankes Entsetzen. Und es sollte noch schlimmer kommen.
In diesem Moment mischten sich neue Geräusche in den Gefechtslärm. Hufgestampf und Zaumzeugklirren. Ohne sich umzuwenden, wusste Niklas, was in seinem Rücken geschah: Die beiden Kavallerieregimenter unter dem Befehl des Grafen Schlick passierten die Elbbrücke. Wallensteins Leibeinheit und das Regiment Tiefenbach würden folgen.
Damit eine solche Truppenbewegung unbemerkt vollzogen werden konnte, war die Brücke vorher mit Zeltplanen verhängt worden. Die Überspannung bot gegen feindliche Ausspähung einen vortrefflichen Schutz. Sobald die kaiserlichen Kürassiere und Dragoner den hinteren Bereich der Redoute erreicht haben würden, sollten sie denselben durch das linke Ausfalltor wieder verlassen und sich im rechtselbischen Uferwald bereithalten. Von dort aus würden sie zu passender Zeit dann hervorbrechen. Danach würden Wallensteins und Tiefenbachs Landsknechte die Ausfalltore nutzen.
Niklas kannte die beabsichtigte Vorgehensweise, weil die Offiziere des Regiments Scherffenberg am Vorabend zu einer Lagebesprechung mit ihrem Kommandeur bestellt worden waren. Bei dieser hatte Scherffenberg ihnen nicht nur das Vorhaben des Generalissimus erläutert, sondern auch die Aufgaben dargelegt, die ihren Kompanien zufielen.
Ununterbrochen donnerten die Geschütze weiter. Die kaiserlichen Musketiere luden und feuerten, so schnell sie konnten. Durch die sich verringernde Entfernung der angreifenden Söldnerblöcke traf nahezu jeder Schuss. Das Musketenblei riss Mansfelds Landsknechte in blutige Fetzen oder zerschmetterte deren Gliedmaßen.
Gegen den mörderischen Kugelhagel half kein Beten und kein Kampfeswille. Die Reihen des erzstiftischen Aufgebots lichteten sich, die Regimenter Ferenz, von Nienhofen und Colli ertranken in ihrem Blut. Unter Mansfelds Söldnern entbrannte ein heilloses Durcheinander.
Der Angriffselan des dänisch-niedersächsischen Heeres stockte vollends. Doch damit nicht genug. An ihrem rechten Flügel brach jetzt die Hölle los.
Denn gleich einem reißenden Gebirgsfluss brandeten hier die Kavallerieregimenter des Grafen Schlick aus dem Uferwald hervor. Die Erde bebte unter unzähligen Pferdehufen. Hunderte Pallasche und Katzbalger flogen in die Höhe.
Zuerst bekam die niederländische Reiterei unter Hatzfeld die Angriffswucht der kaiserlichen Kavallerie zu spüren. Wie eine unaufhaltsame Woge fielen die Kürassiere und Dragoner den Mansfeldern in die Flanke. Unbarmherzig droschen sie mit den Reitersäbeln und Kurzschwertern auf die völlig überrumpelten Soldreiter ein.
Zuhauf stürzten die niederländischen Söldner getroffen aus den Sätteln. Hatzfelds Leute gerieten in Panik, sein Detachement wurde aufgerieben. Nur wenigen Soldreitern gelang es, die Pferde an den Zügeln herumzureißen und davonzupreschen, als sei der Leibhaftige hinter ihnen her.
Wenig später brauste der Reitersturm in die dicht gedrängten Massen des gegnerischen Fußvolks, wieder schwangen Pallasche und Katzbalger in hohem Bogen durch die Luft. Blindlings sausten die scharf geschliffenen Klingen auf die Köpfe der Mansfelder herab, als wollten sie Holzkloben spalten.
Eine Menge Hiebe prallten mit lautem Klirren von den Morions der Landsknechte ab, doch etliche fanden ihr Ziel. Sie zerfetzten Gesichter, Hälse, Nacken, Schulterblätter oder Oberarme. Blutrinnsale besudelten die bunte Tracht der Blessierten.
Unter den wirbelnden Klingen ging Mann um Mann von Mansfelds rechtem Flügel zu Boden. Fahnen und Standarten sanken zur Erde, unzählige Füße trampelten über sie hinweg. Abgrundtiefes Entsetzen erfasste den Heerhaufen des Dänenkönigs, die ersten Söldnerrotten lösten die Gefechtsordnung auf.
Im selben Moment schwieg die kaiserliche Arkeley. Das Risiko, versehentlich die eigenen Leute zu treffen, war zu hoch. Zugleich erhielten die Musketiere auf der Umwallung das Zeichen, ihre Schusspositionen zu räumen. Auf dieses Signal hin sollten sie zum Gegenangriff antreten.
„Feuer einstellen!“, befahl Niklas Bock. „Alle runter vom Wall, am Ausfalltor formieren! Beeilung!“
„Alle Mann zum linken Tor!“, brüllte nun auch Daniel Knorre. „Bewegung, Bewegung!“
Die Schützen packten ihre Musketen und Gabeln und verließen die Umwallung. Während sie sich im hinteren Teil der Redoute sammelten, scheuchten die Leutnants Wolf Stoltze und Johann Schulze die Pikeniere des Regiments bereits durch das Ausfalltor. Noch davor waren Aldringens Pikenierkompanien hinausgezogen.
Niklas Bock und Daniel Knorre begaben sich an die Spitze der angetretenen Musketierrotten. „Alle raus zum Gegenangriff!“, befahl der Hauptmann den Abmarsch.
„Vorwärts, vorwärts – auf sie!“, pflichtete der Leutnant ihm bei. „Wir knacken diese verdammten Mansfelder!“
Mit langen Schritten gingen die Offiziere voran. „Der gräfliche Bastard hat zweimal versucht, die Redoute einzunehmen“, tönte Daniel Knorre und warf seinem Hauptmann einen Seitenblick zu. „Wird Zeit, dass wir ihm für immer das Genick brechen, Capitain.“
„Hoffen wir, dass du recht behältst“, brummte Niklas.
In Windeseile stellten sich die Kompanien der Regimenter Aldringen und Scherffenberg zum Gegenstoß auf. Die Pikeniere bildeten Würfel starrender Lanzen, die Musketiere deckten ihre Flanken. Trompeten schmetterten das Angriffssignal, Kommandorufe ertönten, Trommelwirbel klangen auf.
Die kaiserlichen Geviertblöcke rückten in breiter Front auf Mansfelds zerbröckelnder Gefechtslinie zu. Auf halber Distanz feuerten die Musketiere ihre Schusswaffen ab und pflügten weitere Lücken in die Reihen der Feinde. Die Lanzenträger senkten ihre gut drei Mann hohen Piken.
Brüllend und schreiend prallten die beiden Gefechtslinien aufeinander. Jetzt war das Weiße im Auge des Feindes zu erkennen.
Mit vorgestreckten Stangenwaffen stürzten sich die Pikeniere auf die verwirrten Mansfelder. Das Gewimmel aus farbigen Schlitzwämsern, Pluderhosen, Brustharnischen, Morions und Federhüten stellten nicht zu verfehlende Ziele dar. Eiserne Pikenspitzen bohrten sich tief in Männerleiber und rissen sie in blutige Fetzen. Die Getroffenen heulten qualvoll auf, während ihr Blut aus den klaffenden Wunden floss.
Die Mansfelder begriffen, dass es ums nackte Davonkommen ging. Die nächste Zeitspanne würde über Leben und Tod entscheiden. Binnen Kurzem entbrannte ein wüstes Handgemenge, und auf beiden Seiten wälzten sich blutende Landsknechte im Dreck.
„Fertigmachen zum Nahkampf, Männer!“, rief Niklas Bock mit heiserer Stimme. „Haltet die Formation!“
In der rechten Hand hielt er das blanke Rapier, die Linke umklammerte den Knauf einer schussbereiten Radschlosspistole. Er wusste, dass sein Befehl völlig überflüssig gewesen war. Angesichts des Gewühls, das ihn umgab, verstand ihn niemand.
Aber die Söldner hatten in hartem Drill gelernt, überraschende Gegebenheiten zu bewältigen. Manche gaben die leergeschossenen Schusswaffen an nachfolgende Leute weiter, damit die sie nachladen konnten, und zogen ihre Katzbalger. Andere ließen die Musketen, die sie im Handgemenge nur behindert hätten, einfach fallen, griffen zu den Blankwaffen und droschen auf die zum Teil vor Schreck wie gelähmten Mansfelder ein.
Etwa zehn Klafter voraus sah Niklas ein Banner aufragen. Darauf prangten das erzstiftische und das brandenburgische Wappen. Er stieß eine Verwünschung hervor. Nun geschah, was nicht geschehen sollte: Landsleute standen sich Auge in Auge gegenüber, verkeilten sich im erbitterten Nahkampf ...
Vor ihm krachte ein Schuss. Unwillkürlich zuckte Niklas zur Seite. Gerade noch rechtzeitig. Eine Kugel zischte so haarscharf an seiner Wange vorüber, dass er meinte, ihren Luftzug spüren zu können. Das Geschoss erwischte einen Söldner hinter ihm, der schmerzvoll aufschrie.
Zum Nachdenken blieb dem Hauptmann keine Zeit. Schon sprang ein stämmiger Mansfelder, in der rechten Faust den Katzbalger schwingend, auf ihn zu. Die Schwertklinge wirbelte in hohem Bogen durch die Luft.
Niklas hob die linke Hand und zog den Abzug der Radschlosspistole durch. Eine Flammenzunge zuckte aus der Rohrmündung und spie eine Kugel aus. Das Geschoss traf den Söldner mitten im Gesicht. Sein Schädel zerbarst im Bruchteil eines Atemzugs in eine blutige Masse aus Fleischfetzen, Hirn und Knochensplitter, bevor er steif wie ein gefällter Baum hintenüber kippte.
Der Hauptmann schob die Schusswaffe zurück ins Halfter. Diese Gefahr war gebannt. Aber es drohte ihm bereits die nächste.
Jetzt war es ein hagerer Bursche, der heranstürmte. Ein breitkrempiger Hut mit wallenden Federn bedeckte sein knöchernes Gesicht, die Brust war mit einem gelben Lederkoller ausstaffiert. Offensichtlich handelte es sich um einen der zahllosen Herrensöhne, die späterhin nichts erben würden. Solche Junker im Rang eines Fähnrichs waren sowohl in den katholischen als auch in den protestantischen Heerhaufen keine Seltenheit.
Mit einem überheblichen Grinsen ließ er sein Rapier vorschnellen. Der Stoßdegen zischte heran, während Niklas geistesgegenwärtig nach rechts auswich. Gleichwohl streifte die Klingenspitze seinen Oberarm und fetzte einen klaffenden Schlitz in den Wamsärmel. Fast wäre er durch die Ausweichbewegung noch ins Straucheln geraten.
Gewiss hatte der Fähnrich bereits im Knabenalter eifrig Fechtunterricht genommen, wie es seiner Herkunft entsprach. Jedenfalls bediente er sich aller Finten, die ihm vermittelt worden waren. Er ließ dem taumelnden Hauptmann keine Zeit, sich zu besinnen, sondern drang wieder auf ein.
Ein seitlicher Ausfallschritt des Fähnrichs sollte dieser Angelegenheit ein Ende bereiten. Blitzartig schwang die Degenklinge nach vorn, um dem kaiserlichen Offizier den Todesstoß zu versetzen.
Doch wider Erwarten straffte sich der Hauptmann erstaunlich schnell und parierte den Stoß mit dem eigenen Rapier. Auch die darauffolgenden Angriffe wehrte er ab. Dann schlug er mit einem kraftvollen Hieb die Waffe des Fähnrichs in einem Bogen nach oben und führte einen Stoß gegen den Brustkorb seines Gegners.
Dem Mansfelder fiel das Grinsen aus dem Gesicht. Er schaffte es nicht einmal mehr, zu schreien, als die Rapierklinge den Lederkoller durchstieß und sich unter der Brust in seinen Leib bohrte. Der Degen glitt ihm aus der Hand.
Niklas drehte die Klinge im Bauch des Fähnrichs um, bevor er sie wieder herauszog. Aus der Wunde schoss ein Schwall Blut. Der Mansfelder presste beide Hände auf die offen liegenden Eingeweide, doch das nahm der kaiserliche Offizier nicht mehr wahr.
Niklas beeilte sich, den vorrückenden Musketiere seiner Kompanie zu folgen. Der überwiegende Teil war schon an ihm vorbeigeschritten. Im Vorangehen verschaffte er sich mit einem Rundblick die notwendige Orientierung.
Die Angriffswelle der Regimenter Aldringen und Scherffenberg war inzwischen über die Kette der gegnerischen Feldschanzen hinweggeflutet. Die dänisch-niedersächsischen Truppenteile stoben auseinander wie ein Schwarm Hühner, in den der Habicht stößt. Mansfelds Söldner suchten ihr Heil in der Flucht. Das Banner mit den Insignien des Administrators Christian Wilhelm, das vorher über dem erzstiftischen Aufgebot emporgereckt worden war, schien verschwunden zu sein. Vielleicht lag es zerrissen im Getümmel.
Jetzt befand sich Niklas auf der freien Fläche zwischen zwei Feldschanzen. Zu seiner Linken hieben Flicks Reiter mit ihren Blankwaffen die fliehenden Mansfelder in Stücke. Rechter Hand trieb Leutnant Schulze eine Rotte Pikeniere an der aufgeworfenen Schanze vorbei. In einiger Entfernung hinter den Erdbefestigungen erstreckte sich das Feldlager des dänischen Generals: Zeltgassen, Rüstwagen, Marketenderkarren und Trossfuhrwerke aller Art. Dort winkte Beute.
Irgendwo vorn brüllte jemand: „Achtung, Laufgraben!“
Für den Hauptmann kam der Warnruf zu spät. Er stürzte zwar nicht in den Laufgraben, aber er verfing sich mit einem Stulpenstiefel an einer abgestorbenen Wurzel. Somit verlor er das Gleichgewicht und fiel seitlich zu Boden. Zumindest blieb seine Waffenhand unverletzt.
Eilends wollte er sich wieder aufrappeln, da geschah Unfassbares.
Plötzlich schoss aus dem feindlichen Lager ein Feuerpilz in den Himmel, wipfelhoch und blitzgrell. In der Zeitspanne eines Wimpernzuckens folgte diesem eine gewaltige Explosion, gleichzeitig quollen tiefdunkle Rauchschwaden empor und breiteten sich rasend schnell aus.
Niklas‘ Augen weiteten sich vor Bestürzung. Mein Gott, da erschütterte nicht nur ein Detonationsdonner die Luft! Die Explosion übertraf alles, was er je gehört hatte. Das war die Entfesselung einer Urgewalt!
Erneut glühten Feuerpilze auf, wieder urgewaltiges Detonationsgebrüll. In den sich ausdehnenden Qualmwolken wirbelten Menschenleiber durch die Luft, als handle es sich um Strohpuppen. Rüstwagen und Fuhrwerke lösten sich in ihre Bestandteile auf. Zerborstene Holzstücke und zersplitterte Wagenräder wurden so weit fortgeschleudert, dass sie außerhalb des Feldlagers wie fehlgegangene Geschützkugeln auf den Erdboden klatschten.
Dann kam die Druckwelle. Sie schoss über Niklas hinweg und fegte seinen Federhut irgendwohin in die Ferne. Neben ihm fielen kleinere Trümmerteile herunter. Die Söldner, die in seiner unmittelbaren Nähe gestanden hatten, wurden von der Druckwelle von den Füßen gerissen, einige auch von herabsegelnden Holzteilen erschlagen. Das galt für die Landsknechte beider Seiten.
Eine Ewigkeit schien vergangen zu sein, bis sich das Grollen der Explosionen legte. Die Detonationsflammen sanken in sich zusammen. Von Mansfelds Lager bis zum Elbufer war der Himmel von Qualmwolken verhangen.
Der Hauptmann überwand den Moment der Fassungslosigkeit und erhob sich. Ringsumher gelangten weitere Angehörige seines Regiments, die von der Druckwelle umgemäht worden waren, wieder auf die Beine. Die meisten mussten den Schock, der ihnen in den Knochen steckte, erst einmal abschütteln.
Wie aus dem Nichts stand plötzlich Daniel Knorre neben ihm. „Ein Pulverwagen“, stellte er grinsend fest. „Dem gräflichen Bastard ist ein Pulverwagen hochgegangen!“
„Das war nicht nur einer“, widersprach Niklas. „Da ist so ziemlich alles explodiert, was Mansfeld an Schießpulver vorrätig hatte.“
Der Leutnant hob gleichmütig die Schultern. „Wenn die Höllenladung vorher hochgeht, ist das immer noch besser, als sich hier über den Haufen schießen zu lassen.“
Niklas schwieg, weil er auf einen Vorgang aufmerksam geworden war. Unweit zu seiner Rechten wedelte Johann Schulze mit den Armen durch die Luft und brüllte nach einem Feldscher.
Eine Kopfbewegung forderte Daniel Knorre zum Mitkommen auf. Die beiden Offiziere begaben sich zu der Stelle, wo Schulze sich über den Körper eines verwundeten Mansfelders beugte, der vor ihm auf dem Boden lag.
„Es hat ihn ernsthaft erwischt, Capitain“, erklärte Schulze, als die Offiziere herantraten. „Sehr ernsthaft.“
Niklas betrachtete den Blessierten. Sein Gesicht war verschmutzt, die übrigen Körperteile über und über mit Blut besudelt. Eine Pikenspitze oder Schwertklinge hatte sein Habit, welches ihn als gegnerischen Offizier auswies, ellenlang aufgerissen. An der linken Brustseite klaffte eine grässliche Fleischwunde mit zerfransten Rändern, aus der Blut sickerte.
„Das ist unser guter Bekannter Hans Caspar von Trotha“, setzte der Leutnant seine Erläuterungen fort. „Er wird unweigerlich verbluten, wenn wir ihn sich selbst überlassen. Immerhin gehört er auch der halleschen Pfännerschaft an.“ Seine Stimme überschlug sich fast vor Eifer.
Daniel Knorre schob der Federhut so weit aus der Stirn, dass er auf dem Hinterkopf saß. „Tatsächlich“, murmelte er, „unser sonst stets makellos einhergehender Landsmann ist in der schmutzigen und blutbeschmierten Tracht kaum wiederzuerkennen. Zählte unser alter Bekannter nicht sogar zu den engsten Vertrauten des Administrators Christian Wilhelm, Johann?“
Der Leutnant überhörte die Frage. Stattdessen flehte er inständig: „Hans Caspar verblutet, Capitain ... Wir können ihn noch retten!“
Der Hauptmann winkte ab. Das war keine Sache, die ihm Kopfzerbrechen bereitete.
Er würde den Blessierten dem Herkommen nach als feindlichen Offizier behandeln, der in Gefangenschaft geraten war. Sollte der Adelsspross seine Verletzungen überstehen, dann lag die Entscheidung bei ihm, ob er in den Dienst des Kaisers eintreten, gegen Lösegeld freigekauft oder ausgetauscht werden wollte. So war es Brauch, in den katholischen ebenso wie in den protestantischen Söldnerheeren. Konfessionelle Vorbehalte gab es hier keine.
„Gut, Johann“, stimmte er zu, „hol den Feldscher, damit er unseren Bekannten versorgt. Dann schick ihn auf einer Trage nach hinten.“
Johann Schulzes Gesicht hellte sich auf. „Schafft mir sofort den verdammten Feldscher her!“, blaffte er einige der umstehenden Pikeniere an. „Los, tummelt euch!“
Niklas entfernte sich ein Stück, um sich nach dem mittlerweile fünfstündigen Gefecht über die Lage zu orientieren. Ohne Aufforderung schloss Daniel Knorre sich ihm an.
Das gegnerische Feldlager schien durch die ausgelöste Pulverexplosion vollständig verwüstet zu sein. Mansfelds zusammengeschrumpften Söldnerverbände hatten jede Ordnung verloren und suchten das Weite. Schlicks Reiter jagten in die davonhastenden Landsknechtsrotten hinein und säbelten nieder, was ihnen vor die Klinge kam. Unter den Fliehenden befanden sich auch die Reste des erzstiftischen Aufgebots.
Daniel Knorre knetete sein Kinn. „Erledigt, der Fall!“, urteilte er genüsslich. „Da nimmt er Reißaus, der postulierte Administrator des säkularisierten Erzstifts Magdeburg. Den hochwürdigen Christianus Wilhelmus sind wir los. Wir werden ihn wohl nie mehr wiedersehen.“
Niklas Bock wiegte den Kopf. „Da bin ich keineswegs so sicher.“
1
Zwischen Saale und Bode, August 1626
Über den Landweg, der von alters her den Saalebogen mit dem Bodefluss verband, rumpelten zwei mit Planen überspannte Fuhrwerke. Jeweils vier Kaltblüter zogen die schwer beladenen Wagen. In das Knarren der Wagenräder mischte sich das Knirschen des Lederzeugs und gelegentlich ein Schnauben der Zugpferde.
Berthold Stahm saß in der Schoßkelle des vorderen Frachtwagens. Seine Augen erfassten bald die eine, bald die andere Seite des Fahrwegs. Gelegentlich kniff er die Lider zusammen, wenn ihn die Sonne blendete, die sich an diesem Augustnachmittag allmählich dem Horizont zuneigte.
Der junge Salzspahn warf einen Seitenblick auf den neben ihm hockenden Fuhrknecht, der die langen Zügel in den Händen hielt. Jetzt, auf der Rückfahrt, lenkte Gernot Winscheffel die Gespannpferde des ersten Frachtwagens. Der Fuhrknecht sollte Gelegenheit erhalten, ein angeschirrtes Vierergespann zu führen und die Wegstrecke kennenzulernen.
Berthold schob die Unterlippe vor und widmete seine Aufmerksamkeit der Umgebung. Noch konnte er die sanft gewellte Landschaft weit übersehen. Bald jedoch würde sich die Dämmerung über das Land senken.
In ihm nagte Unzufriedenheit. Um diese Zeit wollte er längst wieder in der Bodestadt Staßfurt sein, zurück auf dem Fuhrhof seines Vaters, statt noch in der Schoßkelle herumzurutschen. Aber die Güterabwicklung auf dem Umschlagplatz am Schlossanger in der Saalestadt Calbe hatte heute länger gedauert als üblich.
Schon das Verstauen der Salzfässer auf die flachbordigen Lastkähne, die sie mit zwei Frachtwagen zum Calbenser Schiffsanleger befördert hatten, war mit Verzögerungen einhergegangen. Später, nach dem Platzwechsel zur Staßfurter Salzniederlage in der Saalestadt, um Holz für die bodestädtische Saline zu laden, waren sie weiter in Verzug geraten. Der Zeitverlust, der sich hieraus ergab, hatte dann nicht mehr wettgemacht werden können.
Er, Berthold, hatte ursprünglich gehofft, in Calbe noch Neuigkeiten erfahren zu können, die in Zusammenhang mit den gegenwärtigen Kriegsläuften im Salzwinkel des Erzstifts Magdeburg standen. Auf einem Umschlagplatz wie Calbe, wo Händler, Fuhrleute und Wanderprediger verkehrten, wusste man damit am ehesten aufzuwarten.
Ja, er hätte gern ein paar Auskünfte über bevorstehende Truppendurchzüge oder Quartiernahmen im Stiftsgebiet gesammelt. Doch selbst hier an der Saale, wo sonst Gerüchte und Nachrichten herumschwirrten wie aus dem Stock gescheuchte Bienen, war an diesem Augusttag nichts zu erfahren gewesen.
Schade, dass es nicht geklappt hatte. Für die bodestädtischen Salzspahne konnten solche Auskünfte wegen der allgemeinen Unsicherheit auf den Fahrstraßen lebenswichtig sein.
Berthold seufzte. Dazu sah sein Vater es immer gern, wenn er bei den Salzfahrten zur Saale auch den Pfoells einen Besuch abgestattet hätte. Tatsächlich hatte er auch beabsichtigt, bei der Calbenser Fuhrmannsfamilie auf einen Sprung vorbeizuschauen. Aber der unvorhergesehene Zeitverzug auf dem Umschlagplatz war letztlich zum Grund dafür geworden, dieses Vorhaben aufzuschieben.
Der Calbenser Salzgast Linhard Pfoell war ein alter Freund seines Vaters. Die beiden Fuhrleute hatten in besseren Zeiten nicht nur jahrelang zwischen Staßfurt und Calbe zusammen Reihefahrten unternommen, sondern zudem auch Salzladungen auf Fernreisen bis hinein ins Böhmische befördert. Seither fühlten sich ihre Familien freundschaftlich verbunden. Für Berthold war der Calbenser Fuhrmann inzwischen so etwas wie ein entfernter Verwandter geworden. Darüber hinaus ...
Der Salzspahn schluckte, während unvermittelt das Bild eines blutjungen Mädchens vor seinem inneren Auge aufstieg. Das Gesicht umrahmten dunkle Locken. Ein zartes Gesicht, anmutig und zauberhaft.
Gerlind!
Linhard Pfoells Tochter war einige Jahre jünger als er. Früher hatte er Gerlind stets nur als ein kleines Kind gesehen. In den letzten anderthalb Jahren hatte Linhard Pfoells Tochter dann freilich eine auffallende Wandlung vollzogen.
Nun hieß Berthold ein voll erblühtes Mädchen willkommen, wenn er Zeit fand, die Pfoells zu besuchen. Es schien, als sei sie über Nacht wie eine Knospe aufgebrochen, die kleine Jungfer Gerlind.
Es gab keinen Zweifel: Gerlind Pfoell war zu einer Schönheit herangereift. Und ihre Erscheinung löste in Berthold mittlerweile Empfindungen aus, die er in seinem Leben bislang nicht gekannt hatte.
Dem Vater würde, spann er seine Gedanken fort, eine noch engere Verbindung mit der Familie Pfoell gewiss nicht ungelegen sein.
Berthold presste die Lippen zusammen. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, musste er zugeben, dass es nicht die Verzögerung bei der Güterabwicklung war, die seine Stimmung trübte. Vielmehr bedrückte ihn die versäumte Zusammenkunft mit Gerlind. Sehr viel mehr.
Der Salzspahn strich sich mit dem Handrücken über die Stirn, als wollte er seinen Verdruss fortwischen. Aber an den Umständen ließ sich nichts mehr ändern.
Ein Ruck, der durch den Frachtwagen ging, riss Berthold aus seinen Überlegungen. Schnell sah er sich um. Offenbar war er so in Gedanken versunken gewesen, dass er den zuletzt bewältigten Wegabschnitt nur unbewusst wahrgenommen hatte.
Die Frachtwagen hatten inzwischen das Runddorf Brumby passiert und waren an der Weggabelung am Ortsausgang in den linker Hand abzweigenden Fahrweg eingebogen. Jetzt führten die Spurrillen einen sanft geschwungenen Hügel hinauf. Sobald das Fuhrwerk die Hügelkuppe erreicht hatte, würden Berthold und Gernot von dort aus das Waldstück sehen, das auf halbem Weg zwischen Brumby und dem Bodefluss lag.
Wieder holperte das rechte Vorderrad des Frachtwagens durch ein Schlagloch. Gernot Winscheffel musste sein ganzes Geschick aufbieten, um das schaukelnden Fuhrwerk heil über den von tiefen Wasserfurchen durchzogenen Fahrweg zu bringen.
„Pass auf, Gernot, die Straße ist voller Löcher!“, warnte Berthold den Fuhrknecht. Er kannte die Wegstrecke wie den Pferdestall auf dem elterlichen Fuhrhof.
„Der Abschnitt hier ist der schlechteste des ganzen Fahrwegs. Und hinter der Hügelkuppe wird es nicht besser.“
Gernot murmelte etwas vor sich hin, was im Hufschlag der Kaltblutpferde und dem Ächzen der Räder nicht zu verstehen war. Darauf blickte er starr geradeaus und konzentrierte sich auf die Lenkung des schweren Fuhrwerks. Niemand sollte ihm vorwerfen können, dass er etwaige Feldsteine, Unebenheiten oder hochstehende Baumwurzeln übersehen würde.
„Gut so, Gernot“, sagte Berthold anerkennend.
Langsam rumpelten die Frachtwagen über die Hügelkuppe und schaukelten den flachen Abhang hinunter. Das Waldstück war jetzt keine fünf Dutzend Pferdelängen mehr entfernt.
Der Salzspahn beugte sich zur Seite und schaute über die Schulter zurück. Der zweite Wagen holperte unmittelbar hinter ihnen über den unebenen Untergrund. Das hochgewölbte Planendach schimmerte im Schein der sinkenden Sonne rötlich.
Über Bertholds Gesicht huschte ein Lächeln. Um dieses Gefährt brauchte er sich nicht weiter zu kümmern. Einmal mehr empfand er die Gegenwart Wilm Pollners als überaus wohltuend.
Der grauhaarige Lohnfuhrmann saß steif wie ein Holzbrett in der Schoßkelle des hinteren Fuhrwerks. Bei Gott, der alte Mann verstand sein Handwerk, wahrscheinlich war er der beste Salzfuhrmann weit und breit. Wirklich schade, dass er in letzter Zeit über gesundheitliche Beeinträchtigungen klagte und deshalb Verzicht über wollte.
Am heutigen Tag schien Wilm jedoch über eine ungebrochene Spannkraft zu verfügen. Diese Erkenntnis beruhigte Berthold. Wenn es nottat, würde auf ihn Verlass sein. Der junge Salzspahn ahnte nicht, wie bald der erfahrene Lohnfuhrmann seine Überzeugung bestätigen sollte.
Die Frachtwagen verließen das offene Hügelland und tauchten in das Waldstück ein. Augenblicklich wurde die Passage so eng wie ein Hohlweg, zwischen deren dichten Baumbewuchs bereits die Schatten der Dämmerung nisteten.
Bertholds Augen wanderten unablässig von rechts nach links und wieder zurück. Unbehagen beschlich ihn. Aber an dem Waldstück führte kein Weg vorbei, es gab nur diese Durchfahrt zum Bodefluss.
Wenn der Rückweg nach Staßfurt unangenehme Überraschungen für die Salzfuhrleute bereithalten sollte, dann würden sie hier lauern. Nirgendwo anders war der Platz für eine Falle günstiger.
Die Wagenräder knarrten und ächzten in den Fahrrinnen, die Pferde schnaubten angestrengt. Gernots langstielige Fuhrmannspeitsche schnalzte über den Rücken der Zugpferde.
Je weiter die Fuhrwerke in den Waldstreifen vorankamen, desto mehr verstärkte sich in Berthold die Empfindung einer drohenden Gefahr. Das Peitschenschnalzen des Fuhrknechts nahm er zum Anlass, sich zu versichern, dass seine Waffen einsatzbereit waren. Die kurzstielige Karbatsche mit der geflochtenen Lederschnur, die sein Vater einst von einer Fernreise mitgebracht hatte, lag rechter Hand in der Schoßkelle. Der Wetterumhang auf dem Holzbord dahinter verbarg nicht nur das Felleisen mit dem Schutzbrief, sondern auch eine geladene Radschlosspistole.
Berthold beobachtete unablässig die bebuschten Waldsäume, die bis dicht an den Fahrweg heranreichten. Sein Unbehagen hielt an. Irgendetwas weckte sein Misstrauen, ohne dass er hätte sagen können, was genau an diesem Abend anders war als sonst. Es war ein unbestimmter, mehr instinktiver Argwohn.
Er wollte gerade den Blick vom linken Waldsaum abwenden, als ihm eine kurze Wegstrecke voraus etwas auffiel. Aus dem Gebüsch am Wegrand stob ein Vogelschwarm hervor und verschwand lärmend zwischen den Bäumen, so als sei er von Störenfrieden aufgejagt worden.
Unter verengten Lidern hervor spähte Berthold zu dem Gebüsch, aus dem die Vögel abgeschwenkt waren. Vielleicht hatte sie ein Fuchs oder anderes Raubgetier aufgescheucht. Es konnten aber auch Wegelagerer sein, die dort lauerten.
„Habt Ihr etwas entdeckt, Herr?“, erkundigte sich Gernot, der dem Blick des Salzpahns gefolgt war.
„Dort!“ Bertholds rechter Arm wies nach vorn. „Dort vor uns über dem Gebüsch, siehst du!“
„Nein, Herr.“ Gernot schüttelte den Kopf. Er kostete ihn viel Mühe, den Frachtwagen in der Fahrspur zu halten. „Etwas Verdächtiges?“
Berthold erläuterte dem Fuhrknecht kurz, was er über dem Gebüsch beobachtet hatte. „Es könnte Raubgetier gewesen sein, das die Vögel aufgescheucht hat“, erklärte er. „Vielleicht ist es aber auch jemand, der uns ans Leder will.“
Gernot holte tief Luft. „Ihr meint, hinter den Büschen liegen irgendwelche Halunken auf der Lauer?“
Der Salzspahn nickte. „Ich befürchte es.“
„Aber wir haben doch ein Papier bei uns, das uns vor allzu großer Unfreundlichkeit schützen soll, Herr?“
Berthold vollführte eine abfällige Handbewegung. „Stimmt, Gernot. Wir besitzen einen Schutzbrief, der vom kaiserlichen Obristen Scherffenberg ausgestellt worden ist. Aber der ist nicht das Papier wert, auf dem der Bescheid geschrieben steht. Wenn Raubgesindel im Hinterhalt lauert, hilft uns kein Schutzbrief weiter.“
Der Fuhrknecht verzog das Gesicht, als hätte er Essig geschluckt. „Was soll ich tun, Herr? Soll ich den Wagen anhalten?“
„Warum? Wir fahren weiter!“, entschied Berthold. „Aber langsam und vorsichtig, Gernot. Vorsichtig und langsam.“
Um Gernots Mundwinkel zuckte es. „Wollt Ihr die Schnapphähne wirklich auf dem Hals haben, Herr?“
Bertholds Gesicht zeigte keine Regung. „Kampflos wird den Schurken jedenfalls nichts in die Hände fallen“, zwängte er zwischen den Zähnen hervor.
Kurz darauf hatten die Fuhrwerke jene Stelle erreicht, wo die Vögel aufgeflattert waren. Der Salzspahn starrte unverwandt zu den dichten Büschen und Bäumen hinüber. Jeden Augenblick konnte ihnen Mündungsfeuer aus dem Hinterhalt in die Gesichter fauchen und heißes Blei um die Ohren fliegen.
Doch nichts geschah.
Die Frachtwagen passierten unbehelligt die verdächtige Stelle und rumpelten weiter. Vier, fünf, sechs Ruten.
Gernot wollte schon erleichtert aufatmen, als der Salzspahn ihm zuraunte: „Sie sind in der Nähe, ich spüre es in allen ... “
Noch bevor er das letzte Wort ausgesprochen hatte, vernahm Berthold ein Geraschel zwischen den Bäumen. Trockene Äste krachten, gleichzeitig ertönte ein schriller Pfiff.
Drei Gestalten tauchten am Waldsaum auf. Wie Raubtiere waren sie zwischen den Büschen hervorgesprungen.
Berthold erfasste die Lage mit einem Blick. Die wildbärtigen Kerle trugen Wämser mit geschlitzten Ärmeln, gestreifte Pluderhosen und Stulpenstiefel. Nichts von alldem wirkte freilich passabel, sondern heruntergekommen und verlottert.
Ihre Köpfe bedeckten Reiterhüte mit hochgebogenen Krempen, deren ehemals wallende Federbüsche sich mittlerweile zerzaust darboten. In ihren Gurten steckten Pistolen und Dolche, am Lederbandelier baumelten Stoßdegen. Ohne jeden Zweifel handelte es sich bei ihnen um Gartbrüder, die nach Beute gierten.
Zwei Kerle blieben am Wegrand stehen, von wo aus sie ein freies Schussfeld auf die Schoßkelle des vorderen Wagens hatten. Der dritte versperrte den Fahrweg, fuchtelte mit einem Faustrohr in der Luft herum und brüllte: „Halt! Haltet an, oder ihr seid des Todes!“
„Soll ich anhalten?“, flüsterte Gernot. „Oder wollen wir versuchen, durchzukommen?“
„Halt an!“, erwiderte Berthold mit völligem Gleichmut.
Gernot brachte die Pferde mit einem heftigen Zügelriss zum Stehen, zog mit einem Ruck den Bremsbalken an und schlang die Gespannzügel um die Holzgriffe.
Unterdessen tasteten die Augen des Salzspahns die beiden Heckenbrüder ab, die sich seitab des Gespanns postiert hatten. Die Visage des bulligen Kerls schräg zu seiner Linken spaltete eine blutrote Narbe von der Schläfe bis zum Kieferknochen. Die Visage sah aus, als hätte ihn jemand in glühender Holzkohle gewälzt. Der andere Wegelagerer war ein hagerer Bursche mit einem Raubvogelgesicht. Jeder hielt eine Radschlosspistole in der Faust, deren Abzugshähne jedoch nicht gespannt waren.
Berthold zuckte mit keiner Wimper, als er die Landstörzer anrief: „Was wollt ihr von uns?“
„Rück die Gulden heraus, Salzkutscher“, verlangte der Bullige, der offenbar der Wortführer der aufgetauchten Gartbrüder war. Ein hämisches Grinsen überzog seine Visage. „Danach sehen wir weiter.“
„Was für Gulden?“ Berthold sah den Schnapphahn fragend an.
„Was für Gulden?“ Das Grinsen in der Galgenvisage des Bulligen erlosch. „Wenn du mich auf den Arm nehmen willst, Bursche, musst du früher aufstehen. Die Gulden, die ihr beim Salzverkauf in Calbe bekommen habt, meine ich.“
Berthold hob bedauernd die Schultern. „Den Verkaufserlös befördert ein Postreiter im Felleisen“, log er mit unbewegter Miene. Er musste den Wegelagerern ja nicht alles auf die Nase binden.
Dem Bulligen lief die Galle über. „Willst du uns für blöd verkaufen, du Rotzbengel?“, blaffte er. „Ja, glaubst du im Ernst, wir wissen nicht, dass alle Salzkarren mit Verstecken ausgestattet sind, damit die Verkaufserlöse darin verstaut werden können? Glaubst du das wirklich?“
Natürlich wusste Berthold, dass eingesessene Räuberbanden in den Umschlagplätzen ihre Zuträger und Gewährsleute hatten, die ihnen verrieten, wann und wo es etwas zu holen gab. Vielleicht kam der Hinweis, der den Überfall des Bulligen überhaupt erst ermöglicht hatte, ja tatsächlich vom Calbenser Schiffsanleger. Vielleicht schwatzte er aber nur Unsinn.
Statt einer Antwort zuckte er wiederum die Achseln.
Die Galgenvisage des Bulligen färbte sich dunkelrot. Einen Atemzug lang schien es, als würde er in einem Wutanfall auseinanderplatzen wie eine überreife Frucht. Ungehalten schrie er: „Rück die Gulden raus! Wo hast du sie versteckt? Zeig und das Geheimfach!“
„Ich hab doch gesagt, dass der Verkaufserlös im Felleisen eines Postreiters steckt“, wiederholte Berthold gelassen, während seine Rechte den Holzstiel und die zusammengerollte Lederschnur der Karbatsche umschloss. Er ahnte, was als Nächstes folgen würde. In Gedanken schätzte er bereits den Abstand, den brauchte, um sein Vorhaben zu verwirklichen.
„Genug jetzt! Los, runter vom Bock!“, schnaubte der Bullige. „Du wirst schon reden, verfluchter Salzkutscher! Und wenn nicht, schlitzen wir dich auf und reißen dir die Gedärme raus!“
Zornbebend legte er den Daumen auf den Hahn seiner Radschlosspistole und spannte ihn. Der Hagere mit dem Raubvogelgesicht tat es ihm gleich.
Berthold zeigte kein Erschrecken. Es dauerte einen Moment, bis er mit der zusammengerollten Karbatsche vom Sitz sprang.
Noch bevor Berthold freilich auf dem Boden stand, lag der Karbatschenstiel in seiner herabhängenden Faust. Die geflochtene Lederschnur rollte ab.
Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, dass auch der zweite Frachtwagen zum Stehen gekommen war. Aber die Schoßkelle war leer und der Gespannlenker verschwunden, als hätte ihn die Erde verschluckt. Der Himmel mochte wissen, wo Wilm Pollner steckte!
Doch an den bejahrten Lohnfuhrmann verschwendete er jetzt keinen Gedanken. Er war sich sicher, dass Wilm genau das Richtige tun würde.
Berthold ging auf die Landstörzer zu. Im Stillen zählte er die Schritte. Eins, zwei, drei ... Die Karbatschenschnur schleifte über den grasbewachsenen Wegrand.
Gleichwohl schluckten die Wegelagerer ein paarmal, denn der junge Salzspahn war ein hochgewachsener Bursche. Jetzt, da er aufrecht in seinen Stiefeln stand, mochte er über sechs Fuß messen.
Aber der Anflug von Unentschlossenheit in den Visagen der Räuber erlosch umgehend. Ach was, besser konnten sich die Dinge gar nicht entwickeln. Die Bereitwilligkeit des Salzkutschers, ihre Anweisungen zu befolgen, war klar als das zu deuten, was es war: Ein Eingeständnis seiner Furcht. Und die Peitsche, die der Bursche bei sich trug, war ein Fuhrmannsutensil ...
Trotz aller bestärkenden Erkenntnisse glomm letztlich Misstrauen in den Augen des Bulligen auf. „Was, zum Teufel, willst du mit der Peitsche, he?“, schnauzte er und schlug die Radschlosspistole auf den Salzspahn an.
Dann ging alles rasend schnell, zu schnell für den Bulligen.
Ein Zucken von Bertholds Handgelenk jagte die Karbatschenschnur auf den Gartbruder zu. Die geflochtene Lederschnur traf die Pistolenfaust des Wegelagerers so zielsicher wie eine zustoßende Giftschlange.
Aufheulend riss der Bullige die blutende Hand zurück. Die Radschlosspistole krachte, Pulverdampf brodelte. Doch der Schuss löste sich erst, nachdem der Salzspahn mit der Karbatsche getroffen hatte. Der Räuber verriss die Waffe und lenkte die Kugel in den Waldsaum. Mit einem Schmerzensschrei ließ er sie ins Gras fallen.
Zu spät begriff auch der Hagere, dass der Salzspahn die Karbatsche nicht nur als zunftüblichen Gegenstand dabei hatte. Er war von dem plötzlichen Angriff auf seinen Kumpan so überrascht, dass mehrere Atemzüge verstrichen, ehe eine Reaktion von ihm erfolgte. Derweil pfiff die Karbatschenschnur erneut durch die Luft.
Bevor der Hagere seine Radschlosspistole abfeuern konnte, umwickelte die heransausende Lederschnur seinen Arm. Ein heftiger Ruck riss den Schnapphahn halb herum. Und dann stand der junge Salzspahn wie hingezaubert vor ihm.
Im nächsten Moment schwang der lederumwickelte Karbatschenstiel nach vorn. Der wuchtige Stoß, der den Hageren am Kinn traf, schleuderte ihn der Länge nach ins Gras.
Von den Raubgesellen blieb noch der Kerl übrig, der zuvor den Fahrweg gesperrt hatte. Dieser schob sich gerade mit schussbereitem Faustrohr im Anschlag um die Vorderpferde herum. Wenn der Räuber jetzt den Abzug betätigte, ging es um Bertholds Leben.
„Lass das Rohr fallen!“, erklang da eine Stimme im Rücken des Wegelagerers.
Der Landstörzer zuckte zusammen, zögerte jedoch. Er war unsicher, wie er sich verhalten sollte.
Hinter ihm klirrten die Worte wie zerberstendes Glas: „Keine Bewegung mehr, sonst puste ich dir ein Loch in deinen Grindschädel! Also los!“
Ein Blick auf die Schoßkelle erleichterte dem Wegelagerer die Entscheidung. Von dorther richtete jetzt auch Gernot Winscheffel eine Pistole auf ihn.
Entmutigt kam der Kerl der Aufforderung nach und ließ das Faustrohr fallen. Nunmehr trat Wilm Pollner mit einem Grinsen im faltigen Gesicht hinter ihm hervor und nickte dem Salzspahn zu. In jeder Hand hielt er eine Radschlosspistole.
Berthold erwiderte sein Kopfnicken. In der kurzen Zeitspanne, in der die Wegelagerer abgelenkt gewesen waren, musste der Alte um das vordere Fuhrwerk herumgeschlichen sein.
„Geh da rüber, Spitzbub!“, winkte Wim Pollner mit seinen Pistolen den dritten Wegelagerer in Richtung des bulligen Schnapphahns, neben dem sich der Raubvogelgesichtige eben wieder aufrappelte. „Und nun lasst die Dolche und Degen mitsamt Scheide fallen, alle drei!“, fauchte er die Gartbrüder an. „Und falls ihr irgendwelche Mätzchen versucht, verpasse ich euch ein Stück Blei, klar?“
Zähneknirschend nestelten die Räuber an ihren Bandelierriemen und Gurten herum. Die Klingenwaffen fielen auf den Boden.
Berthold richtete seinen Blick auf den Bulligen. „Haut ab!“, herrschte er ihn an. „Hau mit deinen Spießgesellen ganz schnell ab, bevor wir euch wirklich ein paar Löcher ins Fell brennen! Ihr solltet es nicht darauf ankommen lassen.“
Flüche und Verwünschungen ausstoßend, verschwanden die Gartbrüder im Gebüsch.
Berthold winkte dem Fuhrknecht. „Sammle alle Waffen ein, Gernot“, rief er ihm zu und nahm seinen Platz in der Schoßkelle wieder ein.
Der Fuhrknecht schob die Pistole auf die Ablage zurück, ergriff einen leeren Leinensack und sprang vom Bock. Im Nu stopfte er die Waffen der Schnapphähne in den Sack und warf diesen aufs Fuhrwerk.
„Fertig!“, verkündete er munter, nachdem er auf seinen Platz zurückgekehrt war. Seine Augen glühten vor Begeisterung. „Ihr seid der reinste Zauberer mit der Karbatsche, Herr!“, sprudelte es aus ihm hervor. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Solch einen Kampf ...“
„Schon gut, Gernot“, unterbrach ihn der Salzspahn. „Aber nun fahr endlich los. Oder sollen wir hier Wuzeln schlagen?“
Als die Salzwagen aus dem Waldstück herausholperten senkte sich langsam die Dämmerung übers Land.
2
Rathaus zu Staßfurt, August 1626
Vier Männer saßen an der langen Beratungstafel im Sitzungssaal des Rathauses der Salzstadt Staßfurt. Ein fünfter begab sich zu dem kleinen Schreibpult vor der mit farbigen Butzenglasscheiben ausgestatteten Fensterreihe, durch welche das Licht der Nachmittagssonne ins Saalinnere fiel.
Die vier Herren, Mitglieder des Inneren Rats und Angehörige der angesehensten Pfännerfamilien der Bodestadt, hatten in den für sie bestimmten Armsesseln Platz genommen. Sie waren vom gegenwärtigen Kommandanten der Bodestadt, dem kaiserlichen Obrist Johann von Aldringen, kurzfristig zu einer Besprechung eingeladen worden. Nein, nicht eingeladen, sondern herbefohlen.
Da es sich an diesem Augusttag um keine reguläre Versammlung handelte, hatten es die Ratsherren nicht für erforderlich befunden, die schwarze Amtstracht mit den roten Aufschlägen anzulegen. Und aus ebendiesem Grund trug Valentin von Halcke auch nicht die goldene Amtskette des Bürgermeisters.
Im Sitzungssaal herrschte Schweigen. Die Ratsherren warteten. Keiner von ihnen wusste, warum der Obrist sie hatte rufen lassen. Alle vier quälte die Ungewissheit.
Eine Vorladung zu einer Zusammenkunft, sofern es sich nicht um ein Saufgelage handelte, hatte nichts Gutes zu bedeuten. Nach einem solchen Treffen hatte Aldringens Vorgänger im Kommando, der Österreicher Johann Ernst von Scherffenberg, nämlich willkürlich vier Staßfurter Ratsherren zwei Wochen lang in den Arrest gesteckt. Diese schikanöse Behandlung lag noch kein halbes Jahr zurück. Und sie wühlte noch allen im Gedärm.
Kein Wunder also, dass die adligen Pfänner wie auf glühenden Kohlen saßen. Immerhin waren sie diejenigen gewesen, die eine solche Demütigung hatten erdulden müssen.
Hinzu kam die sonderbare Bedingung des kaiserlichen Offiziers, dass nicht der gesamte zwölfköpfige Magistrat bestellt worden war, sondern nur der sogenannte Innere Rat, den die Inhaber der vier städtischen Ämter bildeten: der Bürgermeister, der Kämmerer, der Stadtvogt und ein Ratsherr, der die Aufgaben eines Syndikus versah. Alles dies schien nichts Gutes zu bedeuten.
Die fünfte Person im Sitzungssaal nahm diskret hinter dem Schreibpult Platz. Der schmächtige, unscheinbare Mann war der Ratsschreiber Jeremias Dühlbach. Sorgfältig, ja fast penibel, als gäbe es eine Strafe, wenn nicht alles genau ausgerichtet sei, legte er seine Schreibutensilien zurecht, damit er zu gegebener Zeit notierbereit sein würde.
Da zunächst nichts geschah, ließ der Stadtschreiber seine Augen durch den Saal wandern. Die reich geschnitzten Armsessel, die lange Eichenholztafel, die mehrarmigen Wandleuchter und schmiedeeisernen Kandelaber, die dunkelbraune Holztäfelung, die bis hinauf an die kassettierte Decke reichte – das alles hatte er schon unzählige Male betrachtet.
Kurz blieb sein Blick an dem etwa fünf Fuß hohen Wappen der Salzstadt hängen, das auf die hintere Schmalseite des Saals gemalt war. Es zeigte auf einem in den rot-silbernen Farben des Erzstifts Magdeburg geteilten Schild die Figur Johannes des Täufers mit der Kreuzesfahne und dem Agnus Dei, worüber sich eine gebogene Mauerkrone mit drei Türmen erhob. Dann schaute er weiter in die Runde und fasste die Salzjunker des Inneren Rats ins Auge.
Reglos und stumm kauerte Valentin von Halcke in einem Armsessel an der rechten Längsseite der Beratungstafel. Der Bürgermeister und Salzkotbesitzer, der im sechsten Jahrzehnt seines Lebens stand, saß heute nicht an dem ihm zukommenden Platz. Vorab war ihm angezeigt worden, dass der Sessel an der Stirnseite leer bleiben müsse.
Stumm neben ihm hockte der Kämmerer Bernhard von Werdensleben. Sein Wohnhaus im Steinweg galt als eines der prächtigsten und geräumigsten in der Bodestadt. Unmittelbar nach der Besetzung der Stifte Magdeburg und Halberstadt durch Wallensteins Heerhaufen Mitte Oktober 1625 hatte der kaiserliche Obrist Scherffenberg darin Quartier bezogen. Zurzeit war es der Regimentsinhaber Johann von Aldringen, der sich mit seinem Gefolge bei ihm eingenistet hatte.
An der gegenüberliegenden Tafelseite saßen der Stadtvogt Wolf Christoph von der Tanne und der kommissarische Syndikus Wilke von Schladen, beide ebenfalls stumm wie heidnische Götzen.
Der Ratsschreiber atmete tief durch. Noch immer geschah nichts. Aldringen lässt die Ratsherren warten, dachte er. Er lässt sie absichtlich warten, um ihnen seine Macht zu demonstrieren. Er will ihnen die gähnende Kluft aufzeigen, die einen kaiserlichen Obristen von erzstiftischen Salzjunkern trennt.
Jeremias Dühlbach wusste, dass die städtische Herrschaft längst nicht mehr in den Händen der Würdenträger im Rathaus lag, sondern von Offizieren des Generalissimus Wallenstein ausgeübt wurde. Insofern war seit dem Einmarsch der katholisierten Truppen auch kaum ein Tag vergangen, an dem Chargierte kaiserlicher Regimenter sich nicht gewalttätige Übergriffe gegen die bodestädtische Einwohnerschaft angemaßt hatten.
Schließlich brach Bernhard von Werdensleben das Schweigen. Er räusperte sich und erklärte: „Seit gestern sind unter den Offizieren, die bei mir ihr Quartier aufgeschlagen haben, gewisse Aktivitäten zu beobachten. Sie treiben ihre Ordonnanzen an. Das Gepäck soll bereitstehen, wenn der Marschbefehl kommt.“
Die drei übrigen Ratsherren verzogen keine Miene.
„Ein paar Gemeine packen die Truhen der Stabsoffiziere ...“, murrte Wolf Christoph von der Tanne. „Was soll das, Bernhard? Das ist doch nichts Außergewöhnliches.“
Der Kämmerer rieb sein linkes Ohr. „Von einem besoffenen Rittmeister habe ich erfahren, dass Aldringens Regiment unsere Gegend verlassen soll. Der Befehl kommt aus dem Hauptquartier des Generalissimus Wallenstein.“
Der Stadtvogt setzte ein Lächeln auf, das jovial sein sollte, aber reichlich sauer geriet. „Hör auf, Bernhard! Gibst du dich wirklich der Vorstellung hin, dass uns dein Quartiergast rufen ließ, um persönlich Abschied zu nehmen?“
Wilke von Schladen zog gleichfalls die Mundwinkel schief. „Wir wissen doch alle, was hinter Aldringens Vorladung steckt ...“, warf er ein.
„Was denn?“, fragte Bernhard von Werdensleben, als der Syndikus nicht weitersprach.
„Geld will er!“, knurrte von Schladen. „Die Hofschranzen der katholischen Majestät brauchen Geld. Sie sind hinter unsere Gulden her wie der Teufel hinter der armen Seele.“
Von der Tanne hob die Hände, als wolle er sich auf eine höhere Instanz berufen. „Natürlich! Sie brauchen immer Geld“, pflichtete er ihm bei. „Aber sie können es nicht nur uns aus der Nase ziehen. Bei der nächsten Ratssitzung sollten wir den Antrag einbringen, dass ...“
Was er genau sagen wollte, blieb unausgesprochen, denn unvermittelt stieß jemand die schwere Eichenholztür auf. Ein Leutnant aus der Leibkompanie des Stadtkommandanten betrat den Saal und öffnete die Tür sperrangelweit.