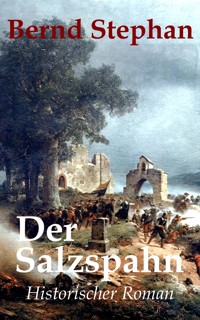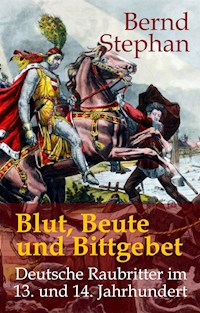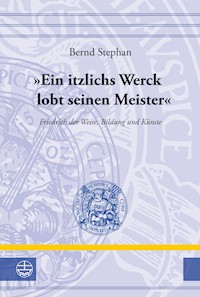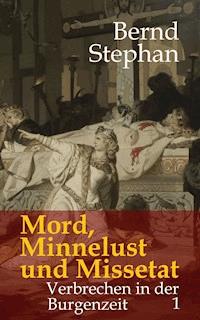
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Verbrechen in der Burgenzeit
- Sprache: Deutsch
Burg Mangoldstein im Januar 1256: Schneeflocken umtosen die Türme der Burg, als Herzog Ludwig vor dem Stufenportal des Palas sein erschöpftes Ross zügelt. Noch ehe das Pferd gänzlich steht, schwingt er sich aus dem Sattel. Er zittert am ganzen Körper, in seinen Augen lodert Hass, der sich mit der Mordlust einer tollwütigen Bestie paart. Der Wittelsbacher stößt einen Laut aus, der nichts Menschliches an sich hat, und reißt mit irrlichternden Augen sein Schwert aus der Scheide. Er sieht aus, als ob er gleich jemanden umbringen will. Und genau das ist es, was er beabsichtigt. Schon tobt er die schneebedeckten Portalstufen hinauf ... Das Mordgeschehen in der Burg Mangoldstein ist eine der geschilderten Bluttaten, deren Spur die Verbrechensgeschichte der Burgenzeit durchzieht. Aber das Buch stellt keineswegs nur Fälle von Mord und Totschlag vor. Auch Freiheitsberaubung, Ehebruch und Brandstiftung gelten als probate Mittel, um eigene Interessen durchzusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Stephan
Mord, Minnelust und Missetat
Verbrechen in der Burgenzeit 1
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Massaker in der Grafenburg
Totengeläut im Schwabengau
Unheil an der Unstrut
Gefangen auf der Reichsburg Trifels
Königsmord in Bamberg
Die Entführung auf Lyö
Eine Nacht des Schreckens
Der Schöne und die Kindsmörderin
Mordbrand in Erfurt
Bibliografie
Impressum neobooks
Das Massaker in der Grafenburg
Burg Geronisroth im Harz,
September 939
Durch die ostelbische Niederungslandschaft zog ein Reitertrupp nach Westen. Aber es handelte sich nicht um einen Beuteritt in den Nordthüringgau. Die Männer zu Pferde unterschieden sich sehr von den slawischen Kriegerhorden, die jahraus, jahrein wie ungezähmtes Wildwasser in das Grenzland am linken Elb- und Saaleufer fluteten und über die sächsischen Dörfer herfielen.
Jeder der Reiter trug ein Festgewand, das mit silbernem und goldenem Besatz versehen war. Die Hüften umschlossen reich verzierte Gürtel, an denen kunstvoll geschmiedete Schwerter hingen. Drei, vier von ihnen versteckten diese Pracht allerdings unter knielangen Pelzumhängen, in die sie sich trotz des milden Wetters eingehüllt hatten.
Vom Morgengrauen an saßen die 30 slawischen Zupane im Sattel. Sie folgten der Einladung des sächsischen Markgrafen Gero zu einem Versöhnungsfest.
Eine Notwendigkeit dazu lag vor. Seit nämlich Otto, der König der Nemitzenvölker, 937 den Edling Gero zum Legaten für das Gebiet an Mittelelbe und Saale bestellt hatte, war es an den Flussgrenzen der slawischen Stämme nicht mehr ruhig zugegangen.
Dass der sächsische Markgraf sich mit ihnen verständigen wollte, erfüllte die Slawenfürsten mit Genugtuung. Im Grunde würdigte Geros Nachgeben nur ihren bisherigen Widerstand: Je entschiedener sie den Ausdehnungsbestrebungen der Nemitzen entgegentraten, desto bereitwilliger zeigte sich der Markgraf, die Unabhängigkeit der Slawenstämme zu respektieren.
Anders konnten sich die 30 Zupane, die Mitte September des Jahres 939 durch die ostelbische Niederungslandschaft ritten, die überraschende Einladung des sächsischen Markgrafen nicht erklären. Keiner von ihnen ahnte, welch tödlichem Irrtum sie erlagen.
30 wendische Oberhäupter hatte Markgraf Gero zu dem Fest eingeladen – die Stammesfürsten der Heveller, Sorben, Daleminzer, Milzener, Sprewanen, Lusizer, Nisanen, Ploni, Neletici, Zerwisti und Morizani.
Und alle, die eingeladen worden waren, hatten dann zunächst einmal zur Wjetsche (Versammlung) zusammenkommen müssen, wo sie beratschlagten, was zu tun sei. Es gab unterschiedliche Meinungen, aber einig war man sich darin, dass man die Einladung des Markgrafen annehmen solle.
Unterwerfung: Im Jahr 937 beauftragte Otto I. den Grafen Gero, die heidnischen Wendenstämme zwischen Saale, Elbe und Oder zu unterwerfen. Durch eine Reihe von Feldzügen zwang Gero die Slawen, die deutsche Tributherrschaft anzuerkennen.
Nur Czisibor, ein Zupan der Lusizer, schätzte den Sachverhalt anders ein als seine Stammesbrüder. Im Gegensatz zu ihnen schloss er sogar einen blutigen Ausgang des Gastmahls nicht aus. Doch er mahnte vergebens, man hielt ihn für einen Schwarzseher ...
Fährboote setzten die Zupane über den Elbstrom. Es dauerte geraume Zeit, bis alle Menschen und Tiere das jenseitige Ufer erreicht hatten.
Nach der Stromüberquerung nahm gewelltes Hügelland die slawischen Reiter auf, in dem es kaum Bäume gab. Über ihnen spannte sich ein blauer Himmel.
Umklappert von Hufgeräuschen, in die sich das Knirschen des Lederzeugs und das das Schnauben der Pferde mischte, ritt Czisibor, der Zupan der Lusizer, am Ende des Zuges. Er war einer der Slawen, dem ein Pelzumhang beim Reiten bis fast auf die Stiefel wallte.
Während er so ritt, kreisten seine Gedanken um das bevorstehende Versöhnungsfest. Und es waren keine erfreulichen Gedanken.
Czisibor verzog das Gesicht, als hätte er sich die Zunge verbrannt. Fürwahr, er war in der Tat der einziger Stammesfürst gewesen, der in der Wjetsche gegen eine Zusammenkunft mit dem sächsischen Markgrafen gesprochen hatte, heftig und beharrlich.
Er misstraute den Nemitzen, witterte einen Hinterhalt. Und ungewöhnlich schien ihm dabei nicht einmal die Zusammenkunft selbst zu sein, sondern der Ort, an dem sie stattfinden sollte, nämlich in der Grafenburg Geronisroth am Rand des Harzgebirges ...
Je weiter sie nach Westen kamen, desto häufiger unterbrachen Waldstreifen das Landschaftsbild. Wenn das Hügelland den Blick freigab, dann sahen die Slawen in der Ferne jetzt das Waldgebirge des Harzes.
Die Zupane ritten durch den Gau Suevon zur Geroburg, sorglos und arglos. Die Unbekümmertheit seiner Stammesbrüder bedrängte Czisibor wie eine Dolchklinge.
Der Lusizer hingegen spähte immer wieder angestrengt hinter Bäume und Büsche, als könnten sich dort sächsische Krieger versteckt halten. Aber sein Argwohn schien unbegründet zu sein. Alles blieb ruhig.
Die noch in Pelze gehüllten Stammesfürsten litten zunehmend unter der Wärme. Czisibor legte seinen Umhang als Erster ab. Das Unbehagen, das er in sich spürte, konnte er nicht ablegen.
Gegen Abend lag Burg Geronisroth, der Stammsitz des sächsischen Markgrafen Gero, vor den Reitenden. Auf Czisibor wirkte die Grafenburg wie ein gestaltloser, durch keine baulichen Verfeinerungen gemilderter Klotz. Fast wie eine Drohung.
Mit Kreuz und Schwert
Als im Jahr 937 König Otto I. seinem Halbbruder Thankmar die Legatenwürde für die Gebiete an der Saale und der mittleren Elbe vorenthielt, brach der schon lange schwelende Zwist im Geschlecht der Liudolfinger offen aus. Eine Vergabe der Legation war durch den Tod des Grafen Siegfried von Merseburg erforderlich geworden.
In Thankmar, ein Sohn Heinrichs I. und dessen verstoßener Gemahlin Hatheburg, tobte der Zorn. Er fühlte sich nicht nur bei der Amtsvergabe übergangen, sondern auch um sein mütterliches Erbe betrogen.
Die Kränkung veranlasste Thankmar, im Bündnis mit Herzog Eberhard von Franken und dem Billunger Wichmann gegen seinen Stiefbruder zu rebellieren. 938 kam es zum Ausbruch des Aufstands.
Die Empörer brachten die Burg Belecke in ihre Gewalt, dann nahmen sie die Eresburg ein, weil sich deren Besatzung auf ihre Seite schlug. Thankmar wählte die altsächsische Befestigungsanlage zu seinem Aufenthaltsort.
Otto I. sah sich zum Handeln gezwungen. Der königliche Heerbann zog zur Eresburg, die auf einem Tafelberg über der Diemel lag. Als der König an der Spitze seiner Kriegerscharen heranrückte, ließ die eingesessene Burgbesatzung Ottos Halbbruder fallen wie ein Stück glühendes Schmiedeeisen. Sie öffnete die Tore.
Thankmar flüchtete in die Burgkapelle, um das Asylrecht der geweihten Stätte für sich zu beanspruchen. Aber ihm übelwollende Verfolger missachteten die Heiligkeit der Kapelle. Eine Wurflanze traf ihn im Rücken, der Sohn Heinrichs I. sank vornüber auf den Altar.
Wenn Otto I. geglaubt hatte, nach der Niederschlagung des Aufstands würde im Ostfrankenreich Ruhe einkehren, so sah er sich getäuscht. Im Gegenteil, die Glut des Aufruhrs schwelte weiter.
Kaum dass Otto die Empörung niedergeworfen hatte, erhob nun sein jüngerer Bruder Heinrich Ansprüche auf den Königsthron. Und dessen Auflehnung durfte der Herrscher schon gar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Heinrich war nämlich im Gegensatz zu ihm selbst, der vor dem väterlichen Königtum das Licht der Welt erblickt hatte, im Purpur geboren worden. Hinzu kam, dass ihre Mutter Mathilde den jüngeren Sohn als Nachfolger Heinrichs in der Königswürde favorisierte.
Und damit nicht genug. Denn während Otto jetzt an den Rheinstrom ziehen musste, um den Bestand des Königtums zu erhalten, stand obendrein das Land beiderseits der Grenzflüsse Elbe und Saale in Flammen. Die Annahme, dass die Slawenvölker zwischen Elbe und Oder unterworfen und dem deutschen König tributpflichtig seien, erwies sich einmal mehr als fataler Trugschluss.
Der Beginn der Eroberungszüge ins Slawenland datierte ins Jahr 928. Im Winter 928/29 fiel nach längerer Belagerung die Brennaburg, der Hauptort der Heveller. Tugumir, ein Sohn des Hevellerfürsten Bacqlabic, wurde als Geisel ins Sachsenland mitgenommen. Einige Zeit später kapitulierte Gana, die Hauptburg der Daleminzer.
Um die Slawenstämme im Griff zu behalten, bedienten sich die sächsischen Eroberer der gleichen Maßnahmen und Vorkehrungen wie anderthalb Jahrhunderte zuvor die christlichen Franken bei der Unterjochung ihrer eigenen Vorfahren – der Bekehrung durch Schwert und Kreuz.
Denn wohin immer der Fuß eines sächsischen Waffenknechts trat, folgte ihm ein eifriger Bekehrer, der den besiegten Wenden die Zwangstaufe brachte. Mit der Bekehrung der heidnischen Slawen zum Christentum sollte die Unterwerfung gefestigt werden.
Das Ziel, die slawischen Stämme bis zur Oder zu unterwerfen, verfolgten die deutschen Feudalherren mit aller Härte. Sie verfolgten es nicht nur rücksichtslos, sondern gingen mit einer ungemeinen, kaum zu übertreffenden Brutalität vor.
Natürlich nahmen die Slawen diese Bedrückung nicht einfach hin. Kaum dass der sächsische Heerbann weitergezogen war, griffen sie ihrerseits zu den Waffen, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten: Sie bemächtigten sich der christlichen Eiferer und opferten sie ihren Göttern. Die im Slawenland verbliebenen Burgwardleute reichten nicht aus, die Einheimischen von blutigen Riten abzuschrecken.
Zwangstaufe: Mit der Bekehrung der Slawen zum Christentum sollte die Unterwerfung gefestigt werden. Viele wendische Stämme widersetzten sich der Christianisierung jedoch vehement. Da die sächsischen Eroberer in Verfolgung ihrer Bestrebungen mit extremer Grausamkeit vorgingen, kam es immer wieder zu Aufständen im Slawenland.
Schlimmer noch: Während ostwärts der Grenzflüsse sächsische Kriegertrupps die slawische Bevölkerung drangsalierten, brausten slawische Reiterhorden wie das Hochwasser im Frühjahr über das Grenzland am linken Elb- und Saaleufer hinweg.
Zahlenmäßig nicht einmal ein halbes Hundert stark, schwammen sie mit ihren Pferden nachts über die Grenzflüsse und suchten das sächsische Hinterland heim. Auf ihren struppigen Pferden jagten sie in die Dörfer, raubten die Gehöfte aus, steckten sie in Brand und verschwanden nach Verrichtung ihres Zerstörungswerks ebenso schnell, wie sie aufgetaucht waren.
Am linken Ufer der Grenzflüsse waren die wendischen Plünderer zur Landplage geworden, am rechten die sächsischen Eindringlinge. So standen die Dinge an Saale und mittlerer Elbe im Jahr 939, während König Otto I. andernorts im Land seinen Herrschaftsanspruch durchsetzen musste.
Folglich kam die Verantwortung, in den Grenzgebieten für Ruhe zu sorgen und die Slawenstämme in Botmäßigkeit zu halten, auf jenen Mann zu, den König Otto zwei Jahre zuvor anstelle seines Halbbruders Thankmar zum Legaten an der Ostgrenze erhoben hatte.
An der Tatkraft gemessen hatte der König mit der Wahl des bis dahin recht unbedeutenden Edlings Gero nicht falsch gehandelt. Schon in den folgenden Wendenfeldzügen vergalt der jüngere Bruder des vorherigen Legaten Siegfried von Merseburg dem König seine Ernennung, indem er äußerst brutal gegen die ostelbischen Slawen vorging. Doch würde er die Aufgabe, die Slawenstämme neuerlich ins Joch zu zwingen, ebenfalls bewältigen können?
Nun, was Graf Gero betraf, so plante er zu diesem Zeitpunkt bereits ein Vorhaben, mit dem er die Wendenstämme an einer sensiblen Stelle treffen wollte. Ein Vorhaben von diabolischer Vehemenz. Es sollte den Beginn der endgültigen Unterwerfung der ostelbischen Slawenstämme kennzeichnen.
Mithin weitete maßloses Erstaunen die Augen der elbslawischen Zupane, als sich ihr ärgster und grausamster Feind unvermittelt erbot, ein Versöhnungsfest auszurichten und sie dazu einlud. Den Elbslawen erschien es zwar wie ein Wunder, dass man sich fortan nicht mehr gegenseitig die Glieder abhacken, sondern die Tage in Eintracht verbringen wolle, aber so eine Zusammenkunft war gleichwohl ein wichtiger Schritt zur gegenseitigen Annäherung. Sie ahnten nicht, wozu dieser Vertraute des Nemitzenkönigs wirklich fähig war.
In der Burg des Schreckens
Die Burg Geronisroth lag auf einer flachen Anhöhe im Ausgang des Hagentals. Im Westen und Südwesten umgab der Hagenbach die Befestigungsanlage, im Norden erstreckte sich Sumpfgelände bis dicht an den Rand eines Waldgebietes heran.
Ein breiter Wassergraben sowie ein mächtiger Wall aus Pfahlwerk und Erde, den ein Wehrgang krönte, schützte die ungedeckte Ost- und Südostseite der Burg. In Augenblick führte der Graben freilich nur wenig Wasser. Aus der Mitte der Anlage spross ein teils steinerner, teils hölzerner Bergfried wie ein Dorn empor und beherrschte mit seiner Höhe die Umgebung.
Das alles registrierte Czisibors Hirn, während er am Schluss der slawischen Reiterschlange auf das Tor der Befestigungsanlage zuritt, das sich im südöstlichen Wallstück befand. Jeden Burgabschnitt, jeden scheinbar nebensächlichen Bestandteil prägte er sich ein, prägte ihn sich ein mit dem Instinkt für Gefahr.
Czernebog, der Herrscher im Reich der Finsternis, mochte wissen, ob ihm die Kenntnis der Gegebenheiten nicht noch einmal von Nutzen sein würde. Momentan fand der Zupan der Lusizer den Beschluss der Wjetsche, sich in die Geroburg zu begeben, jedenfalls gar nicht mehr vorteilhaft.
Wer Einlass in die Burg begehrte, musste die Anlage zunächst im Halbkreis umreiten. Unwillkommene Gäste unterlagen somit dem Zwang, sich dem Tor so zu nähern, dass sie den Burgleuten ihre rechte, nicht vom Schild gedeckte Seite aussetzten.
Eine einziehbare Bohlenbrücke verband den Zugangsweg mit dem Innenhof der Befestigungsanlage. Das Burgtor öffnete sich unter dem Klang von Hörnern, die zur Begrüßung der Gäste geblasen wurden. Die slawische Reiterschlange zog in die Geroburg ein.
Innerhalb der Umwallung standen ein Gebäude von beachtlicher Größe, das gänzlich aus Stein errichtet worden war, und etliche Holzbauten. Der steinerne Palas bildete zusammen mit dem Bergfried den Mittelpunkt der Grafenburg.
Im Innenhof nahm der Burgvogt die Besucher in Empfang. Mit einer Handbewegung bedeute er den bereitstehenden Knechten, sich um die Pferde der Ankömmlinge zu kümmern.
Gleichzeitig trat ein Mann durch die offene Tür des Palas. Kein Mann, sondern ein Riese.
Obwohl Czisibor den Legaten des Nemitzenkönigs nie zuvor gesehen hatte, wusste er auf Anhieb, wer da erschien. Es war der Mann, bei dessen bloßer Erwähnung manchem Elbslawen ein Schauer über den Rücken lief: Graf Gero (anthropologischen Untersuchungen zufolge besaß er eine für die damalige Zeit überdurchschnittliche Körperhöhe).
Vor der Tür blieb Gero stehen und ließ seine Blicke kreisen, als wolle er die Ankunft der herbeigerufenen Wendenzupane genießen. Gut ein Dutzend Atemzüge verharrte er so. Sein weiterer Auftritt entsprach dem Ruf, in dem stand. Er polterte die fünf Treppenstufen zum Burghof hinunter, lärmte und begrüßte die Gäste leutselig.
Noch zwei Jahre zuvor hatte dieser Mann, der jetzt mit der Legatenwürde prunkte, lediglich einen Streubesitz im Nordthüring- und Schwabengau verwaltet. Gero entstammte dem Geschlecht der Grafen von Merseburg. Sein Vater Thietmar und auch sein älterer Bruder Siegfried waren enge Vertraute Heinrichs I. gewesen.
Bislang war sein Aufstieg schwindelerregend gewesen. Nun allerdings, in diesem unseligen Jahr 939, sah Gero sich durch sein rücksichtsloses Machtstreben und die ständig aufflackernden Aufstände der Wenden gegen die sächsische Oberherrschaft erstmals vor ernste Schwierigkeiten gestellt. Und er wusste genau: Wenn er es nicht auf Biegen und Brechen schaffte, die Probleme zu lösen, konnte er auf alles bisher Erreichte ein letztes Gebet sprechen ...
Nach der Begrüßung führte Gero die slawischen Zupane in die Burghalle, wo das Gastmahl stattfinden sollte. Auf dem Weg dahin bildeten etliche Burgleute ein Spalier – bewaffnete Burgleute.
Stumm verharrten sie links und rechts der Gäste wie eine eiserne Mauer. Der Anblick der Gerüsteten wirkte auf Czisibor wie eine böse Prophezeiung. Auch der Blick, den Gero und der Burgvogt tauschten, bevor der Markgraf den Gästen voranging, entging ihm nicht.
Es war Festbrauch, dass jedermann, Gastgeber wie Gäste, vor Betreten der Burghalle seine Waffen ablegte. Demzufolge schnallten alle ihre Schwertgurte ab und brachten sie in einen Nebenraum.
Natürlich wurde auf eine Durchsuchung der Besucher verzichtet, obwohl sich die sächsischen Burgleute sicher waren, dass der eine oder andere Zupan unterm Mantel oder im Stiefelschaft einen Dolch verborgen hielt. Czisibor betrat den Burgsaal als Letzter.
Unzählige Fackeln, die in Eisenringen an den Wänden steckten, erhellten die Halle. Bratenduft stieg zur Decke hoch, die im Burgsaal aufgebaute Tafel bog sich unter der Fülle der Speisen.
Und der sächsische Edling hielt noch eine Überraschung für seine Gäste bereit. Denn nachdem die Zupane den Burgsaal betreten hatten, begrüßte er jemand, den viele der slawischen Gäste gekannt hatten, ehe er vor einem Dezennium in Geiselhaft geraten war: den Sohn des Knäs Bacqlabics.
Nach der Eroberung der Brennaburg im Jahr 929 war jener Tugumir zusammen mit seiner Schwester und anderen Angehörigen des Knäsgeschlechts der Heveller in sächsischen Gewahrsam genommen worden. Wie man freilich gehört hatte, sei er inzwischen von den Nemitzen umerzogen und zum Christentum bekehrt worden. Sogar mit dem liudolfingischen Königsgeschlecht solle er familiär verbunden sein, da der frühere Thronfolger und nunmehrige König Otto seine Schwester geschwängert habe. Die Zupane fragten sich, was Tugumirs Anwesenheit zu bedeuten hatte.
Jovial lächelnd luden Gero und Tugumir die Gäste ein, sich zu setzen. Burgmägde erschienen und kredenzten Bier und Wein. Der Markgraf ergriff einen Krug und trank den Wenden zu.
Steif wurden die ersten Krüge geleert. Die Mägde schenkten neue Getränke ein, immer wieder.
Die Zeit verstrich, die Gespräche wurden freier und zotiger. Fäuste krachten auf die Tafel. Krüge klangen so heftig gegeneinander, dass das Bier überschwappte. Die ausgegossenen Getränke bildeten Lachen auf der Tafel und tropften auf den Fußboden.
Czisibor tat nur so, als trinke er. In Wirklichkeit nippte er von den Getränken. Seine Aufmerksamkeit galt dem Fortgang des Zechgelages.
Ein Teil der Zupane war bereits sturzbetrunken. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie von den Bänken kippten. Es mochte jetzt ungefähr Mitternacht sein.
Unauffällig beobachtete Czisibor den Markgrafen am anderen Ende der Tafel. Gero, Tugumir und der Burgvogt steckten die Köpfe wie Verschwörer zusammen. Weil der Burgvogt zu ihm hinstarrte, beschloss er, so zu tun, als sei er gleichfalls stockbetrunken.
Der Zupan der Lusizer spürte ein unangenehmes Kribbeln im Nacken, während er aus den Augenwinkeln die drei Männer weiter beobachtete. Wieder tuschelten sie miteinander. Die Spannung im Burgsaal schien bersten zu wollen.
Czisibor tastete nach dem Dolch in der Lederscheide unter dem Gewand. Zumindest hinsichtlich dessen hatte er Vorsorge getroffen.
Gleich darauf stand Tugumir auf, schlurfte zur Hallentür und verließ den Burgsaal. Was dann geschah, überraschte die zechenden Zupane völlig.
Unvermittelt flog die Tür wieder auf, krachend, mit Getöse. Gestalten mit gezogenen Schwertern quollen herein wie eine Flutwelle. Gero und der Burgvogt hielten plötzlich ebenfalls Schwerter in den Fäusten. Vermutlich waren diese unter ihren Umhängen versteckt gewesen.
Die Zupane zuckten zusammen und starrten entgeistert auf die Bewaffneten, die den Burgsaal füllten. Ehe sie überhaupt begriffen, dass jetzt kein Gastrecht mehr galt, zerfetzten Schwertklingen ihre Glieder. In einem Hagel von Schwerthieben sanken die ersten Slawen zu Boden und wälzten sich in ihrem Blut.
In den Augen der Gäste lag das blanke Entsetzen, ihre Muskeln waren wie gelähmt. Kaum einer von ihnen war imstande, sich zu bewegen. Die Burgknechte umringten die Tafel, ihre Schwertklingen hackten in die Körper der Slawen, aus denen das Blut spritzte. Immer wieder gellten Schreie auf, Todesschreie. Über ein Drittel der Gäste verröchelte im ersten Ansturm der Burgleute.
Czisibor sah, wie ein Schwert den Zupan der Daleminzer bäuchlings auf die Tischplatte nagelte. Aber der Zupan starb nicht sofort, sondern rief mit zorniger Stimme Czernebog an, den slawischen Herrscher im Reich der Finsternis, und verwünschte die Mordbuben.
Es war eine Fluch voll grimmiger Wildheit. Ein Todesfluch.
In dem Augenblick, in dem Czisibor das alles wahrnahm, federte er bereits hoch, den Dolch in der Faust. Noch ehe der sächsische Waffenknecht sein Schwert aus dem Körper des gemeuchelten Zupans wieder freibekam, rammte er ihm die Dolchklinge in den Hals.
Nun war auch von den anderen Überrumpelten jedwede Trunkenheit abgefallen. Auch sie griffen nach den Dolchen, die sie unter der Kleidung verborgen hatten. Mit Todesverachtung stürzten sie sich auf die Burgknechte.
Die Burgknechte mussten feststellen, dass die Wenden mit den Dolchen umzugehen verstanden. Zwei Sachsen stürzten tödlich getroffen zu Boden, ein dritter sank blutüberströmt zwischen den Bänken zusammen.
Aber die Übermacht der sächsischen Waffenknechte war erdrückend. Die eisernen Schwerter schlugen klaffende Wunden und brachen Knochen. Slawenblut spritzte bis an die Hallendecke und floss in Rinnsalen über den Fußboden. Die Burgknechte wateten in Blutlachen.
Blutiges Gelage: Ermordete Slawen nach dem Massaker in der Grafenburg Geronisroth im September 939. Bei dem heimtückischen Komplott kamen 30 wendische Zupane ums Leben.
Czisibor sah das Weiße in den Augen eines Sachsen, der ihm sein Schwert in den Leib stoßen wollte. Geistesgegenwärtig wich er zur Seite aus. Aber schon stürzten zwei, drei neue Mordbuben, darunter Gero selbst, auf ihn zu.
Blitzschnell ergriff er eine Fackel und schleuderte sie dem Markgrafen entgegen. Gero reagierte jedoch augenblicklich und sprang beiseite. Dort, wo er eben noch gestanden hatte, sauste die Fackel hernieder. Glut sprühend und qualmend fiel sie auf den Steinboden.
Jetzt hatte er wirklich nichts mehr zu verlieren. Ihm blieb keine andere Wahl, als zu versuchen, eines der Bogenfenster zu erreichen.
Die Zeitspanne, ehe die Quaderwand seinen Händen Halt bot, schien sich unendlich in die Länge zu dehnen. Mit einem federnden Satz schwang er sich auf den Fenstersims und sprang in die Dunkelheit.
Wie seine Flucht aus der Burg des Schreckens im Einzelnen vonstattengegangen war, hätte Czisibor später nicht zu berichten vermocht. Er stürzte in die Tiefe und fiel auf etwas Weiches, vielleicht auf irgendwelchen Unrat. Am rechten Fußgelenk fühlte er einen harten Schlag, der sein Bein lähmte und Übelkeit in ihm aufsteigen ließ.
Aber trotz der Schmerzen durfte er keinen Augenblick säumen. Nach Osten, rasten die Gedanken durch sein Hirn, nach Osten laufen.
Taumelnd, dann kriechend erreichte Czisibor den östlichen Burgwall, den Aufstieg zum Wehrgang. Er schleppte sich hinauf. Zu seinem Glück hatte der Mordgraf hier keine Burgleute als Wachtposten zurücklassen können.
Mühsam wälzte er sich über die Palisadenkrone, rutschte an der Außenseite hinunter und kroch auf allen vieren durch den kaum gefüllten Wassergraben. Kurz darauf wankte Czisibor mit unerträglichen Schmerzen im rechten Bein über den abgeholzten Hang vor der Grafenburg, bis der nachtdunkle Wald ihn umhüllte wie ein schützender Mantel. Dennoch: Sobald es hell wurde, würden die Verfolger seine Spuren suchen und ihn mit Bluthunden hetzen.
Aber Czisibor schaffte es, unentdeckt zu bleiben, während er sich in ständigem Misstrauen durch das Harzgebirge schleppte. Er folgte unwegsamen Waldpfaden und erreichte nach Tagen die Saale. Mit einer letzten Kraftanstrengung durchschwamm er den Fluss.
Der Fluch des Zupans