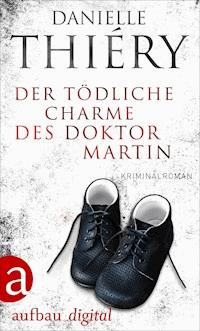Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Edwige Marion
- Sprache: Deutsch
Es herrscht eine angespannte Atmosphäre unter den Kollegen im Revier Gare du Nord: Kommissarin Edwige Marion ist nicht mehr dieselbe. Der Grund dafür ist der bildschöne Victor, mit dem sie seit zwei Monaten eine leidenschaftliche Affäre hat und der plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Als eine große Operation total schiefläuft, überlässt Marion ihren beiden engsten Mitarbeitern Abadie und Valentine die Aufarbeitung der Angelegenheit. Sie selbst steigt, einer irrationalen Eingebung folgend, in einen Zug, der sie nach Compiègne und an den Anfang ihrer Beziehung zu Victor führt. Immer tiefer wird Marion in die absurde Welt der Pendler zwischen Paris und Compiègne hineingezogen, in ihre Geheimnisse und ihre Nöte. So lernt sie Julie, Natacha und Magali kennen, drei hübsche Verkäuferinnen der Galeries Lafayette, die ihr Gehalt Tag für Tag mit Liebesdiensten auf der Zugfahrt aufbessern. Als die Kommissarin erfährt, dass „der schöne Victor“ ebenfalls ein begehrter Kunde war – vornehmlich der Visagistin Elsa, die seit ein paar Tagen offenbar abgetaucht ist – gibt Marions Ermittlerinstinkt keine Ruhe mehr ...
"Psychologische Hochspannung!" Brigitte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über Danielle Thiéry
Danielle Thiéry, geboren 1947, zwei Kinder, war Kriminalkommissarin in Paris und in den siebziger Jahren die erste Frau an der Spitze eines französischen Kommissariats. 1991 findet sie endlich die Zeit zu schreiben. Seitdem hat sie eine Fernsehserie entwickelt, an mehreren Fernsehproduktionen mitgearbeitet, einen autobiographischen Roman (Prix Bourgogne 1997) und zahlreiche Krimis (Prix Polar 1998) geschrieben.
Informationen zum Buch
Es herrscht eine angespannte Atmosphäre unter den Kollegen im Revier Gare du Nord: Kommissarin Edwige Marion ist nicht mehr dieselbe. Der Grund dafür ist der bildschöne Victor, mit dem sie seit zwei Monaten eine leidenschaftliche Affäre hat und der plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Als eine große Operation total schiefläuft, überlässt Marion ihren beiden engsten Mitarbeitern Abadie und Valentine die Aufarbeitung der Angelegenheit. Sie selbst steigt, einer irrationalen Eingebung folgend, in einen Zug, der sie nach Compiègne und an den Anfang ihrer Beziehung zu Victor führt. Immer tiefer wird Marion in die absurde Welt der Pendler zwischen Paris und Compiègne hineingezogen, in ihre Geheimnisse und ihre Nöte. So lernt sie Julie, Natacha und Magali kennen, drei hübsche Verkäuferinnen der Galeries Lafayette, die ihr Gehalt Tag für Tag mit Liebesdiensten auf der Zugfahrt aufbessern. Als die Kommissarin erfährt, dass »der schöne Victor« ebenfalls ein begehrter Kunde war – vornehmlich der Visagistin Elsa, die seit ein paar Tagen offenbar abgetaucht ist – gibt Marions Ermittlerinstinkt keine Ruhe mehr ...
»Psychologische Hochspannung!« Brigitte.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danielle Thiéry
Die Schatten der Toten
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Sabine Schwenk
Inhaltsübersicht
Über Danielle Thiéry
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Quellenangabe
Impressum
Aux étoiles amoureuses des vers luisants.
Aux poissons morts d’amour.
Für Rose, Rose Michot, meine Rose.
Wenn die Liebenden fallen –
die Liebe fällt nicht.
Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.
Dylan Thomas
1
Gare du Nord, Paris, 10. Arrondissement.
Sonntag, 18 Uhr.
Ein doppelter Kordon in Dunkelblau säumte den Bahnsteig von Gleis 7 – etwa dreißig Männer der Bahnhofspolizei, deren breite Schultern und steife Haltung auf schusssichere Westen und schwere Bewaffnung hindeuteten. Ein wenig abseits, ungefähr zehn Meter vor dem Gleisende, hielten sich die Männer der RAID-Eliteeinheit bereit, unter schwarzen Kapuzenmützen und bis an die Zähne bewaffnet.
Langsam schwebte über den Schienen von Gleis 7 eine Hebebühne und wurde in Position gebracht. Auf der Plattform standen Hauptkommissarin Edwige Marion und ihr Teamkollege Guy Flament, der die Männer des RAID befehligte. Beide steckten in Einsatzuniformen, trugen Lederhandschuhe, Springerstiefel und Schirmmützen und waren dabei, die Umgebung mit Ferngläsern abzusuchen.
Während Flament sein Polizeiaufgebot überprüfte, nutzte Marion den Moment, um ihre Mütze abzunehmen und sich Luft zuzufächeln. In dieser Höhe, so dicht unter dem Glasdach, war die Julihitze kaum zu ertragen. Als Marion bemerkte, dass sie nur die stickige Luft hin und her bewegte, setzte sie resigniert die Mütze wieder auf. Mit einem Blick durchs Fernglas vergewisserte sie sich, dass alle Leute auf ihren Posten waren: Capitaine Abadie, der den Einsatz im öffentlich zugänglichen Teil des Bahnhofs leitete, Capitaine Garnier am Nordende des Bahnsteigs, und dazwischen Lieutenant Cara. Jeder war für ein knappes Dutzend Beamte verantwortlich. Lieutenant Wolsky, der an einer noch nicht auskurierten Armverletzung litt, kontrollierte den Außenbereich des Bahnhofs, so dass Marion ihn nicht sehen konnte. Sie warf einen letzten prüfenden Blick auf die Fahrzeugkolonne, die zwischen Gleis 7 und 12 postiert war. Fünf einsatzbereite Kleinbusse inklusive Besatzung, darunter ein medizinisches Betreuerteam.
»Fertig!«, hörte Marion neben sich die Stimme von Kommissar Flament.
»Alles klar?«, fragte sie.
Flament hob als Antwort den Daumen, ohne sie anzublicken.
Jetzt blieb ihnen nur noch eins: warten. Marion spürte, wie sich alles in ihr zusammenschnürte. Warten … Das Wort stieß ihr wie eine heiße Stahlklinge ins Herz. Warten … Auf den Zug, die Nacht, die Ferien, das Gehalt, das Monatsende, den Tod. Ihr war so, als hätte sie schon immer nur das getan: warten. Warten worauf? Oder auf wen? Für den Augenblick lag die Antwort klar auf der Hand: Sie wartete auf Lovici. Einen gerissenen Ganoven. Er war der Grund für dieses beeindruckende Polizeiaufgebot, bei dem höchste Alarmstufe galt.
Doch im Grunde war Marion dieser Lovici reichlich egal. Sie wartete auf einen anderen Mann, verzweifelt. Niemand wusste, was sie durchmachte, nur ihren engsten Mitarbeitern war vielleicht aufgefallen, dass etwas an ihr nagte, das Tag für Tag deutlichere Spuren hinterließ: mangelnde Konzentration, Unruhe, plötzliche Antriebsschwäche und manchmal ein erstaunliches Fehlen von Pflichtbewusstsein. In den letzten zehn Tagen hatte sich ihr psychischer Zustand zusehends verschlechtert. Seit zehn Tagen wartete sie.
Flament gab einen Befehl, der Marion schlagartig auf die Plattform über dem Gleis zurückholte. Sie hatte einen Job zu erledigen. Dies war nicht der Moment, sich in Gedanken an ihren Geliebten zu verlieren.
Sie holte tief Luft, um den Druck von ihrer Brust zu nehmen. Wenn sie sich Flament hätte anvertrauen können, hätte er erfahren, dass die Falte auf ihrer Stirn und der dunkle Schatten, der über ihrem Gesicht lag, nichts mit der anstehenden Überführung eines in die Jahre gekommenen Gangsters zu tun hatten.
Zehn Tage Funkstille. Eine lange Zeit.
Marion sah zu den Männern der Eliteeinheit hinüber, die ihre Positionen eingenommen hatten, dann auf die digitale Anzeige der Bahnhofsuhr.
»Sieben Minuten«, sagte sie in ihr Mikrofon.
Im zweiten Untergeschoss des Bahnhofs, wo sich der zentrale Lage- und Führungsraum befand, rückte Capitaine Amel Mikrofon und Kopfhörer zurecht. Er nahm den Knopf aus dem Ohr, durch den er die Informationen der Zugverkehrsüberwachung mithören konnte. Obwohl die Klimaanlage auf Hochtouren lief, stand ihm der Schweiß auf der Stirn. Er atmete tief durch:
»Der Zug hat gerade Saint-Denis passiert«, sagte er. »Voraussichtliche Einfahrt in den Bahnhof 18 Uhr 12.«
»Position der Zielperson bestätigt?«
»Bestätigt.«
»Roger«, murmelte Marion.
Unmittelbar darauf verkündete die Lautsprecheranlage, dass der Zug in wenigen Minuten auf Gleis 7 erwartet werde. Auf dem Bahnsteig setzten sich Marions Leute und die Männer des RAID wie eine eingespielte Balletttruppe in Bewegung, um sich in dem Abschnitt, wo Wagen 1 halten würde, aufzustellen.
In diesem Wagen sollte Albin Lovici – früher auch »der schöne Albin« genannt – eintreffen, ein Bandenchef, dessen Taten nicht nur Frankreich, sondern auch Belgien, Holland, Deutschland und sogar die Schweiz lange in Atem gehalten hatten. Albin Lovici, der berühmte Tausendsassa der Unterwelt, vielfach verurteilt und seit Jahren in Belgien inhaftiert, zählte zu jenen legendären »Teufelskerlen«, die insgeheim die Phantasie jedes Polizisten beflügelten.
Was nun seine Überführung nach Paris betraf, so hatte Marion lediglich den Empfang in der Gare du Nord organisiert. Die Entscheidung für den Zug als Beförderungsmittel hatte sie äußerst kritisch zur Kenntnis genommen, denn er stellte in ihren Augen ein enormes Risiko dar. Man hatte ihr entgegnet, dass Lovici keine besondere Gefahr drohe und es überflüssig sei, sich darüber weiter den Kopf zu zerbrechen. Als brave Polizeisoldatin hatte sie sich gefügt.
Natürlich widersprach das unglaubliche Aufgebot zu Marions Füßen der Behauptung ihrer Chefs. Und so wurde die Hauptkommissarin schon den ganzen Tag von einer inneren Stimme begleitet, die ihr beharrlich einflüsterte, dass mit dem Schlimmsten zu rechnen sei.
Auf seinem Posten im Lage- und Führungsraum sah Amel, wie eine Frau, offensichtlich eine Zigeunerin, ins Bild der Überwachungskamera lief. Dann verschwand sie in einem toten Winkel, um kurz darauf am Rand der Terrasse des Restaurants Alizé wieder aufzutauchen. Jetzt konnte man das Paket, das sie in den Armen hielt, gut erkennen.
»Verdammte Scheiße!«, brummte Amel und presste eine Hand gegen die Brust.
Ein schmerzhaftes Stechen zog durch den linken Arm des Beamten, sein rundes Gesicht wurde fahl. Er hob die Hand an den Kopf, riss sich das Headset herunter und gab es an Major Morel weiter.
Der Major wollte protestieren, aber Amel steuerte bereits auf die Toilette zu. Morel sah ihm nach, die sonderbare Erscheinung seines Vorgesetzten ließ ihn mit einem Mal aufmerken. Der Capitaine sah aus, als hätte er seit Tagen nicht mehr das Hemd gewechselt. An seinem Kragen machten sich unappetitliche Schweißränder mit Millionen von Schuppen, die aus dem kurzgeschorenen Haar gefallen waren, den Platz streitig. Morel kannte diese Symptome von früher nur zu gut – eine lange Depression, bedingt durch den Alkohol und die Trennung von seiner Frau, die ihn verlassen hatte, eben weil er trank.
Mit einem Stoßgebet, dass während Amels Abwesenheit bloß nichts passieren möge, setzte Morel den Kopfhörer auf. Vor allem durfte Marion niemals erfahren, dass er, »der alte Morel«, während eines so großangelegten Einsatzes den Chef des Lage- und Führungsraums vertreten hatte.
Im selben Moment bemerkte der Barkeeper Manuel Ortega am Eingang zum Alizé, das die Polizisten komplett geräumt hatten, die Zigeunerin. Sie war nur wenige Meter von ihm entfernt. In lange, bunte Rockschichten gehüllt, lief sie mit einem in Lumpen gewickelten Bündel über die Terrasse. Große goldene Ringe leuchteten an ihren Ohren und klirrten leise. Doch der Schmuck konnte nicht über ihr gezeichnetes Gesicht hinwegtäuschen. Manuel wurde regelrecht übel beim Anblick der wulstigen Narben, die zwischen Auge und Kinn eine ganze Gesichtshälfte entstellten. Die Augenlider der Frau waren entzündet, die Haut so ledrig wie die eines Brandopfers. Sie ging dicht an Ortega vorbei, ihm fielen ihre bleiche Stirn und ihre seltsamen Zuckungen auf. Doch erst als die Frau die letzten Tische der Terrasse hinter sich gelassen hatte, entdeckte er den langen Dolch in ihrer freien Hand. Sie war nur noch wenige Meter von der Absperrung und den Polizisten entfernt, die alle in die andere Richtung schauten, dorthin, wo sich das Gros der Einsatzbeamten in Bereitschaft hielt. Wenn die Frau vorhatte, mit ihrem Messer auf die Polizisten loszugehen, dachte Ortega, dann würde sie sofort von einer Kugel niedergemäht. Inzwischen hatte sie die Sicherheitssperre erreicht, und nur noch wenige Schritte trennten sie von einem Polizisten, der ihr den Rücken zuwandte und keinerlei Notiz von dem nahm, was hinter ihm vor sich ging. Manuel sah wie in Zeitlupe, dass die Zigeunerin ihren Arm hob. Unwillkürlich riss er den Mund auf, obwohl er sich erst zehn Sekunden zuvor geschworen hatte, sich so wenig wie möglich in anderer Leute Dinge einzumischen. Sein Schrei erstarb, bevor er überhaupt zu hören gewesen wäre, als sich die Frau die Klinge in die Brust rammte. Sie zog den Dolch aus der Wunde und stach sich in den Hals, dann in den Unterleib und schleuderte schließlich die blutverschmierte Waffe von sich, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt hätte. Wie erstarrt wartete Manuel darauf, dass sie zusammenbrach. Doch sie blieb stehen und begann zu brüllen wie ein Tier. Die beiden Polizisten vor ihr zuckten zusammen und drehten sich gleichzeitig um.
Manuel Ortega befand, dass es nun ratsam wäre, unauffällig zu verschwinden.
Auf ihrem Beobachtungsposten über den Gleisen nahm Marion die Unruhe wahr, die plötzlich herrschte. Sie hörte Schreie. Mit dem Fernglas machte sie Capitaine Abadie aus, er ging auf die Sicherheitszone zu. Dann entdeckte sie, zwischen zwei Beamten, die undeutliche Silhouette einer in bunte Stoffe gehüllten Frau, die etwas im Arm hielt, das wie ein eingemummtes Baby aussah. Das arme Kind, bestimmt kam es unter den vielen Tüchern vor Hitze fast um!
Zumindest war das Marions erster Gedanke.
Gerade wollte sie Abadie auffordern, die unerwünschte Person zu entfernen, da machte einer der Beamten, der den Kopf der Frau verdeckt hatte, eine Bewegung, und Marion sah ihr Gesicht. Es war rot. Blutrot. Ebenso wie ihre Brust und ihre Hände, von denen Blut auf die Tücher tropfte, in die der Säugling gewickelt war.
»Alpha 2, was ist los?«, erkundigte sich Marion über Funk bei Abadie.
»Sie hat Messerstiche abbekommen. Das sagt sie zumindest.«
Durch das Fernglas ließ Marion ihren Blick über die Zone rings um die Verletzte schweifen. Jenseits der Absperrung bückte sich ein Mann und richtete sich schnell wieder auf. Sein Gesicht konnte sie nicht erkennen, nur den fast kahlen Hinterkopf, die Statur und einen hellen Blouson, der ihr irgendwie bekannt vorkam. Eine zweite Person schob sich in Marions Blickfeld.
»Chef, was sollen wir tun?« Abadies Stimme in ihrem Ohr klang angespannt.
Marion kam nicht dazu, etwas zu antworten. Schon eilten zwei Mitarbeiter des Ärzteteams durch die abgesperrte Zone. Sie gingen zu der Frau, um sie zum Krankenwagen zu führen. Sie hinterließ eine rote, feuchte Spur auf dem Boden, die ein seltsames Unbehagen bei Marion auslöste.
»Chef, hören Sie mich?!« Abadie wurde ungeduldig.
Flament, der die Gleisstränge im Auge behielt, stieß Marion mit dem Ellbogen an, worauf sie ihren Blick von der Frau löste.
»Achtung, Achtung! Alle aufpassen!«, mahnte er mit seiner tiefen Stimme. »Zielobjekt in zweihundert Meter Entfernung! Halten Sie sich bereit!«
Die spitze Nase des Thalys schob sich langsam in die Kurve vor der Einfahrt in den Bahnhof.
Die verletzte Frau brüllte auf. Beunruhigt beobachtete Marion durch ihr Fernglas die Ärzte, die mit ihr beschäftigt waren.
»Alpha 2, durchsuchen Sie die Frau«, befahl sie Abadie und schnappte nach Luft.
»Ich? Aber …«
»Beeilen Sie sich!«
»Roger!«
»Und sehen Sie zu, dass sie da wegkommt!«
In diesem Moment glitt die Führerkabine des Zuges unter ihnen vorbei. Ein Luftschwall trieb ihr den heißen Ölgeruch in die Nase, der aus dem Triebwagen aufstieg. Die Bremsen kreischten, der Zug kam am Prellbock zum Stehen.
»Türen auf!«, befahl Marion.
Flament hatte sein Gewehr leicht angehoben und starrte unverwandt auf die Tür, durch die Albin Lovici treten würde.
Abadies Stimme hallte in Marions Ohr: »Chef, hier Alpha 2! Durchsuchung negativ. Ich wiederhole, Durchsuchung negativ. Die Frau ist am Hals und auf Höhe der Milz verletzt. Wir warten auf einen Krankenwagen, um sie abzutransportieren.«
Aus dem Thalys stieg nun eine Gruppe belgischer Polizisten, dicht gefolgt von einem Rollstuhl, in dem Lovici saß und der von zwei Trägern hinausgehievt wurde. Der Alte sah abgezehrt aus, die weißen Haare waren zu lang, die dürren Hände ruhten auf den Knien seiner X-Beine. Er machte einen erschöpften Eindruck. Wahrscheinlich litt er an einer Krankheit, die ihn daran hinderte, sich selbständig fortzubewegen. In seiner schutzsicheren Weste sah er aus wie ein großer Frosch mit mageren Beinen und aufgeblähtem Bauch.
Marion ließ ein letztes Mal ihren Blick über die abgesperrte Zone und die Polizeiwagen schweifen, deren Fahrer gerade die Motoren angelassen hatten. Sie zuckte zusammen, als sie auf der Motorhaube des Krankenwagens das Tuchbündel liegen sah. Mit zugeschnürtem Hals und einer bösen Vorahnung zoomte sie es heran. Adrenalin jagte ihr durch die Adern.
Albin Lovicis Rollstuhl war nur noch etwa zehn Meter vom ersten Auto der Eliteeinheit entfernt. Leibwächter geleiteten ihn. Weitere Männer befanden sich in den Fahrzeugen und waren ringsum postiert. Plötzlich schoss Marion ein Bild durch den Kopf, das schreckliche Bild, wie all diese Leute auf dem Boden lagen, von Kugeln durchsiebt oder in Stücke gerissen durch eine Bombe. Ihr Puls raste.
»Abadie!«, schrie sie und vergaß dabei alle Regeln des Funkverkehrs. »Entfernen Sie alle Leute aus Ihrer Zone! Schnell!«
Es folgte ein unschlüssiges Schweigen.
»Das Bündel auf der Motorhaube des Krankenwagens! Gehen Sie weg dort! Beeilung! Und schalten Sie die Frau aus!«
»Wie?«, stammelte Abadie in sein Mikrofon. Da er am Heck des Krankenwagens stand, begriff er nicht, was Marion von ihm wollte. Dennoch begann er wild gestikulierend, die Leute um den Wagen zu vertreiben. Aber es ging nicht schnell genug.
»He, du da!«, schrie Marion dem Bediener der Hebebühne zu. »Hol uns runter! Los!«
Flament, der Albin Lovici die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatte, verstand nicht sofort, was plötzlich in Marion gefahren war. Es vergingen noch ein paar Sekunden, bis er über das Geländer auf den Bahnsteig sprang, wo sich die Polizisten alle Mühe gaben, die Befehle auszuführen, ohne in Panik zu geraten. Die belgischen Beamten hatten einen Schutzwall in Schildkrötenformation um Lovicis Rollstuhl gebildet. Und Flaments Eliteeinheit begann nun, einen Ring um ebendiesen Bewachungstrupp zu formen, der unbeeindruckt weiter vorrückte.
Während die Lage immer unübersichtlicher wurde, sprang auf einmal die Zigeunerin von ihrer Trage. Mit einer Gewandtheit, die angesichts ihrer Verletzungen erstaunlich war, gelang es ihr, nicht nur den Ärzten, sondern auch den Polizisten zu entkommen. und zur Kühlerhaube des Krankenwagens zu stürzen.
»Achtung!«, schrie Marion, während die Frau das Tuchbündel packte und die Hebebühne mit einem letzten Ruckeln auf dem Boden aufsetzte.
Brüllend und mit irrem Blick stürmte die Zigeunerin auf Lovicis Rollstuhl zu. Sie riss die Tücher von dem Bündel, schleuderte sie ihren Verfolgern zwischen die Beine und schwenkte drohend eine Uzi.
Auch Marion war inzwischen losgerannt, entsetzt starrte sie auf die Maschinenpistole in der Hand der Verletzten.
»Haltet sie auf!«, brüllte sie, traute sich jedoch nicht, den Schießbefehl zu geben.
Das simultane Knacken von einem Dutzend Pistolenverschlüssen jagte ihr einen kalten Schauer über den Rücken.
»Keiner schießt ohne Befehl!«, schrie sie. Rechts neben ihr rannte Flament los.
Die Zigeunerin lief in Marions Richtung, sofort sprintete die Kommissarin ihr entgegen, um der Frau den Weg abzuschneiden. Die um Lovici gruppierten Beamten hatten inzwischen ebenfalls einen Schritt zugelegt. Unter den wehenden Haaren des Alten kam sein hageres, gelbliches Gesicht mit zwei glühenden Augen zum Vorschein, in denen ein Feuer brannte, das wohl keine Krankheit und nicht einmal der Tod jemals auslöschen würden. Marion spürte, wie ihr die heiße, staubige Luft die Kehle austrocknete.
Sie erreichte die Zigeunerin nicht mehr. Eine massige, bewaffnete Gestalt prallte so heftig gegen die Kommissarin, dass es ihr die Beine wegriss und sie in das Loch zwischen Bahnsteig und Prellbock stürzte. Benommen nahm sie die Schreie der tobenden Frau wahr, die auf Lovici zustürmte. Dann den ersten Feuerstoß aus der Maschinenpistole. Befehle ertönten, und es folgten zwei Detonationen. Ein schwerer Gegenstand flog durch die Luft und schlug gegen Marions Schläfe, worauf sie endgültig in Ohnmacht fiel.
Im Restaurant Alizé waren die Detonationen und das Geschrei bis in die Toilette zu hören, wo sich Manuel Ortega verschanzt hatte. Mit flauem Magen wurde ihm bewusst, dass die Lage ernst war.
»Verdammte Scheiße!«, fluchte er und bedauerte es, sich an diesem Tag überhaupt im Bahnhof aufzuhalten. Jetzt würden die Bullen natürlich kommen und ihn verhören, um zu erfahren, was er gesehen hatte.
Er beschloss, sein Versteck zu verlassen. Doch auf der Schwelle zum Restaurant blieb er wie angewurzelt stehen. In dem von der Polizei abgeriegelten Bereich herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Mehrere Menschen lagen auf dem Boden, zwischen ihnen ein umgekippter Rollstuhl, der dieser Szene eine beinahe surrealistische Note gab.
Manuel erkannte Kommissarin Marion, die taumelnd durch das Chaos wankte. Ihr Gesicht war schmutzig und blutverschmiert. Sirenen übertönten den Lärm der panischen Menge. Mehrere Rettungsfahrzeuge rollten heran, mit ohrenbetäubendem Geräusch schien ein Hubschrauber auf der Place Napoléon III zu landen. Das Geknatter der Propeller dröhnte Manuel in den Ohren.
Während die Leute im Bahnhof aufgeregt durcheinanderrannten, rührte sich Manuel nicht vom Fleck. Er sah weiß und grün gekleidete Männer durch die Sperrzone hasten. Feuerwehrleute kamen mit Tragen herbeigeeilt. Bei der Vorstellung, dass man ihn womöglich als Komplizen dieses Massakers vor Gericht stellen würde, begann er zu schwitzen wie ein Stier. Er nahm seine alberne Barkeeper-Fliege ab und knöpfte den Kragen auf. In diesem Augenblick sah er Vlad näher kommen. Leichenblass, was angesichts der Situation durchaus verständlich war, und mit leicht verzogenem Gesicht, wie so oft. Die Versuchung, noch schnell die Flucht zu ergreifen, war groß, aber Manuel begriff, dass Vlad ihn bereits entdeckt hatte. Er steuerte direkt auf ihn zu und baute sich schließlich so dicht vor ihm auf, dass dem Barkeeper sein Körpergeruch in die Nase schlug.
Plötzlich spürte Manuel, wie sich Vlads Hand auf das längliche Portemonnaie legte, das er über der Kellnerschürze trug; er spürte, wie der Reißverschluss geöffnet und etwas hineingeschoben wurde. Dann drehte sich der Mann wortlos um und verschwand.
Bis zu diesem Moment war Manuel immer der Ansicht gewesen, dass er alles in allem ein ziemlicher Glückspilz war. Doch während er nun seine Tasche mit dem Ding betastete, das Vlad ihm hineingesteckt hatte, überkam ihn das dumpfe Gefühl, dass der günstige Stern, der ihn bisher geleitet hatte, im Begriff war zu verlöschen. Schweißperlen rannen ihm über das Gesicht, das so grau war wie ein Gewitterhimmel. Starr vor Angst zog er sich hinter die Bar zurück.
2
Sie schläft. Unter ihren Lidern, die von einem Geflecht aus blauvioletten Äderchen überzogen sind, zucken die Augen. Ihre schmale Nase kräuselt sich, zwischen den Brauen entsteht eine Falte. Dünne Linien zeichnen ihre Stirn, sie sprechen von Angst und Schmerz.
In der Ferne erhebt sich ein Grollen wie von einem gewaltigen Gewitter. Während ein Beben durch ihren schlanken Körper geht und an der Schläfe eine Vene anschwillt, fixiert der Mann die geschlossenen Augen der Frau. Das Geräusch wird lauter, kommt näher, prallt krachend gegen die Wände, ein Toben, als würde die Welt untergehen. Sie bäumt sich auf, ihre zusammengeketteten Füße stoßen klirrend gegen die Metallstangen des Bettes. Er stellt sich ihr Herz vor, wie es zappelt, gefangen unter ihren Rippen.
Gare du Nord.
Montag, 7 Uhr.
Als Marion ihre Dienststelle endlich verlassen konnte, brach nach einer endlosen, verworrenen Nacht bereits der Tag an. Unaufhaltsam hatten sich die Ereignisse aneinandergereiht. Selbst jetzt, nachdem sie Stunden damit zugebracht hatten, die Geschichte zu rekapitulieren und in unzähligen Berichten festzuhalten, konnte Marion nicht mit letzter Bestimmtheit sagen, was sich eigentlich zugetragen hatte. Die Kollegen hatten sofort mit der polizeilichen Untersuchung begonnen. Marion war unter dem Vorwand, sie stehe unter Schock, von den ersten Ermittlungen ausgeschlossen worden. Man hatte sie längere Zeit in einem Krankenwagen festgehalten, und erst als sie sich richtig aufregte, sah man davon ab, sie auch noch zusammen mit Wolsky ins Krankenhaus zu bringen. In dem Chaos war irgendetwas mit der Armverletzung ihres Kollegen passiert. Marion wusste nicht genau, ob er auf seinen lädierten Arm gefallen war oder eine verirrte Kugel abbekommen hatte, denn der Beamte lag wie die anderen Verletzten immer noch auf der Unfallstation des Hôpital Lariboisière. Die korpulente Gestalt, die Marion umgerissen und vom Bahnsteig gestoßen hatte, war er gewesen. Aber sosehr sie auch grübelte, eine präzise Erinnerung an diesen Moment wollte nicht aufleuchten. Auch den Gegenstand, durch den sie für zwei oder drei Minuten die Besinnung verloren hatte, wusste sie nicht zu identifizieren. Zudem fragte sie sich, was Wolsky eigentlich dort verloren hatte. Warum hatte er seinen Posten auf dem Bahnhofsvorplatz verlassen und war mitten in die Schießerei geraten?
Flament war nur so lange wie nötig geblieben. Ausgerechnet er, ihr langjähriger Freund, hatte sich ohne ein tröstendes Wort davongemacht, ja nicht einmal verabschiedet hatte er sich von ihr. Wenn er damit zum Ausdruck bringen wollte, dass sie die alleinige Verantwortung für das Fiasko trug, dann war es ihm gelungen! Seltsamerweise ließ dieser Treuebruch Marion jedoch relativ kalt.
Mitten im Bahnhof, durch den die Pendler bereits strömten wie ein Hochwasser führender Fluss, blieb Marion stehen, zog ihr Handy aus der Tasche und drückte auf die Taste 1. Eine Nummer tauchte auf, ein Vorname. Eine Nummer, die sie auswendig kannte und dafür hasste. Ein Vorname, der ihr durch den Kopf geisterte und jedes Mal wie eine schlechte Nachricht klang. Die Stehcafés begannen sich zu füllen. Schon vor dem ersten Klingeln forderte eine unpersönliche elektronische Stimme den Anrufer auf, eine Nachricht zu hinterlassen.
»Sauerei!«, schimpfte Marion und klappte ihr Handy aufgebracht zu.
Ein stechender Schmerz, der ihr das Herz zu zerreißen schien, bohrte sich durch ihre Brust. Victor de la Ferrière blieb unauffindbar. Seit zehn Tagen hatte sie weder eine Nachricht noch einen Anruf von ihm erhalten. Nichts. Sie spürte die Leere in sich, ein schwarzes, alles verschlingendes Loch, wie es Familien beschrieben, deren Kinder entführt worden waren.
Sie durchquerte die Bahnhofshalle, ohne auf die neugierigen Blicke zu achten, die sie verfolgten. Ihr Gesicht war noch immer verschmiert, auf der Stirn prangte eine bläulichrote Beule, und ihre schlanke Silhouette war an diesem Morgen nach dem Desaster sichtlich gebeugt. Im Thalys-Bereich, der durch die schwarz-gelben Sperrbänder der Spurensicherung abgeriegelt war, waren mehrere Beamte der Bahnhofspolizei noch immer mit der Tatbestandsaufnahme beschäftigt. Marion hatte nicht mehr die Energie, diesen Männern gegenüberzutreten. Sie hatte im Laufe der Nacht schon genug Vorwürfe zu hören bekommen und quälte sich mit Gewissensbissen, weil sie nicht verhindert hatte, dass die vorgebliche Zigeunerin – sie hatte so ausgesehen wie eine von denen, die sie täglich aus dem Bahnhof verscheuchen mussten – in die kritische Zone gelangte. Sie hätte Befehl geben müssen, die Frau sofort zu entfernen, mitsamt ihren Verletzungen und ihrem falschen Baby.
Sie wusste, dass allein der Frust über das Verschwinden ihres Geliebten sie abgelenkt hatte, dass nur deswegen aus einem unerwarteten Vorfall eine Staatsangelegenheit werden konnte. Ein unverzeihliches Versagen.
Restaurant Alizé, Gare du Nord.
Montag, 7 Uhr 05.
Manuel Ortega hatte begonnen, den Dreck auf der Terrasse des Alizé zusammenzukehren, doch dann hielt er einen Moment inne und betrachtete Marion. Noch nie hatte er die Kommissarin so niedergeschlagen gesehen. Und noch nie war sie ihm so einsam erschienen. Sie sah derart mitgenommen aus, dass er ihr einen Kaffee anbot.
»Im Lauf der Nacht habe ich schon mindestens ein Dutzend getrunken«, sagte sie leise, ließ sich aber trotzdem auf einen Stuhl sinken.
Sie kannte den portugiesischen Kellner gut, und wenn sie sich die Mühe gemacht hätte, näher hinzuschauen, wäre ihr aufgefallen, dass er sich nicht wohl in seiner Haut fühlte. Was angesichts der jüngsten Ereignisse durchaus verständlich war: Er hatte sich in unmittelbarer Nähe der Schießerei befunden, die Kugeln waren ihm buchstäblich um die Ohren gepfiffen. Er hatte allen Grund, nicht in Bestform zu sein. Um keine Fragen heraufzubeschwören, ließ Marion ihren Blick über den Teil des Bahnhofs schweifen, der verschont geblieben war. Dort nahm das Leben ungerührt seinen Lauf, was die Kommissarin zu einer Reihe pessimistischer Betrachtungen veranlasste – über den Menschen als solchen und seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer. Während sie noch grübelte, fielen ihr wieder die kleinen Flyer in leuchtendem Pink auf, mit denen die Gare du Nord seit einigen Tagen großflächig plakatiert war. Aber sie kam nicht dazu, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, schon kam Manuel mit dem gewünschten Kaffee zurück und legte die aktuelle Ausgabe des Parisien vor ihr auf den Tisch. Bis jetzt hatte sie die Zeitungslektüre gemieden. Man hatte sie darüber informiert, was im Fernsehen und im Radio verbreitet wurde. Gut kam sie dabei nicht weg. Nervös rührte Marion in ihrem Kaffee, auf dem eine goldbraune Schaumkrone schwamm, und warf einen Blick auf die Titelseite: »Blutbad in der Gare du Nord«. Darunter ein Foto von Albin Lovici, aufgenommen in der glanzvollen Zeit des »schönen Albin«, als sein Gesicht noch nicht alt und abgezehrt war und er noch keine Krankheit hatte, über die die wildesten Gerüchte kursierten. Die Kommentare beschrieben seine kriminelle Laufbahn, seine finstere Vergangenheit als Big Boss der Prostitution und wie er sich später zu einem der ausgekochtesten Gangster seiner Zeit hochgearbeitet hatte. Die Frau, die ihn schließlich mit ihrer Maschinenpistole zur Strecke gebracht hatte, konnte bislang nicht identifiziert werden. Sie war im Kugelhagel der Polizei umgekommen. Einige verirrte Kugeln, so wusste das Blatt zu berichten, hatten auch die Männer der Begleitmannschaft getroffen. Schon wurde Kritik laut. Lang und breit ließ man sich über die Schwächen des Polizeiapparates und das totale Chaos aus, das eine bisher mustergültige Kommissarin, die mit solchen schwierigen Situationen vertraut war, verursacht hatte. Auch das RAID-Einsatzkommando bekam sein Fett weg. Allerdings in einem gemäßigteren Ton, der keinen Zweifel daran ließ, dass letztlich Marion alles auf ihre Kappe zu nehmen hatte.
Sie legte die Zeitung aus der Hand und kippte ihren lauwarmen Espresso hinunter. Mit einer wortlosen Geste wehrte Manuel die Münzen ab, die sie ihm hinhielt. Sie hatte den Eindruck, dass er mit ihr über etwas Bestimmtes reden wollte. Sie stand auf, um ihm klarzumachen, dass ihr jetzt nicht nach einem Gespräch zumute war.
Langsam ging Marion auf die Gleise zu, wie eine verirrte Touristin, die sich fragt, welche Richtung sie einschlagen soll. Sie kam an einem der pinken Flyer vorbei. Der Text hätte lakonischer nicht sein können: »Wenn Sie Elsa gesehen haben – rufen Sie an unter 02 43 50 21 22, Tag und Nacht.« Das dazugehörige Foto zeigte eine hinreißende junge Frau, die lachend zwei perfekte Zahnreihen entblößte. Ihre grünen Augen glänzten in der Sonne, und ein goldener Schimmer lag auf ihrem kupferfarbenen Haar. Die Stirn, die vorspringenden Wangenknochen und das Dekolleté waren mit Sommersprossen übersät, die durchaus etwas Provozierendes hatten.
Rue Saint-Vincent-de-Paul, Paris, 10. Arrondissement.
Montag, 8 Uhr.
Nachdem Marion eine gute Viertelstunde unter dem lauwarmen Duschstrahl gestanden hatte, schlüpfte sie in einen Morgenmantel aus roter Seide. Sie bereitete sich einen japanischen Tee, dazu ein paar Scheiben Zwieback mit Marmelade, die sie rasch vertilgte. Dann legte sie sich im Wohnzimmer aufs Sofa und rief Nina an, ihre Adoptivtochter.
»Aber Mama«, protestierte Nina mit schlaftrunkener Stimme, »es ist zwei Uhr morgens! Machst du das eigentlich absichtlich?«
Es war nicht das erste Mal. Marion stand eindeutig auf Kriegsfuß mit der Zeitverschiebung.
»Geht’s dir gut, mein Schatz?«
»Nein, es geht mir nicht gut. Ich habe mir einen Schnupfen geholt …«
Und Nina fing an, von ihren Ärgernissen zu berichten. Den 50 Grad Celsius im Death Valley und dem eiskalten Zimmer im Lodge, dem glühend heißen Swimmingpool und dem frostigen Speiseraum. Marion nahm an allem lebhaft Anteil, ihren eigenen Kummer erwähnte sie jedoch mit keiner Silbe. Die »Kleine«, die es sich seit ihrem vierzehnten Geburtstag verbat, so genannt zu werden, jammerte munter weiter und gähnte dazu. Marion konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken.
»Und du findest das natürlich lustig!«, schimpfte Nina, die Marion kannte wie niemand sonst. »Du musst dich ja auch nicht damit herumschlagen!«
»Warst du beim Arzt?«
Marion hätte ihrer Tochter gern gesagt, dass sie selbst das Bedürfnis hatte, ein bisschen umsorgt zu werden. Dass sie glaubte, knapp dem Tode entronnen zu sein in einem Spiel, dessen Regeln gefährlich und kompliziert waren. Dass sie nicht das Gefühl hatte, ihr Schicksal in irgendeiner Weise beeinflusst zu haben. Und dass diese Erkenntnis an ihr nagte. Sie hätte ihr auch gern von dem Mann erzählt, der ihr ganzes Denken beherrschte. Aber Nina legte auf, ohne auch nur ihre Frage zu beantworten. Lange verharrte Marion regungslos auf dem Sofa. Wirre Gedanken jagten ihr durch den Kopf, es gelang ihr nicht, sie zu fassen und zu sortieren.
Sie musste sich beruhigen und ein bisschen schlafen, wenn sie die kommenden Stunden überstehen wollte. Und so rief Marion andere Bilder zu Hilfe: Victors Hände, Victors Mund, ihr Körper, an den seinen gepresst. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, obwohl es sommerlich warm war, und sie spürte, wie Begierde in ihren Brüsten pulste. Victor und seine gebieterische, dringliche Art zu lieben. Als würde das Leben davon abhängen.
Abrupt schlug sie die Kanten ihres Morgenmantels übereinander und legte sich mit zusammengepressten Beinen auf die Seite, um einzuschlafen.
Rue Saint-Vincent-de-Paul, Paris, 10. Arrondissement.
Montag, 12 Uhr.
Gegen Mittag erwachte sie aus einem tiefen Schlaf, dessen Träume in die düsteren Farben des Himmels getaucht waren. Dicke Wolkenschichten kündigten ein Gewitter an. Sie horchte auf die Vorboten des Sturms, aber das Einzige, was sich vernehmen ließ, war das beharrliche Piepen des Funkgeräts, das sie zur Ordnung rief. Sie stellte die Verbindung zur Dienststelle der Bahnhofspolizei her, wo Wachleiter Amel – Caramel, wie er sich nannte, wenn er gut aufgelegt war, was in letzter Zeit jedoch selten der Fall war – Marion daran erinnerte, dass ein halbes Dutzend lästiger Pflichten auf sie wartete. Die externe Ermittlungskommission wollte zum x-ten Mal ihre Zeugenaussage aufnehmen, die Ereignisse zerpflücken und den verwaltungstechnischen Fortgang der Untersuchung sowie die unvermeidlichen Sanktionen in die Wege leiten.
Der Stellvertreter des Staatsanwaltes suchte sie, er brauchte einen schriftlichen Bericht über den Vorfall. Derweil wurden die Telefonleitungen von unzähligen Zeitungsund Fernsehjournalisten blockiert – ganz zu schweigen von denen, die bereits die Räume der Bahnhofspolizei belagerten, um Marions Sicht der Dinge in Erfahrung zu bringen und sich ein Bild davon zu machen, inwieweit man sie zur Verantwortung ziehen würde.
Der Gedanke, einfach alles hinzuschmeißen und zu Nina in den Yosemite Park zu fahren, den sie gerade mit ihrer Rucksack-Bande durchstreifte, war verführerisch. Nina behauptete, dass die Bären um Nahrung bettelnd bis zu den Türen der Lodges kämen, dass einem die Eichhörnchen von den Bäumen direkt auf die Schultern sprängen und man sich die Ohren zuhalten müsste, um unter den gellenden Angriffen der Weißwangengänse, die es auf Sandwich-Reste abgesehen hatten, nicht taub zu werden. Und dann die Ranger, die zu Pferd auf den steilen Pfaden des Parks unterwegs waren! Schön wie Götter seien die und »ganz schön heiß« … Marion hatte Marie, Ninas beste Freundin, eine hübsche und ziemlich frühreife Blondine, im Verdacht, ihrer Tochter dieses Detail eingeflüstert zu haben. Denn an Nina war, zumindest bisher, ein Junge verlorengegangen, ihr Interesse am anderen Geschlecht hielt sich sehr in Grenzen. Karate und Laufen waren Ninas Antwort auf Maries Modebewusstsein.
Marion versuchte ihren Trübsinn mit einer kalten Dusche zu verscheuchen. Sie fuhr sich ein paar Mal mit den Händen durchs nasse Haar vergaß, sich zu schminken und legte ihre Standarduniform an: blaue Tuchhose, weißes, kurzärmeliges Hemd, Epauletten und Silbertressen. Ehe sie die Wohnung verließ, stopfte sie noch ihre Einsatzuniform in die Waschmaschine und steckte ihr Handy ein. Voller Groll starrte sie auf das leere Display und drückte auf eine Taste.
»Keine neue Nachricht«, antwortete die elektronische Stimme.
Gare du Nord. Kommissariat.
Montag, 12 Uhr 50.
Marion steckte ihre Magnetkarte in das Lesegerät und stieß die Panzertür auf. Der auszubildende Wachmann am Empfang erhob sich, um sie zu grüßen.
»Guten Morgen, Frau Kommissarin!«, schmetterte er, und Marion war klar, das nun alle Beamten in der Dienststelle instinktiv Haltung annahmen. Sobald sein Gruß ertönt war, wussten sie, dass sie nun besser aufhörten, herumzualbern oder untätig herumzusitzen. Marion ging hinter die Empfangstheke, um einen Blick in die Wachkladde zu werfen. Sie setzte ihre energische Unterschrift neben mehrere Einträge des Vormittags. Präzise, fast schon routinierte Gesten, die bewiesen, dass sie inzwischen Fuß gefasst hatte. Vorausgegangen waren lange, schwierige Monate, in deren Verlauf sie sich hundert Mal gefragt hatte, was zum Teufel sie bewogen hatte, in diese Dienststelle zu wechseln, in die Anonymität eines der größten Bahnhöfe der Welt, wo die Kriminalität immer verworrenere, größere Kreise zog. Abadie, Valentine Cara, Garnier, Amel und sogar Major Morel saßen im Büro der leitenden Beamten versammelt. Sie schienen zu warten. Auf Marions Ankunft reagierte jeder auf seine Weise: freundschaftlich, was Abadie betraf, den sie zu ihrem Assistenten und Vertrauten auserkoren hatte; bewundernd im Fall von Valentine, die keinen Hehl daraus machte, dass sie auf schöne, gern auch reifere Frauen stand. Morel legte eine respektvolle Ehrerbietung an den Tag, was wahrscheinlich an seinem Alter lag, während sich Garnier heute noch distanzierter und mürrischer gab, als er es sonst schon tat. Amel starrte zu Boden, er sah bedrückt aus und krank. Marion beachtete er nicht.
Überrascht nahm die Kommissarin Wolskys Anwesenheit zur Kenntnis. Den linken Arm, der am Handgelenk eingegipst war, trug er in einer Schlinge. Er war etwas blaß, aber diensteifrig wie immer. Seine Kleidung schien seit längerem nicht in den Genuss einer gründlichen Wäsche gekommen zu sein. Marion heftete einen durchdringenden Blick auf Wolskys fleckigen Stoffblouson. Amel trug den gleichen. Fast alle Zivilbeamten besaßen diesen Blouson. Bestimmt hatte da jemand in Barbès Mengenrabatt gegeben.
Eine Erinnerung regte sich in ihr, doch sie blieb ein vages Gefühl. Sie gab sich einen Ruck.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie Wolsky.
»Super!«, antwortete der Beamte mit dem kahlgeschorenen Schädel. »Mein Handgelenk ist mal wieder aus dem Leim. Aber ansonsten …«
Sie bedeutete ihm diskret, zu ihr an die Tür zu kommen.
»Treffen wir uns bitte in meinem Büro. In zehn Minuten. Worauf warten Sie eigentlich alle?« Marion stand schon wieder im Gang, als sie den anderen die Frage stellte.
Abadie deutete mit dem Kinn in Richtung Versammlungsraum, wo die Männer der Ermittlungskommission Quartier bezogen hatten.
»Die wollen alle vernehmen«, sagte er. »Übrigens warten sie auch auf Sie.«
Als Marion die Tür zu ihrem Büro öffnete, drehte sie sich instinktiv um. Wolsky war ihr gefolgt.
»Ich sagte, in zehn Minuten«, rief sie gereizt.
Mit einem beflissenen und, wie Marion fand, dämlichen Lächeln zog er wieder ab. Jetzt würde sie sich erst recht Zeit nehmen. Zeit, um einige drängende Probleme zu lösen, etwa die übereifrigen, ehrgeizigen Journalisten zu bremsen, die sich nicht abwimmeln ließen. Irgendjemand musste mit ihnen reden. Wenn man ihnen keine Erklärungen gab – und zwar schleunigst –, würden sie ihre eigenen verbreiten, die dann mehr oder weniger seriös waren. Sie versprach Interviews, ohne sicher zu sein, ob ihre Vorgesetzten sie absegnen würden. Dann bat sie Wolsky herein.
»Ich weiß, was Sie mir sagen wollen, Chef«, kam er ihr zuvor.
»Haben Sie Schmerzen?«
»Wie bitte?«
»Im Arm.«
»Nein, jetzt, wo ich wieder den Gips habe … Er behindert mich nicht groß.« Er sah Marion an und fragte sich, worauf sie hinauswollte.
»Wenn Sie auf Ihrem Posten geblieben wären, würden wir jetzt nicht hier sitzen«, sagte sie in scharfem Ton.
»Ich hab den Krach gehört und bin hingerannt, um zu helfen. So habe ich’s gelernt, und so bin ich«, verteidigte er sich. »Ich lasse die Kollegen nicht in der Scheiße sitzen. Nie!«
»Und ich verlange, dass Befehle und Aufgabenverteilung eingehalten werden. Stellen Sie sich vor, jeder würde einfach so entscheiden, seinen Posten zu verlassen!«
»Ich hatte einen Grund«, entgegnete er störrisch. »Ich bin meinen Kollegen zu Hilfe geeilt.«
»Aber mich haben Sie vom Bahnsteig gerempelt!«
Er senkte den Blick und verzog den Mund.
»Das war keine Absicht. Ich wollte Sie vor dieser Wahnsinnigen beschützen, die auf Sie zugestürmt kam.«
»Samthandschuhe hatten sie dabei aber nicht an.«
»Ich bin ja selbst auch vom Bahnsteig gestürzt, wenn ich das sagen darf.« Er deutete auf seinen Arm.
Marion seufzte und kapitulierte.
»Gut, aber tun Sie das nie wieder, beschränken Sie sich darauf, Befehle auszuführen, sonst …«
Sie machte eine wedelnde Handbewegung, die jeder andere Mensch ohne weitere Ausführungen verstanden hätte.
»Sonst?«, fragte Wolsky und setzte eine dumme Miene auf.
»Sonst fliegen Sie«, gab Marion knapp zurück.
Kommissar Tour, der die externe Ermittlungskommission leitete, saß mit fahlem Gesicht und tiefen Ringen unter den Augen da. Dabei war er sogar für ein paar Stunden nach Hause gegangen, um zu schlafen, zu duschen und ein frisches Hemd anzuziehen. Bei seinem Anblick konnte Marion nicht umhin zu denken, dass die jungen Chefs von heute doch ziemliche Schwächlinge waren. Aber dann fiel ihr wieder ein, dass Tour im Ruf stand, ein notorischer Miesepeter zu sein, und wahrscheinlich auch nach zehn Stunden Schlaf so abgespannt wirken würde. Mit zusammengekniffenen Lippen nahm der Kommissar Marions Lächeln entgegen, das eigentlich gewinnend sein sollte. Ihn trotz aller Feindseligkeit zur Zusammenarbeit bewegen? Mission impossible, dachte Marion, als sie die unverändert ausdruckslose Miene ihres Kollegen sah.
»Was gibt’s Neues?«, fragte sie dennoch.
Er blickte sie flüchtig an und antwortete, ohne auf ihre Frage einzugehen: »Ich brauche detaillierte Angaben dazu, wie der Einsatz organisiert und wer zum fraglichen Zeitpunkt wo postiert war. Ich will außerdem wissen, welche Befehle du vor und während des Einsatzes gegeben hast.«
»Fallen diese Punkte in die Zuständigkeit der Ermittlungskommission?«
Er ignorierte den ironischen Unterton, mit dem sie versuchte, ihr Unbehagen zu überspielen.
»Sie stehen selbstverständlich im Zusammenhang mit der Herkunft der Schüsse und der Identifizierung der Personen, die geschossen haben. Wir werden deine Angaben mit den Ergebnissen der ballistischen Untersuchung und der Obduktionen vergleichen.«
Marion verbrachte eine geschlagene Stunde mit Kommissar Tour, der sich noch unzugänglicher als üblich zeigte, und seinem haarspalterischen Begleiter, der ihre Aussage aufnehmen musste. Aufgebracht verließ sie schließlich den Raum.
»Mieses kleines Arschloch!«, schimpfte sie und fing an, in Ermangelung eines besseren Feindes auf den Sandwich-Automaten loszugehen.
Dieser Kerl war nicht nur unangenehm und kein bisschen kooperativ, sondern lauerte ganz offensichtlich auf alles, was Marion irgendwie in Schwierigkeiten bringen konnte, das hatte sie deutlich gespürt. Sie hatte sich zu einer möglichst realistischen Darstellung des Vorfalls entschlossen. Ihr selbst nützte das nichts, aber wenigstens würde es ihren Leuten Ärger und Schikanen ersparen. Auch Wolskys Patzer hatte sie kleingeredet, woraufhin Tour schmallippig gelächelt hatte, was wohl bedeuten sollte, dass sie damit einen weiteren Fehler beging.
»Idiot!«, sagte sie so laut, dass Abadie, der sich erkundigen wollte, ob es Neuigkeiten gab, Marion erstaunt ansah.
Sie zog ein kaltes Rosinenbrötchen aus dem Automaten, das nach nichts schmeckte. Es war ihr egal, was dieser Tour tun oder schlussfolgern würde. Ihr war einfach alles egal. Sie dachte an Victor, und die körperliche Sehnsucht nach ihm brachte sie fast um.
»Das ist nicht normal«, flüsterte ihr eine böse Stimme ein. »Man verschwindet nicht einfach so. Es sei denn freiwillig …«
Zum ersten Mal seit zehn Tagen begann sie zu zweifeln.
»Was wollen Sie?«, fragte sie Abadie müde.
Capitaine Abadie, ein gutaussehender braunhaariger, sportlicher Typ um die vierzig, setzte eine bekümmerte Miene auf.
»Nichts, ich wollte nur schauen, wie es Ihnen geht.«
»Sehr liebenswürdig«, sagte Marion mit vollem Mund. »Es geht mir schlecht. Ich glaube, ich kann dann wohl meine Sachen packen.«
»Warum?«
»Nach so einer Scheiße, was glauben Sie denn? Dass ich befördert werde?«
»Nein, aber …«
»Sehen Sie! Aber da pfeife ich eh drauf!«
»Ich verstehe Sie nicht, Chef. Was ist denn los? Ich meine, seit einiger Zeit sind Sie so anders. Das haben übrigens auch die Kollegen schon bemerkt.«
Was soll ich dazu sagen, Abadie?, dachte die Kommissarin. Dass ich verliebt bin? So total verrückt nach einem Typen, dass ich allein bei der Vorstellung erschauere, er stünde in diesem Moment hier vor mir, und nicht du … Nein, sie konnte Abadie unmöglich sagen, was wirklich in ihr vorging. Das wäre für die Leiterin einer Polizeidienststelle einfach unpassend gewesen. Zumal für eine, die schon jenseits der vierzig war und ein Vorbild abgeben sollte. So eine durfte nicht vögeln, nicht lieben, nicht leiden. Sie musste ein unauffälliges Gefühlsleben aufweisen.
»Machen Sie sich keine Sorgen, es geht schon«, antwortete sie beschwichtigend.
Abadie sagte nichts mehr, dachte sich jedoch sein Teil. Seit zwei Jahren verbrachte er jeden Tag an Marions Seite, so leicht konnte sie ihm nichts vormachen: Es ging ihr nicht gut, und irgendwie ahnte er auch, warum. Er war schließlich dabei gewesen, als dieser attraktive Mann mit den hellen Augen zum ersten Mal hier in der Dienststelle aufgekreuzt war. Es hatte ihm nicht gefallen, wie Marion ihn angeschaut hatte, gleich so ein verliebter Blick, sie kannte ihn doch kaum! Abadie lebte seit fünf Jahren mit einem Mann zusammen, den er bedingungslos liebte, und dennoch hatte er sich damals so gefühlt, als entzöge man ihm ein Besitzrecht. Marion war verliebt, und alle Kollegen fühlten sich verraten. Sie war nicht mehr dieselbe, ihre Zuneigung war nicht mehr dieselbe. Und nun trug sie seit einigen Tagen eine fast depressive Trübsal zur Schau, die zehn Meilen gegen den Wind nach Liebesfrust roch.
Marion stopfte die Verpackung ihres Rosinenbrötchens in einen randvollen Abfalleimer. Gerade wollte sie Abadie einen Versöhnungskaffee anbieten, da hörten sie Geschrei. Die Tür des Büros, in dem die leitenden Beamten auf Reaktionen der Ermittlungskommission warteten, anstatt sich in die Arbeit zu stürzen, flog auf, und Amel kam herausgestürmt.
»Verdammte Scheiße!« Er war außer sich.
»Was ist denn mit dir los?«, fragte Abadie.
»Meine Knarre!«, brüllte Amel. »Jemand hat mir meine Knarre geklaut!«
»Wohin gehen Sie?«, rief Marion ihm entgeistert nach, als er zum Ausgang rannte.
Schweißgebadet und wie benommen drehte der Polizist sich zu ihr um. Auch die anderen Beamten kamen jetzt aus dem Büro und versammelten sich im Gang. Die Tür des Zimmers, in dem sich Kommissar Tour gerade Lieutenant Valentine Caras vorknöpfte, öffnete sich.
»Darf man erfahren, was dieses Tohuwabohu zu bedeuten hat?«, fragte Tour mürrisch.
»Amel!«, zischte Marion. »Hören Sie auf mit dem Theater und kommen Sie mit!«
Sie zog ihn in ihr Büro und knallte Tour die Tür vor der Nase zu.
»Haben Sie noch mehr davon auf Lager?«, fragte sie, nachdem sie auf ihren Stuhl gesunken war, der ein trauriges Quietschen von sich gab.
»Wovon?«
»Von diesem Mist!«
»Was? Ich soll Mist gebaut haben? Ich?«
Durchatmen, erst einmal tief durchatmen. Die Kommissarin schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken, um sich zu sammeln. Als sie die Augen wieder aufmachte, ertappte sie Amel dabei, wie er sie anstarrte. Sie wusste nicht, wie sie seinen Blick deuten sollte: Lag Verachtung darin, Verwirrung, Hass? Marion riss sich zusammen und drückte auf den Knopf der Sprechanlage, die sie mit den verschiedenen Abteilungen ihrer Dienststelle verband.
»Abadie«, sagte sie mit gepresster Stimme, »kommen Sie, bitte.«
Amel konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann genau er seinen Manurhin-Revolver verloren hatte. Er hatte ihn bei sich, als er am Vortag kurz vor 14 Uhr zum Dienst erschienen war, um im Lage- und Führungsraum die Operation Lovici zu überwachen. »Als ich gekommen bin, habe ich ihn in der Waffenkammer deponiert«, beteuerte er als Antwort auf Marions nächste Frage.
»Sind Sie sich da ganz sicher?«, beharrte die Kommissarin, sie hatte ein leichtes Zögern bemerkt.
Er bejahte, wobei sein Blick über seine Turnschuhe wanderte, die schon einmal sauberer gewesen waren. Er bestätigte, dass er während des gesamten Lovici-Einsatzes im Lage- und Führungsraum die Stellung gehalten und nach besten Kräften versucht habe, das Chaos, das nach der Schießerei ausgebrochen war, in den Griff zu kriegen. Erst in der Nacht sei er nach Hause gegangen.
»Ohne Ihre Waffe mitzunehmen?«, fragte Marion, die ahnte, dass er sich unterwegs noch ein paar Kneipen von innen angesehen hatte.
Amel schüttelte den Kopf.
»Nein, ich nehme sie selten mit nach Hause. Ich bin doch nicht dazu verpflichtet, oder?«
»Werden Sie nicht gleich aggressiv! Wenn ich es richtig verstehe und wenn sich alles so abgespielt hat, wie Sie sagen, dann ist Ihre Waffe in der Waffenkammer verschwunden?«
Amel durchforstete sein Gedächtnis. Zwischen den kaum sichtbaren Augenbrauen zerfurchten zwei senkrechte Falten seine Stirn. Sein ohnehin trüber Blick blieb jedoch ausdruckslos.
»Versuch dich zu erinnern«, ermunterte ihn Abadie.
»Aber da gibt’s nichts zu erinnern, verdammt!«
»Schnauz mich nicht an, ich kann nichts dafür!«
»Sprechen Sie mal mit den anderen, Abadie«, schaltete sich Marion wieder ein, als sie die zunehmende Anspannung spürte. »Vielleicht hat einer von ihnen die falsche Waffe mitgenommen. War jemand mit Ihnen in der Waffenkammer?«
Amel machte eine vage Kopfbewegung. Allmählich dämmerte es Marion: Amel hatte keinen Fuß in die Waffenkammer gesetzt.
»Und Tour?«, fragte Abadie. »Was sagen wir dem?«
»Erst einmal gar nichts. Der bringt es fertig, uns gleich zu feuern.«
Die beiden Männer nickten. Amel ging mit hängenden Schultern zur Tür. Abadie wollte ihm folgen, aber Marion hielt ihn zurück und wartete, bis der andere draußen war.
»Reden Sie mit Morel«, sagte sie leise. »Die beiden waren bei dem Einsatz von Beginn an zusammen. Vielleicht hat er eine Erklärung.«
Abadie schnalzte skeptisch mit der Zunge. Marion gefiel diese Häufung von unerwarteten Ereignissen überhaupt nicht. Sie gab sich einen Ruck.
»Finden Sie nicht, dass Amel im Moment ein bisschen seltsam ist?«, fragte sie, den Blick auf die Karte des Vorort-Schienennetzes geheftet, die die gesamte Breite der Wand einnahm.
Abadie zuckte mit den Schultern.
»Im Moment sind alle etwas seltsam. Und Sie an erster Stelle.«
»Sie nerven, Abadie.«
Sie setzte sich wieder auf ihren Stuhl und beugte sich über die Papiere auf ihrem Schreibtisch. Er wusste, was das heißen sollte. Wortlos ging er zur Tür.
In der Stille ihres Büros, die nur durch das gedämpfte Dröhnen der Metro-Züge gestört wurde, erging sich Marion ein Weilchen in Selbstmitleid über ihr Schicksal, sie, die arme Chefin, die seit vierundzwanzig Stunden nichts als Scherereien hatte. Es war ja bekannt: Wenn das Schicksal einmal angefangen hatte, zuzuschlagen, war es wie beim Dominospiel, unweigerlich riss ein Stein den nächsten mit sich. Wieder ließ sich der Gedanke an Victor nicht abschütteln. Sie zog ihr Handy aus der Hosentasche. Nichts. Weder Mailbox noch SMS-Eingang zeigten eine neue Nachricht an. Wütend klappte sie das Handy zu.
»Ich verstehe das nicht«, schimpfte sie vor sich hin und begann mit großen Schritten in ihrem Büro auf und ab zu gehen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, um besser nachdenken zu können. Schließlich kehrte sie zu ihrem Schreibtisch zurück, auf dem mehrere gefährlich hohe Aktentürme einzustürzen drohten. Sie griff nach dem Telefon und wählte aus dem Kopf eine Nummer. Am anderen Ende wurde abgenommen.
»Guten Tag«, sagte Marion mit erstickter Stimme. »Monsieur de la Ferrière, bitte. Victor de la Ferrière.«
»Wie ist Ihr Name, bitte?«, fragte eine näselnde Frauenstimme in schleppendem Singsang. Eine Vorort-Pariserin, dachte die Kommissarin gereizt, die es zur Telefonistin gebracht hatte. Wahrscheinlich hieß sie Brigitte oder Nicole oder Valérie oder Nathalie.
»Einen Augenblick, bitte.«
Eine Viertelsekunde verging – ein Akt der Höflichkeit, um Marion nicht sofort abzuservieren –, und Brigitte-Nathalie war wieder dran.
»Der Herr Generaldirektor ist derzeit verreist, Madame. Ich kann Ihre Nummer notieren, und er wird Sie zurückrufen, sobald …«
Mit heißem Gesicht legte Marion auf, ohne sich zu bedanken. Seit zehn Tagen war der Herr Generaldirektor der SODEC verreist. Es ergab keinen Sinn, immer wieder dort anzurufen und sich diesen vorformulierten Spruch anzuhören. Aber sie konnte nicht anders. Sie hätte insistieren und versuchen müssen, mehr zu erfahren, hätte darum bitten können, mit einem Kollegen oder der Sekretärin – einer gewissen Chantal – oder irgendjemandem sonst aus einer der Abteilungen, die er offenbar leitete, zu sprechen. Aber das alles hatte sie eine Woche lang jeden Tag mindestens zehn Mal getan. Anfangs hatte man ihr höflich Auskunft erteilt. Dann waren die Antworten immer knapper geworden, bis sich schließlich keiner mehr die Mühe machte, überhaupt noch mit ihr zu sprechen - mit Ausnahme der Telefonistin. Als in den ersten Tagen auch Victors Assistentin durch Abwesenheit glänzte, war die Phantasie mit Marion durchgegangen: Chantal war die Geliebte des Chefs, sie waren gemeinsam verreist. Dieser Gedanke hatte ihr achtundvierzig Stunden lang zugesetzt. Bis sie die Dame wieder an der Strippe hatte und zu dem Schluss kam, dass sie tatsächlich nichts über Victors Verbleib wusste.
Gleich im Anschluss rief Marion bei den Kriminaltechnikern an, die mit den Nachforschungen bei Telefongesellschaften betraut waren. Marions Gesprächspartner wusste sofort, was sie wollte, denn seit zehn Tagen stellte sie ihm immer die gleiche Frage.
»Vom Handy keine ausgehenden Telefonate, Chef. Und nur zwei Eingänge. Ich habe sie identifiziert. Soll ich sie auf die Liste setzen?«
»Ja. Immer noch keine Lokalisierung?«
»Nein.«
Auch diese Antwort kam mit ärgerlicher Regelmäßigkeit. Victors Mobiltelefon war offenbar ausgeschaltet. Auf der Leitung wurden täglich mehrere eingehende Anrufe registriert, es wurden jedoch immer weniger. Marion hatte bei allen Mobilfunkbetreibern nachgehakt: Victor de la Ferrière hatte keinen zweiten Vertrag, zumindest nicht unter diesem Namen.
Gerade als sie auflegen wollte, schien sich der Techniker an eine wichtige Sache zu erinnern.
»Ach ja, Madame«, meinte er. »Ich habe die Sache überprüft, um die Sie mich gebeten hatten.«
»Nämlich?«
»In Compiègne gibt es nur einen de la Ferrière. Das heißt, nicht direkt in Compiègne, sondern in der Umgebung von Compiègne. In Pierrefonds, um genau zu sein. Sie hatten recht, der Teilnehmer hat eine Geheimnummer.«
Natürlich, wäre ihr beinahe herausgerutscht, sonst hätte ich ihn ja im Telefonbuch gefunden.
»Nummer und Adresse?«, fragte sie stattdessen nur.
Der Techniker gab ihr beides. Sie bedankte sich, doch dann fiel ihr plötzlich noch etwas ein: »Dieser de la Ferrière, wie lautet der Vorname?«
»Hélène. Es ist eine Frau.«
»Hélène de la Ferrière ! Na bitte, bist du jetzt zufrieden?,« fluchte Marion. Sie hatte diesen Moment lange hinausgeschoben. Victor war diskret, ein bisschen sehr diskret. Er sprach wenig über seine Arbeit, kaum über seine persönlichen Interessen, niemals über sein Privatleben. Es war eine Art stillschweigender Pakt, den er Marion aufgezwungen hatte: keine Fragen. Bis zu seinem Verschwinden hatte sie auch nicht den Wunsch verspürt, mehr zu erfahren. »Er ist schön«, dachte sie, wenn sie ihn beim Essen, Trinken oder Lachen beobachtete, und sie versuchte, an seinen Gesten und seinem Gesichtsausdruck abzulesen, wer er war. Er liebte sie, er schlief mit ihr. Immer wieder so leidenschaftlich, als wäre es das letzte Mal. Das hatte sie erfüllt. Doch jetzt musste sich Marion eingestehen, dass sie einer störenden Wahrheit ausgewichen war: Victor hatte eine Frau, eine Ehefrau, eine Angetraute. Sie spürte einen heftigen, nie dagewesenen Schmerz. Eifersüchtig, du bist eifersüchtig, dachte sie missmutig.
Sie warf einen Blick auf das Telefon und überlegte, ob sie die Nummer in Pierrefonds wählen sollte. »Aber was soll ich ihm sagen, wenn er rangeht?, fragte sie sich. Und wenn sie es ist? Dürfte ich bitte mit Ihrem Ehemann sprechen? Oder soll ich ihr gleich mein Herz ausschütten?
Es war dumm. Ihre strapazierte Seele befahl ihr, sich der Wirklichkeit zu stellen und die Wahrheit vollständig ans Tageslicht zu bringen; ihr Verstand wies sie an, nichts dergleichen zu tun. Mit angehaltenem Atem wählte sie schließlich die Nummer. Es klingelte mehrmals, mindestens zehn Mal, bis jemand abnahm.
Eine unglaublich sanfte Frauenstimme meldete sich.
»Ja, bitte?« Die Dame schien etwas außer Atem zu sein und zwischen Hoffnung und Verzweiflung zu schwanken.
Marion schlug einen unpersönlichen Ton an und fragte nach Victor de la Ferrière. Sie gab an, im Auftrag des Kundendienstes des Mobilfunkbetreibers Orange anzurufen. Sie wolle Monsieur de la Ferrière ein Angebot machen und …
»Er ist nicht da«, fiel ihr die Frau mit erschöpfter Stimme ins Wort. »Ich bin seine Ehefrau, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen?«
Seine Ehefrau! Marion musste improvisieren. Die Antworten von Hélène de la Ferrière blieben ausweichend: Ihr Mann sei nicht da, sie wisse nicht, wann er zurückkommen werde. Es sei auch nicht möglich, ihn unter einer anderen Nummer zu erreichen. Schließlich brach sie das Gespräch ab und bat Marion, nicht mehr anzurufen.
Der verheiratete Victor war nicht zu Hause. Die Anspannung, die Marion aus der Stimme seiner Frau herausgehört hatte, deutete darauf hin, dass er schon seit einigen Tagen kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte. Nicht nur der traurige Unterton der Frau, auch Marions Bauchgefühl ließ keinen Zweifel daran. Aber wo war Victor dann?
Kurze Zeit später tauchten Abadie und Amel wieder auf. Ihre Gesichter verrieten, dass sie nichts Gutes zu berichten hatten.
Und so war es auch. Die Dienstwaffe des Beamten blieb verschwunden, niemand hatte sie gesehen.
Amel breitete hilflos die Arme aus. Abadie warf ihm einen mürrischen Blick zu.
»Wir müssen die Seriennummer bekanntgeben«, sagte er.
Marion zögerte. Auch sie ärgerte sich über diese zusätzliche Affäre, die sie von ihren persönlichen Erkundungen ablenkte.
»Wir warten bis morgen. Bis dahin setzen Sie Himmel und Hölle in Bewegung, um diese Knarre wiederzufinden. Ich rede mit Ihnen, Amel!«
»Aber wie …«
»Legen Sie sich ins Zeug«, befahl sie kühl. »Sonst gibt’s das volle Programm, eine Verwarnung verspreche ich Ihnen mindestens, und da werde ich leider nichts für Sie tun können. Verstanden?«
Amel antwortete nicht. Er zog den Reißverschluss seines Blousons hoch, obwohl im Büro eine Gluthitze herrschte, und verließ den Raum, ohne ein Wort zu sagen.
»Und Morel?«, fragte Marion Capitaine Abadie, als Amel die Tür hinter sich geschlossen hatte.
»Dem ist offensichtlich nicht ganz wohl in seiner Haut. Bis jetzt sagt er nichts. Aber ich glaube, dass er etwas verheimlicht.«
»Machen Sie sanften Druck. Und befragen Sie die Wachleute. Ach ja, noch eine Sache«, fügte Marion hinzu, als Abadie sich erhob. »Wolsky ist wieder verletzt und krank geschrieben. Ich will ihn hier nicht mehr sehen.«
Gare du Nord.
Montag, 19 Uhr.
Am Nachmittag herrschte eine Hitze, als stünde das Ende der Welt bevor. Es war Rushhour, Horden von Urlaubern wälzten sich durch die Bahnhofshalle, erschöpft von den riesigen Gepäckstücken, die sie herumschleppten, und den 40 Grad im Schatten, an denen auch die Tatsache, dass es in der Gare du Nord immer irgendwo zog, nichts änderte. Die Luft roch nach Staub, Frittierfett und Schweiß. Im Thalys-Bereich war die von der Bahnhofspolizei abgetrennte Zone weiterhin gesperrt. Gegen 19 Uhr verließ Marion ihr Büro. Sie ärgerte sich über Tour, der weiterhin geheimnisvoll tat und immer nur vage und provozierend lächelte, wenn sie ihm eine Frage stellte. Sie brauchte Luft, musste raus aus diesen geschlossenen Räumen, wo noch nie jemand auf die Idee gekommen war, eine Klimaanlage zu installieren. Außer im Lage- und Führungsraum, wegen der Computer.
Als Marion am Alizé vorbeikam, ließ sie ihren Blick über die gefüllte Terrasse schweifen, keine Spur von Manuel. Während sie sich fragte, wo er wohl abgeblieben war, sprangen ihr wieder die knalligen Flyer ins Auge, die an Pfeilern und Schaufensterscheiben zur Suche nach »Elsa« aufforderten. Der Plakatkleber hatte wieder zugeschlagen. Und er hatte gute Arbeit geleistet. Grob geschätzt hatte sich die Zahl der Flyer seit dem Morgen verdoppelt. Abgerissene Papierfetzen lagen auf dem Boden, von Tausenden Füßen gleichgültig plattgetrampelt. Marion verfolgte die pinkfarbene Spur bis in den Ostflügel des Bahnhofs. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass sie sie zu dem Urheber führen würde, den Abadie inzwischen der vorsätzlichen Sachbeschädigung bezichtigte. Tatsächlich hatte ein Verantwortlicher der Eisenbahngesellschaft SNCF am frühen Nachmittag Anzeige erstattet. Ihm zufolge hatte die Kleberei vor zwei oder drei Tagen angefangen und artete allmählich in Vandalismus aus. Er verlangte eine polizeiliche Überwachung, um den Übeltäter zu schnappen. Marion war es gelungen, erst einmal Zeit zu gewinnen: Im Moment hatten andere Dinge Priorität. Angesichts der Geschwindigkeit, in der sich die Plakate wie von unsichtbarer Hand ausbreiteten, schien dieser Mensch allerdings verdammt geschickt zu sein.
Auf Höhe von Gleis 19 betrachtete Marion die Pendler, die sich auf dem Bahnsteig drängelten und auf den Zug Richtung Compiègne und Saint-Quentin warteten. Die Erinnerung an ihre erste Begegnung mit Victor blitzte auf und versetzte ihr einen Stich. Hier war es passiert, ein Stückchen weiter, auf Höhe des vordersten Wagens der ersten Klasse.
Eine Frau drängte sich an Marion vorbei und verschwand in der Menge. Sie ähnelte dem Mädchen auf dem Foto, und beinahe wäre Marion ihr hinterhergerannt. Aber wozu? Was hatte sie eigentlich mit diesen Plakaten zu schaffen, diesen Aufrufen an das Volk, die meist doch nur dazu führten, dass sich Verrückte angesprochen fühlten. Als Marion sich umwandte, erblickte sie Wolsky, wie er schnellen Schrittes über den Bahnsteig hastete. Abadie hatte ihren Auftrag offenbar wie immer sofort ausgeführt und ihn aufgefordert, nach Hause zu gehen. Wahrscheinlich befand sich der Beamte mit dem rasierten Schädel also gerade auf dem Heimweg. Wo er wohl wohnte, und mit wem?
Marion ließ den Bahnsteig und ihre Erinnerungen hinter sich und ging weiter. Vor einem Zeitungsstand machte sie kurz halt und kämpfte gegen die Versuchung, die Schlagzeilen der Abendzeitungen zu lesen, wo fleißig auf Kommissarin Marion eingedroschen wurde. An der Rolltreppe wurde sie von Valentine Cara eingeholt.
»Tour will Sie sprechen«, sagte die junge Beamtin außer Atem.
»Dann hat er also die Sprache wiedergefunden?«
Valentine Cara zuckte mit den Schultern.
Marion ging an ihr vorbei, ließ sie stehen, ohne ihrem konsternierten Blick Beachtung zu schenken. Auch Valentine fand es höchst befremdlich, dass Marion ihre Mannschaft wegen eines Mannes plötzlich ignorierte und sich zunehmend von ihnen entfernte. Zumal es einer von diesen Männern war, die sie gar nicht leiden konnte: zu gut aussehend, zu perfekt, zu selbstbewusst. Aber die Männer im Allgemeinen fanden keine Gnade vor Valentines Augen. Ihre Liebschaften waren weiblich, und sie hegte durchaus leidenschaftliche Gefühle für Marion, deren Verhalten allerdings keinen Anlass zur Hoffnung gab. Trotzdem bewunderte sie ihre sportliche Silhouette, ihren muskulösen Hintern in der eng anliegenden blauen Hose, den kraftvollen, eleganten Gang und bedauerte immer wieder, dass Marion nicht dieselben Neigungen hatte wie sie.
Gare du Nord. Kommissariat.
Montag, 19 Uhr 15.
»Man hat sie identifiziert«, sagte Tour widerwillig, als Marion, ohne anzuklopfen, in den Versammlungsraum trat.
»Wen?«
»Die Frau. Die Zigeunerin.«
»Ah.«
Fast hätte sie ihn gefragt, aus welchem besonderen Anlass ihn diese Information eigentlich früher erreicht hatte als sie.
»Interessiert dich das oder nicht?«, fragte er ungeduldig.
»Natürlich interessiert es mich!«
In der drückenden Hitze war das am Kragen hermetisch geschlossene Hemd des Kommissars schweißdurchtränkt. Marion verspürte den verrückten Wunsch, ihm den Hals umzudrehen. Als sie jedoch genauer hinsah, entdeckte sie in Tours feuchtem Gesicht Zeichen einer Erschöpfung, die ihrer in nichts nachstand. Plötzlich hatte sie das merkwürdige Gefühl, dass der Kerl eher unglücklich als bösartig war.
»Sie heißt Lucette Bourgeois.«
»Wahrscheinlich ist sie genauso wenig Zigeunerin wie ich. Wo kommt sie her?«
Tour verzog das Gesicht. Er hatte gesagt, was gesagt werden musste, mehr war von ihm nicht zu erwarten. Wenn es hier nur solche Spinner gibt, dachte Marion, kann es unter uns Kommissaren ja keinen Zusammenhalt geben.
»Regele das mit deinen Leuten. Wir haben andere Probleme.«
»Welche denn?«
Tours Assistent, dessen Stimme Marion noch nicht ein einziges Mal vernommen hatte, stand auf und fing an, mit einem Blick auf die Uhr seine Papiere einzusammeln. Tour sah ihn ärgerlich an, was dem Mann nicht entging.
»Heute Abend feiert mein Sohn seinen Geburtstag, Chef«, rechtfertigte er sich. »Ich muss wirklich gehen.«
»Na gut«, räumte Tour ein, »aber sehen Sie zu, dass Sie morgen um acht hier sind.«