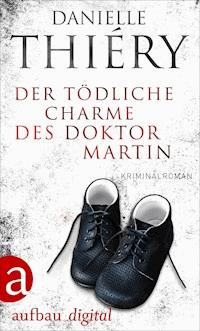Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Edwige Marion
- Sprache: Deutsch
Kaum zur Leiterin der Pariser Bahnhofspolizei befördert, steht Marion das Wasser schon wieder bis zum Hals: Rund um den Gare du Nord verschwinden Kinder, und ihre Adoptivochter Nina wird eines Abends auf der Straße überfallen. Obwohl sie nicht mit den Ermittlungen betraut ist, hat Marion nur eines im Sinn: den Verbrecher aufspüren - das ist sie Nina schuldig ...
Jahrzehntelange Tuchfühlung mit dem Verbrechen, große Menschenkenntnis und ein Händchen für spannende Plots ergeben jene unverwechselbare Mischung, mit der Danielle Thiéry ihre Leser immer wieder begeistert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über Danielle Thiéry
Danielle Thiéry, geboren 1947, zwei Kinder, war Kriminalkommissarin in Paris und in den siebziger Jahren die erste Frau an der Spitze eines französischen Kommissariats. 1991 findet sie endlich die Zeit zu schreiben. Seitdem hat sie eine Fernsehserie entwickelt, an mehreren Fernsehproduktionen mitgearbeitet, einen autobiographischen Roman (Prix Bourgogne 1997) und zahlreiche Krimis (Prix Polar 1998) geschrieben.
Informationen zum Buch
Kaum zur Leiterin der Pariser Bahnhofspolizei befördert, steht Marion das Wasser schon wieder bis zum Hals: Rund um den Gare du Nord verschwinden Kinder, und ihre Adoptivochter Nina wird eines Abends auf der Straße überfallen. Obwohl sie nicht mit den Ermittlungen betraut ist, hat Marion nur eines im Sinn: den Verbrecher aufspüren – das ist sie Nina schuldig!
Jahrzehntelange Tuchfühlung mit dem Verbrechen, große Menschenkenntnis und ein Händchen für spannende Plots ergeben jene unverwechselbare Mischung, mit der Danielle Thiéry ihre Leser immer wieder begeistert.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danielle Thiéry
Die verhängnisvolle Liebe der Madame Claude
Roman
Aus dem Französischen von Sabine Schwenk
Inhaltsübersicht
Über Danielle Thiéry
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
Kapitel 128
Kapitel 129
Kapitel 130
Kapitel 131
Kapitel 132
Kapitel 133
Kapitel 134
Kapitel 135
Kapitel 136
Kapitel 137
Kapitel 138
Kapitel 139
Kapitel 140
Kapitel 141
Kapitel 142
Kapitel 143
Kapitel 144
Kapitel 145
Impressum
Sein Kopf war schwer wie Blei, die Beine versagten ihren Dienst. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt, und als er nach vorn kippte, schlug sein Schädel dumpf auf dem Boden auf. Widerlich stinkender Staub drang in alle Öffnungen seines Gesichts. Er spürte keinerlei Schmerz. Wie auch, wenn die Angst alles andere vergessen ließ? Nackte, ungeheure Angst, weil alles um ihn herum so finster war, absolut, hoffnungslos finster und vollkommen still.
Inmitten des scheußlichen Geruchs traf plötzlich ein blendender Lichtstrahl auf seine Netzhaut. Er blinzelte, Tränen schossen ihm in die Augen und vermischten sich mit dem Blut und der Erde auf seinen Wangen. Er spürte, wie die Hände auf seinem Rücken von etwas gestreift wurden, dann hörte er ein leises, ungeduldiges Quieken. Etwas Weiches strich über seinen Hals, ganz sanft. Für einen Moment überkam ihn der Wunsch, es einfach geschehen zu lassen. Aber aus einem kleinen Teil seines Bewußtseins, den die chemischen Substanzen noch nicht erreicht hatten, kam der Befehl, nicht aufzugeben, sondern zu begreifen, wem diese kleinen Pfoten gehörten, die er auf seiner Haut spürte, während er gefesselt dalag, angestrahlt wie ein Insekt auf dem Seziertisch.
Er richtete seinen Blick auf eine spitze Schnauze, darüber zwei kleine, neugierige Augen. Grausame Augen, dachte er und begann zu knurren. Laut, so laut er konnte. Aus seiner trockenen Kehle drang nur ein heiseres Fauchen, und mit vor Entsetzen geweiteten Augen sah er, wie sich zwei kleine, spitze Zähne seinem Mund näherten. Er riß den Kopf nach hinten, um dem Biß zu entgehen.
Schwere Schritte ließen den Boden erbeben und wirbelten eine Wolke aus beißendem Staub auf. Das Licht wurde schwächer. Das Kitzeln auf seinem Rücken hörte auf, und durch die Kleider hindurch spürte er das Trippeln unzähliger Pfoten. Die Ratten ergriffen die Flucht.
Ein massiger Schatten bückte sich, um mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen die Hände des Kindes, das vor Schmerz stöhnte, loszubinden. Wie versteinert starrte es auf die Lippen, die sich dicht vor seinem Gesicht bewegten:
»Du kommst jetzt mit mir mit, meine Hübsche …«
Sein Herz begann zu rasen. Meine Hübsche! Meine Hübsche! Was sollte das?
»Wir müssen dich herrichten … Freust du dich?«
In seinem umnebelten Hirn begann sich alles zu drehen, der Junge schloß die Augen, als er plötzlich an seinen nackten Oberschenkeln eine sonderbare Berührung wahrnahm. Ein kalter Gegenstand strich über seine Haut.
Der Unbekannte streichelte mit dem kalten Ding weiter über seine Unterarme, sein Gesicht, den Mund und das glatte Kinn. Schließlich glitt er über den Bauch zu den Hoden hinab, die sich zusammenzogen, als wollten sie sich verkriechen.
Der Junge rührte sich nicht, weinte nicht, bettelte nicht, er befand sich in einem Zustand jenseits der Angst. In panischem Entsetzen war er zu einer liegenden Statue erstarrt.
Erregt zog ihn der Unbekannte hoch.
Kaum auf den Beinen, sank der Junge gegen den gedrungenen Körper, dessen bestialische Ausdünstungen für einen Moment den widerlichen Gestank vergessen ließen, der in diesem finsteren Loch herrschte. Er war auf Küsse, Umarmungen und obszöne Gesten gefaßt, hatte von Anfang an damit gerechnet. Zu seiner großen Erleichterung geschah nichts dergleichen. Im Gegenteil, der Schatten ließ von ihm ab und verschwand.
Hastig bückte sich das Kind, um die Jeans hochzuziehen. Obwohl seine Hände zitterten, gelang es ihm, die Hose zuzuknöpfen, da tauchte plötzlich der Mann wieder auf. Mit anzüglichem Grinsen schwenkte er ein Stück Stoff.
Sofort war die Angst wieder da. Was wollte dieser Mann von ihm? Ihn wie ein Mädchen anziehen? Und dann?
Der Schauer, der den Jungen überlief, weckte zugleich seine Lebensgeister. Verzweifelt sah er sich um. Er unterdrückte den Brechreiz, den die Berührungen des Mannes bei ihm auslösten. Der hatte sich hinter ihn gestellt und strich über seine Hüften. Die Kälte der Messerklinge, die seinem Gürtel folgte und sich schließlich unter den Hosenknopf schob, riß die letzten Fetzen seiner Lethargie entzwei. In einer raschen Geste ließ er sich zu Boden gleiten, um dem Messer zu entrinnen, und schlug dabei mit den Händen wild um sich. In diesem Moment sah er es, schimmernd im weißen Licht. Ein Rasiermesser! Sein Herz tat einen Sprung, und es war so, als ginge die Watte in seinem Schädel in Flammen auf. Plötzlich nahm das Hirn seine elementaren Funktionen wieder auf, der Überlebenstrieb war erwacht.
Es dauerte nur eine Sekunde, und das Rasiermesser war in seiner Hand. Blindwütig schlug er um sich. Der Mann heulte auf und hob die Hände schützend vor seinen Oberkörper. Aber dann tat er einen Sprung zur Seite und ließ die Hand, die noch immer das Messer hielt, nach vorne schnellen.
Der Junge spürte, wie ihn der Hieb in der Taillengegend traf, während die dicken Finger seinen Arm umklammerten. In seiner Verzweiflung stieß er den Angreifer mit solcher Wucht zurück, daß der das Gleichgewicht verlor und hintenüberfiel.
Mit einem Satz stürmte das Opfer los, vorbei an seinem Peiniger, ohne zu wissen, wohin. Die Panik, in die ihn der Schmerz und das warme Blut zwischen seinen Fingern versetzten, fiel jäh von ihm ab, als er plötzlich den Ausweg sah: unverhofft, aber zum Greifen nah eine Lichtschneise in der Nacht. Wohin führte sie?
Ohne weiter nachzudenken, stürzte er durch die Dunkelheit darauf zu.
1
Sonntag. Gare du Nord. Videoüberwachungsraum
Die Wanduhr über den Bildschirmen zeigte 16 Uhr 38, als auf Monitor vier, mittlere Reihe, der Junge ins Blickfeld kam. Roger Lenfant, Angestellter des Sicherheitsdienstes, zuckte zusammen und richtete sich auf. Die Federung seines Stuhls quietschte. Sein Herz begann zu rasen, als ihm der Vorname seines Sohnes durch den Kopf schoß. Er hatte sogar fast das Gefühl, »Kevin!« geflüstert zu haben, als das Kind langsam an der weißen Kachelwand entlangglitt, ehe es auf dem Boden in sich zusammensank.
Der Wachmann trat näher an den Bildschirm, um sich den Jugendlichen, der zusammengekauert im Sichtbereich der Kamera K28TF lag, genauer anzusehen. Mit der linken Hand betätigte er den Zoom. Die Großaufnahme zeigte ihm, daß es nicht Kevin war.
Der Junge auf dem Bildschirm war dreizehn bis vierzehn Jahre alt, vielleicht auch ein bißchen jünger, aber keinesfalls älter, und gekleidet wie die meisten Jugendlichen seines Alters. Sein Gesicht machte einen sanften, mädchenhaften Eindruck, das blonde Haar war mittellang.
In seinem Blick lag jene Mischung aus Provokation, Angst und Hilfsbedürftigkeit, die Roger Lenfant in den Augen der Kinder, die sich am Bahnhof herumtrieben, schon so oft gesehen hatte. Sie waren kleine, erschöpfte Bettler, angehende Fixer, die ihr Leben schon hinter sich hatten, Prostituierte beiderlei Geschlechts. Sie waren überall. Auch in dem kleinen Gang, der vom Zwischengeschoß zum Eingang der Damentoilette führte.
»Was macht der da?« murmelte Matthias, ein stämmiger, rothaariger Mann mit kleinen, lebhaften Augen, der am anderen Bedienungspult saß. »Hat sich da mal wieder einer von den Junkies ins falsche Klo verirrt?«
Ein kurzer Seitenblick, und er sah das leichenblasse Gesicht seines Kollegen, um dessen schmerzverzerrten Mund sich tiefe Furchen zogen. Matthias verbiß sich die dumme Bemerkung, die ihm schon auf den Lippen lag, stand auf und verkündete, daß er mal pinkeln müsse. Roger Lenfant nickte, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden. Auf dem Monitor bewegte der Junge seine Lippen und versuchte mit starren, weit aufgerissenen Augen, die eilig vorbeigehenden Frauen auf sich aufmerksam zu machen. Aber sie würdigten ihn allenfalls eines flüchtigen Blickes. Manche schlugen einen Bogen, als wollten sie einer Gefahr ausweichen. Plötzlich drehte der Junge den Kopf nach links, zu den Toiletten, durch deren schemenhaft erkennbare Türen anonyme Menschen ein und aus gingen. Der Wachmann las eine jähe Panik in den hellen Augen des Kindes, das wild mit den Händen zu fuchteln begann. Es hob den rechten Arm vor sein Gesicht, spreizte die Finger, ballte sie zur Faust und schlug sich damit vor die Brust. Zweimal wiederholte es diese Geste, bis sich plötzlich ein Schatten ins Sichtfeld der Kamera schob. Das Kind verschwand hinter der massigen Silhouette eines dunkel gekleideten Mannes, der nur von hinten zu sehen war. Roger Lenfant ließ schimpfend die Maus, mit der er die Kameras steuern konnte, auf das Bedienungspult knallen.
»Zieh Leine, du Idiot!« fluchte er, weil er glaubte, der Mann sei ein Angestellter des Sicherheitsdienstes oder ein Feuerwehrmann oder Polizist, den irgendwelche besorgten Passanten herbeigerufen hatten.
Daß ein Angestellter des Sicherheitsdienstes allein und ohne vorherige Rücksprache in die Damentoilette eindrang, verstieß allerdings eindeutig gegen die Regeln. Roger Lenfant stand unvermittelt auf.
»Ich seh mal nach«, sagte er.
»Nein, verdammt noch mal!« fluchte der ihm vorgesetzte Kollege, der an einem Schreibtisch in der Mitte des Raums thronte. »Das ist nicht dein Job, Roger! Ich rufe die Jungs, die dafür zuständig sind …«
Aber als der Mann das aschfahle Gesicht und die flackernden Augen des Beamten sah, nahm er die Hand wieder vom Telefon.
»Leg das Band schon mal zur Seite«, sagte Roger Lenfant mit belegter Stimme.
Er zog sich seinen Blouson über und nahm eins der Funkgeräte, die nebeneinander an der Wand hingen, aus der Halterung.
Es dauerte vier Minuten, bis er die Stelle erreicht hatte. Die Kamera K28TF deckte eine Zone im zweiten Untergeschoß ab, dem sogenannten Zwischengeschoß, Sektor 8, südliches Ende. Der Gang war leer und der Junge verschwunden. Dort, wo er gefilmt worden war, zog sich eine breite, dunkelrote Spur über die weißen Kacheln, und auch auf dem Boden waren rote Flecken zu sehen, durch die bereits zahllose gleichgültige Passanten hindurchmarschiert waren. Bis auf eine Putzfrau, die mit ihrem Wagen angeschlurft kam, war der Ort jetzt menschenleer. Die Türen sämtlicher Toilettenkabinen waren geöffnet, und der Wachmann inspizierte eine nach der anderen, dann drehte er sich wieder zu der Putzfrau um.
»Was tun Sie denn da?« schrie er, als er sah, daß die Frau mit ihrem Aufnehmer über die Blutlache wischte.
Ohne auch nur aufzublicken, spülte sie seelenruhig den Lappen in ihrem Plastikeimer aus. Das klare Wasser nahm sofort eine schmutzigrosa Färbung an.
»Hören Sie auf damit, Herrgott noch mal!«
Die Frau gehorchte. Auf ihren Schrubber gestützt, wandte sie dem Beamten ihr häßliches Gesicht zu, das von zwei dicken Brillengläsern beherrscht wurde, mit denen sie aussah wie eine vom Licht überraschte Eule. Beim Anblick ihrer starren, ausdruckslosen Züge wurde Roger Lenfant wieder von Übelkeit erfaßt, und er wandte sich ab.
»Ja, und? Was mache ich jetzt?« fragte die Eule mit schriller Stimme. »Mach ich sauber, oder guck ich den Zügen hinterher?«
Roger Lenfant warf ihr einen vernichtenden Blick zu.
»Haben Sie ihn gesehen?« fuhr er sie an.
»Wen?«
»Den Jungen …«
»Welchen Jungen?«
Er gab es auf. Es war ohnehin zu spät, sie hatte bereits den größten Teil der Spuren beseitigt.
»Kann ich jetzt meine Arbeit weitermachen?« keifte die Frau hinter seinem Rücken. »Ich hab weiß Gott genug zu tun!«
Er mußte an Kevin denken, an Kevins Blut. Einmal hatte sich der Junge in den Finger geschnitten, und um ihn zu beruhigen, hatte der Vater seinen Mund auf die Wunde gepreßt. Die Erinnerung an den Blutgeschmack ließ ihn wanken.
Er spürte die Augen der Eule in seinem Rücken, während er zur Bahnhofshalle zurückging, und empfand einen diffusen Groll gegen diese zänkische »Raumpflegerin«.
»Wieder mal eine, die nur herumstänkert und sich nichts sagen läßt«, dachte er, während er sich bückte, um ein fettiges Stück Papier aufzuheben, das jemand weggeworfen hatte.
Neben dem leeren Einwickelpapier bemerkte er einen dunkelroten, von winzigen Tröpfchen umsprenkelten Kreis von etwa einem Zentimeter Durchmesser. Ein kleines, blutiges Auge, dann noch eins, einen Meter weiter. Und ein drittes, dem weitere folgten, die teils unberührt, teils durch die Schuhsohlen der Passanten verwischt waren. So erreichte er den Fuß der großen Rolltreppe und fuhr hinauf.
Oben herrschte ein einziges Gedränge. In der Zeit nach siebzehn Uhr ging es im Bahnhof hoch her. Roger Lenfant mußte eine Weile suchen, bis er mehr von den kleinen, runden Flecken entdeckte, die sich durch den Bahnhof zogen wie der Kreuzweg eines unbekannten Märtyrers. Tief gebückt und ohne sich um die verwunderten Gesichter der Passanten zu kümmern, folgte er der Tropfenspur.
2
Vom Rumpeln des Zuges eingelullt, versuchte Marion krampfhaft die Augen aufzuhalten. Nina, die vor ihr saß, hielt nervös und mit finsterer Miene einen Stadtplan von Paris in der Hand. Mit halbgeschlossenen Augen betrachtete Marion ihre Adoptivtochter. Sie hatte feine, klare Züge und helle Augen, die einen ganz unverwandt und geradeheraus ansehen konnten. Durch das kurze weiße T-Shirt zeichneten sich ihre winzigen Brüste ab, der rote Rock bedeckte nur einen kleinen Teil ihrer schlanken Beine. Marion lächelte gerührt.
»Was grinst du so?« murrte Nina gereizt.
»Wegen dir … Du bist hübsch, das hübscheste Mädchen auf der Welt.«
»Ja ja, klar doch«, brummelte Nina, die natürlich fand, daß sie zu klein war, einen zu dicken Hintern hatte, zu kurze Beine, eine zu große Nase, zu helle Augen … eben nicht hübsch war.
Sie wandte sich zur Fensterscheibe, hinter der die dreckigen Tunnelwände vorbeizogen, und Marion konnte ihrer bockigen Stirn die ganze Enttäuschung eines verpatzten Sonntagnachmittags ansehen. Zwei Stunden Schlange stehen vor dem Eiffelturm, und vor dem Triumphbogen ein unüberwindlicher Pulk von Touristen mit Fotoapparaten um den Hals – all das, worauf sich die Kleine so gefreut hatte, war wie eine Seifenblase zerplatzt. Marion streckte ihr die Hand hin, doch Nina zog sich nur weiter in ihre Ecke zurück und rümpfte die Nase, als die Station Châtelet-les-Halles mit ihren Kanalisationsgerüchen näher kam.
»Ich hab’s satt«, sagte sie so laut, daß es niemand in dem brechend vollen Metrowagen überhören konnte. »Paris ist ätzend, es ist häßlich und stinkt. Lyon war viel schöner.«
Marion hatte dem nichts entgegenzusetzen. Sie schloß die Augen, um die erstaunten Blicke der Umsitzenden nicht sehen zu müssen.
Auch sie mußte ständig daran denken, daß es ihr in Lyon besser gefallen hatte.
3
Auf dem Vorplatz drängten sich Taxis und Gepäckwagen. Die Blutspur endete direkt vor den automatischen Schiebetüren, jetzt wußte Roger Lenfant nicht weiter. Zweimal hatte Matthias bereits versucht, ihn über Funk zu erreichen. Natürlich hatte er nicht reagiert, denn dieser Junge brauchte ihn, das spürte er so deutlich, wie er die Distanz gespürt hatte, die zwischen ihm und Kevin entstanden war. Er hatte es nicht begreifen können, nicht begreifen wollen oder vielleicht auch einfach nicht den Mut dazu gehabt. Gefangen im Alltagstrott, hatte er es nicht einmal versucht. Dann war Kevin verschwunden. Hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Geblieben war eine unerträgliche Leere.
Er konzentrierte sich wieder auf den Bahnhofseingang, denn er war sich jetzt sicher, daß die blutige Spur tatsächlich vor dieser Schiebetür endete. Seit drei Minuten stand er nun schon davor und beobachtete, wie sie auf- und zuging. In der festen Überzeugung, daß er ganz nah dran war, machte er kehrt, um in der unmittelbaren Umgebung weiterzusuchen. Zwei Meter vor der Ecke eines der Reisepoint-Geschäfte tauchten die roten Punkte wieder auf, und Roger Lenfant hätte vor Freude fast einen Luftsprung gemacht. Er folgte der Spur bis zu den Aufzügen neben dem Zeitungsgeschäft, die zur Tiefgarage hinunterfuhren. An der mittleren Aufzugstür war ein länglicher brauner Fleck zu sehen. Als Roger Lenfant die Kabine betrat, stellte er fest, daß er sich nicht getäuscht hatte: An einer Stelle hinten im Aufzug hatten sich die Blutstropfen zu einer kleinen Pfütze verdichtet.
Schwerfällig setzte sich die Kabine in Bewegung.
Die Bahnhofstiefgarage hatte sieben Ebenen. Nun stellte sich die Frage, auf welcher der Jugendliche den Aufzug verlassen hatte.
4
»Wir sind da!« Ninas vorwitzige Stimme übertönte das Rumpeln des Zuges, der in den Gare du Nord einfuhr.
Marion, die doch noch eingeschlafen war, schreckte hoch.
Sie folgten dem Strom von Fahrgästen, die, mit riesigen Gepäckstücken beladen, den Ausgängen entgegenstrebten, und Ninas Laune besserte sich ein wenig. Marion hatte sich an die häufigen Stimmungswechsel ihrer pubertierenden Tochter gewöhnt und hütete sich, sie nach dem Grund zu fragen. Als sie an den Gleisen vorbeikamen, von denen die Vorstadtzüge losfuhren, bemerkte Marion, daß ihr Handy zwei Anrufe aufgenommen hatte, während sie in der Metro saßen, und blieb vor einem Schuhgeschäft stehen, um ihre Mailbox abzuhören.
»Die Dienststelle«, sagte sie zu Nina, die sich zerstreut die Auslagen ansah. »Ich muß hin.«
»Und ich?«
»Du kommst mit. Ich hoffe, es wird nicht lange dauern.«
»Kann ich nicht schon nach Hause gehen?«
Marion zögerte. Ihre Wohnung war nur zwei Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Sie lag mitten in einem Häuserdreieck, dessen Seiten Gare du Nord, Boulevard de Magenta und Hôpital Lariboisière bildeten. Ein »sensibler« Stadtteil, in dem alle denkbaren Formen von Kriminalität und normabweichendem Verhalten zu finden waren. Total ätzend, fand Nina, die sich hinter den Fenstern der siebten Etage nahezu täglich die Prügeleien der Dealer oder die wüsten Auseinandersetzungen der abgewrackten Penner unterschiedlichster Couleur ansehen durfte. Und Marion wußte, daß dies nur die Spitze eines Eisbergs war, der von Tag zu Tag größer wurde.
»Kommt nicht in Frage«, sagte sie schließlich und nahm ihre Tochter entschlossen an der Hand.
5
Als sie die Polizeidienststelle betraten, überfiel Marion wie jedesmal, wenn sie herkam, ein Gefühl der Beklemmung. Die dreihundert Quadratmeter großen Räumlichkeiten der Bahnhofspolizei im zweiten Untergeschoß des Gare du Nord waren in einem verlotterten, schmutzigen Zustand. Das Neonlicht verstärkte noch den ungepflegten Eindruck, den die klapprigen Möbel und die von Stuhllehnen zerkratzten Wände erweckten. Rund um die Uhr kümmerten sich an die hundert Polizisten im Schichtdienst um die etwa dreißig Personen, die täglich in Polizeigewahrsam genommen wurden, und um die zahlreichen Bahn- oder Metroangestellten und sonstigen Menschen, die kamen und gingen, um Anzeige zu erstatten. Sie schienen sich damit abgefunden zu haben, diese triste Atmosphäre ertragen zu müssen. In den Polizeidienststellen der fünf anderen Pariser Bahnhöfe sah es kein bißchen anders aus, bis auf einen kleinen Unterschied: Hier, im Gare du Nord, schaltete und waltete Hauptkommissarin Edwige Marion, seit kurzem zur Chefin der Bahnhofspolizei befördert, hier befanden sich ihr Generalstab und der zentrale Lage- und Führungsraum.
Die drei Männer vom Wachdienst, die hinter der Empfangstheke saßen, standen gleichzeitig auf, um sie zu begrüßen. Marion hatte sich noch nicht an ihre neue Truppe gewöhnt und trat noch nicht so souverän auf, wie sie es sich gewünscht hätte. Sie schüttelte ihnen die Hand, und Nina tat das gleiche, wobei sie interessiert ihre marineblauen, eng anliegenden Uniformen und ihr kurz geschnittenes Haar musterte. Die Truppe war jung, im Schnitt höchstens um die Dreißig, und auch das nur aufgrund einer Handvoll Beamter, die schon stramm auf die Vierzig zugingen. Gerade fand der Schichtwechsel statt, es war unruhig und laut.
Im Gang lungerten allerlei Individuen herum sowie zwei Hunde, die knurrend die Zähne fletschten, sobald eine Uniform in ihre Nähe kam. Eine Ansammlung merkwürdiger, nicht gerade wohlriechender Typen, durch die sich Marion und Nina mit angehaltenem Atem ihren Weg bahnten. Ganz hinten, bei der Treppe zum Lage- und Führungsraum, der durch eine Panzertür geschützt war, lehnte ein einzelner Mann an der Wand. Er schien unter seinem Hut eingenickt zu sein. Kurz bevor Marion bei ihm angelangt war, öffnete sie eine Tür, die aussah wie alle anderen, und führte Nina in ihr Büro, das ein ziemlich geräumiger, wenn auch fensterloser Raum war. Nina hatte ihre Mutter schon häufiger begleitet und steuerte sofort auf den Fernseher zu.
Es klopfte, und ein Mann in Polizeiuniform – marineblaue Hose, weißes Hemd – kam herein, ohne auf eine Antwort zu warten. Er war groß, schlank und gutaussehend, mit kurzem braunen Haar, einem schwarzen Schnurrbart und dunklen Augen, deren lange Wimpern fast etwas Mädchenhaftes hatten. Für Marion waren vor allem die abstehenden Ohren das Erkennungsmerkmal, und als er den Mund auftat, fiel ihr auch sein Name wieder ein. Der südfranzösische Akzent war unverwechselbar, es handelte sich um Capitaine Abadie.
»Chef!« murmelte er zur Begrüßung in seinen Schnurrbart.
Er sah erschöpft aus, das Hemd hatte sichtlich gelitten, und seine nikotingelben Finger deuteten darauf hin, daß die letzten vierundzwanzig Stunden hart gewesen waren.
»War am Wochenende viel los?« erkundigte sich Marion denn auch.
Er nickte kurz und wiederholte rasch, was er ihr schon am Telefon über den letzten Fall gesagt hatte, der die Ansammlung von Individuen im Flur erklärte. Sie hatten sich alle am Bahnhof herumgetrieben, bevor das geschah, was in den Augen von Capitaine Abadie nur eine »Keilerei zwischen Bahnhofspennern« gewesen sein konnte. Er nannte den Namen des ersten und bislang einzigen Zeugen der Tat. Roger Lenfant, vierundvierzig Jahre alt, Angestellter im Videoüberwachungsraum des Gare du Nord, war durch die Parkhäuser und Hinterhöfe des Bahnhofs einer Blutspur gefolgt, die ihn bis zum Eingang des Hôpital Lariboisière geführt hatte, wo ein blutüberströmter Jugendlicher Zuflucht gefunden hatte.
»Der Zeuge hat keinen der Verdächtigen erkannt«, seufzte der Capitaine. »Er ist nebenan, wollen Sie mit ihm sprechen?«
»Ja«, sagte Marion, während sie schon zur Tür ging. »Ist jemand im Krankenhaus bei dem Verletzten geblieben?«
»Lieutenant Valentine Cara. Ich mußte sie anrufen, sie hatte Bereitschaftsdienst und war zu Hause …«
»Gut gemacht. Seine Personalien haben wir wahrscheinlich nicht, oder?«
Die Frage war überflüssig. Die meisten Typen, die sich am Bahnhof herumtrieben, hatten keine Papiere. Oder wenn, dann gefälschte.
»Nein«, bestätigte Abadie. »Ich habe das Paßfoto, das ich in seiner Hosentasche gefunden habe, an alle Dienststellen weitergeleitet. Das Krankenhaus hat mich gebeten, die Leute vom Jugendschutz zu informieren. Ich denke, daß das Opfer noch keine fünfzehn ist, aber der Ossifikationszustand seiner Knochen ist noch nicht untersucht worden. Wenn das getan ist, wissen wir mehr. Sieht nicht gut für ihn aus. Stichverletzung an der Leber mit inneren Blutungen. Im Moment liegt er im Koma.«
»Was sonst?«
»Das ist alles. Na ja, bis auf … Seine Kleider sind ganz mit Staub bedeckt.«
»Haben Sie schon mal einen blitzsauberen Obdachlosen gesehen?«
Mit einer müden Handbewegung verscheuchte Abadie eine unsichtbare Fliege.
»Nein, natürlich nicht. Aber hier handelt es sich um extrem viel Staub, bis in die Taschen hinein. Man könnte fast meinen, er hätte sich darin gewälzt.«
»Das Labor wird uns sagen, was es davon hält. Ich würde gern zu der Stelle gehen, an der ihn dieser … Lenfant zum erstenmal bemerkt hat.«
Capitaine Abadie schien überrascht zu sein.
»Was ist?« fragte Marion ein bißchen zu schnell. »Ist das zuviel verlangt?«
»Nein, nein. Aber ich war schon dort und habe die Tatbestandsaufnahme gemacht, die Leute von der Spurensicherung waren da, und ich habe die Videos sichergestellt …«
»Ich vertraue Ihnen.«
»Aber dann …«
»Ja?«
»Nichts, Chef, gehen wir, wenn Sie wollen.«
Er warf einen Blick auf Nina, die sich den Hals verrenkte, um weder von ihrer Sendung noch von dem Gespräch etwas zu verpassen.
»Nina«, sagte Marion, »wartest du hier auf mich?«
»Ich hab doch eh keine andere Wahl …«, murrte das Mädchen.
Marion war schon an der Tür.
»Kann ich nicht doch mitkommen?« fragte Nina versuchsweise.
Capitaine Abadie zeigte keine Regung, aber seine Haltung hatte etwas Verkrampftes, das Marion nicht entging: Ihre Bewährungsfrist war noch nicht abgelaufen. Ihr gesamtes Verhalten, jedes Lächeln, jeder Wutausbruch und jede noch so harmlose Äußerung aus ihrem Mund wurde von ihren Leuten zur Kenntnis genommen, kommentiert und analysiert, um daraus Schlüsse auf ihren Charakter zu ziehen. Sie wußte, daß sie die Prüfung noch nicht bestanden hatte.
»Nein, Nina. Es wird nicht lange dauern, das verspreche ich dir. Gehen wir, Abadie?«
Im Türrahmen drehte sie sich noch einmal um, und ihr Blick begegnete dem ihrer Tochter. Es war ein offener, inniger Blick. Auch Nina unterzog ihre Mutter einer Prüfung, Tag für Tag.
6
Die Digitaluhren in der Halle zeigten 20 Uhr 30 an. Zügig marschierte Marion wieder auf die Büros der Bahnhofspolizei zu, und Capitaine Abadie war so müde, daß er Mühe hatte, Schritt zu halten. In der Damentoilette hatte Marion nichts gefunden, was nicht schon bemerkt worden wäre, und inzwischen hatte das Sicherheitspersonal der SNCF mit seinen Kontrollgängen begonnen. Der Verkehr nahm langsam ab, bald würde der letzte Eurostar abfahren, und die Menschen hatten es eilig, in ihre trostlosen Vorstädte zurückzukehren. Das war der Startschuß für Marions Leute, denen nun die anstrengendsten Stunden des Tages bevorstanden: Wenn die letzten Züge fuhren und nur noch vereinzelt Fahrgäste unterwegs waren, kamen die Ganoven aus ihren Löchern.
Schon in der Eingangstür hörte Marion Ninas helle Stimme, dann Männerstimmen, die ihr Antwort gaben, und dazwischen aufgeregtes Hundegebell.
»Ist es nicht nervig, den ganzen Tag am Bahnhof herumzuhängen und nichts zu tun?«
»Hast du uns eigentlich mal richtig angeguckt, Puppe? Was sollen wir denn schon arbeiten?«
Ein dickbäuchiger, bärtiger Mann brach in provozierendes Gelächter aus und kratzte sich dabei vielsagend zwischen den Beinen. Die anderen taten das gleiche. Nina baute sich vor einem großen Typen mit wäßrigen Augen auf, der sie lüstern anstarrte, und hielt seinem Blick mit gerümpfter Nase stand.
»Ich weiß nicht, wie ihr so leben könnt! Hier stinkt’s, wirklich.«
Der Mann gab in einer fremden, brutal klingenden Sprache eine Schimpfkanonade von sich. Marion hatte gerade noch Zeit, Nina am Arm zu packen und in ihr Büro zu ziehen, dessen Tür sie laut hinter sich zuschlug.
»Sag mal, hast du den Verstand verloren?« polterte sie los. »Kann ich dich denn nicht mal fünf Minuten alleine lassen? Kann ich dir nicht vertrauen?«
»Was habe ich denn Schlimmes getan?« rief Nina mit weit aufgerissenen Augen.
»Du weißt also nicht, daß das alles Junkies sind, die sich mit Schnaps und Koks vollgepumpt haben? Die Hälfte von denen war gerade im Knast, und die andere Hälfte hätte es verdient reinzukommen. Diese Typen sind gewalttätig, die würden jeden umlegen … Ehrlich, Nina, du machst mir Sorgen!«
»Aber mir war langweilig, du hättest halt nicht so lange wegbleiben sollen.«
Marion sah auf die Uhr, während sie aufgebracht um ihren Schreibtisch herumging.
»Zwanzig Minuten! Ich war zwanzig Minuten weg! Das soll ja wohl ein Witz sein!«
Sie drückte auf den Knopf ihrer Sprechanlage, sofort war eine Männerstimme zu hören.
»Schicken Sie mir den Major. In mein Büro. Sofort.«
Auf der anderen Seite der Tür hörte man Luc Abadie, der noch immer zu tun hatte. Das letzte verdächtige Subjekt war erkennungsdienstlich behandelt worden. Für alle Fälle und gemäß dem Prinzip, daß man sämtliche Informationen sammeln und bereithalten mußte, bis sie vielleicht einmal von Nutzen waren. Jetzt mußte noch die Zeugenvernehmung abgeschlossen werden, die dann ebenfalls in die Akte kam, aber danach gab’s nur noch eins: Schluß für heute. Der Capitaine unterdrückte ein Gähnen, als Marion aus ihrem Büro kam und Nina durch den Flur vor sich her schob.
»Ich gebe sie für fünf Minuten in Ihre Obhut, Capitaine. Wenn Sie mit den Burschen fertig sind, schmeißen Sie sie alle raus.«
Der Mann mit dem Hut, der am Ende des Ganges saß, hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Leise fragte Marion ihren Kollegen:
»Gehört der auch zu der Clique?«
»Nein, nein, der will Anzeige erstatten. Man hat ihm seine Papiere gestohlen. Ich hatte noch keine Zeit, mich um ihn zu kümmern.«
Er wandte sich an eine Beamtin, die in einem der offenen Büros vor einem Computer saß und tippte.
»Wenn du fertig bist, Nathalie, nimmst du dann die Strafanzeige von dem Herrn dort auf?«
Während die junge Frau nickte, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, kam Major Morel aus dem Besprechungsraum. Er warf Marion, deren schlechte Laune ihm nicht verborgen geblieben war, einen beunruhigten Blick zu. Nichtsdestotrotz nahm er sich eine Minute Zeit, um sich den Bericht einer Streife anzuhören, die gerade Dienstschluß hatte, und verlor dann noch eine Minute, weil er den Männern erst die Tür zur Waffenkammer öffnete. Befehle nahm er entgegen, aber er war nicht unterwürfig und ließ sich nicht hetzen, auch wenn Marion ungeduldig mit den Fingern gegen den Türrahmen trommelte.
Marion wußte, daß es unangebracht war, ihre Tochter in die Dienststelle mitzunehmen, genauso unangebracht wie, zu Hause einen Beamten auf sie aufpassen zu lassen, wenn sie selbst aus beruflichen Gründen unterwegs war. Trotzdem hatte sie es bereits mehrmals getan.
Wenn sich alle das gleiche Recht nähmen, würde hier das reinste Chaos herrschen, mußte sich Marion eingestehen, als der Major schließlich auf sie zukam.
Major Morel, der kurz vor der Pensionierung stand, hatte vor zwölf Jahren die Abteilung aufgebaut. Seine damalige Vorgesetzte, eine Kommissarin vom alten Schlag, hatte deutliche Spuren hinterlassen und wurde von ihm noch immer zutiefst verehrt. Morel, der die Seele und das Gedächtnis der Bahnhofspolizei war, konnte nicht umhin, die Dame bei jeder Gelegenheit zu zitieren, und Marion war sich alles anderes als sicher, ob sie dem Vergleich standhalten würde.
Im Unterschied zu Luc Abadie, der sich ganz den polizeilichen Ermittlungen verschrieben hatte, kümmerte sich Morel nur um Organisatorisches, die Dienstpläne der Beamten, ihren Urlaub, ihre Disziplin. Jeder Tag brachte sein Maß an bösen Überraschungen mit sich. Hinter dem heiteren, höflichen Auftreten von Major Morel verbarg sich eine eiserne Faust. Aber es gab auch Tage, an denen er nicht mehr konnte. Dieser Sonntag war so ein Tag, und als Marion sein erschöpftes Gesicht sah, brachte sie es nicht fertig, ihm noch weiter zuzusetzen. Sie bat ihn in ihr Büro und hörte sich, ohne ihn auch nur einmal zu unterbrechen, die Bilanz eines mehr oder weniger gewöhnlichen Wochenendes an.
»Danke, Major«, murmelte sie dann und schob ihn aus ihrem Büro. »Alles weitere sehen wir morgen.«
Sie deutete auf den leeren Flur, aus dem sogar der Mann mit dem Hut verschwunden war. Von den Gestalten, deren Personalien man überprüft hatte, war nur noch ein ekelhafter Geruch geblieben, ein bißchen Müll und eine große, trübe Pfütze, die sich auf dem Fliesenboden ausgebreitet hatte. Mittendrin schwamm ein Zigarettenstummel. Marion rümpfte die Nase.
»Die Hunde?«
»Glaube ich nicht.«
Major Morel verzog resigniert das Gesicht. Mit dem Fuß schob er ein paar Papierschnipsel zur Seite und rief dann einen Beamten herbei, der neben der Eingangstür saß und auf die Überwachungsbildschirme starrte, auf denen nichts zu sehen war. Der Mann entgegnete, daß er nicht fürs Putzen bezahlt werde, und der Major mußte laut werden. Marion biß sich auf die Lippen, um sich nicht einzumischen. Der Beamte hatte recht, fürs Putzen waren andere zuständig. Trotzdem wäre sie am liebsten über ihn hergefallen für seinen arroganten Ton, seine hemmungslos zur Schau getragene Faulheit, seine Jacke, die er nicht ordentlich zugeknöpft hatte, und das Käppi auf seinem Schoß.
»Den schicken Sie morgen mal zu mir«, sagte sie zu Morel, obwohl sie nicht wußte, ob das die richtige Methode war.
»Ich werde mich gleich um ihn kümmern, das ist besser«, sagte der Major, und wie zum Trost fügte er hinzu:
»Sie werden sich daran gewöhnen, Chef, Sie werden sehen.«
»Ich weiß nicht.«
Sie konnte es kaum erwarten, mit Nina in ihre Dachgeschoßwohnung zurückzukehren, ihre Tochter auf dem alten Sofa an sich zu drücken und zuzuhören, wie sie einschlief. Von einer Sekunde zur nächsten, wie ein Stein, der auf den Meeresgrund sinkt.
Sie gingen ein Stück den Flur entlang, und Marion bückte sich, um eine leere Bierdose aufzuheben, die jemand achtlos auf den Boden geworfen hatte. Als sie sich wieder aufrichtete, bemerkte sie, daß die Tür zur Waffenkammer einen Spaltbreit aufstand. Mit der Fußspitze stieß sie die Tür ganz auf. Morel folgte ihr, und sie konnte deutlich hören, daß sein Atem schneller ging. In dem Raum war niemand, die Waffen standen aneinandergereiht in den Gestellen über den Ladekisten, wo die Männer bei jedem Dienstschluß und jedem Dienstbeginn mit ihnen hantierten.
»Haben Sie hierfür eine Erklärung, Major?«
»Nein. Ich habe die Tür aufgeschlossen, als die letzte Streife zurückgekommen ist. Die Jungs hätten mich rufen müssen, damit ich sie wieder abschließe. Ich werde dafür sorgen, daß dem nachgegangen wird.«
Marion lehnte sich an einen der Tische und sah sich besorgt in dem kleinen Zimmer um.
»Ich hoffe, es fehlt nichts …«, sagte sie und suchte im Gesicht des Majors nach Anzeichen dafür, sich nicht aufregen zu müssen.
»Ich mache eine Bestandsaufnahme, sobald alle Teams wieder zurück sind.«
Er trat zur Seite, um Marion vorbeizulassen. Sie blieb vor ihm stehen und sah ihn besorgt an.
»Ist das hier immer so?«
Major Morel zuckte steif die Achseln.
»Wir sind eine große Abteilung.«
Ninas Hand lag in ihrer Hand. Die Kleine gähnte. Müde schmiegte sie sich an ihre Mutter, bemüht, mit ihr Schritt zu halten. Der Bahnhof war leer und ganz in den Händen des Reinigungspersonals, das mit den Kehrmaschinen seine nächtliche Arbeit anging. Sie durchquerten das Zwischengeschoß und gelangten über die große Rolltreppe in die Bahnhofshalle. Mit kreischenden Rädern fuhr im Bereich der Vorstadtzüge eine Wagenkolonne in den Bahnhof ein, wohl eine der letzten an diesem Tag. Eine dreiköpfige Polizeistreife stieg aus und eilte am Gleis entlang Richtung Dienststelle. Die Handschellen, Knüppel und Funkgeräte klirrten und klapperten im Takt. Die Polizisten hatten niemanden festgenommen, Capitaine Abadie konnte endlich auf dem Feldbett die müden Beine ausstrecken und eine letzte Zigarette rauchen, ehe im Fernsehen die Spätnachrichten kämen.
Marion blieb kurz am Gleisende stehen. Die Männer, die sie schon von weitem erblickt hatten, schienen überrascht zu sein, denn sie zögerten kaum merklich. Dann führten sie alle gleichzeitig die rechte Hand an die Schläfe.
»Findest du diesen militärischen Gruß eigentlich nicht komisch?« kicherte Nina.
»Doch.«
»Aber es gefällt dir, oder?«
»… ja.«
Sie lachten, und ihre Stimmen verhallten unter dem gläsernen Dachgewölbe, hinter dem die schimmernden Umrisse der majestätischen Statuen zu sehen waren, die die größten Städte Nordfrankreichs symbolisierten. Nina äffte die Polizisten nach, indem sie die Hacken zusammenschlug, die flache Hand an die Stirn legte und zu den Vögeln hochsah, die unter dem Glasdach nach Schlafplätzen suchten. Marion drehte sich um, weil sie fürchtete, die Beamten könnten bemerkt haben, daß Nina sich über sie lustig machte. Aber sie waren verschwunden, nur das gedämpfte Stampfen ihrer Schnürstiefel war noch zu hören.
»Du Spottdrossel, du … Schäm dich was! Und überhaupt, hast du eigentlich deine Hausaufgaben gemacht?«
7
Marion war schlecht eingeschlafen. Vom Bahnhof zu ihrer Wohnung waren es zwar nur ein paar hundert Meter, aber der Weg hatte ihr wieder einmal bestätigt, was sie längst wußte.
Mehrmals waren sie im Vorbeigehen von finsteren, aggressiven Gestalten angebettelt worden. An der Ecke Rue de Maubeuge, Rue Ambroise Paré waren sie durch eine kleine Menschenmenge aufgehalten worden. Mehrere Dealer machten sich ein Stück Asphalt streitig und wurden dabei von anderen verkrachten Existenzen, die Beleidigungen skandierten, angefeuert. Marion hatte Nina weitergezogen und über Handy das zuständige Kommissariat informiert. Sie hatten die Flucht ergriffen, ohne auf das Eintreffen der Beamten zu warten.
»Warum bist du nicht hin und hast die Typen getrennt?« hatte Nina im Treppenhaus gefragt, als sie den vierten Stock erreichten.
Marion hatte ihr keine Antwort gegeben. Sie hatte einen Kloß im Hals, und außerdem geriet sie viel zu schnell außer Atem, seit sie ihre Nikes im Schrank verstaut hatte. Ein Verzicht, der ihrer Versetzung nach Paris geschuldet war. Ihr war auch Gilles zum Opfer gefallen, der letzte Mann, der sie geliebt hatte. Er war in seinen Bergen geblieben, weil er ihre Entscheidung nicht verstehen konnte und nicht so verrückt war, alles hinzuschmeißen und mit ihr zu gehen.
Als Marion die Wohnungstür aufschloß, hatte ihr Nina den Rest gegeben:
»Es wäre gut, wenn ich ein Handy hätte.«
»Ein Handy?«
»Ja. Ein Mobiltelefon. Meine ganzen Freundinnen haben eins. Ich könnte dich anrufen, und du wüßtest immer, wo ich bin.«
Marion war so verdattert, daß sie ihre Antwort lieber auf den nächsten Tag verschob.
Trotzdem hatte die wohltuende Wirkung eines warmen Bades, eines frischen Pyjamas und eines Entspannungstees auf sich warten lassen.
Gegen ein Uhr war sie schließlich weggedämmert.
Um ein Uhr dreißig hörte sie Nina im Traum aus einem Handy um Hilfe rufen und fuhr mit wild klopfendem Herzen aus dem Bett. Das Klingeln – Pulp Fiction hatte Amazing Grace abgelöst – hörte in dem Moment auf, als sie das Telefon, das sich tief in ihrer Blousontasche heiser schrie, endlich zu packen bekam. Sie las die Nummer auf dem Display. Es war die der Dienststelle.
»Ich glaube, jetzt oder nie«, sagte Capitaine Abadie. »Er ist bei Bewußtsein, und ich bin mir nicht sicher, ob er’s lange bleiben wird.«
Marion verschränkte fröstelnd die Arme vor der Brust, worauf sich Luc Abadie zu ihr vorbeugte.
»Ist Ihnen kalt? Möchten Sie meinen Parka anziehen?«
Sie schüttelte den Kopf. Sie hatten den kleinen, halbkreisförmigen Platz vor der Unfallstation des Hôpital Lariboisière überquert, und Marion hielt kurz inne, drehte sich um und warf einen Blick auf die Hinterseite des grauen, tristen Gebäudes, dessen Fenster im siebten Stock nicht erleuchtet waren. Dort oben schlief Nina. Allein, inmitten der feindlichen Umgebung. Marion spürte, daß der Capitaine drauf und dran war, einen Kommentar abzugeben, und ging rasch weiter.
»Sind Sie vom Krankenhaus benachrichtigt worden?« fragte sie, während sie auf den Aufnahmeschalter zugingen.
»Soll das ein Witz sein?« entgegnete er mit einem bitteren Lachen. »Seit ich in Paris arbeite, bin ich noch nicht ein einziges Mal von einem Krankenhaus angerufen worden, um jemanden zu vernehmen. Nicht mal ein Opfer.«
»Er ist minderjährig …«
»Das stört die nicht. Lenfant hat mich benachrichtigt. Na, Sie wissen schon, der Wachmann der SNCF.«
8
Dieser Roger Lenfant war wirklich unermüdlich. Vor ein paar Stunden hatte er Marion erzählt, wie er der Spur des verletzten Jungen bis zum Krankenhaus gefolgt war, wie er zur Bahnhofspolizei gegangen war, um den Überfall zu melden, und wie er anschließend in die Unfallstation zurückgekehrt war, um am Bett des Jungen darauf zu warten, daß er aufwachte. Um zwei Uhr morgens war er immer noch voller Energie, und die Kommissarin fragte sich, warum er eigentlich so hartnäckig war.
Aber als der Wachmann wieder vor ihr stand und sie die dunklen, bläulichen Ringe unter seinen Augen und die großen Schweißflecken auf seinem Hemd sah, vergaß sie ihre Frage.
»Ich bin noch einmal gekommen, um zu sehen, wie es ihm geht«, sagte er, auf das verglaste Zimmer der Intensivstation deutend, in dem der junge Verletzte lag.
»Und Valentine Cara?« wollte Marion wissen.
»Sie ist gegangen, als ich kam«, antwortete Roger Lenfant, dessen Blick unablässig zwischen Marion und ihrem Kollegen hin- und herwanderte.
»Ich habe mich natürlich um eine durchgehende Bewachung gekümmert«, fügte Capitaine Abadie, dem das gefährliche Stirnrunzeln seiner Chefin nicht entgangen war, schnell hinzu.
Er wies mit dem Daumen auf einen Raum hinter sich, wo ein Polizeibeamter mit der Mütze im Schoß in einer Zeitschrift blätterte.
Marion schob Roger Lenfant vorsichtig zur Seite und ging auf die Tür des Krankenzimmers zu. Der Zeuge, der ihr folgte, berichtete in gehetztem Ton:
»Lieutenant Cara war gerade gegangen, da hat der Junge die Augen aufgeschlagen. Ich war froh, daß er aufgewacht war, aber als er mich hinter der Scheibe gesehen hat, ist er in Panik geraten. Eine Krankenschwester hat ihn gehört, sie ist reingegangen und ich hinterher. Der Junge hat versucht zu reden, aber er brachte nichts raus. Ich habe ihm Fragen gestellt, aber er war halbtot vor Angst. Er hat sich erst wieder beruhigt, als sich die Krankenschwester vor mich gestellt hat, damit er mich nicht mehr sehen konnte. Mir ist klargeworden … na ja … ich glaube, er hat Angst vor Männern. Ich dachte, es sei besser, Sie zu benachrichtigen.«
Und darum bin ich jetzt hier, dachte Marion verbittert. Der Junge hat Angst vor Männern. Valentine Cara ist heimgegangen, und eine andere Frau, die sich diese Nacht an sein Bett hocken würde, gibt’s gerade nicht, also bin ich jetzt da, ich wohne ja auch nur zwei Fußminuten von hier …
Vor der Tür des Zimmers angelangt, drehte sie sich zu den beiden Männern um.
»Bleiben Sie hier. Vor Männern hat er doch Schiß, oder?«
Abadie hielt Marion einen Gegenstand hin, den er aus einer schwarzen Tasche gezogen hatte. Eine kleine Digitalkamera …
»Nehmen Sie das«, meinte er. »Damit nichts verlorengeht, falls er Ihnen etwas Verwertbares sagt.«
Und er erklärte ihr rasch, wie der Apparat funktionierte.
»Ich wußte nicht, daß wir mit so was arbeiten«, sagte Marion, etwas verärgert darüber, wieder einmal nicht auf dem laufenden zu sein.
»Das gehört zu meiner persönlichen Ausrüstung«, erklärte Abadie. »Haben Sie verstanden, wie die Kamera funktioniert?«
Sie musterte ihn und hätte am liebsten eine bissige Antwort gegeben. Aber sie beherrschte sich und trat wortlos in das Zimmer.
Das Kind war bei Bewußtsein, das erkannte sie an den leicht zuckenden Lidern und den fahlen, verkrampften Lippen. Sie beugte sich über das bleiche Gesicht und strich mit den Fingerspitzen über die auf dem Laken ruhende Hand. Der Junge zitterte und schlug langsam die Augen auf.
»Hab keine Angst«, murmelte sie. »Ich bin hier, um dir zu helfen. Möchtest du mit mir sprechen?«
Er öffnete leicht die Lippen, und zwischen den Krankenhausgerüchen stieg Marion sein Atem in die Nase.
»Ich werde dich jetzt filmen, hab keine Angst«, wiederholte sie leise, als der Junge panisch die Augen verdrehte.
Plötzlich wurde ihr wieder bewußt, daß man sie vor Betreten der Intensivstation in einen Kittel gesteckt und mit einer Haube und einem Mundschutz verkleidet hatte. Ohne nachzudenken, aber so langsam und vorsichtig, wie sie nur konnte, schob sie das Stück Stoff vor ihrem Mund zur Seite.
»Ich bin von der Polizei, hab keine Angst. Du bist hier in Sicherheit. Wie heißt du?«
Der Jugendliche fixierte die kleine Kamera und das rote Lämpchen, das den Aufnahmemodus anzeigte.
»Du hast doch einen Namen?«
Er sah wieder zu Marion, blinzelte mehrmals und bewegte dabei die Lippen.
»Kannst du nicht sprechen?«
Mühsam hob er seine schmale weiße Hand und deutete ein paar rätselhafte Bewegungen an. Dann richtete er mehrmals seinen Zeigefinger auf Marion und versuchte vergeblich, die andere Hand zu Hilfe zu nehmen, an der ein Infusionsschlauch hing. Seine Lippen bildeten mehrere Worte, die sie nicht hören konnte.
»Ich verstehe nicht, was du sagst. Wie heißt du? Woher kommst du? Wo sind deine Eltern? Was ist im Bahnhof passiert?«
Wieder wurde der Junge von panischer Angst erfaßt, und er hob die Hand, während er Marion anstarrte.
»Ich verstehe nichts«, schimpfte die junge Kommissarin leise vor sich hin.
Hinter ihrem Rücken waren Geräusche zu hören, aus denen sie schloß, daß sie nicht mehr viel Zeit hatte. Als sie sich umdrehte, kam ein weißer Kittel auf sie zugestürzt. Der Arzt blieb so dicht vor ihr stehen, daß er sie fast berührte, und deutete auf die Kamera, die jetzt auf ihn gerichtet war.
»Sie schrecken wirklich vor nichts zurück.«
Mit einer schroffen Handbewegung zog er an Marions Mundschutz.
»Und jetzt ziehen Sie das Ding wieder an! Wir sind hier nicht am Bahnhof, sondern in einem Krankenhaus.«
»Hat er mit Ihnen gesprochen?« fragte Marion ausweichend, aber mit ruhiger Stimme. »Ich muß wissen, wer er ist und was ihm zugestoßen ist.«
»Tatsächlich?«
»Ich tue meine Arbeit.«
»Und meine Arbeit besteht darin, Kranke zu pflegen und nicht Menschen zu quälen, damit sie auf ihrem Sterbebett irgendwelche Dinge zugeben.«
»Sterbebett?«
Der Arzt packte Marion an der Hand, mit der sie die Kamera hielt, und zog sie aus dem Raum.
»Lassen Sie ihn in Ruhe«, sagte er, als sie zu Roger Lenfant und Capitaine Abadie zurückgekehrt waren. »Er ist schwer verletzt. Er wird es nicht schaffen.«
»Scheiße!«
Der weiße Kittel wirbelte kommentarlos herum, und der Arzt verschwand, um sich anderen Todeskandidaten zu widmen. Bestürzt sah Marion zu dem Raum, hinter dessen Scheiben mehrere grüne Lämpchen blinkten. Der unbekannte Verletzte war wieder bewußtlos geworden.
9
Leise schlich sie ins Kinderzimmer und kniete sich nach Überwindung diverser Hindernisse neben das Bett. Nina hatte es sich in den Kopf gesetzt, ihre Wände violett zu überstreichen, und der Farbgeruch hing immer noch in der Luft. Das auf dem Rücken liegende Mädchen schnarchte leise. Gerührt betrachtete Marion ihren halbgeöffneten, im Schlaf noch so kindlichen Mund und die breite Stirn zwischen den goldblonden Haaren, die weich übers Kopfkissen fielen.
»Wie groß du bist«, hauchte sie. »Warum bist du nicht klein geblieben, mein Mäuschen?«
Nina bewegte sich, lächelte leise, fast spöttisch im Schlaf und drehte sich zur Wand.
Als im Nachbarzimmer das Telefon klingelte, rannte Marion sofort los.
»Sie waren doch noch nicht im Bett, Chef?«
»Fast«, murmelte sie vor sich hin. »Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund«, fügte sie dann lauter und in drohendem Ton hinzu. Ihre Kehle war wie zugeschnürt.
Abadies Seufzen am anderen Ende der Leitung war nicht zu überhören.
»Roger Lenfant hat etwas Wichtiges entdeckt.«
»Als ich mir das Video angesehen habe, das Sie im Krankenhaus aufgenommen haben, ist es mir sofort ins Auge gesprungen.«
Der Wachmann der SNCF zeigte keinerlei Anzeichen von Müdigkeit mehr. Und er war sichtlich stolz auf sich.
In der nächtlichen Stille ihres Büros wartete Marion auf das, was nun kommen würde. Die Männer waren schon vor einer guten Weile nach Hause gegangen. An den Bedienungspulten im Lage- und Führungsraum saßen nur noch zwei Beamte die immer knapper gehaltene Funksprüche mit den aus den Vororten zurückkehrenden Polizeistreifen austauschten.
Außer Luc Abadie war keiner der leitenden Beamten anwesend. Er schob eine Kassette in den Videorecorder, und Marion sah zum drittenmal die Szene, die die Überwachungskameras am Nachmittag aufgenommen hatten. Dann reichte ihr der Capitaine die Digitalkamera, und sie spulte nochmals die Bilder des Jungen aus der Intensivstation ab. Es war unübersehbar.
»Ich verstehe.«
»Der Junge ist taubstumm. Er drückt sich in Gebärdensprache aus.«
»Zum Donnerwetter!« murmelte Marion. »Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er mich so durchdringend anstarrt. Er hat versucht, die Worte auf meinen Lippen zu lesen!«
»Genau.«
»Ich habe geredet wie ein Wasserfall! Kein Wunder, daß er mich nicht verstanden hat! Ein Glück, daß ich wenigstens diesen blöden Mundschutz abgenommen habe … Können Sie verstehen, was er sagen will?«
»Nicht wirklich«, schaltete sich Abadie ein. »Da ist so eine Geste, die er ständig wiederholt, aber …«
»Meiner Meinung nach«, unterbrach ihn Roger Lenfant, »hat ihn der Mann angegriffen, den man von hinten auf dem Video sieht. Wenn man ihn nur besser erkennen könnte …«
Marion legte die Kamera aus der Hand.
»Vielleicht hat doch jemand was gesehen. Wir müssen morgen früh sofort einen Zeugenaufruf starten.«
Es folgte Schweigen. Marion warf Abadie einen fragenden Blick zu.
»Sie scheinen nicht gerade begeistert zu sein.«
Der Capitaine spulte bedächtig den Film zurück, nahm die Kassette aus dem Recorder und schob sie in eine durchsichtige Hülle.
»Durch diesen Bahnhof kommen täglich Hunderttausende von Menschen«, sagte er in neutralem Ton. »Die meisten von ihnen nehmen einen Zug ins Ausland und haben nicht die leiseste Chance, unseren Aufruf zu lesen oder zu hören.«
»Ja, und? Sollen wir deshalb gleich die Segel streichen?«
Marion hatte sich schon oft gefragt, was sich hinter dem aalglatten, distanzierten Auftreten ihres Kollegen verbarg. Er trug eine höfliche Gleichgültigkeit zur Schau, für die sie ihn am liebsten am Kragen gepackt und ordentlich durchgeschüttelt hätte. Sie hob die Stimme.
»Dieser Junge liegt im Sterben, und wir sollen die Hände in den Schoß legen?«
»Sie sind der Chef«, sagte Abadie, ohne ihrem Blick auszuweichen.
Ein Beamter steckte den Kopf zur Tür herein und winkte den Capitaine zu sich. Sobald die beiden Männer den Raum verlassen hatten, nahm die Spannung ab.
»Sie dürfen die Sache nicht fallenlassen«, sagte Roger Lenfant in eindringlichem Ton. »Dazu haben wir nicht das Recht.«
»Was meinen Sie, was ich hier gerade tue?« entgegnete Marion gereizt. »Und überhaupt würde ich gerne wissen …« Der Wachmann hatte sich auf einen Stuhl gesetzt, während Marion sich die Videobänder ansah. Jetzt erhob er sich schwerfällig. Mit kummervollem Gesicht griff er in die Innentasche seines blauen Blousons und zog eine Ausweishülle hervor, die er aufklappte und Marion reichte.
Auf einem etwas unscharfen Foto, das so aussah, als sei es schon durch viele Hände gegangen, lächelte ihr ein blonder Teenager entgegen. Eine lange Haarsträhne fiel ihm in die Augen, und zwischen den vollen Lippen blitzten kleine, ebenmäßige Zähne.
»Wissen Sie schon über die Vermißten Bescheid?«
»Bitte? Die Vermißten?«
»Ja.«
»Nein.«
Fast hätte sie hinzugefügt, daß sie auch in zehn Jahren über all die Dinge, die man ihr zu sagen vergaß, nicht Bescheid wissen würde.
»Bevor Kevin verschwand, sind bereits mehrere Jungen als vermißt gemeldet worden. Das hat vor zwei Jahren angefangen, vielleicht ist es auch schon etwas länger her. Diese Jungs hielten sich häufig am Bahnhof auf.«
»Kevin, ich meine … Ihr Sohn ist im Bahnhof verschwunden?«
Roger Lenfant zögerte eine Sekunde, dann ließ er sich erschöpft wieder auf seinen Stuhl sinken.
»Ich weiß es nicht. Ich denke schon, aber ich bin mir nicht sicher. Er kam oft nach Paris, ich wohne in Sarcelles, am nördlichen Stadtrand, da ist er natürlich oft hier umgestiegen.«
Capitaine Abadie kam mit einem kleinen Zigarillo im Mund wieder herein.
»Wie wär’s, wenn du jetzt heimführest, Roger?« schlug er vor und pustete eine dicke graue Rauchwolke in die Luft. Aber der Wachmann schüttelte müde den Kopf und stand wieder auf.
»Zu Hause wartet eh niemand auf mich«, sagte er mit einem verkrampften Lächeln. »Aber es ist spät, und ich halte Euch hier nur auf, es tut mir leid.«
Er gab erst Marion, dann Capitaine Abadie die Hand. Es war ein langer, eindringlicher Händedruck, bei dem ihm plötzlich noch etwas einzufallen schien.
»Du weißt doch, daß bei uns im Büro seit mehreren Jahren Videokassetten aufbewahrt werden …«
»Ja«, sagte Abadie. »Und?«
Marion sah Roger Lenfant erwartungsvoll an. Abadies Begeisterung schien sich hingegen in Grenzen zu halten. Der Wachmann führte seinen Gedanken trotzdem zu Ende.
»Wir könnten sie uns ansehen.«
»Hör zu, Roger, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Das sehen wir später.«
»Gut, einverstanden. Jedenfalls weißt du, daß ich sie habe. Bis morgen dann?«
»Oh, morgen ganz bestimmt nicht!« entgegnete der Capitaine, während er Asche von seinem Zigarillo in den Papierkorb fallen ließ. »Da habe ich frei. Drei Tage. Aber Valentine Cara ist da, und natürlich die diensthabenden Kollegen, die werden die Sache weiterverfolgen.«
Marion begleitete Roger Lenfant zur Tür und sah ihm nach, wie er auf etwas wackeligen Beinen davonging.
Sie hatte nicht übel Lust, dasselbe zu tun, in ihre Wohnung hochzugehen und ihren gleichgültigen Kollegen einfach stehenzulassen. Als sie sich umdrehte, sah sie, daß er schon zielstrebig auf sein Feldbett zusteuerte.
Sie schlug laut die Tür hinter sich zu, und Abadie zog instinktiv den Kopf ein.
10
Quietschend öffnete sich die Gittertür, und Nina hüpfte auf den Bürgersteig. Ihre Freundin Ange-Lou, eine kleine, zierliche Brünette mit etwas schräg stehenden Augen, kam sofort lachend hinterher, und die beiden begannen kichernd und prustend Gervaise nachzuäffen, die ihnen das Theaterspielen beibrachte.
»Auf, auf, Mädels!« schimpfte Nina mit heiserer, unwirscher Baßstimme. »Ihr müßt euer ganzes Herzblut reinlegen! Was ist denn das für ein dünnes Stimmchen? Und was fuchtelt ihr da so herum? Los, das muß glaubhaft rüberkommen, verdammt noch mal!«
»Und du da, Fräuleinchen, wie alt wirst du eigentlich heute?« fuhr Ange-Lou im gleichen Ton fort und schwenkte die grüne Mappe, in der sie ihre Texte aufbewahrte. »Dreizehn? Na, so sieht mir dein hübscher kleiner Hintern auch aus!«
Die Mädchen brachen in schallendes Gelächter aus. Ange-Lou hatte mit den anderen aus dem Kurs ihren Geburtstag gefeiert, wozu Gervaise eine Flasche Champagner spendiert hatte. Auch durch sechzehn geteilt, war der Schampus nicht ganz unbeteiligt an ihrer Heiterkeit.
Weitere Mädchen und Jungen kamen in demselben Zustand aus dem Gebäude und gingen in kleinen Grüppchen, zu zweit oder zu dritt, davon. Dann wurde das Licht in der ehemaligen Reparaturwerkstatt, aus der dank Gervaise Bousse ein Theater geworden war, vom Hof aus gelöscht. Die schweren Schritte der Lehrerin kamen näher und gaben den aufgekratzten Mädchen einen kleinen Dämpfer. Die korpulente, in ein buntes Umschlagtuch gehüllte Frau blieb vor den beiden stehen, eine Zigarette im Mundwinkel.
»Ihr hättet euch eure Kriegsbemalung ruhig abwaschen können«, bemerkte sie mit ihrer rauhen Stimme. »Eure Mütter werden sich freuen! Worauf wartet ihr eigentlich?«
»Na, auf meine Mutter«, erwiderte Nina. »Sie kommt uns heute abend abholen. Wir gehen noch zu McDonald’s …«
Gervaise hatte keine eigenen Kinder. Dafür zwanzig in der Theatergruppe, sechzehn im Kurs für Körperausdruck und noch einmal so viele Erwachsene, die sich an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten ähnlichen Spezialgebieten widmeten. Ihre schmal gezupften Augenbrauen zogen sich zusammen.
»Stimmt das auch?«
»Natürlich. Warum sollte ich mir so was ausdenken?«
»Was weiß denn ich!«
»Man merkt, daß du meine Mutter nicht kennst. Die würde mich sogar zu Hause nie allein lassen, selbst mit doppelt verriegelter und von außen abgeschlossener Tür«, fügte Nina mit einem leisen, gezwungenen Lachen hinzu.
»Gut.«
Gervaise warf einen Blick auf ihre Uhr und sah sich kurz in der verlassenen Sackgasse um, an deren Ende das winzige Theater lag.
»Sie ist aber spät dran«, sagte sie unschlüssig.
»Sie kommt immer zu spät«, grinste Nina. »Aber das ist schon in Ordnung, du kannst gehen, sie wird gleich dasein.«
»Bist du dir sicher? Soll ich euch nicht ein Stück begleiten? Oder euch irgendwo absetzen?«
»Nein, wirklich. Sie kommt ganz bestimmt.«
Die Leiterin der Theater-AG strich einmal kurz über Ninas Kopf. Überschwengliche Liebesbekundungen waren nicht ihr Ding, und für das Küßchen, das sie Ange-Lou anschließend auf die Stirn drückte, gab es außer dem Geburtstag eigentlich keine Erklärung. Sie deutete auf die grüne Mappe.
»Und fürs nächste Mal tut ihr ein bißchen was, okay, meine Damen?«
Die Mädchen nickten, und Gervaise setzte ihren mächtigen Körper in Bewegung und marschierte davon.
Kurz darauf durchbrach der Motor ihres alten Simca die Stille, und als der Wagen sich entfernt hatte, sahen sich die beiden Freundinnen an. Auf einmal fragten sie sich, ob tatsächlich alles in Ordnung war.
11
Capitaine Abadie bearbeitete die Schreibtischkante mit seinem Gummiknüppel, der jedem Polizeibeamten zu Verteidigungszwecken zugeteilt wurde und gewissermaßen zur Uniform gehörte. Die Uniformen der leitenden Beamten unterschieden sich im übrigen nur durch die mit Klettverschlüssen an der Brust befestigten Galonen von denen ihrer Untergebenen. Bei ihrer Ankunft hatte Marion die Spielregeln akzeptieren müssen und sich von ihrer geliebten Jeans-Boots-Blouson-Kluft verabschiedet. Jetzt trug sie entweder die klassische Kommissarinnenuniform oder die eng anliegende marineblaue Kombination aus feuerfestem Stoff, die bei Einsätzen vorgeschrieben war.
Mit starrem Blick verfolgte sie die Bewegung des Knüppels, die in der Stille des Raums etwas Hypnotisierendes hatte.
»Was ist los, Abadie?«
Aus dem Gang und den anderen Büros drangen vertraute Geräusche durch die Wände. Knallende Türen, schreiende Männer im Polizeigewahrsam, schnauzende Beamte. Zurufe, Gelächter und in regelmäßigen Abständen das Rumpeln eines Zuges, das den fahlen Lichtkreis von Marions Schreibtischlampe erzittern ließ.
»Ich muß nach Hause.«
»Sind Sie müde?«
»Nein. Ich muß nach Hause, das ist alles.«
»Okay.«
Marion raffte die auf ihrem Schreibtisch verstreuten Zettel und Unterlagen zusammen. Sie hatte sich geschworen, daß sie sich durch diesen Papierkram, der angesichts des brandneuen Computers eigentlich gar nicht existieren dürfte, nicht unterkriegen lassen würde. Ihre Bewegungen waren fahrig und nervös. Abadie hörte auf, mit seinem Knüppel zu spielen.
»Ich hatte mir schon gedacht, daß uns das keinen Deut weiterbringen würde«, sagte er mit tonloser Stimme.
»Es mußte sein«, bekräftigte Marion und rückte dabei ihren Gürtel zurecht.
Das blöde Ding störte sie, vor allem weil man die Handschellen und das Holster daran befestigen mußte. Der Manurhin-Revolver hing schwer an ihrer Hüfte, noch schwerer aber lastete die Müdigkeit dieses endlos langen Tages auf ihr.
»Wir machen morgen weiter, und zwar so lange, bis wir etwas gefunden haben«, beharrte sie. »Wenn’s sein muß, setzen wir zusätzlich alle Zivilpolizisten und alle verfügbaren Beamten vom Gewahrsamsdienst ein.«
»Natürlich.«
Sie musterte ihn verstohlen. Er war so ernst, so glatt und so undurchschaubar wie immer. Entgegen seiner Aussage vom Vorabend und trotz der Vierundzwanzig-Stunden-Schicht, die ihm bestimmt noch in den Knochen steckte, war er gegen Mittag wiedergekommen. Glattrasiert und mit blitzblanken Stiefeln. Marion traute sich nicht, ihn zu fragen, ob er die freie Zeit, die ihm zustand, noch weiter beschneiden und auch am nächsten Tag erscheinen würde. Im übrigen wäre sie gar nicht mehr dazu gekommen: Valentine Cara betrat nach kurzem Anklopfen das Zimmer.
»Achtundvierzig«, sagte sie und legte ein Papierbündel auf den Tisch.
Lieutenant Valentine Cara, die erst seit drei Jahren bei der Polizei arbeitete, wollte damit sagen, daß man über die achtundvierzig Personen, die im Laufe des Nachmittags im Bahnhof festgenommen worden waren, alle in solchen Fällen vom Gesetzgeber erlaubten Nachforschungen angestellt hatte. Ergebnislos.
Die einzige gute Nachricht war bisher aus dem Krankenhaus gekommen: Der junge Unbekannte lebte noch. Er war weiterhin bewußtlos, und keiner der Ärzte mochte sich zu seinen Überlebenschancen äußern, aber es gab durchaus einen gewissen Anlaß zur Hoffnung.
Marion drehte sich zu der Tafel um, die einen großen Teil der gegenüberliegenden Wand einnahm. Eine junge Mitarbeiterin eines Zentrums für Gehörlose hatte die auf Video aufgenommenen Zeichen entschlüsselt und mit einem Marker auf die weiße Tafel aufgezeichnet. Die Bilderfolge erinnerte an einen Comic.
Die Gebärdendolmetscherin hatte außerdem die stummen Rufe auf den Lippen des Jugendlichen lesen können. Der Inhalt war im großen und ganzen identisch.
»Hilfe! Helfen Sie mir!«
»Ach, übrigens, Abadie«, sagte Marion plötzlich. »Was hat sich bei den Zentren ergeben?«
»Negativ«, antwortete er in gewohnt neutralem Ton. »Ich habe zwei Jungs darauf angesetzt, bisher gibt es seitens der spezialisierten Einrichtungen in der Region Île de France keine Vermißtenmeldung. Wir weiten die Suche aus.«
»Vergessen Sie Belgien nicht, Luxemburg, die Schweiz und … nun ja, Sie wissen schon.«
Frankophon, hatte die Gebärdendolmetscherin gesagt. Der Junge hatte seinem Entsetzen auf französisch Ausdruck verliehen.
12
»Ah! Nina!«
Ange-Lous Schrei hallte von den fensterlosen Wänden der Sackgasse wider. Es war einer jener ehemaligen Werkstatthöfe, die von einer Handvoll Künstlern oder Vereinen genutzt wurden und sich nur tagsüber oder am Spätnachmittag mit Leben füllten.
Der Mann war ohne jede Ankündigung und fast lautlos aus der Dunkelheit getreten.
»Entschuldigen Sie, Mademoiselle …«
Ange-Lou traute sich nicht aufzublicken. Sie hatte zu große Angst und zitterte plötzlich am ganzen Leib. Während sie auf die Beine ihrer schwarzen Stretchhose starrte, stellte ihr der Mann eine Frage.
Sie hörte die Worte und verstand auch in etwa ihren Sinn. Beklommen gab sie Antwort und warf dabei einen kurzen Blick nach links, in der Hoffnung, daß Nina wieder auftauchen würde.
»Aha«, sagte der Mann mit einer gewissen Enttäuschung in der Stimme.
Er rührte sich nicht, was Ange-Lou noch mehr Angst einjagte.
»Nina, komm zurück!« schrie sie voller Panik.