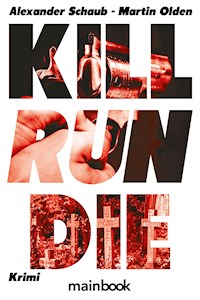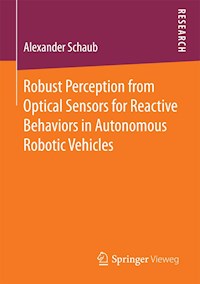Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Engelmacher
- Sprache: Deutsch
"Der Schatten des Engelmachers" ist Band 2 der "Engelmacher"-Trilogie nach Band 1 "Der Engelmacher aus Frankfurt". Es ist nicht vorbei – es war nie vorbei ... Er ist nicht allein – er war nie allein ... Der Plan des Engelmachers ist perfider und weitreichender, als es Tom Martini je angenommen hatte. Ihm steht ein Helfer zur Seite, der mit dem Detektiv spielt wie mit einer Marionette an Fäden aus Ketten. Ein weiteres Mal wird Martini die Vergangenheit zum Verhängnis. Doch es ist nicht nur der Killer, der den Privatdetektiv in Bedrängnis und an die Grenze seiner seelischen Belastbarkeit bringen wird ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
„Der Schatten des Engelmachers“ ist Band 2 der „Engelmacher“-Trilogie nach Band 1 „Der Engelmacher aus Frankfurt“.
Es scheint ein normaler Fall zu werden. Thomas Martini soll einen vermissten Banker suchen, doch die Kripo findet ihn tot auf, praktisch vor Martinis Haustür. Einen Tag später taucht die zweite Leiche auf, vor dem Haus von Martinis bestem Freund Kommissar Carstens. Beide Leichen sind identisch gekleidet und haben einen Zettel in der Tasche mit dem Wort „KOMM!“ Ist das Wort eine Nachricht, ein Hinweis des Killers? Die Ereignisse spitzen sich zu, als an einem alten Tatort des Engelmachers zwei weitere Opfer gefunden werden. Alle Spuren führen zu einer Gemeinde am Sachsenhäuser Berg. Der Fall wird immer nebulöser. Jede Spur, die Martini und die Kommissare finden, wirft weitere Fragen auf wie die abgeschlagenen Köpfe einer Hydra. Zusätzlich kämpft Martini mit den Dämonen, die ihn seit dem Engelmacher-Fall verfolgen.
Warum werden nur Banker getötet? Was hat die Sankt Bonifatius-Gemeinde mit dem Fall zu tun? Und warum schaltet sich der BND in die Ermittlungen ein? Um dieses Rätsel zu lösen, erhält der Detektiv Hilfe von einer Psychologin, die nicht nur seine Ermittlungen beeinflusst …
Der Autor:
Der gebürtige Frankfurter Alexander Schaub erblickte 1969 das Licht der Welt. Bis 2014 lebte er in der Mainmetropole. Im April ´14 zog er mit seiner Traumfrau Corinna nach Hattersheim. Über zwanzig Jahre arbeitete Schaub in der IT und war für Netzwerke im Microsoft-Umfeld verantwortlich. Seit 2007 arbeitet er im technischen Support eines 3D Drucker Herstellers.
Über sein Schreiben sagt er: „Ich liebe Serien mit einem roten Faden und so soll es auch mit meinen Büchern werden. Die Charakterentwicklung meiner Protagonisten ist mir enorm wichtig.“ Mehr Informationen über den Autor sowie anstehende Lesungen finden Sie unter: www.alexander-schaub.de
Alexander Schaub
Der Schatten des Engelmachers
Krimi
ISBN 978-3-946413-54-7
Copyright © 2017 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung: Olaf Tischer
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher:
www.mainbook.de
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Epilog
Für Mama1935 - 2016
There is nothing left but troubleAnd the longing for the sweetness of revenge
Demon & Wizard –Beneath These Waves
Prolog
18. Dezember 2012, Uhrzeit unbekannt
Es war dunkel. Es war kalt. Es war feucht. Es war totenstill. Es war wie in einem Grab.
Die Zeit verrann langsam, sehr langsam. Ohne jeden optischen oder akustischen Reiz war es nicht auszuhalten. Meine Handgelenke schmerzten. Die Seile, mit denen ich gefesselt worden war, schnitten tief in meine Haut. In meinen Füßen breitete sich langsam ein Kribbeln aus. Auch dort waren die Schlingen sehr fest angezogen.
Ich begann langsam laut zu zählen, um die Zeit zu messen und einfach etwas zu hören.
Wie war ich nur in diese Situation geraten? Was hatte mich geritten auf dies alles einzugehen?
„Einhundertfünfundneunzig.“
In den letzten Tagen hatte ich viele Entscheidungen getroffen. Gute und schlechte. Wie hieß es so schön, jeder Mensch ist die Summe seiner Entscheidungen. Irgendwo war ich falsch abgebogen. Ja, ein Entschluss war richtig dumm gewesen. Neue Menschen hatten meinen Weg gekreuzt und einen davon wollte ich unbedingt wiedersehen.
„Dreihundertsiebenundsechzig.“
Im Moment erschien mir alles wie ein großes Desaster ohne Chance auf ein Happy End. Ich hatte alle Sicherheit über Bord geworfen und jetzt saß ich hier, gefesselt auf einem alten Holzstuhl.
„Fünfhundertachtundachtzig.“
Sollte die Vergangenheit sich wirklich wiederholen? Es sah fast so aus. Die Dämonen, mit denen ich seit mehr als zwei Jahren kämpfte, schienen ihre gierigen, Blut dürstenden Krallen nach mir auszustrecken. Das Monster unter meinem Bett war langsam hervor gekrochen, um mich zu sich zu holen in sein dunkles, krankes und mörderisches Universum.
„Achthundertvierundneunzig.“
Plötzlich – Helligkeit. Kleine Lichtfinger schlängelten sich durch die Maschen des alten Sacks, der über meinen Kopf gestülpt worden war. Schritte neben mir. Sohlen, die sich über einen Steinboden bewegten. Mit einem Ruck verschwand der muffig riechende Stoff vor meinem Gesicht.
Die Helligkeit blendete mich und ich konnte nichts sehen. Ich blinzelte, schloss die Augen, öffnete sie wieder, sie begannen zu tränen. Die ersten Umrisse des Raums zeichneten sich vor mir ab. Rohe Steinwände. Mir gegenüber eine alte Stahltür, die halb offen stand. Dahinter sah ich einen Gang. Über mir eine Fassung mit einer nackten Glühlampe. Ansonsten war der Raum leer.
Ein Mann stand neben mir, in der Hand den Sack. Ein zufriedenes Grinsen im Gesicht. Nein … eher schadenfroh. Ich konnte nur seinen Mund erkennen, der Rest seines Gesichts wurde von der gleißend hellen Lampe verborgen.
„Wer sind Sie?“
Er grinste breiter. „Das wissen Sie nicht?“
„Nein, würde ich sonst fragen?“
Mein Gegenüber verbarg sich weiterhin hinter der Lampe. „So sehen Sie also aus. Thomas Martini“, spöttisch verzog er die Lippen. „Dieser Name.“
„Was meinen Sie damit?“
„Ich dachte, Sie wären imposanter. Aber Sie wirken ganz normal.“
„Sie haben einen Vorteil mir gegenüber. Sie kennen mich, ich Sie nicht. Also bitte, wer sind Sie?“
„Sie sollten mich kennen. Wir sind uns schon begegnet.“
„Wo denn? Ich kann mich nicht erinnern.“ Ich brauchte Informationen, denn Wissen war im Moment meine einzige Waffe.
Er ließ den Sack auf den Boden fallen. „Sie erinnern sich wirklich nicht … interessant.“
„Sagen Sie mir einfach, wer Sie sind und was Sie wollen.“
„Was ich will ist simpel.“ Hatte sein Lächeln anfangs schadenfroh gewirkt, so wurde es jetzt bösartig. Das Grinsen eines verrückten, durchgeknallten Killers. Eine Gänsehaut lief mir den Rücken hinunter.
Er trat aus dem Lichtkegel der Lampe, brachte sein Gesicht so nah vor das meine, dass ich seinen Atem spüren konnte. Seine Nase berührte fast die meine. Da dämmerte es mir. Ich hatte ihn bereits getroffen und ich fühlte mich wie mit Eiswasser übergossen, als er bedrohlich flüsterte: „Ich will Ihr Leben.“
Master of Puppets I’m pulling your stringsTwisting your mind and smashing your dreams
Metallica –Master of puppets
Zwei Wochen vorher …
Kapitel 1
05. Dezember 2012, 23:55
Die großen gläsernen Türen der Ratio-Bank in der Solmsstraße öffneten sich. Hans Büchner trat in die kalte Nachtluft, atmete tief ein und wieder aus, um dann die drei Stufen bis zu dem Parkplatz, auf dem sein Auto stand, herabzusteigen. Er gönnte sich ein paar Sekunden der Ruhe, um die weihnachtlich geschmückte Skyline Frankfurts zu begutachten. Die Vorweihnachtszeit mochte er am liebsten. Allerdings behielt er dies für sich, um sein Image als knallharter Banker zu bewahren. Büchner war Mitglied des Vorstands der 1980 gegründeten deutschen Filiale einer niederländischen Bank. Der attraktive Endfünfziger hatte volles, annähernd schwarzes Haar. Er war mittel groß und wirkte sportlich.
Am heutigen Abend, oder besser in der heutigen Nacht, hatte er wieder eine seiner Besprechungen gehabt. Normalerweise endeten diese Sitzungen gegen zweiundzwanzig Uhr, aber Büchner führte nach dem offiziellen Ende meistens eine zusätzliche Besprechung mit seiner Sekretärin. So verhielt es sich auch in dieser Nacht. Seine Sekretärin war Ende zwanzig und konnte mehr äußerliche als innerliche Attribute auf der Habenseite verbuchen. Und dementsprechend sahen diese Besprechungen aus.
Fast jedes Mal versprach ihr Büchner, dass er seine Frau verlassen würde, in Wahrheit dachte er überhaupt nicht daran. Vor einer Woche hatte er entschieden, dass er sie in einem Monat feuern würde. Er brauchte Mal wieder Frischfleisch. Bei dem Gedanken musste er lachen. Frischfleisch!
Sie zu entlassen brachte einen zweiten, nicht zu vernachlässigenden Vorteil, denn seine Frau schien Verdacht geschöpft zu haben. Also war es an der Zeit, die Sekretärin zu wechseln und seiner Frau einen neuen Pelzmantel zu kaufen. Bei Pelzen wurde Frau Büchner immer handzahm und er konnte für das nächste halbe Jahr wieder tun und lassen, was er wollte.
Büchner zog den Schlüssel seines neuen 7er BMW aus der Tasche und drückte die Öffnen-Taste an der Fernsteuerung. Mit einem dezenten Surren wurde die Verriegelung der Türen gelöst. Er drückte eine weitere Taste, die den Kofferraum aufschwingen ließ. Als Büchner den Koffer mit seinen Unterlagen hineinlegte, bemerkte er eine Bewegung hinter sich. Er drehte sich um und sah in ein fremdes Gesicht. Es war ihm suspekt, dass sich hier spät in der Nacht eine ihm unbekannte Person aufhielt. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragte der Banker.
„Ja, können Sie mir sagen, wie ich in die Kasseler Straße komme? Ich habe eine Verabredung am Arche Nova-Haus.“ Bei diesen Worten wedelte der Unbekannte mit einem Stadtplan.
„Kommen Sie näher, hier am Auto sehen wir besser, ich zeig es Ihnen.“ Büchner drehte sich zum Kofferraum, in dem die Beleuchtung aufgeflammt war. Er nahm die Karte und versuchte sich zu orientieren. „Warten Sie mal, hier sind wir“, er beschrieb einen kleinen Kreis auf der Karte, „hier in der Solmsstraße, Sie müssen jetzt …“ Plötzlich spürte Büchner einen Stich in der rechten Seite seines Halses. Er sprach weiter, doch in derselben Sekunde sackten ihm die Beine weg.
27. April 1982, 07:01, Brasilien
Der Raum wirkte schmuddelig. Putz bröckelte von der Decke und Farbe blätterte von den Wänden. Die alten Holzstühle standen in einem Kreis um einen kleinen kniehohen Tisch herum. Sie wirkten abgewetzt, als hätten sie schon viele Menschen kommen und gehen sehen. Stickige Luft füllte den rechteckigen Wartesaal, denn es gab nur ein Fenster gegenüber der Tür, die schon vor langer Zeit aus den Angeln gebrochen war und nun an der schäbigen Wand lehnte. Die Sonne brannte unbarmherzig durch das offene Fenster. Wenn der Wind wehte, brachte er noch mehr heiße Luft mit sich. Eine Klimaanlage wäre einem Gottesgeschenk gleichgekommen.
Fünf Personen saßen in dem überhitzten Zimmer. Jeder wartete auf Nachrichten über einen seiner Angehörigen oder Freunde. Ein Lautsprecher, der meist nach irgendeinem Arzt rief, durchschnitt die gespenstige Stille, die hier herrschte.
Der junge Mann, der auf einem Stuhl mit direktem Blick zur Tür saß, wurde immer nervöser. Schon eine Stunde saß er hier, seit ihn die Krankenschwester aus dem Kreissaal hinaus komplementiert, ja hinaus geworfen hatte.
Dabei hatte alles blendend ausgesehen, als sie heute Morgen hier angekommen waren. Die kleine zierliche Brasilianerin bekam regelmäßig Wehen und die Ärzte meinten, es würde eine Bilderbuch-Geburt werden. Drei Stunden nach ihrer Ankunft verfrachtete die Schwester die beiden glücklichen, werdenden Eltern in den Kreissaal. Der Arzt kam zu ihnen und alles war, wie sie es sich immer vorgestellt und beim Schwangerschaftskurs gelernt hatten. Doch nach einer weiteren halben Stunde, das Baby steckte noch im Mutterleib, traten die Probleme auf. Er verstand nicht, was vor sich ging, aber er merkte, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Seine Freundin glühte im Gesicht, sie schwitzte aus allen Poren. Kalter Schweiß. Der Arzt und die Schwester wirkten auf einmal nicht mehr locker und entspannt wie zu Anfang der Geburt. Weitere zehn Minuten später schob ihn die Schwester unsanft aus dem Operationssaal. Nun saß er hier und wurde von Minute zu Minute unruhiger.
Er blickte zu Boden, schüttelte den Kopf, stand auf, blickte aus dem Fenster, setzte sich wieder, sah zur Tür und blickte wieder zu Boden. Plötzlich stand die Schwester in der Tür. In ihren Armen lag ein kleines in weiße Tücher eingewickeltes Bündel. Es wimmerte leise, sein Kind. Er hastete auf die Frau zu und stolperte dabei über den Tisch in der Mitte des Wartezimmers. Als er vor ihr stand, fiel ihm auf, dass sie nicht lächelte.
„Ist das mein Kind?“, fragte er schüchtern.
Sie nickte. „Ja, ein Sohn.“ Immer noch keine Regung im Gesicht der Frau. Sie reichte ihm vorsichtig das kleine Menschenbündel.
Er sah es an und es erfüllte ihn mit Stolz. Ein Sohn, genau was er sich erhofft hatte. Dann richtete er seinen Blick auf die Schwester, „Wie geht es meiner Frau?“
Die Schwester blinzelte, wich seinem fragenden Blick ein paar Sekunden aus. Dann schluckte sie schwer, bevor sie ansetzte, „Sie ist leider bei der Geburt gestorben, es tut mir sehr leid.“ Die Welt um ihn begann sich zu drehen. Das Kind wäre ihm fast aus der Hand gefallen, doch die Schwester griff zu und behütete es davor, auf den harten Steinboden zu fallen. Ein anderer Mann sprang auf, stützte den schwankenden jungen Mann und bugsierte ihn auf einen Stuhl.
Seine Welt brach zusammen. Alles, was die Beiden sich ausgemalt hatten, zerbrach in dieser Sekunde. Alles war vorbei, nur das Baby blieb ihm. Ein Baby, mit dem er nichts mehr anfangen konnte, ohne sie.
Zwei Tage später. Die Trauer und der Schmerz über den Verlust seiner Frau waren unermesslich. Sie fehlte ihm so sehr, seine kleine süße Frau. Was sollte er mit dem Baby machen? Er war kein Vater, nicht ohne sie. Dazu seine finanzielle Situation. Was soll ich nur tun, dachte er immer und immer wieder, während das Baby weinte und schrie. Er rang sich zu einem Entschluss durch.
Er saß in einem schmucklosen Büro auf einem zerschlissenen Besucherstuhl, vor ihm ein alter Massivholz-Schreibtisch. Auf den Beinen das weinende Bündel Mensch. Von der anderen Seite des wuchtigen Holzungetüms schaute ihn eine streng dreinblickende Frau an. Die Leiterin des Kinderheims.
„Ihr Entschluss ist endgültig? Sie wollen Ihr Kind in unsere Obhut und die des Herrn übergeben?“ Die grauen Augen der etwa sechzigjährigen Frau musterten ihn argwöhnisch.
„Ja. Ich bin mir sicher. Ich kann nicht für ihn sorgen, so wie seine Mutter es gekonnt hätte.“ Ihm steckte ein Klos im Hals.
„Sie sind sich der Schwere Ihrer Entscheidung bewusst? Sie werden das Kind nie wiedersehen und es wird nie erfahren, wer seine Eltern sind. Das ist die Philosophie, die unsere Einrichtung verfolgt.“
„Ja, ich weiß“, war alles, was er herausbrachte. Das schlechte Gewissen nagte an ihm.
„Gut!“ Damit beugte sich die Heimleiterin herunter und zog einige Formulare aus einer der Schreibtischschubladen. „Bitte füllen Sie diese Dokumente komplett und sogfältig aus. Mit Ihrer Unterschrift auf dem letzten Bogen überstellen Sie das Baby unwiderruflich in unsere Obhut.“
Sie reichte ihm einen Kugelschreiber. Er füllte alle Felder der Fragebögen aus. Seine Hand zitterte. Auf der letzten Seite, an dem Unterschriftsfeld, zögerte er einige Sekunden. Dann setzte er seinen Namen auf die dafür vorgesehene Linie. Ihm war, als habe er mit seinem Blut unterschrieben und einen Pakt mit dem Teufel geschlossen.
15. Juli 2010, 10:20
Christopher lief die Straße entlang wie schon viele Male zuvor. Auf beiden Seiten parkten Fahrzeuge, um den Durchgangsverkehr zu verlangsamen und den Anwohnern etwas Ruhe zu verschaffen. Die Sonne, die vom blauen wolkenlosen Himmel herab brannte und die Temperaturen über die dreißig Grad Marke trieb, wurde von den Windschutzscheiben reflektiert.
Seine Gedanken verweilten bereits bei ihm. Eine große Tat warf ihren Schatten voraus und weitere würden folgen. Vorfreude ergriff ihn, er durfte daran Teil haben. Und nicht nur er, all die anderen auch.
Fünf Minuten später erreichte Christopher das Haus und klingelte. Der Türsummer erklang nach ein paar Sekunden. Er stieg die drei Treppen hinauf. An der Tür wartete er schon, der Meister. Christopher verneigte sich respektvoll und trat dann ein. Er folgte ihm in das Wohnzimmer und durfte auf einem der Sessel Platz nehmen. Der Meister ließ sich gegenüber nieder.
„Meister, ich habe von Eurem Werk gelesen. Wundervoll!“
„Das war nur der Anfang, Christopher. In zwei Wochen wird das nächste folgen. Dieses wird eine Reihe von Vorgängen auslösen und neue Spieler auf den Plan rufen. Ganz zum Schluss, zum Finale, werde ich deine und die Hilfe der anderen benötigen.“
„Wir stehen bereit und warten auf Eure Anweisungen, Meister.“ Christophers Wangen röteten sich vor Erregung. „Wir werden alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigen. Habt Ihr schon einen Plan?“
Der Meister lehnte die Unterarme auf seine Oberschenkel, beugte sich nach vorne und faltete die Hände. „Ja, ich habe einen Plan. Alle werden daran Teil haben und ihn zu meinem Triumphzug werden lassen. Jeder erhält eine spezielle Rolle, keiner darf versagen. Wer versagt, stirbt.“ Seine dunklen Augen spiegelten Härte wider.
„Keiner wird versagen, verlasst Euch auf uns Meister!“
„Ich verlasse mich auf dich. Du trägst die Verantwortung. Enttäusche mich nicht.“
„Niemals“, schüttelte Christopher den Kopf. „Niemals.“
„Du musst dir alles merken, es dürfen keine Notizen über den Plan auftauchen. Dies hier ist unsere letzte Unterredung, bevor alles zu Ende ist. Es darf keine nachvollziehbare Verbindung zwischen uns existieren oder auftauchen. Wenn irgendwer uns beide in Verbindung bringt, ist der Plan gefährdet. Ist das klar?“
„Ja, Meister.“
„Dann höre mir jetzt genau zu …“
06. Dezember 2012, Uhrzeit unbekannt
Hans Büchner erwachte. Seine Lider waren tonnenschwer. Sein Genick schmerzte wie der Rest seines Körpers. Der Schädel pochte, als er die Augen langsam öffnete. Eine nackte Glühbirne blendete ihn und er schloss die Lider sofort wieder. Das zweite Mal hob er sie ganz langsam, damit sich die Pupillen an die Helligkeit gewöhnen konnten. Dann richtete er sich vorsichtig auf und blickte sich um.
Was war das für ein Raum?
Die Wände bestanden aus rohen Steinen, ebenso der Boden. Er saß auf einer Holzpritsche ohne Matratze oder Decke. Es war kalt und er fror, zitterte leicht. Hinzu kam Ungewissheit und Angst. Ihm wurde übel. „Nur nicht kotzen“, sagte er zu sich selbst.
Wo war er?
Jemand hatte ihn entkleidet und ihm eine Jacke und Hose aus rauem, kratzigem Baumwollstoff angezogen. Seine Füße waren nackt. Die grünliche Farbe des Stoffs erinnerte ihn an seine Bundeswehrzeit. Tarnkleidung?
Was sollte das?
Büchner stand auf, lief durch seine Zelle. Hin und zurück. Die in die Jahre gekommene Metalltür war verrostet, stellte aber trotzdem ein unüberwindbares Hindernis dar. Er schlug dagegen. Es klang hohl und seine Hand schmerzte.
07. Dezember 2012, Uhrzeit unbekannt
Etwa einen Tag, nachdem Büchner eingesperrt worden war, bekam er eine warme Mahlzeit. Überraschenderweise sehr schmackhaft, wie das verwöhnte Vorstandsmitglied zugeben musste. Ein paniertes Schnitzel mit Gemüse und Salat, das ließ ihn neue Hoffnung schöpfen.
Er steckte gerade den letzten Bissen in den Mund, da wurde das Licht ausgeschaltet und ein mörderisch lautes Pfeifen drang aus einem versteckten Lautsprecher. Er hielt sich die Ohren zu, ohne Wirkung. Der Ton war einfach zu laut, sehr hoch und schmerzte im Gehör als würde eine Nadel durch das Trommelfell gebohrt. Egal was Büchner auch tat, er konnte nicht entkommen. Teller, Tablett und Besteck fielen zu Boden. Der Teller zerbrach. Er stand auf, lief durch den Raum, trat dabei in eine der Scherben, stieß im Dunkeln an die Wände, schlug sich die Stirn blutig und suchte die Ecke, in der das marternde Geräusch am Leisesten war. Der Unterschied war minimal.
Nach gefühlten Stunden endete sein Martyrium so schnell wie es begonnen hatte. Das Licht ging wieder an und die Luke am Fuß der Tür öffnete sich erneut. Diesmal erhielt er eine Tasse Kaffee und ein Croissant. Es schien eine Menge Zeit vergangen zu sein, denn als er den Kaffee roch, knurrte sein Magen. Als erstes untersuchte Büchner seine Fußsohle und zog die Scherbe heraus. Zum Glück war die Wunde nicht sehr tief, die Scherbe relativ klein. Seine Stirn hatte nur ein wenig geblutet, dafür brummte sein Schädel umso mehr. Er trank den Kaffee und aß das Croissant. Das Ganze erinnerte ihn an eine Versuchsanordnung in einem Tierlabor.
Er trank den letzten Schluck Kaffee, dann begann es wieder, Licht aus und Pfeifen. Ihm schoss durch den Kopf, dass man dies weiße Folter nannte. Er hatte einmal einen Krimi von einem Hattersheimer Autor gelesen, der sich mit diesem Thema befasst hatte. Der Roman war sehr spannend gewesen, aber Büchner hätte nie für möglich gehalten, dass ihm so etwas passieren könnte.
Nach vier Wiederholungen war endlich Schluss, am siebten Dezember gegen Mitternacht. Hans Büchner war physisch und psychisch am Ende. Als das Licht anging, lag er in einer Ecke seiner Zelle in Embryonalstellung und weinte vor Erschöpfung, Schmerz und Angst. Er hätte zu diesem Zeitpunkt alles getan, um aus dieser Zelle zu entkommen … Alles!
08. Dezember 2012, Uhrzeit unbekannt
Er hielt seinen Kopf mit beiden Händen fest umschlossen, um ihn zu stützen. Die Zeit verrann langsam und zäh. Das Schlimmste war für Hans Büchner, dass er nicht wusste, was sein Entführer mit ihm vorhatte. Die Angst fraß an ihm wie ein Hund an einem alten Knochen. Wie lange würde dieses zermürbende Spiel weitergehen? Wann würde er endlich erfahren, was sein Entführer, oder waren es mehrere, von ihm wollte? Ihm wurde schlecht. Er hatte sich bereits zwei Mal übergeben. Die Todesangst brachte ihn schier um den Verstand und seinen Magen dazu, alle feste Nahrung von sich zu geben. Die Situation überforderte ihn. Er war Bankchef, er konnte Entscheidungen über Millionenbeträge fällen, Kunden ins Gesicht lügen, Untergebene feuern oder seine Sekretärin vögeln, aber das ging über alles, was er fassen konnte.
Er hörte ein Knacken aus dem verborgenen Lautsprecher. Nein, nicht wieder dieser mörderische Ton, eine weitere Folterrunde. Eine Stimme sprach diesmal zu ihm. Sein Kerkermeister und Folterknecht?
„Guten Tag Herr Büchner. Konnten Sie sich bereits einleben?“ Der Mann lachte über seinen Scherz.
„Ich habe unbeschreibliche Kopfschmerzen. Ich brauch eine Aspirin!“
„Darüber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden bald keine Probleme mehr mit Ihrem Kopf haben.“
Hans Büchners Herz verdoppelte die Schlagzahl und in seinem Mund sammelte sich Speichel, süßlich scharf schmeckend, so wie es immer war, bevor er sich übergeben musste. „Was meinen Sie? Wollen Sie mich töten? Haben Sie Lösegeld für mich verlangt?“
„Lösegeld?“, kam es hämisch aus dem Lautsprecher. „Warum glauben Sie, dass ich Geld für Sie verlangen sollte? Haben Sie einen hohen Wert?“
„Ja! Meine Bank und meine Frau, sie werden Ihnen jede Summe zahlen, egal was Sie verlangen.“
„Jede Summe?!“
„Ja, jede!“ Hoffnung keimte in Büchner auf. Der ekelhafte Geschmack in seinem Mund schwächte sich ab. „Wie viel wollen Sie haben?“
„Mehr als Sie zu zahlen bereit sind.“
„Nennen Sie einen Betrag. Ich verspreche, Sie bekommen ihn.“
„Der Preis ist höher.“
„Wie hoch? Glauben Sie mir, ich habe mit Summen gehandelt und jongliert, die Sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können.“ Büchners Stimme wurde fester. Er fühlte sich das erste Mal, seit er hier war, der Situation gewachsen.
„Herr Büchner, ich rede von keiner Summe … Ich rede von Ihrem Leben.“
Büchners Knie gaben nach, er sackte auf dem Boden zusammen. Im nächsten Moment schoss ein Strahl halb Verdautes aus seinem Mund, zusammen mit aller Zuversicht, die er in den letzten Sekunden gesammelt hatte. „Nein!“ Er hustete, wischte sich den Mund ab. „Oh Gott, was wollen Sie von mir …?“
„Genau so habe ich Sie eingeschätzt. Kein bisschen Selbstachtung. Sie sind verabscheuungswürdig, eine arme Kreatur, ich glaube, das Beste wäre, Sie einfach umzubringen. Aber Sie sollen ein faire Chance bekommen, wie Ihr Mitgefangener.“
Hans Büchner horchte auf. „Eine faire Chance?“ Seine Stimme zitterte und Tränen liefen ihm die Wangen herunter.
„Sie sind ein jämmerlicher Versager, aber vielleicht zeigen Sie einmal in ihrem Leben Rückgrat.“
„Wie? Rückgrat?“
„Indem Sie sich wie ein Mann verhalten. Nicht wie ein Waschlappen, der bei jeder Gelegenheit anfängt zu jammern, zu weinen und zu kotzen. Sie sind erbärmlich, wie Sie da in Ihrer Kotze knien.“
„Was soll ich …?“
„Die Fragestunde ist beendet!“ Die Aussage duldete keinen Widerspruch. Mit einem elektronischen Klicken öffnete sich die Tür der Zelle. „Folgen Sie dem Gang bis zur nächsten offenen Tür. Sollten Sie versuchen zu fliehen, werden Sie es nicht überleben.“
Büchner erhob sich mit wackligen Knien, der Vergleich mit Wackelpudding schoss ihm durch den Kopf. Mit unsicheren Schritten führten ihn seine nackten Füße zur Tür. Er öffnete den rostigen Verschlag. Ein langer, spärlich erleuchteter Gang lag vor ihm. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen und betrat den unendlich scheinenden Flur. Der Boden bestand aus Metallplatten. Als er ein paar Schritte gegangen war, schloss sich die Tür seiner Zelle mit einem Klicken. Nun blieb ihm keine andere Möglichkeit, als dem Verlauf des Gangs zu folgen. Nach ungefähr zehn Metern passierte er eine weitere Tür. Verschlossen. Im Gegensatz zu seiner eigenen Zelle verfügte diese Tür über eine Glasscheibe in Augenhöhe. Der Raum dahinter sah aus wie seine eigene letzte Herberge, mit dem Unterschied, dass zwei Betten darin standen. In beiden lagen Menschen. Links ein Mann, rechts eine Frau. Beide Personen waren mit braunen Lederriemen an das Metallgestell ihres Bettes gefesselt. In ihren Unterarmen steckten Kanülen mit Schläuchen, die eine klare Flüssigkeit in ihre Körper leiteten. Als Büchner weitergehen wollte, erblickte ihn der Mann. Seine Arme spannten sich, als wolle er sie Büchner entgegenstrecken. Die Fesseln hinderten ihn daran. Seine Lippen formten Worte, die der Banker nicht verstand. Der Gefangene wiederholte sie wieder und wieder. Büchner gab sich einen Ruck und ging weiter.
Nach etwa fünf Metern die nächste Tür. In dem dahinter liegenden Raum bot sich ihm das gleiche Bild. Die gleiche Zelle, zwei Betten, ein Mann und eine Frau, die gefesselt waren. Der Unterschied zum ersten Szenario bestand darin, dass diese beiden bedauernswerten Gestalten einfach nur an ihre Betten geschnallt waren. Weder der Mann noch die Frau schlugen die Augen auf. Die beiden Gefangenen sahen mager aus, unterernährt. Büchner nahm an, dass sie schliefen.
Der Banker riss sich von dem Bild los und setzte seinen Weg fort. Was geschah in diesen Zellen? Experimente? Der Gedanke jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Und da war sie wieder, die Angst. Was würde am Ende des Ganges auf ihn warten? Würde er je wieder das Licht der Sonne erblicken?
Ein paar Meter weiter erreichte er eine angelehnte Metalltür. Er öffnete sie vollständig, trat hindurch und lehnte sie wieder an. Mit einem elektronischen Klick schloss sich die Tür wie von Geisterhand.
Der Raum, in dem er stand, unterschied sich in Länge und Breite von seiner bisherigen Zelle. Er war doppelt so groß, jedoch ohne Bett und sanitäre Einrichtung. Der Boden bestand nicht aus Stein, sondern wie der Gang aus Metallplatten. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich eine zweite Tür. Sie stand einen Spaltbreit offen.
„Warten Sie hier!“, erklang plötzlich wieder die Stimme.
Jetzt fiel Büchner auf, dass links von ihm ein Spiegel den größten Teil der Wand einnahm, vom Boden bis zur Decke. Während er überlegte, was nun passieren würde, schob sich ein verängstigt dreinblickender Mann durch die gegenüber liegende Tür. Er schätzte den korpulenten Weißen auf Mitte vierzig. Seine braunen Augen schauten hektisch umher. Die Halbglatze verstärkte den Eindruck, einen gepeinigten Verlierer vor sich zu haben. Büchner notierte, dass sein Gegenüber die gleiche Kleidung wie er trug und keine Schuhe. Das Gesicht kam ihm bekannt vor, aber er wusste nicht woher.
Die Tür hinter dem Dicken fiel ins Schloss. Wieder eingesperrt!
Die Stimme meldete sich erneut: „Beschnuppern Sie sich. Ihnen bleibt eine Stunde.“
„Und was dann?“, fragte Büchners Mitgefangener laut.
Keine Antwort.
„Wie sind Sie hier gelandet?“, fragte der Mann.
„Ich wurde mitten in der Nacht von einem Parkplatz entführt.“ Nach ein paar Sekunden fügte er hinzu: „Betäubungsmittel.“
„Wie ich.“
„Wie heißen Sie?“, fragte Büchner.
„Mein Name ist Sebastian Gerstel.“
„Hans Büchner. Haben wir uns schon einmal getroffen?“
„Vielleicht, ich weiß nicht. Ganz ehrlich … Ich habe im Moment zu viel Angst, um mich an irgendwas zu erinnern“, erwiderte Gerstel.
Büchner nickte wissend. Ihm ging es genauso. Die beiden verängstigten Männer setzten sich eng nebeneinander, als ob sie sich auf diese Weise gegenseitig Schutz bieten könnten. Beide zitterten am ganzen Leib. Ob vor Kälte oder Angst gab keiner von beiden preis. Doch beide wussten die Antwort auf die ungestellte Frage.
In der folgenden Stunde erfuhr Büchner, dass Gerstel Bankangestellter war. Er arbeitete bei der Deutschland Bank in der Taunus-Anlage in Frankfurt. Sein Job war der Wertpapierhandel, im ganz großen Stil. Die Bankenkrise war auch an ihm nicht spurlos vorbei gegangen. Gerstel hatte Verluste einstecken müsse, wie seine Kunden.
„Ich glaube, unser Entführer ist ein geschädigter Mandant, entweder von Ihnen oder von mir. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Er denkt, wenn er zwei Banker entführt, bekommt er seine Verluste wieder rein.“ Gerstel sah Büchner erwartungsvoll an: „Was glauben Sie?“
Büchner klangen die Worte ihres Entführers in den Ohren: Ich will Ihr Leben. „Haben Sie gefragt, wie hoch das Lösegeld ist, das er verlangt?“
Gerstel sah ihn verdutzt an: „Nein. Sie?“
„Ja. Er wollte nur mein Leben. Ich glaube, er hat nicht vor, Forderungen zu stellen.“
Gerstel wurde blass. „Haben Sie sich vielleicht verhört?“
„Bestimmt nicht“, antwortete Büchner mit einem humorlosen Lachen.
Bevor Gerstel etwas erwidern konnte, knackte es im Lautsprecher. „Hallo, die Herren. Gut unterhalten? Ich hoffe, Sie vertragen sich.“
Büchner fasste einen Entschluss, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. „Was wollen Sie von uns? Verdammt! Ich bin das scheiß Warten satt.“
„Ah, da hat sich jemand ein Rückgrat wachsen lassen, sehr interessant. Herr Büchner, ich mag mutige Männer.“
„Ich will endlich Antworten, Sie Psychopath!“ Im selben Moment, in dem er das letzte Wort ausgesprochen hatte, bedauerte er es bereits. War er zu weit gegangen? Das Eis unter seinen Füßen schien dünner zu werden und er glaubte, es leise knacken zu hören. Dann spürte er ein Kribbeln an den Füßen, welches von Augenblick zu Augenblick stärker und unangenehmer wurde. Es traf ihn wie ein Hammerschlag, Strom! Die Platten unter seinen Füßen standen unter Strom. Gerstel sprang ebenfalls auf und bewegte sich hektisch von einer Platte zur nächsten, aber der gesamte Boden war elektrisch aufgeladen.
„Was haben Sie getan?“, Gerstel blickte panisch zu Büchner. „Sie Idiot. Au … au … autsch …!“ Er hüpfte von einem Fuß auf den anderen.
So plötzlich wie der Spuk begonnen hatte, war er zu Ende. Gerstel blieb stehen, beendete seinen Regentanz.
„Das war ein Vorgeschmack. Sollten Sie meinen Anweisung nicht Folge leisten oder aufbegehren … Strom! Ist diese Nachricht angekommen?“, klang es aus dem Lautsprecher.
Beide nickten einhellig.
„So, kommen wir zu ihrer Aufgabe für heute. Begeben Sie sich zurück zu der Tür, durch die sie den Raum betreten haben.“ Beide Männer verharrten auf der Stelle. „Worauf warten sie?“ Ein kurzer Elektroschock fuhr durch den Boden. Büchner und Gerstel hüpften synchron wie auf ein lautloses Kommando. „Ich fordere sie kein drittes Mal auf.“ Die Männer begaben sich zu den ihnen zugewiesenen Positionen.
Büchner stand mit dem Rücken zur Tür, als sich rechts von ihm ein Schacht öffnete. Auf Gerstels Seite geschah das gleiche.
Mit einem lauten Klong fiel eine Waffe in das Fach. Eine Automatik-Pistole, mehr wusste Büchner nicht über Waffen. Modell, Kaliber, keine Ahnung.
„Sie haben jetzt beide die Möglichkeit, sich eine Fahrkarte zu erspielen. Derjenige von ihnen, der den anderen mit zwei Kopfschüssen niederstreckt kommt raus.“ Nach einer Pause fügte er hinzu: „Machen sie sich keine Hoffnung, in der Glock befinden sich nur je zwei Patronen. Sollten sie sich beide entschließen, nicht zu schießen, werde ich den Strom anstellen und sie rösten.“
Eisiges Schweigen lag im Raum.
„Sie Schwein!“, schrie Gerstel plötzlich und feuerte seine Waffe ab, aber nicht gegen Büchner, sondern in Richtung des großen Spiegels. Nichts geschah. Der Spiegel musste aus Panzerglas sein. Das wäre viel zu einfach gewesen, ging es Büchner durch den Kopf.
„Herr Gerstel, Sie haben sich entschlossen, nicht auf Herrn Büchner zu schießen. Jetzt liegt es an Ihnen, Herr Büchner.“
Büchner wurde es blitzartig schlecht. Sein Magen drehte sich um die eigene Achse, zumindest fühlte es sich so an. Entweder er beging einen Mord, kam hier heraus und war Zeit seines Lebens ein Verbrecher oder er wurde gegrillt wie auf dem elektrischen Stuhl. Keine Option wirkte verlockend.
„Herr Büchner, eine Minute, dann stelle ich den Strom an. Entscheiden Sie sich! Ich bin kein geduldiger Mensch.“
Gerstel fing an, unartikuliert zu schreien. Büchner verstand nur die Worte: nein … Mörder … noch nicht sterben.
„Noch dreißig Sekunden.“
„Ich kann nicht. Ich bin kein Mörder!“
„Noch zwanzig Sekunden.“
„Nein! Bitte zwingen Sie mich nicht!“
„Zehn Sekunden.“
Büchner überlegte gefühlte tausend Mal hin und her, dachte an den Strom, das Gefühl von vorhin und an sein Leben. Gerstel kauerte auf dem Boden, weinend und schreiend.
„Ich stelle den Strom jetzt an …“
„Stopp!“, schrie Büchner, „Ich mach’s … Ich mach’s …“ Gerstel sah ihn ängstlich und verwirrt an.
„So, so, Herr Vorstandsmitglied will seinen Mitgefangenen erschießen. Dann mal frisch ans Werk“, ein hämisches Lachen erklang.
Büchner setzte sich langsam in Bewegung. Der Weg vom einen Ende des Raums zum anderen kam ihm unheimlich kurz vor, so langsam er auch lief. „Geht das schneller?“ Büchner erreichte Gerstel, der am Boden kauerte.
„Bitte tun Sie mir nichts … bitte … BITTE!“ Das Flehen des Mannes grub sich in Büchners Herz, es schmerzte. Doch er wusste, entweder er oder sie starben beide.
Büchner ließ die Waffe sinken, bis sie die Stirn von Gerstel berührte. „Abdrücken ist ganz einfach, der Widerstand des Abzugs ist gar nicht hoch … versuchen Sie es!“ Du verdammter Sadist, dachte Büchner, die Waffe sollte auf deinen Kopf gerichtet sein.
Gerstel blickte ihn an, Angst und Wahnsinn spiegelten sich in seinen Augen. Büchner war verzweifelt. Aber was blieb ihm übrig? Sein Finger spannte sich um den Abzug, nur ein kleines Stück noch, dann … In diesem Moment löste sich der Schuss.
Büchner hatte nicht damit gerechnet, dass es so leicht gehen würde. Seine Hand wurde von dem Rückstoß der Pistole nach oben geschleudert, für eine Sekunde fühlte es sich an, als bräche sein Handgelenk. Der Kopf von Gerstel wurde gegen die Wand geschleudert und eine riesige Blutlache – vermischt mit Dingen, über die Büchner nicht nachdenken wollte – breitete sich in Windeseile an der Wand und auf dem Boden aus.
Er starrte auf den Toten.
Was habe ich getan?! Diese Frage hämmerte durch seinen Kopf, sie wiederholte sich wieder und wieder wie ein nie verklingen wollendes Echo. Dann wurde ihm schlecht, er schaffte es noch, den Kopf wegzudrehen und übergab sich auf den Stahlboden. Er sank auf die Knie, blickte zu Gerstel, zu dessen lebloser Hülle. Nein, nein, nein, dachte er.
„Noch einmal“, meldete sich die Stimme. „Ich sagte, zwei Kopfschüsse. Also los, schießen Sie. Oder ich stelle den Strom an.“
Büchner war kotzübel, aber sein Magen war mittlerweile komplett leer. Er stellte einen Fuß auf den Boden, dann den anderen und stemmte sich wieder hoch. „Bitte nicht!“, jammerte er.
„Los jetzt! Es tut ihm nicht weh … Ich verspreche es Ihnen.“ Bei den letzten Worten hörte er wieder das Lachen des Unbekannten.
Er hob die Waffe. Der Geruch von Urin stach ihm in die Nase. Die Blase des Toten hatte sich entleert. Seine Hand mit der Waffe zitterte. Er setzte die Pistole an den Kopf des Toten und drückte ab. Der Schlitten blieb hinten stehen, die letzte Patrone war verschossen.
Applaus erscholl aus dem Lautsprecher: „Na also. Geht doch.“
„Sie Sadist …“ Zu mehr war Büchner nicht fähig.
„Aber, aber, wer vergisst da seine gute Kinderstube? Legen Sie die Waffe in das Fach.“
„… und wenn nicht?“
„Strom.“
Büchner legte die Waffe ab. Das Fach schloss sich.
„Wann kann ich gehen?“
Keine Antwort.
Nach einer gefühlten Ewigkeit, in der Büchner den Blick von dem Toten nur schwer abwenden konnte, öffnete sich die Tür an der ihm gegenüber liegenden Seite. Ein Mann trat ein. Er trug normale Straßenkleidung und es war nicht sein Entführer. Der Mann, der ihn auf dem Parkplatz betäubt hatte, trug einen Vollbart, dieser nicht.
„Hallo, Herr Büchner.“ Büchner glaubte, den Mann zu erkennen, denn sein Gegenüber trug keine Maske. In seiner linken Hand hielt er eine Pistole, in der rechten ein kleines weißes Kästchen.
„Versuchen Sie keine Dummheiten.“ Der Mann drückte kurz auf den roten Knopf auf der Oberseite des Kästchens. Ein Stromstoß, stärker als alle bisherigen, fuhr Büchner in die Glieder. Während Büchner versuchte, seine Benommenheit abzuschütteln, war der Unbekannte mit ein paar Schritten an ihn heran getreten. „Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie heraus kommen.“ Der Banker hob den Kopf, aber ihm schien bereits alles egal zu sein. „Doch ich sagte nicht, dass Sie lebend heraus kommen.“ Mit diesen Worten hob er die Waffe, setzte sie an die Stirn seines verdutzten Gefangenen und drückte ab, zwei Mal.
Ein martialisches Grinsen umspielte die Mundwinkel des Mannes, während der leblose Körper seines Opfers in sich zusammen sackte. „Sehr gut“, flüsterte er. „Der Anfang ist vollbracht.“
09. Dezember 2012, 07:23
Die Dunkelheit zog sich langsam zurück und wich dem neuen Tag, der von den ersten zaghaften Strahlen der Morgensonne angekündigt wurde. In den Bäumen, die den Main bei Schwanheim wie eine Allee flankierten, saßen Dutzende von Vögeln, die den Morgen begrüßten. Man konnte das Gefühl bekommen, als wollten sie nie wieder aufhören mit ihrem vielstimmigen Gesang. Die Mainwiesen lagen unter einer zarten Schneedecke, die in den nächsten Stunden das Grün der Wiesen freigeben würde.
Im grauen Dämmerlicht liefen zwei dunkel gekleidete Gestalten über die knirschende Schneeschicht. Die Hände tief vergraben in den Taschen ihrer Mäntel, wirkten sie wie frühe Spaziergänger. Nach ein paar Metern stoppten sie vor einem grünen Bündel, das auf dem kalten Boden lag. Der eine der beiden, völlig in schwarz gekleidet, kniete sich nieder und inspizierte den Fund. Aus der Vogelperspektive, mit dem ausgebreiteten Mantel, wirkte er wie ein Vampir aus den Tagen Christopher Lees.
Kriminalhauptkommissar Till Ressmann hob den Kopf zu seinem Kollegen: „Kopfschuss!“
„Schüsse“, korrigierte ihn Kriminalhauptkommissar Carstens. „Zwei Mal in den Kopf. Ich glaube Selbstmord scheidet aus.“
„Sehr scharfsinnig für die frühe Stunde.“
Der Tatort am Schwanheimer Ufer war großräumig abgesperrt. Die uniformierten Kollegen vom 10. Revier hatten ringsherum das rot-weiße Flatterband mit der Aufschrift Polizei gespannt. Der Leichenfund war von einer Joggerin um fünf Uhr fünfzig gemeldet worden. Das K11, die Frankfurter Mordkommission, wurde um sechs Uhr zwanzig angefordert.
Ressmann ließ seine Augen Zentimeter für Zentimeter über den auf dem Rücken liegenden Toten schweifen. Als erstes bemerkte er, dass Hose und Jacke des Mannes aus dem selben grünen Stoff gefertigt waren. Seine Füße waren nackt. Die Kleidung wirkte wie ein Tarnanzug von der Bundeswehr. Der Kommissar griff in seinen Mantel und zog zwei Latexhandschuhe heraus.
„Ich hoffe, die sind neu“, meldete sich Carstens zu Wort. „Was denn sonst?“ Ressmann blickte tadelnd nach oben.
„Glaubst du, die sind von meinem letzten Urologen-Besuch?“
Carstens verzog angewidert das Gesicht. „Die Bilder bekomme ich nie wieder aus meinem Kopf. Meister wird trotzdem nicht begeistert sein … aber deine Entscheidung.“
Der Kommissar streifte die Handschuhe über, um dann den Toten abzutasten. „Da ist nix. Alles le …“, er stockte mitten im Wort. Ressmann hörte ein Knistern. Aus der linken Tasche zog er einen kleinen Zettel. Er hielt ihn dicht unter die Nase, um im Dämmerlicht besser lesen zu können: „KOMM! … das ist alles.“
Carstens beugte sich hinab zu seinem Partner. „Sonst nichts?“ Beiden schien die Verwirrung ins Gesicht geschrieben zu sein. „Was soll das?“
„Keine Ahnung“, erwiderte Ressmann. Er drehte den Zettel mehrere Male zwischen den Fingern und dachte über den tieferen Sinn des Wortes nach. Er wollte sich ihm nicht erschließen. Darüber mussten sie sich später Gedanken machen, denn …
„Vielleich ist der Zettel gar nicht vom Killer“, beendete Carstens den Satz, der Ressmann durch den Kopf gegangen war. „Oh, oh, da kommt Reiner.“
Reiner Meister und einer seiner Mitarbeiter kamen über den Rasen gestapft. Der Chef der Spurensicherung, der vor ein paar Wochen seinen siebenundfünfzigsten Geburtstag gefeiert hatte, runzelte skeptisch die Stirn, als er Ressmann neben dem Leichnam knien sah. „Na, konnten wir unsere Finger mal wieder nicht im Zaum halten?“, und nach einem Blick zu Carstens: „Zumindest rauchst du nicht. Zum Thema Kippen und DNA.“
Ressmann erhob sich und richtete sich zu seiner vollen Größe auf, knappe zwei Meter. Seine fast schwarzen, dämonisch wirkenden Augen fixierten Meister: „Net aufregen. Die Handschuhe sind nagelneu aus der Verpackung. Kann dir sogar die Chargennummer geben.“
Meister schien beschwichtigt. „Na dann. Aber wir führen dieses Gespräch nicht zum ersten Mal.“
„Ich weiß.“
„Ich will einfach nicht, dass ich Spuren finde, mich freue und sie am Ende von dir sind.“
„Ja klar.“ Mit einem Blick auf den Zettel fragte Ressmann: „Hast du mal einen deiner Beweisbeutel greifbar?“
Meister öffnete einen seiner Koffer und zog einen Zip-Beutel heraus. Der Kommissar tütete das erste Beweisstück ein und steckte es in seine Manteltasche.
„Ähm, wolltest du das nicht mir geben?“ Meister hielt ihm die Hand entgegen. „Spuren, DNA, Fingerabdrücke? Du erinnerst dich?“
Ressmann beförderte den Beutel gedankenverloren aus seiner Tasche, nahm sein Handy und schoss ein Foto. „Hier.“ Er legte die kleine Plastiktüte auf Meisters Hand. Der steckte sie wortlos ein, winkte seinem Kollegen und die beiden begannen mit der Arbeit. Ressmann bückte sich zu dem Toten und fotografierte dessen Gesicht.
Die beiden Kommissare erkannten, dass sie im Weg standen. Sie begaben sich an den Rand der Absperrung und beobachteten die Spusi bei der Arbeit, als eine junge Frau Ressmann auf die Schulter tippte. Der Kommissar drehte sich zu ihr um. Sie trug einen Jogginganzug mit neongelben Schuhen und Stirnband. Sie war einen Kopf kleiner als er, brünett, hübsches Gesicht und sportliche Figur.
„Brauchen Sie mich noch?“
Der Kommissar schaltete sofort: „Sie haben die Leiche entdeckt? Frau …“
„Schneider, Verena Schneider. Ja, ich war auf meiner morgendlichen Runde und bin über ihn, mehr oder minder, gestolpert. Auf der Wiese laufen ist besser für die Knie.“
„Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Personen, die sich schnell entfernt haben, ein Auto, Motorrad, Fahrrad? Irgendwas?“
„Nein, leider nicht. Das habe ich schon Ihren Kollegen in Uniform erzählt, die haben auch meine Personalien.“ Nach einer kurzen Pause, in der sie den Kommissar von oben bis unten musterte, fügte sie hinzu: „Oder wollen Sie meine Telefonnummer haben?“
Carstens verkniff sich ein Lächeln. Er war sehr auf die Reaktion seines Kollegen gespannt.
„Wenn die Kollegen alles aufgenommen haben, besteht keine Notwendigkeit, alles erneut zu tun. Um auf Ihre ursprüngliche Frage zurück zu kommen, nein Sie können gehen. Danke.“ Ressmann nickte ihr zu und lächelte unverbindlich.
Verena Schneider blickte Ressmann ein letztes Mal in die Augen und verabschiedete sich mit enttäuschtem Gesichtsausdruck.
„Mann, bist du blind? Die ist voll auf dich abgefahren“, entrüstete sich Carstens. „Ich hätte die Nummer genommen.“
„Dann lauf ihr nach und frag sie! Aber lass mich endlich in Ruhe. Versuch nicht ständig mir Dates zu verschaffen. Ok?!“, erwiderte Ressmann unwirsch.
„Es ist jetzt ein halbes Jahr her. Willst du dich nicht mal wieder mit einer Frau treffen?“ Carstens legte seinem Freund und Kollegen die Hand auf die Schulter. Dieser drehte sich weg von ihm und schlüpfte unter dem Absperrband hindurch. „Till!“ Er reagierte nicht. Carstens lief schneller um seinen Kollegen einzuholen. „Wart mal.“ Ressmann blieb stehen und blickte Carstens mit versteinerter Miene in die Augen. „Lass uns mal zu Tom rüber gehen.“ Carstens deutete auf die andere Seite der Schwanheimer Uferstraße. Beide blickten jetzt in die Hänggasse zu dem weißen Mietshaus, in dem ihr Freund Thomas Martini wohnte. „Tom hatte sozusagen einen Logenplatz mit Blick auf den Leichenfundort. Vielleicht hat er was gesehen. Den Rest der Anwohner können die Kollegen vom 10. befragen.“ Er blinzelte Ressmann zu.
Ein Nicken war die einzige Regung, die Carstens dem Kommissar abringen konnte.
09. Dezember 2012, 08:11
Es war dunkel. Es war still, aber es fuhren schon erstaunlich viele Fahrzeuge die Uferstraße entlang. Ich öffnete die Augen und blickte auf meinen Wecker. Warum war ich jetzt schon wach? Nachdem ich gestern, besser heute Morgen, erst um ein Uhr ins Bett gegangen war. Aber mein Körper schien anderer Meinung. Zehn Minuten später gab ich auf und schwang mich aus dem Bett. Was soll‘s, dachte ich, manche Kämpfe sind aussichtslos.
Ich putzte mir die Zähne, wuschelte mir zwei Mal durch meine schwarze Mähne, in der sich in den letzten zwei Jahren einige graue Haare angesiedelt hatten. Der drei Tage Bart war mittlerweile komplett grau, rasieren stand an. Meine blauen Augen wirkten etwas müde, aber da würde ich gleich Abhilfe schaffen. In der Küche kochte ich einen starken Kaffee und stellte mich auf den Balkon, um meinen Sinnen frische Luft zu spendieren, während ich genüsslich an meiner Tasse nippte.
Mein Blick fiel auf die entgegengesetzte Seite der Schwanheimer Uferstraße. Was war da los? Vier Autos standen auf der Wiese, eines davon ein Polizeiwagen. Die anderen waren bestimmt Zivilfahrzeuge. Spurensicherung, Kripo, Pathologie. Als Ex-Bulle fiel mir sowas auf und als Privatdetektiv sollte es mir auffallen. Ich kniff die Augen zusammen. Liefen da nicht zwei Personen lebensmüde über die Uferstraße? Ja, ich kannte sie sogar, Stefan und Till. Sie kamen geradewegs auf mein Haus zu.
Ich holte zwei frische Tassen aus dem Schrank und wartete auf das Klingeln. Da war es schon. Ich drückte den Türsummer und öffnete die Haustür. Zwei Minuten später betraten meine beiden Freunde die Wohnung. Nach einer herzlichen Begrüßung fragte ich: „Kaffee?“ Beide nickten ohne zu zögern. „Was treibt euch so früh aus dem Bett?“ Ich goss das schwarze Elixier in die Keramikgefäße und reichte sie den beiden.
„Ein Toter“, erwiderte Till kurz und knapp. „Direkt vor deiner Nase.“ Sein Arm wedelte Richtung Mainwiesen.
Irgendwas stimmte mit Till nicht, ich wusste nur nicht was. Normal war Stefan der kurz angebundene, wenn es um die Arbeit ging. Privat war das völlig anders.
„Wir wissen nicht viel. Eigentlich nix, außer dass die Leiche männlich ist, mit zwei Kopfschüssen getötet wurde und eine Art Tarnkleidung trägt“, ergänzte Stefan.
„Ich habe einen Zettel bei dem Toten gefunden.“ Till zückte sein Handy und hielt es mir hin. Er hatte ein Bild geöffnet, auf dem ich einen Zettel mit dem Wort ‚KOMM!‘ sehen konnte.
Ich wischte über das Display und erblickte das Gesicht des Toten. „Ups, den kenn ich.“ Beide öffneten gleichzeitig ihren Mund. „Hans Büchner. Vorstandsmitglied der Ratio-Bank in der Solmsstraße. Ist in der Nacht vom fünften auf den sechsten Dezember verschwunden. Die Frau hat am siebten eine Vermisstenanzeige erstattet. Da sie das Gefühl hatte, die Kollegen seien nicht recht motiviert, hat sie sich zusätzlich an mich gewandt. Elmie hat mich ihr empfohlen.“
„Polizeimeister Ernst Mielke?“, fragte Stefan.
„Yep. Seit der Sache am Dom vor zwei Jahren, ist er besser auf mich zu sprechen. Er war nie begeistert, wenn ich mich an Tatorten habe sehen lassen, die er absperren musste. Das hat sich geändert.“ Ich fand das gut. Frau Büchner war nicht die erste verzweifelte Ehefrau, die Elmie zu mir geschickt hatte.
„Was weißt du außerdem über Büchner?“
„Na ja, ein Casanova bei den Frauen, ein Filou bei der Arbeit. Seine Frau wusste genau, wann er welche Affäre hatte. Das schien nicht selten zu sein. Bei der Arbeit hat er mit allen Tricks gearbeitet und selbst während der Finanzkrise hat er Gewinn gemacht. Der Kerl war mit allen Wassern gewaschen.“
„Warum hat seine Frau so ein Aufhebens gemacht, um ihn zu finden, wenn er sie nach Strich und Faden betrogen hat?“, fragte Stefan verständnislos.
„Keine Ahnung. Liebe?“ Ich zuckte die Schultern. „Wollt ihr die Adresse haben?“ Beide nickten. „Ich mach euch eine Kopie von meiner Akte.“ Ich ging in mein Arbeitszimmer und kopierte die fünf Blätter über Büchner. Viel war es nicht und mehr würde es nicht werden. Ich händigte Stefan die losen Seiten aus. „Redet ihr mit der Witwe?“, die noch nicht weiß, dass sie jetzt eine ist, fügte ich in Gedanken hinzu. Stefan nickte.
Till hatte bisher sehr wenig gesprochen, von seinem Kaffee getrunken und geschwiegen. Ich blickte in seine Richtung: „Was ist los?“