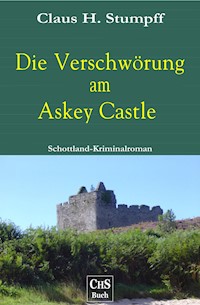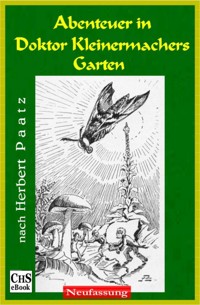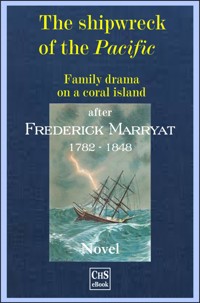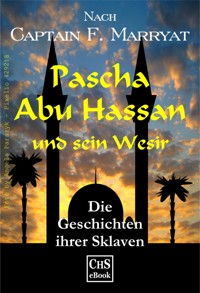2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Fahrt nach Australien geriet der Großsegler ›Pacific‹ in einen schweren Sturm. Er verlor alle Masten und strandete vor einer anscheinend unbewohnten Koralleninsel. Der Kapitän und alle Matrosen verließen den Dreimaster in einem Beiboot, während sich die zurückgelassenen Passagiere und der alte Seebär Ready darum bemühten, Tiere und Warenbestände des langsam sinkenden Schiffs zu bergen. Mittels der noch an Land geschafften Lebensmittelvorräte und Gerätschaften begann für die Schiffbrüchigen ein abenteuerliches und entbehrungsvolles Insel-Dasein.
Die Gestrandeten hatten bereits alle Hoffnung auf Rettung aufgegeben und sich primitive Behausungen geschaffen, als sie von wilden Eingeborenen überfallen wurden. Im Augenblick höchster Gefahr kam unerwartete Hilfe, aber dennoch schlug das Schicksal unbarmherzig zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Schiffbruch der Pacific
Familiendrama auf einer Koralleninsel
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDer Schiffbruch der ›Pacific‹
Familiendrama auf einer Koralleninsel
nach Frederick Marryat
1782 - 1848
Entsprechend der Originalversion
»Masterman Ready or the Wreck of the Pacific«
sowie der deutschen Übersetzung
von Dr.Karl Kolb unter dem Titel
»Sigismund Rüstig«
Text überarbeitet und neugefasst
von Claus H. Stumpff
www.chsautor.de
Zum Inhalt
Auf der Fahrt nach Australien geriet der Großsegler ›Pacific‹ in einen schweren Sturm. Er verlor alle Masten und strandete vor einer anscheinend unbewohnten Koralleninsel. Der Kapitän und alle Matrosen verließen den Dreimaster in einem Beiboot, während sich die zurückgelassenen Passagiere und der alte Seebär Ready darum bemühten, Tiere und Warenbestände des langsam sinkenden Schiffs zu bergen. Mittels der noch an Land geschafften Lebensmittelvorräte und Gerätschaften begann für die Schiffbrüchigen ein abenteuerliches und entbehrungsvolles Inseldasein.
Die Gestrandeten hatten bereits alle Hoffnung auf Rettung aufgegeben und sich primitive Behausungen geschaffen, als sie von wilden Eingeborenen überfallen wurden. Im Augenblick höchster Gefahr kam unerwartete Hilfe, aber dennoch schlug das Schicksal unbarmherzig zu.
Vorwort
Der englische Schriftsteller und einstige Fregatten-Kapitän Frederick Marryat erzählt in seinen Abenteuerromanen von der Segelschifffahrt aus einer Zeit, als viele Regionen der Erde noch unerforscht waren und man noch nicht über Funkverkehr, Radar oder andere technischen Errungenschaften verfügte.
In seinem wohl berühmtesten Buch dreht es sich um den tragischen Schiffbruch des Dreimast-Seglers ›Pacific‹ auf der Fahrt nach Australien und dem Schicksal der gestrandeten Passagiere, die ihre Rettung dem tapferen Seemann Sigismund Ready zu verdanken haben.
Frederick Marryat darf man als großartigen, fantasiereichen und humorvollen Erzähler bezeichnen. Sein 1841 fertiggestellter Roman mit dem Originaltitel »Masterman Ready, or the Wreck of the Pacific« wurde erstmals 1844 vom Teubner-Verlag unter dem Titel »Sigismund Rüstig - der Bremer Steuermann« herausgebracht. Das Buch gilt als Klassiker der Jugendliteratur. Ebenso wie der legendäre Abenteuerroman »Robinson Crusoe« von Daniel Defoe hat auch das Schicksal der Passagiere nach dem Schiffbruch des Dreimastseglers ›Pacific‹ Generationen von Lesern begeistert.
Frederick Marryat war seinerzeit Kapitän eines Kriegsschiffes der Royal Navy. Seine somit authentische Darstellung von Abenteuern, denen die Seeschifffahrt im 18. und 19. Jahrhundert ausgesetzt war, kommt in dieser fesselnden Erzählung zum Ausdruck. Es lohnt sich, auch die Biografie Frederick Marryats zu lesen – siehe am Schluss.
Erstes Kapitel
Auf hoher See
Im Oktober 1843 geriet der Dreimast-Schoner ›Pacific‹ im Atlantik auf der Fahrt nach Australien in einen orkanartigen Sturm. Die meisten Segel waren gestrichen, da sie sonst von den heftigen Windstößen, die das Meer aufwühlten und die schwarzen Wolken am Himmel dahinjagten, unweigerlich zerfetzt worden wären. Wie ein Spielball tanzte das Schiff auf den schaumgekrönten Wellen, wurde emporgehoben und in die Tiefe geschleudert; aber es war ein starkes und gutgebautes Fahrzeug und sein Captain ein erfahrener Seemann, der mit ruhiger Überlegung die erforderlichen Maßnahmen traf.
Außer ihm und den beiden Männern am Steuerrad befanden sich noch zwei weitere Personen an Deck, ein etwa zwölfjähriger Knabe und ein alter, wettergebräunter Seemann, dessen graue Haare im Winde flatterten. Die beiden standen an Backbord und schauten eben einer sich auf das Schiff zuwälzenden hohen Welle entgegen.
»Wenn sie nur nicht über das Schiff schlägt, Ready!«, rief der Knabe und klammerte sich ängstlich an des Alten Arm.
»Nein, Master William, das wird sie nicht«, erwiderte Ready. »Sieh her, schon ist sie unter uns weggerollt. Aber einer nächsten könnte es einfallen, uns über Bord zu spülen, wenn ich nicht so sicher auf meinen Füßen stünde und dich festhielte.«
»Wissen Sie, Ready, ich mag die See nicht besonders. Ich wollte, wir wären schon an Land. Sehen diese Wellenberge nicht aus, als könnten sie das Schiff unter sich begraben?«
»Gewiss, Master William, so sehen sie aus. Und höre nur, wie sie vor Zorn brüllen, weil es ihnen nicht gelingt, uns unterzukriegen? Aber wir Seeleute haben uns daran gewöhnt und machen uns nicht mehr viel daraus.«
»Es kommt doch immer wieder vor, dass Schiffe untergehen und ihre Besatzungen ertrinken?«
»Ja, Master William, mit Mann und Maus. Und manchmal gerade dann, wenn man sich am Sichersten glaubt. Aber es hat, keinen Sinn, sich zu ängstigen. Unser Leben liegt in Gottes Hand.«
»Ready, was sind das für kleine Vögel, die so nahe über dem Wasser dahinfliegen?«
»Das sind Sturmschwalben oder ›Mutter Careys Küchlein‹, wie wir Seeleute sie nennen. Sie zeigen sich nur bei Sturm.«
»Ready, haben Sie auch schon einmal Schiffbruch erlitten wie Robinson Crusoe?«
»O ja, Master William, schon mehrmals. Aber einem Robinson Crusoe bin ich nie begegnet. Man kann nicht alle Leute kennen, die je Schiffbruch erlitten haben.«
»O, die Geschichte von Robinson Crusoe steht in einem wunderbaren Buch, das ich gelesen habe. Ich werde sie Ihnen erzählen, sobald das Schiff wieder in Ruhe ist. Aber helfen Sie mir jetzt bitte hinunter. Ich habe meiner Mutter versprochen, nicht zu lange oben zu bleiben.«
»Ja, dann müssen wir schon gehen«, antwortete Ready. »Ein braver Junge muss immer halten, was er versprochen hat. Reich mir deine Hand, dann wollen wir sehen, ob wir die Kajüte erreichen, ohne zu stürzen. Und wenn wir wieder schönes Wetter haben, dann erzähle mir von deinem Robinson, und ich werde dir von meinen Seefahrten berichten.«
Als der Alte den Knaben glücklich hinuntergebracht hatte, kehrte er auf Deck zurück, da die Wache an ihm war. Sigismund Ready fuhr schon seit mehr als fünfzig Jahren zur See. Als zehnjähriger Knabe war er als Schiffsjunge auf ein englisches Kohlenschiff gekommen und hatte später viele Jahre lang auf einem Kriegsschiff gedient. Auf seinen Fahrten hatte er alle sieben Meere kennengelernt und viele Abenteuer erlebt, so dass er die seltsamsten Geschichten zu erzählen wusste. Dabei kam nie ein unwahres Wort über seine Lippen. Er konnte lesen und schreiben und hatte seine Bibel mehrmals von vorn bis hinten durchgelesen. Dabei war er ein tüchtiger Seemann, der es ohne weiteres verstanden hätte, die Leitung eines Schiffes zu übernehmen. Er war von unermüdlicher Tatkraft, jederzeit hilfsbereit und verfügte über eine ungewöhnliche Erfahrung, so dass sich der Captain nicht selten von ihm beraten ließ. An Bord der ›Pacific‹ hatte er den Posten des Zweiten Steuermannes inne. Der Captain des Schiffes, das mit einer wertvollen Ladung von Eisen, Stahl und andern Waren nach Neusüdwales unterwegs war, hieß Osborne. Er war ein tüchtiger Seemann und dazu ein Mensch, dem es durch eine glückliche Veranlagung gegeben war, allem die beste Seite abzugewinnen und auch in schwierigen Lagen seine Heiterkeit nicht zu verlieren. Der Erste Steuermann, ein Schotte namens Mackintosh, war das pure Gegenteil von ihm: ein grober und mürrischer Geselle, immer kurz angebunden und unfreundlich gegen alle. Aber in der Erfüllung seiner Pflichten war auch er gewissenhaft, so dass sich der Captain unbedingt auf ihn verlassen konnte.
Die übrige Besatzung bestand aus dreizehn Matrosen, für ein so großes Schiff unbedingt eine zu schwache Mannschaft. Aber kurz vor der Ausfahrt hatten fünf Matrosen die ›Pacific‹ verlassen, mit der Begründung, die schlechte Behandlung durch Mackintosh gründlich satt zu haben. Um keine kostbare Zeit zu verlieren, hatte der Captain auf die Anheuerung von Ersatzleuten verzichtet, eine Sorglosigkeit, die sich noch bitter rächen sollte.
Als Passagiere befanden sich an Bord der ›Pacific‹ ein Mr. Seagrave und dessen große Familie. Seagrave war Regierungsbeamter in Sidney, der Hauptstadt von Neusüdwales, wohin er eben nach einem dreijährigen Urlaub zurückkehrte. Er besaß dort einige tausend Hektar Land, das ihm durch die darauf betriebene Schafzucht einen reichen Ertrag abwarf und während seiner Abwesenheit von einem Vertrauensmann verwaltet wurde. Um seinen Landbesitz noch besser bewirtschaften und ausnutzen zu können, führte Seagrave eine Menge von Haus- und Ackergeräten, mehrere Rinder, Schweine, Hunde und mancherlei Sämereien und Pflanzen auf dem Schiff mit.
Mrs. Selina Seagrave war eine liebenswürdige, um das Wohl ihrer Familie treu besorgte Frau. Von den vier Kindern war William das älteste. Er war ein anstelliger Junge, gutherzig und jederzeit fröhlich aufgelegt. Sein Bruder, der sechsjährige Thomas, war dagegen ein rechter Springinsfeld, der mit seinen unüberlegten Streichen die ganze Familie in Atem hielt. Das einzige Töchterchen hiess Caroline und war ein Jahr jünger als Tommy. Es war ein stilles und anhängliches Kind, das in allen Teilen der Mutter nachschlug. Das Nesthäkchen endlich, der kleine Albert, war ein gesundes und quietschvergnügtes Kerlchen von noch nicht einem Jahr. Es wurde von einer Schwarzafrikanerin umsorgt. Sie hieß Juno und war von Seagraves schon vor drei Jahren vom Kap der Guten Hoffnung nach England mitgenommen worden. Im Übrigen machten noch zwei große Schäferhunde, Romulus und Remus, sowie die Dachshündin Diana die Reise mit. Die Schäferhunde gehörten Mr. Seagrave, während der Dackel das Eigentum und der besondere Liebling des Kapitäns war.
Der Sturm hielt vier Tage mit unverminderter Heftigkeit an. Als er endlich nachließ, hängten die Seeleute, die Tag und Nacht gewacht hatten, ihre von Regen und Sturzwellen ganz durchnässten Kleidungsstücke am Takelwerk zum Trocknen auf. Auch mussten sie die vom Salzwasser durchtränkten Segel ausrollen, um zu verhindern, dass sie stockig wurden. Der Wind war nun zu einer leichten Brise abgeflaut, die aber genügte, um das Schiff mit einer Geschwindigkeit von vier englischen Meilen in der Stunde durch die Fluten zu treiben. So konnten sich denn auch die Passagiere wieder an Deck aufhalten. In einen Mantel gehüllt, hatte es sich Mrs. Seagrave auf einem Liegestuhl bequem gemacht. Ihr Mann und die Kinder waren bei ihr, und alle freuten sich des schönen Wetters und atmeten in vollen Zügen die reine Seeluft.
Da trat Captain Osborne zu ihnen. »Nun, Tommy«, wandte er sich lächelnd an den Jungen, »du bist wohl froh, dass der Sturm vorüber ist?«
»Oh, eigentlich habe ich mir nicht viel daraus gemacht«, gab der kleine Schelm zur Antwort. »Ich habe lediglich meine Suppe verschüttet, als es so wackelte. Aber Juno ist, mit dem kleinen Albert auf dem Arm, vom Stuhl gepurzelt.«
Alle lachten.
»Glücklicherweise ist dabei keines von beiden zu Schaden gekommen«, sagte Mrs. Seagrave.
Da kam Mackintosh, um dem Captain zu melden, dass es nach dem Sonnenstand zwölf Uhr sei.
Osborne nickte ihm zu. »Gut. Dann bringen Sie bitte die Karte her, auf der ich heute früh die Breite eingetragen habe.« Und zu Mr. Seagrave gewandt, fuhr er fort: »Wenn es Sie interessiert, werde ich Ihnen auf der Karte den Punkt zeigen, an dem wir uns eben befinden.«
Es stellte sich heraus, dass die ›Pacific‹ noch etwa hundertdreißig Meilen vom Kap der Guten Hoffnung entfernt war. Da der Wind günstig blieb, erreichte das Schiff das Kap schon am nächsten Tage. In der Tafelbay ging es vor Anker.
»Ready, warum heißt diese Bucht Tafelbay?«, fragte William.
»Warum? Schau dir nur den dort Berg an, Master. Ist er oben nicht flach wie eine Tafel? Na also. Manchmal lagern weiße Wolken auf ihm, und dann sieht es aus, als wäre ein riesiges Tischtuch über ihm ausgebreitet worden. Wir Seeleute sehen das zwar nicht gern, denn es ist ein untrügliches Schlechtwetterzeichen.«
»Dann wollen wir auf dieses Tischtuch lieber verzichten«, scherzte William, »wir haben nun lange genug Regen gehabt.«
Da das Schiff zwei Tage hier liegenbleiben sollte, schlug der Captain Mr. Seagrave vor, die Gelegenheit zu benützen, um mit seiner Frau an Land zu gehen und Kapstadt zu besichtigen. Aber Mrs. Seagrave erklärte, dass ihr an einem Ausflug nicht viel gelegen sei.
»Jetzt, da es so ruhig daliegt, gefällt es mir ganz gut auf dem Schiff«, lächelte sie. »Ich bleibe lieber mit Albert und Caroline zurück.«
Also wurde abgemacht, dass Mr. Seagrave und die beiden Jungen in Begleitung des Kapitäns an Land fahren sollten. Tommy musste der Mutter versprechen, sich gut aufzuführen und nichts auf eigene Faust zu unternehmen. Natürlich war der Kleine zu diesem Versprechen sofort bereit. Dann ließ Osborne das größte Boot hinunter.
»Was gibt es denn in Kapstadt alles zu sehen?«, fragte William unterwegs. »Wir sind doch hier in Afrika.«
»Sogar an seinem südlichsten Zipfel«, nickte Osborne vergnügt. »Oh«, mischte sich Tommy aufgeregt ins Gespräch, »gibt es da wohl auch Löwen?«
»Versteht sich«, schmunzelte der Captain. »Die gehen hier in den Straßen umher wie bei uns zu Hause die Hunde und Katzen.«
Tommy wurde ganz aufgeregt. »Und wir haben nicht einmal Waffen mitgenommen?«
Osborne lachte aus vollem Halse. »O du kleiner Löwenjäger! Man soll sich nicht nur keine Bären, sondern auch keine Löwen aufbinden lassen! Aber Spaß beiseite. Ihr sollt wirklich Löwen zu sehen bekommen. Zwar spazieren sie nicht frei in der Stadt umher, aber in den Gärten der Holländisch-Ostindischen Kompanie gibt es welche. Wenn Mr. Seagrave einverstanden ist.«
»Aber selbstverständlich. Sind dort eigentlich viele Tiere?«
»Weniger als früher. Die Anlage ist heute zur Hauptsache ein Botanischer Garten mit allerlei seltenen Pflanzen, doch werden immer noch verschiedene wilde Tiere gehalten.«
Nun hatten die Jungen für nichts anderes mehr Interesse. Als man die Gärten endlich erreicht hatte, versuchte Tommy zu entwischen, um als erster bei den Löwen zu sein. Der Captain fing ihn aber ein und ließ seine Hand von da an nicht mehr los. Eine hohe und starke Steinmauer umgab die Löwengrube. Durch eine mit Eisenstäben vergitterte Öffnung konnte man die Tiere in ihrem Zwinger herumliegen sehen. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Stäben war so breit, dass ein Löwe seine Tatze ohne weiteres herausstrecken konnte. Aus diesem Grunde war es auch verboten, zu nahe an das Gitter zu treten. Etwa zehn der stolzen Tiere lagen regungslos in verschiedenen Stellungen herum, sonnten sich behaglich und schenkten den sie bewundernden Menschen nicht die geringste Beachtung. William betrachtete sie aus ehrfurchtsvoller Entfernung, und Tommy hielt sich vorerst an seiner Seite. Aber sobald einer der Löwen nur das Haupt mit der mächtigen Mähne schüttelte, zuckte er zusammen.
Nach und nach schwand jedoch seine Furcht, und als dann der Captain von einem Bekannten gegrüßt und mit dem Vater in ein Gespräch gezogen wurde, schlich er sich hurtig zum Gitter hin. Es war doch zu dumm von diesen Löwen, dass sie nur so herumlagen und sich kaum bewegten. Wenn sich einer von ihnen doch endlich erhoben hätte! Aber keinem fiel es ein, dem jungen diesen Gefallen zu tun.
Da bückte sich Tommy nach einem Steinchen und warf es nach dem ihm am nächsten liegenden Tier. Der getroffene Löwe schlug sich nur lässig mit dem Schweif die Flanke, als gelte es, ein ihn belästigendes Insekt zu verscheuchen. Immerhin fasste er den Ruhestörer ins Auge und wandte den Blick nicht mehr von ihm. Der junge ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Er warf einen zweiten, dann einen dritten Stein.
Plötzlich stieß der Löwe ein fürchterliches Gebrüll aus und sprang mit einem gewaltigen Satz gegen das Gitter. Der Anprall seines schweren Leibes war so stark, dass Mörtel und Steinchen von der Mauer herunterfielen. Tommy krähte auf vor Entsetzen und kippte rücklings zu Boden, zum Glück so, dass ihn der zornige Löwe mit seinen Pranken nicht zu erreichen vermochte. Der Captain und Mr. Seagrave stürzten herbei und hoben den jungen auf, während der Löwe fletschend am Gitter stand.
Tommy zitterte am ganzen Leib. »Ich will aufs Schiff«, stammelte er und klammerte sich an die Beine des Vaters.
Der Captain wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. »Das hätte schlimm ausgehen können«, schalt er den Jungen.
»Ach, lieber Löwe, ich werde gewiss keine Steine mehr werfen«, sagte Tommy weinerlich, »ich verspreche es dir.«
Mr. Seagrave nahm ihn bei der Hand. »Ja ja, etwas zu versprechen, dazu bist du schnell bereit. Und ein paar Minuten später hast du es schon wieder vergessen.«
Diesmal war es Tommy doch nahegegangen. Er erholte sich von seinem Schrecken erst, als vom Löwenzwinger nichts mehr zu sehen war.
Als sie aufs Schiff zurückkamen und Mrs. Seagrave vernahm, in welcher Gefahr sich der Junge befunden hatte, versicherte sie immer wieder, sie werde ihn von nun an nie mehr aus den Augen lassen.
Am nächsten Morgen nahm die ›Pacific‹ frisches Wasser und Lebensmittel auf, dann wurden die Anker gelichtet, und das Schiff setzte bei günstigem Wind seine Fahrt fort. Es bestand alle Aussicht auf eine schnelle und glückliche Reise, bis plötzlich Windstille eintrat und volle drei Tage anhielt. Kein Lüftchen regte sich, spiegelglatt war die weite Fläche des Meeres. Die ganze Natur schien in Schlaf versunken zu sein. Nur dann und wann umflog ein Albatros das Schiff, um plötzlich aufs Wasser hinabzustoßen und einen über Bord geworfenen Brocken aufzuschnappen.
Am dritten Tag fiel das Barometer so tief, dass ein neuerlicher Sturm zu befürchten war. Der Captain traf alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um gerüstet zu sein. Und er hatte sich auch nicht getäuscht. Gegen Mitternacht türmten sich schwere Wolkenmassen am Himmel auf, die in allen Richtungen von Blitzen durchzuckt wurden. Dann erhob sich der Wind in einzelnen heftigen Stößen, um sich aber gleich darauf wieder zu legen.
»Was meinen Sie, Ready«, wandte sich Osborne an den neben ihm stehenden Zweiten Steuermann, »werden wir heute noch Wind abkriegen?«
»Ich glaube schon«, erwiderte der Alte, »doch wenn mich nicht alles täuscht, wird er nicht lange aus der gleichen Richtung wehen. Zuerst wird es scharf aus Norden blasen, dann aber wird der Wind umspringen und noch heftiger werden.«
»Und was sagen Sie, Mackintosh?«, fragte der Captain.
»Wir werden diesmal genug abbekommen«, antwortete der Schotte. »Der Sturm wird lange anhalten. je eher wir die toten Lichter schließen, desto besser wird es sein.«
William, der mit seinem Vater in der Nähe stand, erschrak über diesen noch nie gehörten, ihm unheimlich vorkommenden Ausdruck. Ready sah es und beruhigte ihn.
»Ach, Master William, du brauchst dich nicht zu ängstigen. ›Tote Lichter‹ heißen bei uns die Klappen, mit denen die Kajütenfenster geschlossen werden, damit kein Wasser eindringen kann, wenn das Schiff vor dem Winde segelt. Du erinnerst dich doch, dass wir beim letzten Sturm die Fenster auch geschlossen hatten. Jage nur mit diesem dummen Ausdruck deiner Mutter keine unnötige Angst ein.«
»Ich habe tatsächlich nicht an mich, sondern an Mama gedacht, die sich seit zwei Tagen gar nicht wohl fühlt.«
»Ready«, fragte der Captain wieder, »warum glauben Sie, dass wir Windwechsel haben werden?«
»Das kann ich nicht erklären, und vielleicht irre ich mich«, sagte Ready achselzuckend, wandte sich ab und ging zum Kompasshaus, um nach dem Stand der Nadel zu schauen. Mr. Seagrave und William stiegen in die Kajüte hinunter, und Mackintosh begab sich nach vorn, um den Matrosen seine Befehle zu erteilen.
Als Ready sah, dass Captain Osborne allein war, trat er wiederum zu ihm hin.
»Captain, ich habe vorhin meine Meinung nicht gesagt, weil Passagiere dabeistanden und ich sie nicht erschrecken wollte. Aber jetzt, wo die Küste klar ist, sage ich Ihnen, dass uns viel Schlimmeres als ein gewöhnlicher Sturm bevorsteht. Ich kenne mich in diesen Breiten aus und weiß ungefähr, wie es hier zugehen kann. Seit drei Tagen liegt etwas in der Luft, was nur auf einen Orkan hindeuten kann, und zwar auf einen Orkan, der lange anhalten wird. Ich habe die Vögel beobachtet, die irren sich nicht, denen sagt es ihr Instinkt. Drei Tage lang haben sich nun die Winde ausgeruht. Und wenn sie wieder zu blasen anfangen, dann werden sie das gründlich besorgen. Das ist meine Meinung, Captain.«
»Ich muss Ihnen beipflichten, Ready«, erwiderte Osborne mit ernster Stimme. »Wir dürfen keine Zeit verlieren, die kleinen Segel müssen alle gestrichen werden.«
Kaum waren die Befehle hierzu erteilt, als auch schon ein wütender Nordoststurm losbrach, der dem Schiff haushohe Wellen entgegenschleuderte. Obwohl die Matrosen in aller Eile Segel um Segel einholten, jagte die ›Pacific‹ im trüben Dämmerlicht pfeilschnell über das Wasser hin. Die Schläge, die die hochgehende See dem Schiff versetzte, waren so heftig, dass die Kraft dreier Männer kaum ausreichte, um das Steuerrad zu halten.
Sonderbarerweise fiel der Wind gegen drei Uhr morgens plötzlich ab, doch dauerte die unheimliche Stille nur wenige Minuten. Nach dieser kurzen Atempause brach der Sturm, wie Ready vorausgesagt hatte, aus einer ganz anderen Richtung auf das Schiff los, riss das Vordersegel in Fetzen und führte es mit sich fort; der Himmel war pechschwarz, und nur der milchweiße Schaum, der die Wogenberge krönte, verbreitete ein spärliches Licht.
Der plötzliche Windwechsel nötigte den Captain, den Kurs zu ändern und mit äußerster Vorsicht zu steuern. Dadurch stürmten nun aber die Wellen gegen die Seite des Schiffes, fegten darüber hin und rissen unter ihrem gewaltigen Druck alles mit sich fort. Sogar ein Matrose wurde über Bord gespült, und jeder Versuch, ihn zu retten, wäre sinnlos gewesen.
Osborne, auf die tanzende Kompassnadel niederstarrend, rief Mackintosh zu, wie lange das seiner Meinung nach noch dauern werde.
»Länger, als es das Schiff aushält«, gab der Schotte zur Antwort.
»Das wollen wir denn doch nicht hoffen. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Und Ihre Ansicht, Ready?«
»Vorläufig droht uns von oben größere Gefahr als von unten«, rief Ready und wies zu den Mastspitzen hinauf, die von elektrischen Lichtbüscheln, sogenannten Elmsfeuern, umsprüht waren. »Sehen Sie nur jene zwei Wolken, wie sie aufeinander zujagen! Wenn ich ...«
Er konnte den Satz nicht zu Ende sprechen, denn ein Blitzstrahl, so blendend, dass er die Männer für Augenblicke ihrer Sehkraft beraubte, zuckte hernieder, und gleichzeitig ließ ein furchtbarer Donnerschlag das Schiff in allen Fugen erbeben. Unmittelbar darauf erfolgte ein entsetzliches Krachen. Ein Ruck nach vorn, ein Schrei, und als die Männer wieder sehen konnten, entdeckten sie, dass der Blitz den Vormast zerschmettert und in Brand gesteckt hatte. Er loderte wie eine Fackel, und auch das Schiff hatte schon Feuer gefangen.
Die Leute am Steuer, geblendet und betäubt, vermochten dem Sturm nicht länger zu trotzen, das Schiff legte sich auf die Seite, der Hauptmast ging über Bord, überall herrschten zwischen Trümmern Verwirrung und Schrecken. Innerhalb einer Minute war aus dem schönen, stolzen Schiff ein brennendes Wrack geworden. Glücklicherweise wurde von den Sturzseen das Feuer bald gelöscht, sonst wären wohl alle verloren gewesen. Aber hilflos war der Schiffsrumpf den Wellen preisgegeben, die heftig gegen die leewärts am Tauwerk niederhängenden Massentrümmer schlugen und diese in einem fort an den Planken aufprallen ließen.
Sobald sich Ready und Mackintosh einigermaßen von der gewaltigen Erschütterung erholt hatten, kämpften sie sich durch Wasserfluten und über Trümmer zum Steuerrad hin, um zu versuchen, die ›Pacific‹ wieder vor den Wind zu bringen. Allein das Schiff, des Fockmastes und des Hauptmastes beraubt und durch den stehengebliebenen Besanmast einseitig beschwert, gehorchte nicht mehr. So überließ Ready das Steuer zwei Matrosen und gab Mackintosh durch Zeichen zu verstehen, er möge ihm folgen. So schnell sie konnten, gingen sie nach hinten, verschafften sich Axte und machten sich daran, durch mächtige Hiebe die Wanten des Besanmastes zu durchschlagen, bis dessen oberer Teil über Bord stürzte und durch diese Erleichterung des Hecks das Gleichgewicht wieder einigermaßen hergestellt war. Dann bemühten sie sich unter schier übermenschlichen Anstrengungen, das Schiff auch noch von den Trümmern des Hauptmastes zu befreien. Erst nachher machten sich Ready und Mackintosh daran, das Ausmaß der vom Sturm angerichteten Verwüstungen festzustellen. Dabei entdeckten sie im wilden Durcheinander der Trümmer vier Matrosen, die durch den Blitz und den niederstürzenden Fockmast getötet worden waren. Also waren außer dem Captain und dem Ersten und dem Zweiten Steuermann von der ganzen Mannschaft nur noch acht Leute am Leben.
Solange aber noch die kleinste Aussicht auf Rettung besteht, verlieren Seeleute den Mut nicht. Unverzüglich ließ Mackintosh die Besatzung antreten und wies dann jedem eine ganz bestimmte Arbeit an. Und mit vereinten Kräften gelang es schließlich, die schwer beschädigte ›Pacific‹ wieder flott zu machen. Am Stumpf des noch rauchenden Vordermastes wurde ein Notsegel gehisst, das vollauf genügte, um das Schiff, halbwegs gesichert, vor dem Sturm dahinschießen zu lassen.
Dann brach die Nacht herein; aber die Männer durften nicht an Ruhe denken, so sehr sie ihrer bedurft hätten. Man wusste ja nicht, was schon der nächste Augenblick bringen mochte, so dass jeder auf seinem Posten verharren musste. Nicht weniger schlimm war die Lage der Passagiere. Immer wieder stiegen der Captain und Ready in die Kajüte hinab, um den Verängstigten Mut zuzusprechen. Die ohnehin schwächliche Mrs. Seagrave war ernstlich erkrankt, ihr Mann wachte bei ihr. Die Kinder waren angewiesen worden, in ihren Betten zu bleiben, und die gute Juno hielt den kleinen, in einem fort wimmernden Albert unermüdlich in ihren Armen fest.
Zweites Kapitel
Die Abtrünnigen
Zum drittenmal seit Ausbruch des Sturmes dämmerte der Morgen herauf. Noch immer hielt der Orkan mit unverminderter Heftigkeit an. Von den stets von Neuem über das Schiff hinfegenden Sturzwellen war das Kompasshäuschen weggerissen und über Bord gespült worden, so dass nicht einmal mehr festgestellt werden konnte, wo man sich befand. Unter diesen Umständen war es ganz ausgeschlossen, einen bestimmten Kurs einzuhalten.
Das Gesicht des Kapitäns verriet größte Besorgnis. Er war siel darüber klar, dass das vielfach leck gewordene Schiff dem Anprall der Wogen auf die Dauer nicht Widerstand zu leisten vermochte. Was aber dann? Er trug ja nicht nur die Verantwortung für das Schiff und dessen Ladung, sondern auch für das Leben der Passagiere und der Mannschaft.
Nach Osbornes Berechnung befanden sie sich an einer Stelle wo das Meer mit Korallenriffen dicht durchsetzt war. »Die Sache gefällt mir gar nicht«, wandte er sich kopfschüttelnd an den vorbeigehenden Ready. »Der Sturm kann uns scho im nächsten Augenblick auf eine Klippe schleudern. Und wir sind dazu verurteilt, es einfach geschehen zu lassen.«
»Leider«, brummte Ready. »In dieser Ungewissheit ist nur eint gewiss. Was auch geschehen mag: wir stehen in Gottes Hand.
»Ja, Ready«, nickte der Captain ernst. Gleich darauf rief er:
»Aufgepasst, eine Welle!«
Der Alte hatte eben noch Zeit, sich an die Speichen des Steuerrades zu klammern, als auch schon ein riesiger Wellenberg auf das Schiff niederkrachte, sodass die beiden Männer den Boden unter den Füßen verloren. Aber sie hielten sich fest, bis der Wirbel über sie hinweg war.
»Dieses Sturzbad hat die ›Pacific‹ vermutlich ein paar weitere Planken gekostet«, meinte Ready, während er das Wasser von der Jacke klopfte.
»Vermutlich schon. Solche Stöße kann auch das beste Schiff auf die Dauer nicht aushalten. Wenn wir nur noch mehr Leute zur Verfügung hätten! Dann könnten wir wenigstens versuchen, etwas mehr Segel zu setzen.«
Während der ganzen Nacht flog das Schiff in der Finsternis vor dem Sturm dahin. Erst bei Tagesanbruch fiel der Wind ab. Sofort ging auch die See niedriger. Osborne benützte die Gelegenheit, um in aller Eile Notmasten aufrichten zu lassen.
Die Seeleute waren mitten in der Arbeit, als Mr. Seagrave und William auf Deck erschienen. Der Junge war starr vor Staunen über das Bild, das sich ihm bot. Was hatte sich da zugetragen? Wo waren die hohen Masten, wo die Segel und das ganze Takelwerk hingeraten? Entsetzt blickte er auf das wilde Durcheinander um sich herum.
Sobald Ready die beiden Passagiere gewahrte, trat er zu ihnen hin, um ihnen kurz mitzuteilen, was vorgefallen war. »Und dabei sind fünf unserer besten Matrosen ums Leben gekommen«, schloss er seinen Bericht. »Einen von ihnen, Jonathan, hat eine Sturzwelle über Bord geschwemmt.«
»Furchtbar!« entfuhr es Mr. Seagrave. William aber wollte wissen, wie nun das Schiff, ohne Masten und Segel, Sidney erreichen solle.
»Ja, Master William«, erwiderte Ready bedächtig, »wenn es Gottes Wille ist, dann werden die paar Notmasten mit ihren kleinen Segeln genügen, die unsere Leute eben zu setzen im Begriffe sind. Wir wissen aber nicht, was uns noch alles bevorsteht. Nach dem Nebel zu schließen, der sich da über dem Wasser zusammengebraut hat, haben wir den Sturm noch nicht hinter uns.«
»Da tut mir meine Frau leid«, seufzte Mr. Seagrave.
»Fühlt sie sich noch nicht besser?« erkundigte sich Ready. Mr. Seagrave machte eine abwehrende Handbewegung. »Ehe wir schöneres Wetter haben, wird sie sich nicht erholen können. Doch komm nun, William, es hat keinen Sinn, länger hier oben zu bleiben. Helfen können wir ja doch nichts, wir stehen den Matrosen bei ihren Arbeiten nur im Wege.«
Ready nickte ihm dankbar zu. »Es ist besser so. Wir sind zu sehr beschäftigt, als dass wir auf Sie und ihren William achtgeben könnten. Gute Nacht.«
»Das wünschen wir auch Ihnen, Ready!«, rief der Junge.
»Danke. Aber von uns wird heute keiner an Schlaf denken können«, meinte der Alte und entfernte sich.
Mr. Seagrave fasste seinen Sohn um die Schulter und ging mit ihm in die Kajüte hinab. Bereits auf der Treppe scholl ihnen Lärm und Geschrei entgegen. »Du meine Güte, was hat es da wieder gegeben!« Und schon stand Seagrave, auf Schlimmes gefasst, unter der Tür. Es war wirklich höchste Zeit, dass er gekommen war, um zu helfen.
Vor ein paar Minuten hatte der Koch für die Kinder eine Schüssel mit heißer Erbsensuppe gebracht, die von Juno, die den kleinen Albert auf dem Arm hielt, in Empfang genommen worden war. Aber Tommy hatte ihr in seinem Ungestüm die Schüssel aus der Hand gerissen und dabei einen Teil der heißen Suppe über Carolinchen geleert, das neben ihm im Bette saß und nun Zeter und Mordio schrie.
Als Seagrave unter die Tür trat, wollte Juno dem Mädchen eben zu Hilfe eilen, glitt aber aus und stürzte mit Albert zu Boden. Der Kleine heulte nun ebenfalls, obwohl ihm nichts geschehen war. Natürlich stimmte darauf auch der Dachshund Diana kräftig bellend in den Lärm ein, so dass sich Mrs. Seagrave, bleich vor Schrecken und an allen Gliedern zitternd, jammernd im Bette aufrichtete. »Gütiger Himmel, was ist da geschehen!«
»Es ist nur halb so schlimm«, rief ihr Mr. Seagrave zu. Schon hatte er die gute Juno und das Kind aufgehoben. Dann tröstete er die kleine Caroline und stellte mit Genugtuung fest, dass sie weiter keinen Schaden genommen hatte.
»Massa Tommy seien ein sehr, sehr unartiger Junge«, begehrte Juno auf, und Thomas sah in der bedrohlichen Nähe des Vaters ein, dass es diesmal am Klügsten war, zu schweigen. Um tüchtige Schelte kam er zwar nicht herum; doch als dann der Koch die ausgeschüttete Suppe aufgewischt hatte und Carolinchens und Alberts Tränen getrocknet waren, war die Ordnung soweit wieder hergestellt.
Inzwischen war es gelungen, auf Deck einen Notmast aufzurichten. Aber nun mussten die total erschöpften Leute unausgesetzt an den Pumpen arbeiten, damit das durch das Leck in den Schiffsraum eindringende Wasser nicht noch mehr anstieg. Wie Ready vorausgesagt hatte, erhob sich mit Einbruch der Nacht der Sturm wieder, und unter dem neuerlichen Anprall der Wogen leckte das Schiff immer mehr, so dass alle andere Arbeit vor dem Pumpen zurückstehen musste.
Zwei weitere Tage verflossen, ohne dass der Sturm nachließ. Das Wasser im Kielraum stieg so rasch, dass es ganz aussichtslos war, seiner noch Herr werden zu wollen. Zudem waren die Matrosen dermaßen erschöpft, dass schon aus diesem Grunde die Arbeit an den Pumpen aufgegeben werden musste. Aber die Trostlosigkeit der Lage wurde durch ein weiteres Unglück noch verschlimmert:
Als Captain Osborne auf dem Vorderdeck stand, wurde er von der plötzlich herunterstürzenden Rahe des Notsegels getroffen und zu Boden geschlagen, wo er besinnungslos liegenblieb. Osborne war bei seinen Matrosen beliebt gewesen, sie hatten seiner Tüchtigkeit vertraut und keinen Augenblick daran gezweifelt, dass er das Schiff retten werde. Und deshalb waren sie willig zum. äußersten Kräfteeinsatz bereit gewesen.
Jetzt aber, da er nicht mehr befehligte, überfiel Mutlosigkeit und Verzweiflung die todmüden Männer. Und als Mackintosh, der Erste Steuermann, die Führung des Schiffes übernahm, verweigerten sie ihm mit groben Worten den Gehorsam. Sie hatten den Schotten nie leiden können. So sehr er nun auch tobte, fluchte und schwere Strafen androhte, die Matrosen vermochte er damit nicht einzuschüchtern. Sie kümmerten sich keinen Pfifferling um seine Befehle, ließen ihn stehen und beratschlagten unter sich, wie sie sich auf eigene Faust helfen könnten.
Ready, den das Verhalten der Männer mit steigender Besorgnis erfüllte, trat zu ihnen hin, um sie zur Vernunft zu ermahnen.
»Der Sturm ist so gut wie vorüber, Leute, der Wind wird sich legen, und bald werden wir das schönste Wetter haben.«
»Mag sein«, entgegnete einer der Matrosen. »Aber wenn es soweit ist, schwimmt das Schiff nicht mehr.«
»Bestimmt, wenn ihr es sinken lasst. Vorwärts, ein tüchtiger Zug an den Pumpen täte uns jetzt gut«, fuhr Ready fort. »Also Leute, was meint ihr dazu?«
»Ein tüchtiger Zug Grog täte uns noch besser«, grinste der Wortführer der Matrosen. »Was haltet ihr davon?«, wandte er sich an die Kameraden. »Könnte der Captain noch sprechen, er würde gewiss nicht ›nein‹ sagen.«
»Seid ihr von allen guten Geistern verlassen?«, schrie Mackintosh dazwischen. »Ihr habt doch nicht etwa vor, euch zu betrinken?«
»Warum nicht?«, entgegnete ein anderer Matrose mürrisch. »Das Schiff geht ohnehin bald unter.«
»Und wenn auch«, polterte der Steuermann, »Grund genug, nicht länger als nötig darauf sitzenzubleiben. Oder ist euch vielleicht das Leben nicht lieber als das Schiff? Nun also! Da ist es wohl gescheiter, sich zu retten, als sich zu betrinken. Schaut mich nur an, als wäre ich vom Mond heruntergefallen. Wenn ihr euch betrinkt, so sind wir verloren, einer wie der andere. Kapiert? Bestimmt nun selber, was geschehen soll. Ich werde mich euerm Beschluss fügen, Männer. Aber betrinken? Nein, das gibt es nicht. Das werde ich mit allen Mitteln verhindern. Darauf könnt ihr euch verlassen.«
»Darf man wissen, wie Sie es verhindern wollen?«, fragte trotzig einer der Matrosen.
»Nun, wenn ihr keine Vernunft annehmt, dann eben mit Gewalt«, antwortete Mackintosh mit erhobener Stimme. »Wenn ihr es zum Äußersten kommen lasst, dann werde ich Ready und den Kajütenpassagier auf meiner Seite haben. Drei entschlossene Männer vermögen viel, besonders wenn sie wie wir im Besitze von Feuerwaffen sind. Aha, nun geht euch endlich ein Licht auf! Daran habt ihr wohl bisher nicht gedacht, dass sich alle Waffen in der Kajüte befinden? Was nützen euch da eure Messer gegen unsere Büchsen? Warum aber sollen wir uns streiten? Sagt offen heraus, was ihr zu tun gedenkt. Und wenn ihr unschlüssig seid, dann will ich euch einen Vorschlag machen. Wollt ihr mich anhören?«
So wenig beliebt Mackintosh bei den Leuten auch war, sein entschlossenes Auftreten imponierte ihnen. Sie zweifelten nicht daran, dass er Mut genug hatte, seine Drohung auszuführen. Und deshalb schien es ihnen klüger zu sein, es nicht auf eine Kraftprobe ankommen zu lassen. »Nun denn, was haben Sie uns vorzuschlagen?«
»Nach meiner Vermutung sind wir hier nicht weit von Inseln entfernt. Eine von ihnen zu erreichen sollte durchaus möglich sein. Außer der kleinen Jolle, die halb zertrümmert ist und uns nichts nützen kann, besitzen wir noch ein gutes Boot. Ich habe mich vorhin überzeugt, dass es ganz unbeschädigt ist. Selbst die Masten, Segel und Ruder sind noch in bester Ordnung. Dieses Boot wollen wir mit allem Nötigen ausrüsten. Wenn ihr dabei ein Glas Grog trinken wollt, nun, meinetwegen, ich bin kein Spielverderber. Vor allem aber wollen wir einen genügenden Vorrat davon mitnehmen. Wenn wir so einander helfen, müsste es seltsam zugehen, wenn wir uns nicht retten könnten. Ready, was sagen Sie zu meinem Vorschlag, ist er gut oder nicht, he?«
»Gegen Ihren Rat ist nichts einzuwenden, Mackintosh, was aber soll aus den Passagieren werden, aus den Frauen und Kindern? Und der Captain? Wollt ihr den einfach im Stich lassen?«
»Nein, unseren Captain lassen wir nicht im Stich«, rief ein Matrose.
»Niemals«, stimmten ihm die andern zu. »Unseren Captain nehmen wir mit, das ist ja klar.«
»Und die Passagiere, was soll mit ihnen geschehen?«, fragte Ready wieder.
»Die können wir unter keinen Umständen auch noch mitnehmen. Dazu ist das Boot zu klein«, erklärte der Matrose. »Sie tun mir ja leid«, fügte er dann brummend hinzu; »aber schließlich ist jeder sich selbst der Nächste. Wir haben genug zu tun, um uns selber zu retten.«
Die Leute schauten erwartungsvoll zu Mackintosh auf.
»Gut, ich bin mit euch einverstanden«, sagte dieser. »Es ist vernünftiger, dass wenigstens ein paar Leute sich retten, als dass alle miteinander aus lauter Barmherzigkeit untergehen. Sind wir also einig?«
»Jawohl«, riefen die Leute einstimmig. Ready sah ein, dass es zwecklos war, sie umstimmen zu wollen.
Mit großem Eifer gingen nun die Matrosen daran, das Boot auszurüsten, und der Zimmermann hieb ein Stück der Schanzverkleidung heraus, damit man es durch diese Lücke hinunterlassen konnte. Sobald es auf dem Wasser lag, wurden Schiffszwieback, gesalzenes Fleisch, einige Fässer Wasser und ein Fässchen Rum darin verstaut. Dazu kamen einige Gewehre sowie Pulver und Blei. Und Mackintosh brachte noch seinen Quadranten und einen Kompass.
An allen diesen Arbeiten war Ready unbeteiligt. Er untersuchte die Pumpen, um festzustellen, ob das Wasser im Kielraum immer noch steige, dann setzte er sich neben den weiterhin bewusstlos daliegenden Captain.
Als nach etwa einer Stunde das Boot zum Ablaufen fertig war, kam Mr. Seagrave auf Deck. Verwundert sah er erst dem geschäftigen Treiben der Matrosen zu, und schließlich fiel sein Blick auf Ready und den Captain. Eine böse Ahnung stieg in ihm auf:
»Um Gottes willen, was hat das alles zu bedeuten, Ready? Es sieht ja aus, als ob die Leute den Captain umgebracht hätten und sich nun anschickten, das Schiff zu verlassen!«