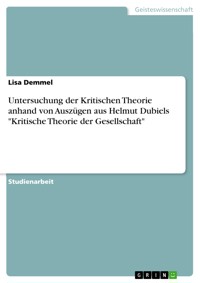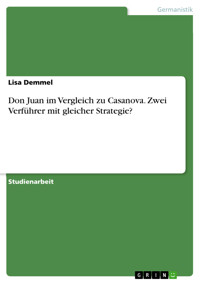Der Schluss, der "zu sehr aus der Stimmung fiel". Eine Analyse des ursprünglichen Endes Theodor Storms "Schimmelreiter" E-Book
Lisa Demmel
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Ludwig-Maximilians-Universität München, Sprache: Deutsch, Abstract: Ganze 50 Jahre lang begleitet die Thematik des Schimmelreiter-Stoffes Theodor Storm. Schon 1838 stößt der 21-jährige Student auf eine Deichsage mit dem Titel „Der gespenstige Reiter. Ein Reiseabentheur“. Die Geschichte ist in „Pappes Hamburger Lesefrüchten“ gedruckt worden und war eine Übernahme aus der Zeitschrift „Danziger Dampfboot“. Die Erzählung schildert eine Begegnung eines Kaufmannes mit einem unheimlichen Reiter auf einem weißen Pferd. In der sogenannten Wachtbude wird der Ich-Erzähler über die sonderbare Erscheinung aufgeklärt: Ein „einsichtsvoller und allgemein beliebter Mann aus ihrer Mitte [bekleidete] das Amt eines Deichgeschworenen“. Während seiner Amtszeit bricht jedoch eines Tages der Deich. Voller Verzweiflung „drückt [er] seinem Schimmel die Sporen in die Seiten, ein Sprung – und Roß und Reiter verschwinden in den Abgrund. – Noch scheinen beide nicht Ruhe gefunden zu haben, denn sobald Gefahr vorhanden ist, lassen sie sich noch immer sehen.“ Was sich zunächst wie der Schluss des Schimmelreiters selbst anhört, ist der Anstoß für Storms berühmteste und zugleich letzte Novelle. [...] Storm nimmt kurz vor der Publikation seines Werkes eine Veränderung vor: Er streicht „während der Arbeit an der Korrektur, genau: zwischen dem 24. Februar und 10. März 1888“11 eine kleine Szene aus dem Schluss. In einem Brief an den Verleger schreibt Storm, dass die Szene „zu sehr aus der Stimmung fiel“.[...] Fast 100 Jahre bleibt der ursprüngliche Schluss unbemerkt. [...] Zu Beginn werden die verschiedenen Quellenangaben und Motive beleuchtet, um die unterschiedlichen Erzähler einschätzen und damit den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen beurteilen zu können. Anschließend werden die beiden wichtigsten Motive, die Schimmelreitergestalt selbst und die Thematik des Deichopfers genauer beleuchtet, um so Storms Spiel mit Aberglaube und Vernunft, welches sich in den Erzählern und im Originalschluss widerspiegelt, aufzuzeigen. Danach werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Originalendes und des veröffentlichten Schlusses festgehalten. Erst daraufhin kann man sich der Ausgangsfrage nähern. Um die Streichung möglichst genau erläutern zu können, müssen zur Differenzierung beide Seiten betrachtet werden: Gründe für die Tilgung aber auch Gründe für die Beibehaltung der Schlussszene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsangabe
1. Einleitung
2. Der ursprüngliche Schluss
3. Die verschiedenen Quellenangaben
3.1. Der Schulmeister
3.2. Die Wirtschafterin Antje Vollmers
3.3. Die anwesenden Dorfbewohner und der Deichgraf
3.4. Der Dienstjunge Carsten und Frau Vollina
3.5. Der Ich-Erzähler
4. Aberglaube und Vernunft
4.1. Die Schimmelreitererscheinung
4.1.1. Der mysteriöse Reiter am Anfang
4.1.2. Die sachliche Erklärung des Schulmeisters
4.1.3. Die Funktion des Schimmelreiters
4.2. Das Deichopfer
4.2.1. Das Bauopfer
4.2.2. Hauke als menschliches Deichopfer
5. Gründe für die Beibehaltung des ursprünglichen Schlussteils
5.1. Carsten als Quellenangabe
5.2. Unterstreichung des Mysteriösen der Schimmelreitergestalt im ersten Teil der ursprünglichen Schlussszene
5.3. Konsequente Fortsetzung des bisher Erzählten im zweiten Teil der ursprünglichen Schlussszene
6. Das übernommene Motiv des „Pferdsgerippes“
7. Gründe für die Streichung des ursprünglichen Schlussteils
7.1. Die fehlende Knappheit
7.2. Die fehlende Nüchternheit
7.3. Das Zerstören der Stimmung
8. Fazit
9. Literatur- und Quellenangabe
1. Einleitung
„Jetzt spukt eine gewaltige Deichsage, von der ich als Knabe las, in mir […].“[1]
- Theodor Storm an Tochter Lisbeth
Ganze 50 Jahre lang begleitet die Thematik des Schimmelreiter-Stoffes Theodor Storm. Schon 1838 stößt der 21-jährige Student auf eine Deichsage mit dem Titel „Der gespenstige Reiter. Ein Reiseabentheur“[2]. Die Geschichte ist in „Pappes Hamburger Lesefrüchten“ gedruckt worden und war eine Übernahme aus der Zeitschrift „Danziger Dampfboot“.[3]Die Erzählung schildert eine Begegnung eines Kaufmannes mit einem unheimlichen Reiter auf einem weißen Pferd. In der sogenannten Wachtbude wird der Ich-Erzähler über die sonderbare Erscheinung aufgeklärt: Ein „einsichtsvoller und allgemein beliebter Mann aus ihrer Mitte [bekleidete] das Amt eines Deichgeschworenen“.[4]Während seiner Amtszeit bricht jedoch eines Tages der Deich. Voller Verzweiflung „drückt [er] seinem Schimmel die Sporen in die Seiten, ein Sprung – und Roß und Reiter verschwinden in den Abgrund. – Noch scheinen beide nicht Ruhe gefunden zu haben, denn sobald Gefahr vorhanden ist, lassen sie sich noch immer sehen.“[5]Was sich zunächst wie der Schluss des Schimmelreiters selbst anhört, ist der Anstoß für Storms berühmteste und zugleich letzte Novelle.
Die anhaltende Wirkung dieser Deichsage auf Storm scheint enorm, denn erst 1885, rund 47 Jahre nach seiner Entdeckung, wagt sich der mittlerweile 67-Jährige an die erste Konzeption seines Schimmelreiters.[6]Weitere eineinhalb Jahre vergehen, bis er weitestgehend alle Vorstudien der Thematik des Deichstoffes abgeschlossen hat, sodass er erst Mitte 1886 mit der Niederschrift beginnen kann.[7]Für die Novellen Ein Doppelgänger sowie Ein Bekenntnis unterbricht Storm die Arbeit an der Novelle. Eine anschließende schwere Rippenfellentzündung fesselt den Schriftsteller zunächst ans Bett. Als sich Storm Anfang Mai 1887 erneut dem Schimmelreiter widmet, wird eine langwierige Erkrankung als Magenkrebs diagnostiziert. Angesichts des baldigen Todes „überließ [er] sich tiefster Schwermut, so daß alle sahen, er würde den 'Schimmelreiter' […] nicht vollenden“[8]. Einzig eine Lüge seines Bruders Emils, von Beruf Arzt, gibt Storm neue Lebenshoffnung und den Antrieb, die Arbeit am Schimmelreiter wieder aufzunehmen. Emil versichert ihm nämlich nach einer Scheinuntersuchung, dass seine Magenschmerzen harmlos seien. „Das Meisterwerk, mit dem er sein Künstlerleben krönte, ist [also] ein Produkt barmherziger Illusionierung.“[9]
Trotz der anhaltenden Schmerzen schafft Storm täglich Fortschritte am Schimmelreiter. Die Begeisterung dieses Sagenstoffes ist so groß, dass er trotz Unterbrechungen schon ein Jahr später das Werk fertigstellen kann. Im Februar 1888 beendet er die Reinschrift der Novelle und schickt sie an seine Verleger, die Gebrüder Paetel. Im April- und Mai-Heft des gleichen Jahres der Deutschen Rundschau wird der Schimmelreiter zum ersten Mal veröffentlicht. Den Druck der Buchausgabe erlebt Storm nicht mehr, sie erscheint erst nach seinem Tod.[10]
Storm nimmt kurz vor der Publikation seines Werkes eine Veränderung vor: Er streicht „während der Arbeit an der Korrektur, genau: zwischen dem 24. Februar und 10. März 1888“[11]eine kleine Szene aus dem Schluss. In einem Brief an den Verleger schreibt Storm, dass die Szene „zu sehr aus der Stimmung fiel“.[12]Wenngleich Storm zu Pausen gezwungen und gesundheitlich geschwächt war, nimmt der Leser den Korrekturvorgang nicht wahr. Nahtlos sind die Übergänge der verbliebenen Schlussteile.
Fast 100 Jahre bleibt der ursprüngliche Schluss unbemerkt. Die Reinschrift beziehungsweise Urfassung wird in der Kieler Landesbibliothek aufbewahrt.[13]Erst 1981 verfasst Karl Ernst Laage einen Beitrag über eben diesen in einem Band der Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft und macht so auf das ungekürzte Ende aufmerksam. Trotz Laages Neuentdeckung und seiner kurzen Analyse der Gründe für diese Veränderung, bleibt der Schluss in der Storm-Forschung dennoch weitgehend unbeachtet. Zu ungenau wurde die nun fehlende Passage analysiert. Daher wird diese Arbeit nun näher auf das ursprüngliche Ende von Storms Schimmelreiter eingehen und versuchen der Frage auf den Grund zu gehen, warum die Schlussszene aus der Stimmung und somit auch aus dem Schimmelreiter fiel.