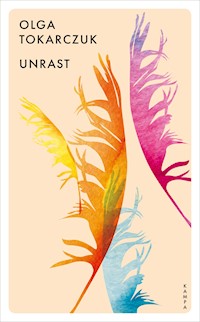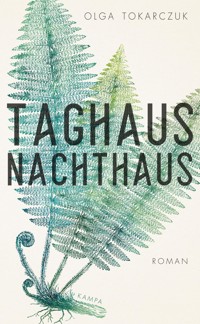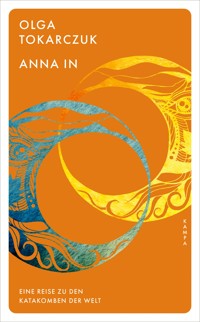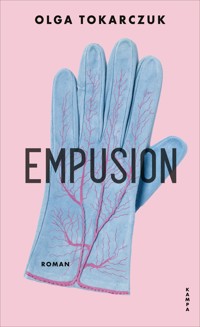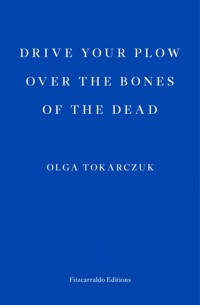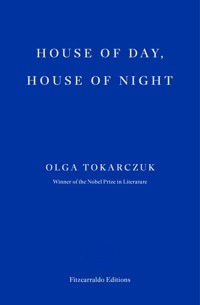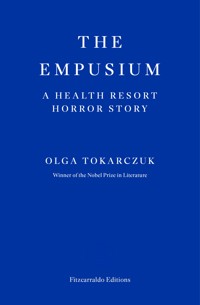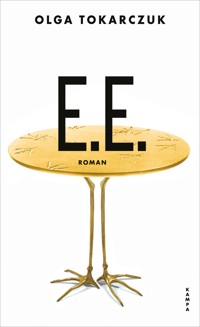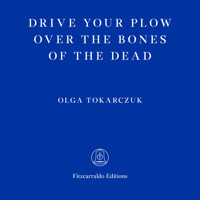Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gatsby
- Sprache: Deutsch
Ein junges Paar sucht Zuflucht in einem Schrank und findet eine Gegenwelt zur eintönigen Wirklichkeit. Während seineFrau sich der Meditation widmet und hin und wieder etwas Leichtes zu essen kocht, spielt D. am Computer Gott, erschafft und vernichtet Menschen, bis schließlich rings um ihn alles aus den Fugen gerät. Was die Unordnung eines verlassenen Hotelzimmers über einen Menschen erzählt, das weiß das Zimmermädchen mit der rosa-weißen Schürze im Hotel Capital. Chaos erfährt auch die kleine Bankangestellte Krystyna, die im Traum wiederholt den Liebesschwüren eines gewissen Amos lauscht, bis sie sich schließlich auf die Suche nach ihm macht.Liebe und Tod, Traum, Mythos und Wirklichkeit - die in diesem Band versammelten sieben Geschichten der polnischen Literaturnobelpreisträgerin erzählen von einer Welt, die uns in all ihrer Fremdheit doch immer vertraut ist: unser Unbewusstes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Olga Tokarczuk
Der Schrank
Erzählungen
Aus dem Polnischen von Esther Kinsky
Gatsby
Der Schrank
Als wir hier einzogen, kauften wir den Schrank. Er war dunkel und alt und kostete weniger als der Transport vom Geschäft zu unserem Haus. Er hatte zwei Türen, die mit einem Pflanzenornament verziert waren, die dritte Tür war aus Glas, und in der Scheibe spiegelte sich die ganze Stadt, als wir ihn mit einem gemieteten Lieferwagen nach Hause brachten. Wir mussten eine Kordel um den Schrank binden, damit sich die Türen während der Fahrt nicht öffneten. Damals, als ich mit der verknoteten Kordel vor dem Schrank stand, hatte ich zum ersten Mal dieses Gefühl der Unsinnigkeit meiner Existenz. »Er passt gut zu unseren Möbeln«, sagte R. und strich zärtlich über den hölzernen Körper des Schranks, ganz so, als handele es sich um eine Kuh, die man für den neuen Hof gekauft hat. Zuerst stellten wir ihn im Flur auf. Das sollte seine Quarantäne sein, bevor er in die Welt unseres Schlafzimmers eingelassen wurde. Ich spritzte Terpentin in die kaum sichtbaren Löcher, eine zuverlässige Impfung gegen den Zahn der Zeit. In der Nacht gab der an seinen neuen Ort verpflanzte Schrank knarrende Seufzer von sich. Die sterbenden Holzwürmer klagten.
Im Laufe der nächsten Tage räumten wir in unserer neuen alten Wohnung auf. In einer Fußbodenritze fand ich eine Gabel mit einem eingravierten Hakenkreuz auf dem Griff. Hinter der Holztäfelung sahen die Reste einer alten vergilbten Zeitung hervor, das einzige noch lesbare Wort war Proletarier. R. öffnete das Fenster weit, um die Gardinen aufzuhängen, und der Lärm der Bergmannskapellen, die gegen Abend durch die Stadt zogen, drang ins Zimmer. In der ersten Nacht, in der der Schrank unsere Träume mit uns teilte, konnten wir lange nicht einschlafen. R.s Hand fuhr schlaflos über meinen Bauch. Von da an hatten wir gemeinsame Träume. Wir träumten von einer absoluten Stille, einer Stille, in der alles schwerelos wie eine Schaufensterdekoration hing und in der wir glücklich waren, denn wir waren nirgendwo gegenwärtig. Am Morgen brauchten wir uns diesen Traum gar nicht erst zu erzählen – es reichte ein einziges Wort. Danach erzählten wir einander unsere Träume nicht mehr.
Eines Tages war es so weit, dass es in unserer Wohnung nichts mehr zu tun gab. Alles stand an seinem Platz, war sauber und ordentlich. Ich wärmte mir den Rücken am Ofen und betrachtete meine Servietten. In deren Webmuster herrschte allerdings keine Ordnung. Jemand hatte mit der Häkelnadel Löcher in die geschlossene Materie gestochen. Durch diese Löcher blickte ich auf den Schrank, und mir fiel jener Traum wieder ein. Vom Schrank ging diese Stille aus. Wir standen einander gegenüber, und ich war es, die zerbrechlich, unbeständig und vergänglich war. Der Schrank hingegen stellte einfach sich selbst dar. Auf eine vollkommene Weise war er das, was ist. Ich berührte mit den Fingern den blank gegriffenen Türknauf, und der Schrank tat sich vor mir auf. Ich sah die Schatten meiner Kleider und der beiden abgewetzten Anzüge von R. Im Dunkeln hatte alles ein und dieselbe Farbe. Im Schrank unterschied sich meine Weiblichkeit in nichts von R.s Männlichkeit. Es war auch ganz unwesentlich, ob etwas glatt oder rau, oval oder eckig, fern oder nah, fremd oder vertraut war. Es roch nach anderen Orten und einer anderen Zeit, die mir fremd war. Aber mein Gott – es erinnerte mich trotzdem an etwas so Bekanntes, so Vertrautes, dass mir die Worte fehlten, um es beim Namen zu nennen. (Die Worte brauchen Abstand, um etwas benennen zu können.) Meine Gestalt trat in den Raum, der vom Spiegel auf der Innenseite der Tür reflektiert wurde. Ich spiegelte mich als dunkler Umriss, der sich kaum von einem Kleid auf dem Kleiderbügel unterschied. Es gab keinen Unterschied zwischen dem Lebenden und dem Leblosen. Das war ich – in dem einen Spiegelauge des Schranks. Jetzt musste ich nur den Fuß heben und in den Schrank steigen. Das tat ich. Ich setzte mich auf die Tragetaschen mit Wollresten und hörte meinen eigenen Atem, der in dem abgeschlossenen Raum lauter und tiefer wirkte.
Wenn das Denken ganz mit sich allein gelassen ist, verfällt es in ein Gebet. Das ist von Natur so. »Gottesengel, Schutz und Schild« – dabei sah ich meinen Engel vor mir, und sein Gesicht war so schön, dass er tot sein musste; »steh mir immer bei …« – seine wächsernen Flügel legen sich liebevoll um den Raum, der mich umschließt; »am Morgen« – Kaffeegeruch und blanke Fenster, die den verschlafenen Augen wehtun; »am Abend« – die langsamer werdende Zeit, wenn die Sonne untergeht; »am Tag« – das Sein wird identisch mit Erleben, Lärm, Bewegung, tausend Tätigkeiten ohne Bedeutung; »in der Nacht« – der kraftlose, in der Dunkelheit vereinsamte Körper; »sei mir immer zur Seite« – der Engel, der die Kinder behütet, die am Abgrund gehen; »behüte und beschütze meinen Körper und meine Seele« – Pappkartons mit der Aufschrift VORSICHT: ZERBRECHLICH; »und führe mich zum ewigen Leben, Amen« – die Kleider, die im Halbdunkel des Schrankes hängen.
Von diesem Zeitpunkt an zog mich der Schrank jeden Tag in sich hinein, er war ein großer Trichter in unserem Schlafzimmer. Anfangs verbrachte ich die Spätnachmittage, wenn R. nicht zu Hause war, im Schrank sitzend. Dann erledigte ich morgens nur die allernötigsten Dinge – Einkäufe, Einschalten der Waschmaschine, das ein oder andere Telefonat – und stieg gleich darauf in den Schrank, wobei ich die Türe immer leise hinter mir zuzog. Drinnen spielte es keine Rolle, welche Tageszeit, welche Jahreszeit, welches Jahr es war. Es war immer samten. Ich ernährte mich von meinem eigenen Atem.
Eines Nachts wachte ich aus einem Traum auf, der schwer wie stickige Gewitterluft gewesen war, und ich hatte Sehnsucht nach dem Schrank wie nach einem Mann. Ich musste meine Arme und Beine um R.s Körper klammern und mich krampfhaft an ihm festhalten, um im Bett zu bleiben. R. sagte etwas im Schlaf, aber seine Worte waren ohne jeden Zusammenhang. Und eines Nachts schließlich weckte ich ihn. Er wollte das warme Bett nicht verlassen. Ich zog ihn hinter mir her, und wir blieben vor dem Schrank stehen. Er war unveränderlich, mächtig und verlockend. Ich berührte mit den Fingern den abgegriffenen Türknauf, und der Schrank tat sich vor uns auf. Darin war genug Platz für die ganze Welt. Der Innenspiegel zeigte unsere Umrisse, er löste unsere beiden Gestalten aus dem Dunkel. Unsere Atemzüge, die anfangs abgehackt und unregelmäßig gewesen waren, fanden einen gemeinsamen Rhythmus, und es gab keinen Unterschied zwischen ihnen. Wir saßen im Schrank einander gegenüber. Die hängenden Kleidungsstücke verdeckten unsere Gesichter. Der Schrank schloss die Tür hinter uns. So wurden wir darin wohnhaft.
Anfangs ging R. noch nach draußen, um Dinge zu erledigen – zum Einkaufen, zu irgendwelchen Arbeiten und dergleichen. Aber danach wurden diese Gänge zu quälend und anstrengend. Die Tage wurden länger. Von der Straße drang manchmal die gedämpfte Musik der Bergmannskapellen bis zu uns. Die Sonne geht und kommt wieder, und die Fenster versuchen erfolglos, sie hereinzuziehen. Über Möbel, Servietten und Geschirr breitet sich eine immer dickere Schicht Staub, und unsere Wohnung versinkt immer weiter in der Dunkelheit.
Deus Ex
D. war ein echtes Computergenie, lebte allerdings von der Sozialhilfe. Manchmal nahm er einen Auftrag an, das aber nur deshalb, um seine Wohnung nicht verlassen zu müssen, sein kleines vollgestopftes Zimmer und diesen Platz vor dem Altar der Tastatur, an dem sich das Leben abspielte. Sein Leben und das der gesamten Welt.
Als Erstes machten immer seine Augen schlapp. Sie begannen zu brennen und zu tränen, und er stand unwillig auf und trat ans Fenster, vor dem sich draußen in der Tiefe eine belebte schmale Straße auftat. Die Erde war von der Sommerhitze ausgedörrt, und von der Straße stieg Staub auf, der sich mit den Abgasen vermischte. In seinem Raum richtete D. die erschöpften Augen wie Flügel wieder gerade. Er sah nur die Wand des gegenüberliegenden Mietshauses und ein rechteckiges Fenster, hinter dem sich manchmal ein Schatten bewegte. Unten in der Tiefe schoben sich die verwaschenen, blassfarbenen Autos vorbei. Das war mehr oder weniger das, was D. sah, wenn er aus seinem Fenster schaute, aber für ihn hatte dieser Anblick die gleiche Konsistenz wie ein Traum – verwischt, zusammenhanglos, alogisch. Sein Blick hielt sich nicht mit Einzelheiten auf, verweilte nicht bei der Form des Simses oder den Zügen eines menschlichen Gesichtes auf der anderen Seite der Scheibe. D. schaute nur.
»Das ist eine Sinnestäuschung, ein Traumgespinst«, sagte seine langhaarige Frau, die Buddhistin, als sie gemeinsam ihren Salat aßen. In ihrer Stimme schwang immer der Singsang kindlicher Abzählreime mit, vor allem dann, wenn sie ihren Lieblingssatz anstimmte:
»Ich bin ich, du bist du …«
Dieser Satz hatte keinen Schluss.
D. begann erst etwas zu sehen, wenn er sich vor den Bildschirm seines Computers setzte. Dann hatte er eine Ordnung vor sich, eine unendliche Harmonie, die Einfachheit von Wegen, die zum Ziel führen, die Klarheit der Wahl, ein ungeheures Potenzial an Gedanken. Sofort empfand er eine Ruhe, wie sie sich einstellt, wenn man das Bewusstsein gewinnt, frei zu sein. Innerhalb gewisser Grenzen. Aber kann man überhaupt von Grenzen sprechen, wenn man Welten erschafft?
Denn das war es, was D. tat – er schuf Welten. Er begann mit der Erschaffung von Städten. Zuerst waren es kleine Städte mit Märkten voller kleiner Buden, dann große Metropolen. Das Programm bewährte sich besser bei großen Städten, deren Grenzen sich unmerklich dem Gedächtnis entziehen. Ganz besonders gerne schuf er Städte am Rand des Meeres, Hafenfenster in die Welt, mit etlichen Docks, Werften und Kränen. Er begann immer mit der Elektrifizierung des Gebietes, zog ein Hochspannungsnetz und baute sichere Kraftwerke. Dann errichtete er Fabriken, stets in Gedanken bei den Menschen, die er bald hier einziehen lassen würde. Menschen brauchen Arbeit. Seine Wohnsiedlungen waren hübsch gelegen und umweltfreundlich. Er hatte eine eindeutige Vorliebe für Einfamilienhäuser, ohne eine einzige große Betonplatte. Er dachte an Kläranlagen, Müllverwertung und all die notwendigen Dinge, die in der verwaschenen Illusion draußen vor dem Fenster fehlten.
Die innere Zeit des Computers rechnete in Monaten und Jahren, und die Bewohner seiner Städte vermehrten sich und wurden älter. Er baute ihnen Sportstadien und Vergnügungsparks, wo sie sich nach Herzenslust die Zeit vertreiben konnten. Seine Städte wurden größer und wuchsen ins Riesenhafte. D. hatte sich schon daran gewöhnt, dass die Vorstädte ab einem gewissen Zeitpunkt verwahrlosten und die allgemeine Harmonie störten, er musste auf sie besonders achtgeben. Es war ein innerer Prozess, der sich von der Existenz der Stadt nicht trennen ließ. Städte altern. Die Menschen im Computer waren mit einem Instinkt ausgestattet, der ihnen befahl, die Städte zu verlassen, wenn sich deren Untergang ankündigte. Wohin gingen sie dann? An irgendeinen anderen Ort, wo sie in einem Schwebezustand ausharren konnten und darauf warteten, dass D.s Finger ihnen eine neue Existenz verliehen.
Immer war das gleiche Prinzip wirksam: Die sich selbst und einer künstlichen, inneren Zeit überlassenen Städte, die nicht in Ordnung gehalten und in Stand gesetzt wurden, verwahrlosten und fielen, getreu der allgegenwärtigen und unsterblichen Entropie, dem Verderben anheim. Je mehr Zeit und Mühe D. auf eine Struktur verwandte, desto leichter bemächtigte sich ihrer der Zerfall. Die Kläranlagen verstopften, die Parks wurden zu Verbrechervierteln, die Sportstadien zu Gefängnissen und die Strände zu Friedhöfen ölverseuchter Vögel.
Müde und enttäuscht entließ D. dann Stürme, Feuersbrünste und Überschwemmungen, Ratten- und Heuschreckenplagen auf seine Städte.
Während D. seine Städte schuf und dann – aus trauriger Notwendigkeit – vernichtete, gab sich seine Frau im Nebenzimmer endlosen Meditationen hin, die sie nur von Zeit zu Zeit unterbrach, um eine leichte Mahlzeit zuzubereiten und die Dinge an ihren Platz zu rücken. Jede Bewegung, die sie ausführte, war praktizierter Zen in der Kunst des Haushalts. Manchmal stellte sie sich hinter ihn und sah zu, wie er Städte schuf (und vernichtete), aber auch dann hörte D., wie sie Bauchatmung übte. Abends ging sie zwei Stunden arbeiten. Sie putzte in einem Geschäft voller begehrenswerter Luxusgegenstände, auf denen ihr Blick aber nicht einmal verweilte. Sie putzte den Fußboden systematisch und gründlich, es war eine Zenübung in der Kunst des Ladenputzens.
»Liebst du mich?«, hörte er abends ihre Singsangstimme, wenn sie im Bett auf ihn wartete.
Dann drückte er die Taste ESCAPE, und auf dem Bildschirm erschienen zwei Fensterchen mit den Worten JA und NEIN. Er klickte JA, und mit einem leisen Schnurren bereitete der Computer die Welten auf den Schlaf vor.
Als ihn die Städte endgültig langweilten, besorgte sich D. ein Programm, das er sich schon lange gewünscht hatte. Es hieß SemiLife und simulierte die Evolution der Welt.
D. bekam einen jungen, vom urzeitlichen Ozean überschwemmten Planeten. Im Urozean schwammen Aminosäuren wie Abfall herum. Damit fing es an. In diesem Spiel gab es keinen Zufall. Es gab D.
Jetzt verbrachte er die Tage damit, Aminosäuren mit Eiweiß zu verbinden, nach rechts und nach links zu drehen, Druck und Temperatur zu erhöhen oder zu senken. Er ließ Blitze auf die Wasseroberfläche schlagen. Da ihn die Neugier trieb, beschleunigte er die Zeit. Am Abend, als seine langhaarige Frau zur Arbeit gegangen war, entstanden die ersten Einzeller. In der Nacht erschienen die ersten primitiven Amphibien auf dem Festland. Am Morgen beherrschten Reptilien die Welt. Er wusste, wie es weiterging, deshalb zerstörte er den Planeten.
»Wollen Sie SemiLife verlassen? JA/NEIN«, fragte der Computer.
D. klickte auf JA und trat ans Fenster, wo ihm verschwommen die in der Illusion befangene Straße erschien. Zum ersten Mal sah D., dass der Verfall an der Illusionsstadt mit demselben Erfolg nagte wie an seinen Städten. Graue, abgemagerte Tauben saßen auf den Simsen, von denen der Putz abblätterte. Seit einem Monat hatte es nicht geregnet. Die gelbe Wolke der Abgase stieg zum Himmel auf wie die Seele eines gerade Verstorbenen.
»Liebst du mich?«, fragte ihn der Computer im Schlaf.
Da bemerkte D., dass auf der Tastatur die zusätzliche Taste ICHWEISSNICHT erschienen war. Als er sie drückte, wachte er auf. Die Frau, die jede Nacht bei ihm lag, hatte ein schönes und ruhiges Gesicht. Ihre Augen betrachteten das vollkommene Antlitz der Leere.
In dieser Nacht schuf D. einen Menschen. Es war ein schwacher, geschlechtsloser Mensch. Er hatte Pfoten, ein Vogelgesicht und Augen ohne Pupillen. D. betrachtete aufmerksam das chaotische Leben, das in der beschleunigten Computerzeit verfloss. Ein Leben, das erfüllt war von Nahrungssuche und ewiger Angst. Deshalb erkannte D. voll Bedauern, dass er den Menschen vernichten und noch einmal ganz von vorn anfangen musste. Er schickte also eine Sintflut und Feuerregen, denn etwas Besseres fiel ihm nicht ein. Aber das schwächliche Wesen überlebte irgendwie, und D. quälte sich mit Schuld- und Mitleidsgefühlen.
Er machte sich einen Kaffee und spürte dessen Bitterkeit genau in dem Augenblick auf der Zunge, als das verwaschene Morgengrauen begann, durch das Fenster in sein Zimmer zu sickern.
Er hörte auf, in das Leben des von ihm erschaffenen geschlechtslosen Wesens einzugreifen und sah, wie das Verderben wellenweise in das unbeirrt weiterlaufende Programm schwappte. Die Menschen kämpften miteinander um ihre eingebildeten Reichtümer, um wirre Ideen, um Frauen, Bauwerke und Friedhöfe. In der Zeit, in der er eine Zigarette rauchte, waren in der inneren Welt des Computers mehrere Kriege entflammt und verloschen. Durch die verödeten Streifen der Welt bewegten sich ganze Stämme, wanderten Völker, die ihrer Länder beraubt waren. D. schlief auf dem Stuhl vor seinem Bildschirm ein, und als er aufwachte, gab es im SemiLife-Programm schon keine Lebewesen mehr. Leere Zeit verrann, untermalt vom Summen des Computers.
»Möchten Sie noch einmal spielen? JA/NEIN«, fragte der Bildschirm hellblau.
»NEIN.«
Die nächste Woche über arbeitete D. an einem neuen Programm, dem er die Gelegenheit geben wollte, alles wieder einzurenken. Gleich zu Anfang musste er die Neigung zu Zerfall und Verderben ausschalten. In diesem Spiel würde man die Welt von Anfang an erschaffen können, noch einmal, fehlerfrei. Er nannte es SemiUniverse.
Am Sonntag spielte er das Spiel zum ersten Mal.
»Sieh mal«, sagte er zu seiner Frau, die sich auf die Stuhllehne gesetzt hatte und die Finger zu einer heilenden Gebärde zusammenlegte. »Das hier ist das Nichts, und darin ist alles in unendlicher Menge enthalten.«
Und sie warteten den ganzen Tag und die ganze Nacht, aber das Nichts wollte sich nicht weiterentwickeln, denn es war vollkommen. D. trat ans Fenster und schaute von oben auf die Tauben, die von den Abgasen und vom Durst ganz niedergedrückt waren.
»Mache nichts mehr«, sagte seine Frau und blickte ihn unter ihren halbgeschlossenen Augenlidern an. »So ist es gut, soll es so bleiben.«
»Bist du sicher, dass du das Licht nicht vom Dunkel scheiden willst? JA/NEIN«, fragte der Computer.
»JA und NEIN«, antwortete D.