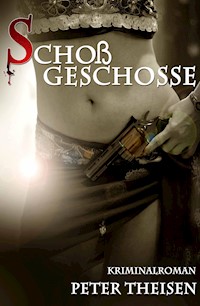7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pedro ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Von einer Reise nach Süd- und Mittelamerika erhofft er sich Antworten auf drängende existenzielle Fragen: Was ist meine Lebensaufgabe? Wie führt man ein glückliches Leben? Wie funktioniert die Liebe? Seine Reise führt ihn von der Copacabana bis in den tiefsten Amazonas. Dabei erlebt er viele Abenteuer, die er in Nachrichten an einen Freund äußerst lebendig schildert. Durch den ständigen Wechsel zwischen der distanzierten Erzähler- und der sehr persönlichen Ich-Perspektive lernt der Leser Pedro auf seiner Reise immer wieder neu kennen. Ein zugleich lehrreicher wie spannender Roman über Lateinamerika und den Sinn der Lebensreise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Peter Theisen
Der Sinneswandler
Unterwegs in Lateinamerika
© 2019 Peter Theisen
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-4344-1
Hardcover:
978-3-7482-4345-8
e-Book:
978-3-7482-4346-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für meine Eltern
Vorbemerkung zur 1. Auflage
Liebe Leserin! Lieber Leser!
Sie halten die erste Auflage des Romans „Der Sinneswandler“ in Ihren Händen. Das freut mich! Ich hoffe, dass Sie das Buch mit Vergnügen und Gewinn lesen werden. Vermutlich wird diese erste Fassung nur in kleiner Auflage erscheinen und nur für kurze Zeit als E-Book.
Der Grund: ich möchte weiter daran arbeiten. Ich würde mich daher über Kritik und Anregungen sehr freuen. Vielleicht reist Pedro dann in einer zweiten, verwandelten Auflage noch sinnerfüllter durch Lateinamerika. Schreiben Sie mir einfach!
In diesem Sinne! Viel Spaß beim Lesen!
Peter Theisen
Wiesbaden
Es regnete. Kein feiner Nieselregen, sondern dicke, schwere Tropfen fielen aus der grauen Wolkenschicht. Zwei Schritte vor die Tür, und schon spürte Pedro diese unangenehme, kalte Nässe auf seiner Haut. Noch ein paar Meter zum Fahrrad, das die ganze Nacht draußen gestanden hatte. Pedro suchte in seiner Hosentasche nach einem Tempotaschentuch. Während er den Sattel trocken rieb, und dann den Lenker, sah er, dass das keinen Sinn machte. Es prasselte so vom Himmel herab, dass alles gleich wieder nass war. Also setzte er sich auf den feuchten Sattel und radelte los.
Das Kopfsteinpflaster im Westend rüttelte ihn durch und war zudem gefährlich schmierig. Seine Jeans waren schon nach wenigen Metern durchnässt. Die Kapuze des Anoraks hatte er sich bis weit über die Stirn gezogen. Sein Gesichtsfeld war stark eingeschränkt. Egal, da musste er noch einmal durch. Auch durch die Pfützen, deren aufspritzendes Braun seine Schuhe einfärbten.
Warum muss diese blöde Ampel immer auf Rot springen, wenn ich gerade ankomme, ärgerte sich Pedro. Wieder eine Minute länger im Regen. Er hatte noch drei Kilometer bis ins Büro vor sich. Dunkle Gedanken flossendurch seinen Kopf. Heimtückisch wie die Nässe, die das Gewebe des Jeansstoffs durchdrang.
Deutschland im November, dachte Pedro, ist einfach nicht lebenswert. Alles ist grau. So ist das Leben ein Grauen. Ein Graus. Er wunderte sich, dass sein Gehirn selbst in schlechter Stimmung noch Wortspielereien fabrizieren konnte. Galgenhumor an Allerseelen. Irgendwie passte das ja. Er fuhr nun durch die Bahnhofsstraße und wich gerade noch dem Wasserschwall eines vorbeifahrenden Busses aus. Als er gegenüber vom Hauptbahnhof wieder an einer Ampel halten musste, hatte er jegliche Hoffnung aufgegeben, noch einigermaßen trocken im Büro anzukommen. Er triefte und schniefte. Nur jetzt nicht krank werden, dachte er.
Er betrachtete die traurigen Gestalten auf der anderen Straßenseite. Lange Gesichter unter Kapuzen und Schirmen. Die Mundwinkel merkelig nach unten gezogen. Die Armen, dachte Pedro. Seine Stimmung besserte sich nun ein wenig, denn er machte sich bewusst, dass er ein Glückspilz war. Denn anders als die meisten grauen Gestalten hier, würde er bald weg sein. Zwei Monate in Lateinamerika. Heute war sein letzter Arbeitstag. Den würde er auch noch überstehen.
Als er klatschnass das Büro betrat, schauten ihn die Sekretärinnen mitleidig an. Tropfen perlten von seiner Nase, doch Pedro lächelte. „Ist heute viel los? Nein? Dann würde ich gerne früher Feierabend machen. Ich muss noch Koffer packen.“ Mit diesen Worten ging er in seinen Büroraum und fuhr den Rechner hoch.
Mail aus Wiesbaden
Mein Freund, heute ist mein letzter Arbeitstag. Deshalb wollte ich mich nochmal kurz bei Dir melden. Morgen geht es ja schon los nach Südamerika. Ich habe es aber auch wirklich nötig. Das Wetter ist doch nicht auszuhalten. Ehrlich gesagt: ich will nur noch weg. Das ist doch keine Lebensqualität hier über die Wintermonate. Du gehst aus dem Haus raus, wenn es noch dunkel ist. Und wenn Du das Büro verlässt, dämmert es auch schon wieder. Das kann doch nicht gesund sein! Gut, ich weiß, Du bist nicht so wetterfühlig wie ich.
Wie Du weißt, stecke ich gerade in einer ziemlichen Sinnkrise. Da schlägt dieses Mistwetter noch mehr aufs Gemüt als sonst. Du hast mich letztens gefragt, ob ich das wirklich durchhalten würde: zwei Monate alleine durch Lateinamerika? Wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich nur sagen: Alles ist besser als hier zu bleiben. Was habe ich auch schon zu verlieren? Die Beziehung ist leider futsch, und im Job trete ich auf der Stelle.
Ich muss mir mal über einiges klar werden. Es kann ja so nicht weitergehen. Jahrein, jahraus der gleiche Trott. Manchmal zweifle ich an der Sinnhaftigkeit meines Daseins. Ist das etwa die Midlifecrisis? Wie dem auch sei: Da kann doch so eine Reise nur guttun! Klar habe ich auch Manschetten, aber Du kennst mich ja: wenn ich die Chance habe, zu neuen Ufern aufzubrechen, bin ich nicht zu halten. Irgendwie steckt wohl immer noch ein kleiner Abenteurer in mir.
Also, mein Freund, wenn alles planmäßig läuft, melde ich mich bald aus Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro
Pedro trat auf die Terrasse. Hoch oben über dem Fels kreiste ein Adler. Wie leicht er in der Luft liegt, dachte Pedro. Wie muss es wohl sein, so zu schweben? Pedro zündete sich eine Zigarette an. Der Morgen warnoch frisch, die Sonne gerade erst aufgegangen. Pedro nahm noch einen tiefen Zug, dann ging er zurück in die Wohnung.
Er fühlte sich ein wenig einsam und setzte sich an den Computer. Ich werde ein Buch schreiben, dachte er. Darin werde ich all meine Fragen stellen und vielleicht bekomme ich dann Antworten. Doch als er das leere Blatt vor sich sah, wusste er nicht, wie er anfangen sollte.
Er ging noch einmal heraus auf die Terrasse. Inzwischen war die Sonne über den Felsen gekrochen und schien ihm direkt ins Gesicht. Das tut gut, dachte er, endlich bin ich an einem Ort, wo es warm ist. Pedro hasste die Kälte des Winters in seinem Heimatland. Ein kleiner Vogel setzte sich ganz nahe auf eine Stromleitung und begann zu trällern.
Pedro war mit so unendlich vielen Fragen nach Brasilien gereist. Was war eigentlich seine persönliche, ureigene Lebensaufgabe? Hatte er eine? Wie führte man ein glückliches Leben? Und auch – natürlich - die Liebe. Was ist die Liebe, wie funktioniert sie? So, dass sie bleibt, gedeiht. Er hatte sie noch nicht gefunden. Oder doch? Und er hatte es nur nicht klar genug gesehen, obwohl sie vor seinen Augen war? Hatte er sie vielleicht sogar ohne Not aus der Handgegeben, sie losgelassen und ziehen lassen? So genau wusste er das gerade nicht.
Er wischte die Gedanken beiseite und setzte sich an den Tisch, um Portugiesisch-Vokabeln zu pauken. Pedro hatte sich vorgenommen, die Sprache besser zu lernen, um mit den Einheimischen richtige Gespräche führen zu können. Ihn reizte es, tiefer zu gehen und er liebte es, Sprachen so gut zu lernen, dass er in die Begegnungen mit Menschen anderer Länder besser eintauchen konnte.
Eine halbe Stunde später schob er das Vokabelheft beiseite. Schließlich war er in Rio, in einer der schönsten Städte der Welt. Er trat vor die Tür und lief dann an der Kaimauer von Urca entlang. Er sah die wunderschöne Bucht von Flamengo und dahinter die Hochhäuser sowie die mal grünen, mal braunen Hügel der Stadt. Rio de Janeiro. Was für ein schöner Ort, dachte er. Ich bin ein Glückspilz, hier sein zu dürfen. Er sah die Gesichter der vorbeieilenden Menschen und wunderte sich, dass die Meisten keinen besonders glücklichen Eindruck machten. Das Land befand sich in einer schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage. Er kannte die Brasilianer von früheren Reisen. Und obwohl Rio eine Stadt der Kontraste war und ist, auch Armut das Leben prägt, waren ihm die Menschen immer froh und optimistischvorgekommen. Plötzlich schien genau das zu fehlen: Optimismus und Frohsinn.
Er gelangte auf einen Platz, der nach Nelson Mandela benannt war. Er bewunderte diesen Staatsmann, weil der so viele Jahre zu Unrecht im Gefängnis verbracht hatte - Jahrzehnte - und trotzdem nicht auf Rache gesonnen hatte. Unglaublich! Ein großer Mann, der irgendwie auch immer glücklich wirkte. Wie hatte er das hingekriegt trotz seines Schicksals? Ein bestimmt vier Meter hohes Bild von Mandela war an die Wand gepinselt. Obwohl dieser Ort so weit entfernt ist von Mandelas Südafrika, schienen die Menschen hier ihn zu verehren. Sicher hatte es damit zu tun, dass auch in Rio viele Menschen mit verschiedenen Hautfarben zusammenleben. Und: es gab zwar keine staatliche Diskriminierung wie früher in Südafrika, aber es war überdeutlich, dass es den meisten dunkelhäutigen Menschen viel schlechter ging als der weißen Ober- und Mittelschicht.
Auf dem Platz spielten Kinder. Es gab eine große Rutsche und witziger weise auch Trainingsgeräte, die ausschließlich von Senioren genutzt werden. Es könnte ein so gutes und nicht nur schönes Land sein, dachte Pedro, wenn es nicht so viel Ungleichheit gäbe. Warum überhaupt gibt es diese eine Menschheit nur im Arm-Reich-Paket? So absurd, dass wir das nicht besser hinkriegen.
Am Rande des Platzes entdeckte er hinter einer Bank eine junge Familie. Das Baby mochte ein halbes Jahr alt sein, die Eltern hatten ihm auf dem Kopf ein süß aussehendes Löckchen mit Schleifchen gedreht. Doch irgendetwas stimmte nicht in diesem Bild. Der Vater lag im Gras und schien zu dösen. Die Mutter streichelte abwechselnd ihn und das kleine Kind, das immer wieder davon zu krabbeln versuchte. Sie saß auf derselben schäbigen Decke, auf der auch der Mann lag.
Pedro war sicher, dass die Familie hier draußen übernachtet hatte. Er fragte eine junge Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging, was mit der Familie los sei. Sie sagte, dass er keine Angst zu haben brauche. „Diese Leute sind nicht gefährlich“, meinte sie. Auf den Gedanken wäre er gar nicht gekommen. Er hatte gar keine Angst, sondern einfach nur großes Mitleid mit dem kleinen Baby, das unter solchen Umständen sein Dasein fristen musste. Die Frau mit dem Hund schien das nicht groß zu wundern. „Es ist normal, dass hier Menschen schlafe“, sagte sie. „Sie haben kein Zuhause. Und hier ist es sogar relativ sicher für sie.“
Pedro zögerte einen Moment, ob er die obdachlose Familie ansprechen sollte. Die Mutter wirkte auf die Distanz recht freundlich auf ihn, und so ging er hin. „Leben Sie hier?“, fragte er die Frau, währendder Mann neben ihr weiter döste. Sie hatten nur zwei Plastiktüten, die neben der schmutzigen Decke lagen. Darin schien ihr ganzes Hab und Gut zu sein. Die Frau lächelte. Sie mochte Mitte Zwanzig sein, und obwohl sie ärmlich gekleidet war, wirkte sie nicht verwahrlost, eigentlich sogar ganz hübsch. Nur ein paar Narben an den bloßen Beinen und im Gesicht verrieten, dass sie sicher kein einfaches Leben bisher gehabt hatte. „Ja“, sagte sie freundlich, „seit ein paar Tagen sind wir hier, wir haben keinen anderen Ort zum Schlafen.“ Pedro fragte, warum. „Ich habe meine Arbeit verloren vor einiger Zeit. Ich hatte einen kleinen Laden, eher ein Büdchen, in dem ich Nüsse und kleine Speisen verkauft habe. Ich habe nicht viel verdient, aber es reichte zum Leben. Doch dann kamen die Olympischen Spiele. Leute aus der ganzen Welt besuchten die Stadt. Da wollte der Bürgermeister den Platz mit den kleinen Lädchen nicht mehr. Er wollte dort eine moderne Straßenbahn bauen, damit die Sportler und Touristen sich schnell und bequem fortbewegen konnten. Die Lädchen wurden alle komplett abgerissen, und so verlor ich meine Arbeit.“ Pedro erfuhr, dass es keinen Schadenersatz oder alternative Lösungen gegeben hatte. Der Bürgermeister hatte alle Büdchen-Besitzer ihrer Existenz beraubt - von jetzt auf gleich. Was für ein Mistkerl, dachte Pedro.
Die Frau schaute jetzt sehr traurig, doch als das Baby sich an ihren Hals warf, lächelte sie wieder. Pedro bemerkte, dass der Mann neben ihr sich bewegte. Er hatte nichts als eine Badehose an. Mit schläfrigen Augen richtete er sich auf und begrüßte Pedro freundlich. Er schien überhaupt nicht misstrauisch gegenüber dem fremden Besucher.
„Ich heiße Bruno“, sagte er. „Du scheinst aus einem fernen Land zu kommen. Warum interessierst Du Dich für unser Schicksal?“ Er musste schon länger mitgehört haben. „Hier in Rio interessiert das niemanden.“ Es machte Pedro traurig, dass die meisten reichen Menschen in Rio anscheinend wenig Mitgefühl mit den Armen hatten. Und es gab auch keine funktionierende Solidargemeinschaft. Das kleine Mädchen mit dem witzigen Schleifchen schaute Pedro erwartungsvoll an und lächelte dabei. Es konnte noch nicht ahnen, dass seine Eltern in großem Elend leben – es schien sehr glücklich zu sein und strahlte immer, wenn seine Mutter es auf den Arm nahm.
Kleinkinder brauchen nicht viel, um glücklich zu sein, dachte Pedro. Sie denken nicht in sozialen Kategorien. Sie brauchen Liebe von den Eltern, Windeln und genug zu essen. Mehr nicht. Das kleine Mädchen hieß Clarissa, und es sah wohlgenährt aus. Seine Mutter allerdings wirkte recht mager. Pedro ärgerte sich über den Mann an ihrer Seite. Warum gab er ihrnicht genug zu essen? Deshalb fragte er Bruno, ob er keinen Job habe.
„Leider kann ich zur Zeit nicht arbeiten“, erzählte Bruno und schaute dabei traurig drein. „In Brasilien braucht man dafür ein Dokument, es heißt „Arbeitsbuch“. Da stehen alle bisherigen Anstellungen drin. Aber als wir nachts auf der Straße schliefen, nicht hier, sondern im Zentrum der Stadt, da haben Diebe meine Tasche mit allen Dokumenten darin geklaut. Ich habe jetzt auch keinen Personalausweis mehr, aber am meisten fehlt mir das Arbeitsbuch, ohne das ich keine Anstellung finden kann. Früher habe ich mit einem kleinen Lastwagen Sachen ausgeliefert. Aber jetzt kann ich nur noch Nüsse auf der Straße verkaufen. Ich verdiene damit sehr wenig Geld.“
Bruno erzählte, dass er eigentlich sogar ein kleines Häuschen besitze. „Doch das liegt oben auf den Hügeln in einer sehr gefährlichen Favela. Dort handeln sie mit Drogen, und jeden Tag werden Menschen auf der Straße erschossen. Wir können dort mit unserem kleinen Kind nicht mehr hin.“
Pedro war geschockt. Er wusste, dass die Armut sehr groß und die Kriminalität sehr hoch waren in Rio. Aber jetzt wurde er zum ersten Mal direkt damit konfrontiert. Diese Familie musste draußen auf der Straße leben, weil sie nicht in ihr Haus zurückkehrenkonnte. Und eine bessere Bleibe konnten sie sich nicht leisten, weil sie keine reguläre Arbeit fanden. Und das nur, weil ein paar blöde Papiere fehlten. Vom Arbeitsbuch existierte nämlich keine Kopie.
Trotz allem machten die Drei keinen unglücklichen Eindruck. Bruno meinte, dass er wohl bald wieder Ausweispapiere bekommen könnte. Allerdings würde es ohne das Arbeitsbuch schwer, eine reguläre Arbeit zu finden.
„Ich brauche einen starken Glauben“, meinte Bruno. „Aber manchmal mangelt es mir daran. Gottseidank ist meine Frau optimistischer. Es muss etwas geschehen, denn sie ist wieder schwanger. Und meine größte Angst ist, dass die Polizei uns nach Papieren fragt. Die von der kleinen Clarissa sind nämlich auch gestohlen worden. Wenn die Polizei kommt, kann sie uns das Baby einfach wegnehmen.“
Pedro fragte sich, ob Bruno und Rosana - so hieß die Frau - selbst einen Anteil Schuld an ihrer Lage tragen würden. Dann schämte er sich, dass er das überhaupt dachte. In Deutschland jedenfalls würden Leute wie Bruno und Rosana nicht so leicht auf der Straße landen. Dort gab es Hilfe vom Staat. Und dass man durch den Verlust eines Arbeitsbuches keinen Job mehr finden kann, war geradezu absurd. Er fragte die Beiden, ob er ihnen etwas zu essen kaufen dürfe, undsie nickten froh mit dem Kopf. Er brachte ihnen zwei warme Käsebrote und ein Mousse aus Acai, einer Beere, die besonders viele Vitamine enthält. Das Baby konnte das sicherlich gut gebrauchen. Sie bedankten sich herzlich, als er sich verabschiedete.
Er war froh, dass er der Familie ein bisschen hatte helfen können. Er fühlte sich viel zufriedener als zuvor. Und Gottseidank gibt es in wahrscheinlich jedem Land dieser Welt Menschen, die eine soziale Ader haben und anderen helfen. Oder sind die Mutter Teresas dieser Welt am Ende auch weniger geworden? Er beschloss, sich in Zukunft mehr um sozial Benachteiligte zu kümmern. Die gab es schließlich auch in Deutschland.
Er nahm sich auch vor, in Zukunft zufriedener zu sein. „Diese Leute haben wirklich Probleme, und ich jammere oft schon über Kleinigkeiten“, meinte er zu sich selbst. Aber ich habe immer genug zu essen, eine schöne Wohnung und genug Geld zum Reisen. Trotzdem sind diese Leute vielleicht gar nicht unglücklicher als ich. Sehr seltsam, dachte Pedro, wie schnell man mit etwas unzufrieden sein kann, obwohl es einem materiell ausgezeichnet geht.
Andererseits hatte Bruno ihm etwas voraus. Obwohl der viel jünger war als er selbst, hatte der schon eine Frau und bald zwei Kinder. Pedro spürte leichtenNeid aufkommen. Aber das ist doch nicht möglich, dachte er. Wie kann ich allen Ernstes Menschen beneiden, die auf der Straße leben und kaum genug zu essen haben?
Er blickte noch einmal zurück. Immer noch schauten ihm Rosana und Bruno nach und winkten. Eine schöne Erkenntnis: Anderen helfen macht glücklich. Pedro lief zurück nach Urca, um das aufzuschreiben. Er dachte: Das sind die Mosaiksteine, die ich für mein Buch gut gebrauchen kann. Die muss ich suchen und sammeln - wie ein Goldschürfer…
Mail aus Rio de Janeiro
Mein Freund, Du möchtest wissen, wie meine ersten Tage in Rio verlaufen sind? Du weißt ja, wie groß meine Vorfreude war. Als ich vom Flugzeug aus den Cristo auf dem Corcovado erblickte, hüpfte mein Herz. Rio ist eine der atemberaubendsten Städte der Welt. Daran kann es nicht den leisesten Zweifel geben. Diese Lage zwischen von Urwald überwucherten Hügeln und traumhaften Stränden – Wahnsinn.
Ich nahm ein Taxi in die Stadt. Es war früher Sonntagmorgen. Die Palmen wiegten sich sanft im Wind. Kaum Verkehr, ich kurbelte das Fenster herunter und fühlte die laue Luft auf meinem Gesicht.
Ankunft in Urca, einem der schönsten Stadtteile Rios. Und außerdem ziemlich sicher, weil hier viele Militärs wohnen. Obwohl müde vom Flug sprang ich die Treppen hoch und klingelte an Jürgens Tür. Keine Reaktion. Ich wartete eine Höflichkeitsminute und drückte noch einmal den Knopf. Wieder nichts. Ich dachte schon: bin ich hier im falschen Film, als ich jemand von innen die Treppe herunter rumpeln hörte.
Jürgen schnauzte mich erst einmal an: warum ich denn so penetrant die Klingel betätigen würde. Dann lagen wir uns in den Armen, es war ja mehr als ein Jahr her, dass wir uns gesehen hatten. Ich sah ihn an und war ein wenig schockiert. Unter seinen Augen lagen tiefe Ringe. Die Haut war so blass, als hätte er die letzten Wochen am Nordpol verbracht und nicht unter tropischer Sonne. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Sonst hatte er immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Doch heute wirkte er irgendwie bekümmert. Wir stiegen die steilen Stufen zu seinem Apartment hinauf.
Auf seinem Balkon steckten wir uns eine Zigarette an. Wir schwiegen eine Weile und schauten zum Zuckerhut. Dann murmelte er etwas von Endzeitstimmung. Wegen Bolsonaro? Ich wollte wissen, was los war.
„Die Schwulen hier versuchen noch schnell zu heiraten, bevor Bolsonaro sie daran hindern wird. Könnte sein, dass homosexuelle Ehen bald verboten werden.“
Ich wusste nicht, warum er ausgerechnet damit anfing. Er ist ja ebenso wenig schwul wie ich, und doch bekümmerte ihn das Thema offenbar. Wir gingen wieder hinaus auf die riesige Terrasse, auf der Jürgen alle möglichen Sorten von Palmen züchtete. Ein Mann in Unterhose am Fenster gegenüber zückte seine Kamera und fotografierte in unsere Richtung. Seltsam.
„Hier brauchst Du dir keine Sorgen zu machen, in diesem Viertel wohnen viele Soldaten. Aber sonst: die Sicherheitslage hat sich enorm verschlechtert“, meinte Jürgen.
Bevor er weiter lamentierte schlug ich einen kleinen Spaziergang vor. Vielleicht würde ihn das auf andere Gedanken bringen. Er nickte stumm und so bummelten wir kurze Zeit später rüber zur Praia Vermelha - da, wo die Gondeln in zwei Etappen zum Zuckerhut aufsteigen. Ein sensationelles Panorama, doch Jürgen konnte es nicht genießen. Er fuhr fort mit seinen düsteren Erzählungen.
„Vor ein paar Monaten wurde zum ersten Mal in der Geschichte die Seilbahn abgeschaltet. Von da hinten“ - er zeigte auf den Felsen, der Urca von der Copacabana trennt - „sind die Banditen gekommen, die Polizei ihnen nach. Heftige Schusswechsel. Die Leute hier am Stand haben sich auf den Boden geworfen, weil sie Angst hatten, dass sie was abkriegen. Und die Seilbahn stand einen halben Tag lang still.
Wir kauften zwei Kokosnüsse und schauten auf die Bucht. Sofort kam mir das abgenutzte Wort „paradiesisch“ in den Sinn. Am Strand spielten die Kinder und lagen die Schönheiten. Kaum vorstellbar, dass hier kürzlich noch geschossen wurde.
Wir gingen zurück, und ich legte mich erst einmal hin. Der Jetlag. Am frühen Abend ging ich mit Jürgen noch ein Bier trinken. Wir erzählten uns alte Geschichten. Das tat gut. Wir lachten sogar ein wenig trotz seiner düsteren Stimmung.
Und was auch gut tat: Mir war so wohlig warm. Endlich fror ich nicht mehr.
Im ersten Moment erkannte Pedro sie nicht. Sie ihn aber schon. „Ola Pedro“, rief sie. Genau: es war dieselbe Lehrerin wie damals vor zwei Jahren. Paula hatte inzwischen graue Haare bekommen, um ihren Mund hatte sie jetzt etwas Strenges bekommen, was Pedro noch nicht kannte.
Die erste Unterrichtsstunde fand in einem Café statt. Paula war eine sehr gute Lehrerin, strukturiert („wie eine Deutsche“ - würden viele Brasilianer sagen). Sie besaß die Fähigkeit, sich in denSchüler hineinzudenken, so dass sie immer in einem Tempo und mit einem Vokabular sprach, dem man gerade so folgen konnte. Pedro stellte fest, dass noch Einiges da war von seinem Portugiesisch. So wie er Paula kannte, würde sie ihn wieder fordern und fördern. Und mit vielen Hausaufgaben quälen.
Sie fing von sich aus an, über Politik zu reden. Sie hatte Bolsonaro gewählt, weil endlich wieder Ordnung herrschen müsse. „Die Arbeiterpartei hat uns bestohlen. Der frühere Präsident Lula ist ein Räuber“, meinte sie bestimmt. All ihre Hoffnung ruhte nun auf diesem seltsamen Mann, der fortwährend Frauen, Schwule, Indigene und Schwarze beschimpfte und haushoch die Wahlen gewonnen hatte. Pedro konnte nicht dagegen zu halten - es fehlten ihm noch die nötigen Vokabeln dazu.
Pedro war überrascht, mit welcher Härte Paula sprach. Sie war schließlich eine gebildete und weltoffene Frau. So hatte er sie zumindest kennen gelernt und in guter Erinnerung behalten. Die portugiesische Grammatik konnte sie in perfektem Englisch und sogar ein wenig auf Deutsch erklären. Sie leibte Geschichte und Kunst. Wie konnte das sein, diese extreme Wendung in ihrer politischen Gesinnung? Wie hatte dieser rüder als Trump daherkommende Bolsonaro seine aufgeklärte Lehrerin dazu gebracht, ihn zu wählen?
„Bolsonaro ist nicht wie Trump. Trump ist wirklich vulgär, Bolsonaro redet nur Klartext“, meinte Paula. „Aber er hat doch zu einer Abgeordneten gesagt, sie sei es nicht einmal wert, dass man sie vergewaltige“, hielt Pedro ihr entgegen. „Das war aus dem Zusammenhang gerissen. Das passierte im Anschluss an eine Debatte über eine grausame Tat vor ein paar Jahren. Ein Jugendlicher hatte ein Mädchen brutal vergewaltigt und ermordet. Ganz Brasilien sprach darüber, dass man deshalb jugendliche Straftäter härter bestrafen müsse. Diese Abgeordnete war aber dagegen - deshalb hatte er ihr in seinem Furor entgegengeschleudert, dass sie es nicht wert sei, vergewaltigt zu werden.“ Und das machte es besser? Fragte er sich.
Pedro sollte Paula jetzt jeden Tag sehen, drei Stunden zum Unterricht. Er mochte sie immer noch. Solange sie nicht über Politik sprach, hatte sie ihren guten Humor. Aber dass sie Bolsonaro gewählt hatte und so verbissen verteidigte, bekümmerte ihn sehr. Es schien, dass sich in Brasilien ein großer Hass breit machte und zum Nährboden für Rechtspopulismus wurde. Bolsonaro hatte seinen Wahlkampf mit WhatsApp-Nachrichten geführt. Unzählige Verschwörungstheorien waren im Umlauf. Viele Menschen wussten nicht mehr, was richtig und falsch war. Ganz ähnlich wie in anderen Ländern wie Ungarn oder Polen,wo Rechtspopulisten an die Macht gekommen waren.
Pedro dachte über die Gefahr nach, die verdeckte oder offene Manipulationen in den sozialen Netzwerken für die Demokratie haben konnten. In Brasilien gab es zwar noch freie Wahlen, aber das gesellschaftliche Klima war vergiftet. Und an der Spitze stand nun ein Mann, der aus seiner Verachtung für manche demokratische Institutionen kein Hehl machte. Das waren keine guten Aussichten.
Am Abend schlenderte Pedro mit seinem Freund Jürgen zu einem kleinen Restaurant - da wo die Straße sich wie ein Hufeisen um den kleinen Strand von Urca legt. Der Fisch war winzig und Pedro bemerkte, dass sich sein Freund und die Kellner nicht mehr mit derselben Freundlichkeit begegneten wie früher.
„Ich hätte Lust, hier wegzugehen“, meinte Jürgen. „Viele sind schon gegangen. Nach Portugal oder in die USA, in die Schweiz und nach Italien.“
„Warum?“ fragte Pedro.
„Es läuft nichts mehr in Brasilien. Die Wirtschaft geht den Bach runter. Die Korruption wird immer schlimmer, die Kriminalität auch.“
„Kann der neue Präsident Bolsonaro diesen Abschwung stoppen?“
„Vielleicht wird sich die Wirtschaft ein bisschen erholen, kann schon sein. Aber da sind so viele Baustellen. Das Rentensystem müsste dringend reformiert werden. Die Militärs zum Beispiel arbeiten nur bis 48 und bekommen dann 100 Prozent ihrer Bezüge ihr Leben lang. Bolsonaro aber besetzt sein halbes Kabinett mit ehemaligen Soldaten. Wird er da deren Privilegien beschneiden? Kaum vorstellbar! Die ganzen Staatsbediensteten profitieren davon. Und draußen sitzen 13 Millionen Arbeitslose. Die Jugendlichen in den Favelas haben nur zwei Möglichkeiten: mitmachen in den Drogengangs oder nicht. Normale Arbeit werden sie kaum finden.“
Sein Freund war nie ein besonderer Rio-Fan. Früher lebte er in Sao Paulo, das hatte ihm besser gefallen.
„Hier in der Südzone von Rio sind die Leute ignorant. Sie gehen schön an den Strand, während oben in den Favelas die Polizisten die Jugendlichen abknallen. Kommen dann Favela-Gangs mal runter und klauen, bedeutet das für die Cariocas: die Polizei und das Militär haben ihre Arbeit in den Favelas nicht richtig gemacht. Aber niemand denkt mal drüber nach, dass man den jungen Leuten dort eine Perspektive bieten müsste.“
Sie gingen zurück in die Wohnung. Dunkle Wolken verhüllten den Zuckerhut. Gerade mal 18 Grad, es hattedie ganze Nacht gedonnert und geregnet. Rio zeigte sich Pedro wirklich nicht von der sonst so gewohnt fröhlichen Seite.
Über die Plattform Internations hatte Pedro Talita kontaktiert. Er hatte gute Erfahrungen mit diesem sozialen Netzwerk. Es war auf Expats spezialisiert. Dementsprechend waren die Mitglieder dort meist polyglott und offen. Wobei es auch immer „Locals“ gab, die sich über Internations Kontakt zu einem reichen Ausländer erhofften…
Talita und Pedro hatten schon seit ein paar Wochen Nachrichten ausgetauscht, nun trafen sie sich erstmals von Angesicht zu Angesicht. Sie war Lehrerin für brasilianische Geschichte an einer Grundschule. Sie sah genauso hübsch aus wie auf den Bildern bei Internations. Braune Haut, volle Lippen, die eigentlich krausen Haare mit viel Mühe glatt gestrichen. Als sie den ersten Satz sprach, merkte er, dass sie leicht lispelte.
Das Erste, was sie machte: sie beschwerte sich, dass Pedro die Biersorte „Brahma“ bestellt hatte. „Das ist das schlechteste brasilianische Bier überhaupt!“ Sie beorderte den Kellner an den Tisch. Ein neues Bier wurde gebracht, Talitas Laune besserte sich sichtlich. Ihre zwei oberen Schneidezähne standen ein kleines Stück vor, und Pedro beobachtete, wie sich ihre spitze Zunge beim Reden immer wieder nachvorne schlängelte, an die Zähne stieß und das kleine Lispeln hervorrief. Irgendwie fand Pedro das süß.
Er erfuhr, dass Talita nur noch ihre Mutter hatte. Sie lebte irgendwo im Landesinnern. Und zwei Brüder, zu denen kaum Kontakt bestand. Sie wohnte zusammen mit einer Freundin in einem kleinen Apartment im Stadtteil Copacabana und das Unterrichten schien ihr nicht wirklich Spaß zu machen.
Eigentlich wollte er das Thema Politik nicht anschneiden, doch irgendwie passierte es dann doch. Die Kommunikation spitzte sich daraufhin zu wie Talitas Zunge beim Buchstaben „L“. Sie hatte zwar nicht gewählt, weil sie noch in einem anderen Bundesstaat gemeldet und daher nicht wahlberechtigt war.
„Aber natürlich hätte ich Bolsonaro meine Stimme gegeben, denn wir brauchen einen Wandel. Die Arbeiterpartei hat doch nur das Land bestohlen.“
Pedro fragte, ob sie es denn wirklich in Ordnung finde, dass der frühere Präsident Lula so lange im Gefängnis sitze.
„Natürlich, er ist ein Gauner.“
„Aber die Beweislage gegen ihn ist doch dünn!“
„Ach was, er hat uns bestohlen, er hat früher mal gute Dinge gemacht, früher habe ich ihn auch gewählt, aber er ist einfach ein Verbrecher.“
Pedro fand diese Schwarz-Weiß-Malerei furchtbar. Aber konnte er sich als Ausländer anmaßen, darüber ein Urteil zu fällen?
„Wenn es Dir hier in Brasilien nicht gefällt, kannst Du ja schnell nach Deutschland zurück“, meinte Talita.
Sie lächelte dabei, es hatte Ironie, und doch: so etwas hatte Pedro in Brasilien früher nie gehört. Als er zu Hause ankam, berichtete er Jürgen von seiner Begegnung. Der starrte gerade angewidert auf seinen Computer-Bildschirm.
„Sieh Dir hier dieses Video mal an! Dieser Muskelprotz, ein Bodybuilder, hat mit die meisten Stimmen bei den Wahlen gewonnen. Ein Bolsonaro-Mann, ab Januar wird er im Parlament sitzen.“
In dem Video saß ein muskelbepackter wütender Mann in seinem Auto und drohte einer Schulleiterin mit derben Worten: „Du bist die Erste, die dran glauben wird. Pass bloß auf, bald wird Schluss sein mit der kommunistischen Indoktrination der Kinder.“
Der zukünftige Abgeordnete zeigte sich immer wütender. „Eure Angst riecht wie Scheiße!“ In einem anderen Video riss er stolz ein Straßenschild herunter, das im Gedenken an Marielle Franco angebracht wurde. Eine schwarze Bürgerrechtlerin, die vergangenenMärz brutal von rechten Milizen ermordet worden war.
Jürgen schüttelte traurig den Kopf.
„Wenn ich eine Chance hätte, würde ich Brasilien verlassen, nach Deutschland zurückgehen.“
„Warum bist Du damals eigentlich hier hergekommen?“, fragte Pedro.
„Brasilien war ein Land im Aufbruch, als ich vor 20 Jahren kam. Zwar arm, aber mit Potential und der Aussicht, dass es bald besser wird. Und dann kam mit Lula ein Präsident an die Macht, der Millionen Menschen aus der Armut befreite. Es herrschte eine tolle Stimmung im Land. Aufbruch. Doch dann wurde der gute Präsident vielleicht etwas übermütig, er nahm Geschenke an von großen Firmen. Und jetzt sitzt er sogar im Gefängnis. Die Leute wollen ihn nicht mehr. Sie haben vergessen, was er für sie getan hat.“
Pedro dachte: wie traurig. Jürgen hatte eigentlich das Glück gefunden. War in das Land gegangen, dass er liebte und hatte dort eine Familie gegründet. Doch nun gefiel ihm das Land nicht mehr, und die Beziehung mit der Mutter seiner Tochter war zerbrochen.
„Warum ist es nicht gut gegangen mit Deiner Frau?“
„Sie ist eine Einheimische, wir waren sieben Jahre zusammen.“
Pedro musste unwillkürlich an das berühmtberüchtigte verflixte siebte Jahr denken.
„Die Frauen hier sind anders. Sehr feminin und sinnlich. Doch sie nutzen das auch als Waffe, um Dich zu beherrschen. Irgendwann wollte ich das nicht mehr: immer nur nach ihrer Pfeife tanzen.“
Mail aus Rio de Janeiro
Mein Freund, vielen Dank für Deine aufmunternden Worte. Damit Du nicht denkst, dass ich die ganze Zeit hier Trübsal blase, bekommst Du heute mal einen anderen Bericht aus Rio.
Es geht mir nämlich gar nicht so schlecht hier, obwohl das Wetter bisher eher durchwachsen ist. Gestern schüttete es bei 15 Grad aus allen Kübeln. Und das im November – also kurz vor dem hiesigen Sommer. Da hätte ich auch daheim bleiben können, dachte ich. Nach meiner App war es in Deutschland nur drei Grad kühler und sogar sonnig. So kann es gehen. Wobei ich auch schon schöne Strandtage hier hatte – und zwei lange Monate Sommer vor mir, während Du in der winterlichen Heimat darben musst.
Gestern hatte ich ein witziges Erlebnis. Jürgen nahm mich mit zu einem Empfang der Auslandskorrespondenten. Es fand statt in einer schicken Villa gar nicht weit von Jürgens Wohnung entfernt. Im Innenhof roch es nach gegrilltem Fleisch, aus den Lautsprechern dröhnte fröhliche Latino-Musik. Die illustre Gästeschar war in vielen kleinen Grüppchen in meist vergnügte Gespräche vertieft. Da waren deutsche und brasilianische Journalisten, Diplomaten und Künstler.
An einem kleinen Stehtisch in der Nähe des großen Bierfasses entdeckte ich eine sehr hübsche Frau. Es stellte sich heraus, dass sie aus Deutschland kam und Praktikum beim Korrespondenten einer großen deutschen Zeitung machte. Heute war ihr letzter Tag – und augenscheinlich wollte sie deshalb dieses Fest in vollen Zügen genießen. Sie nahm einen Drink nach dem anderen und rauchte Kette.
Sie hieß Annette und erzählte mir, dass sie vor ihrem Praktikum drei Monate lang durch Südamerika gereist war. Mit strahlenden Augen zählte sie die Namen der Länder und Städte auf.
„Am liebsten würde ich hier bleiben, aber das geht ja leider nicht. Der Ernst des Lebens: ich muss mich auf mein zweites juristisches Staatsexamen vorbereiten.“
Wir unterhielten uns sehr angeregt. Ich war gut drauf, und Annette mochte meine Wortspiele. Besser noch: Sie machte selbst welche. Die Praktikantin hörte gar nicht mehr auf zu reden und zu trinken und zu rauchen. Und ich tat das Gleiche und genoss den lauen Abend zusammen mit ihr sehr.
Irgendwann kam auch Jürgen dazu und stellte uns einen Kollegen vor. Wulf Lietzenburg. Der arbeitete gerade an einem Buch über ein Amazonasvolk. Ein sehr sympathischer Kerl. Gleichzeitig souverän und selbstbewusst. Einer jener Menschen, die wissen, wo es lang geht und mit sich und der Welt im Reinen sind. Wir stießen miteinander an, und Wulf begann von dem Volk zu erzählen, das er seit vielen Jahren regelmäßig besuchte.
„Als ich für meine Zeitung damals zum ersten Mal zu dem Volk gereist bin, gab es dort große Probleme. Die Indianer und die weißen Siedler waren aneinandergeraten, es gab sogar Tote. Das kleine Indianervolk galt im Vergleich zu den Nachbarvölkern als besonders rebellisch. Und ich wollte wissen, was da los war.“