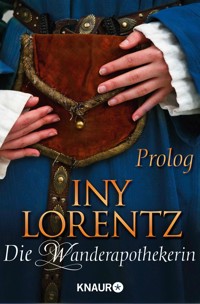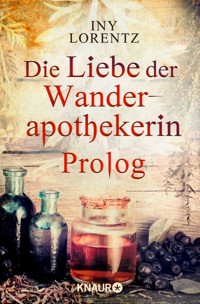9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann setzt sein Leben für seine Freunde und seine Liebe ein – Historische Spannung von Bestsellerautorin Iny Lorentz exklusiv als eBook! Gegen Ende des 17. Jahrhunderts am Rhein: Martin ist der uneheliche Sohn des verstorbenen Reichsgrafen von Berrinsburg und dessen Mätresse, der Gräfin Hallberg. Von seinem Halbbruder als Leutnant in die Armee gesteckt, kämpft er für seine Heimat. Als ein Geldkurier ermordet wird, deutet alles auf seinen Kameraden Stakke als Täter hin. Martin will dessen Unschuld beweisen. Bald begreift er, dass er dafür ein schmutziges Geflecht aus Mord und Intrigen auflösen muss, welches nicht nur sein Leben bedroht ... Spannend und historisch: Entdecken Sie auch andere Historienromane von Iny Lorentz - Die Rose von Asturien (Spanien) - Das Mädchen aus Apulien (Italien) - Die Löwin (Italien) - Die Pilgerin (Spanien) - Die Rebellinnen (Mallorca) - Die Wanderhuren-Reihe (Deutschland)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Iny Lorentz
Der Sohn der Mätresse
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein junger Mann setzt sein Leben für seine Freunde und seine Liebe ein – Historische Spannung von Bestsellerautorin Iny Lorentz exklusiv als eBook!
Anfang des 19. Jahrhunderts am Rhein: Martin ist der uneheliche Sohn des verstorbenen Reichsgrafen von Berrinsburg und dessen Mätresse, der Gräfin Hallberg. Von seinem Halbbruder als Leutnant in die Armee gesteckt, kämpft er für seine Heimat. Als ein Geldkurier ermordet wird, deutet alles auf seinen Kameraden Stakke als Täter hin. Martin will dessen Unschuld beweisen. Bald begreift er, dass er dafür ein schmutziges Geflecht aus Mord und Intrigen auflösen muss, welches nicht nur sein Leben bedroht …
Inhaltsübersicht
Erster Teil
Verrat
Zweiter Teil
Neuigkeiten
Dritter Teil
Die Schiffe
Vierter Teil
Kriegslist
Fünfter Teil
Der Reichsgraf
Sechster Teil
Die Entscheidung des Reichsgrafen
Siebter Teil
List gegen List
Achter Teil
Im Handstreich
Historischer Hintergrund
Glossar
Erster Teil
Verrat
Moíra blickte besorgt zum Himmel empor. Im Osten erhellten bereits die Vorboten des kommenden Tages den Horizont, dabei hatten sie den Rhein noch nicht einmal erreicht, geschweige denn überquert.
»Wir müssen schneller werden!«, flüsterte sie ihrem Onkel Aindriú zu.
»Das ist unmöglich, Moíra Ní Briain! Viele Frauen und vor allem die Kinder haben schon jetzt keine Kraft mehr. Wir sind seit Anbeginn der Nacht unterwegs, und das auf den elendigsten Feldwegen und Waldpfaden. Zudem haben wir einen großen Umweg gemacht, weil wir in die Irre gelaufen sind.«
Moíra zog einen Augenblick den Kopf ein, straffte sich aber sofort wieder. »Wir müssen über den Rhein gesetzt haben, bevor der Tag anbricht! Auf dieser Seite können uns Roi Louis’ Schergen und deren Helfer stellen. Drüben aber sind wir in Sicherheit!«
»Sofern es für uns irgendwo in diesen Landen Sicherheit gibt!« Aindriú O’Briain zweifelte daran, obwohl er wusste, dass sie nach dem, was in Frankreich geschehen war, nicht länger dort bleiben konnten.
Während des Gesprächs waren sie weitergegangen. Als sie sich umdrehten, verrieten ihnen die wenigen Fackeln, die sie zu entzünden gewagt hatten, dass die Marschkolonne sich weit auseinandergezogen hatte.
»Wir sollten anhalten und warten, bis unsere Leute aufgeschlossen haben«, schlug Aindriú vor.
Moíra schüttelte den Kopf. »Sobald wir den Rhein erreicht haben, werden wir auf sie warten, können aber schon einiges vorbereiten, um dann möglichst rasch überzusetzen.«
»Dafür müssen wir den Strom erst einmal finden!«
Aindriú fürchtete bereits, sie wären erneut in die falsche Richtung gegangen.
Doch kurz darauf kehrte einer der Männer zurück, die Moíra als Vorhut losgeschickt hatte. »Wir haben den Fluss erreicht, sind aber verdammt nahe an einer Stadt«, meldete er.
»Wenn es nur Oppingen wäre!«, entfuhr es Moíra.
Sie wusste jedoch selbst, dass dieser Ort nicht nur auf der anderen Seite des Rheines, sondern auch mindestens dreißig Meilen weiter südlich lag. Außerdem durften sie auch nicht einfach bei den dort lagernden Truppen auftauchen.
»Zuerst müssen wir bei Reichsgraf Joseph vorstellig werden«, sagte sie, als dieser Gedanke ihr durch den Kopf schoss.
»Der Berrinsburger soll kein besonders mächtiger Herr sein«, wandte Aindriú ein.
»Er kämpft gegen die Truppen des Comte de Vallier, und er sucht Söldner. Das muss uns genügen!«
Aindriú fand, dass seine Nichte sich die Sache zu einfach machte. Allerdings hatte sie die Flucht ihres gesamten Clans ausgezeichnet geplant. Zumindest waren sie schon weit gekommen, obwohl sie sämtliche Frauen und zahlreiche Kinder bei sich hatten.
»Da ist der Strom!« Der Bote wies den Hügel hinab auf eine dunkle Fläche, die sich kaum gegen die Schwärze der Nacht abhob.
Moíra vernahm das Klatschen, mit dem das Wasser ans Ufer schlug, und atmete auf, während ihr Onkel den Mann fragte, wie sie den Steilhang überwinden sollten.
»Weiter vorne führt ein Pfad hinab«, erwiderte der Bote. »Es müssen alle sehr vorsichtig sein und einander helfen, damit keiner von uns in die Tiefe stürzt.«
Moíra blickte sich um und sah, dass die einzelnen Gruppen langsam aufholten. Doch nun stand sie vor dem Problem, wie sie etwa einhundert Männer, fast ebenso viele Frauen und noch mehr Kinder heil über den Strom bringen sollte.
»Seht zu, dass ihr Boote findet!«, wies sie den Späher an. »An dieser Stelle sind wir äußerst gefährdet. Wenn uns die Franzosen oder ihre Trierer Speichellecker hier überraschen, sind wir kaum in der Lage, ihnen Widerstand zu leisten. Sie würden so viele von uns niedermachen, wie es ihnen möglich ist, und den Rest in den Rhein treiben, so dass die meisten ertränken.«
Im Schein einer Fackel erkannte Moíra, dass der Späher breit grinste. »Wir haben mehrere Boote entdeckt und schon heimlich hierhergebracht. Sie bieten Platz für etwa dreißig Personen.«
»Damit müssten wir mehr als zehnmal hin- und herfahren. Das dauert weit bis in den Tag hinein«, wandte Aindriú O’Briain ein.
Moíra schüttelte den Kopf. »So lange darf es nicht dauern! Die Männer, die schwimmen können, sollen neben den Booten herschwimmen, und ebenso die Frauen, die sich das zutrauen.«
»Trotzdem müssen wir mehr als die Hälfte unserer Leute mit den Booten ans andere Ufer schaffen.« Aindriú O’Briain klang besorgt. Sie hatten weder die Erlaubnis, diese Lande zu durchqueren, noch konnten sie darauf rechnen, dass ihnen jemand helfen würde, den Franzosen zu entkommen.
Unterdessen hatte Moíra ihren Entschluss gefasst. »Dreißig unserer Krieger sollen als Erste hinüberrudern und das andere Ufer sichern!«
»Wäre es nicht besser, gleich Frauen und Kinder zu transportieren?«, fragte ihr Onkel.
Moíra schüttelte den Kopf. »Wenn wir das tun, reicht ein Dutzend Landreiter aus, um die erste Gruppe zu überwältigen und ihr die Boote abzunehmen. Wir Übrigen könnten dann nur hilflos zuschauen.«
»Da hast du recht!« Aindriú O’Briain zollte seiner Nichte widerstrebend Respekt. Trotz ihrer Jugend war sie eine gute Anführerin, wenn auch außer ihr und ihm kein Clanangehöriger den wahren Grund kannte, weswegen sie Frankreich verlassen mussten.
»Die Männer sollen rasch zum Ufer hinabsteigen und übersetzen. Dann können die Boote zurück sein, bis die Frauen den Abhang bewältigt haben«, fuhr Moíra in ihren Anweisungen fort.
Sofort eilten gut dreißig Männer los. Moíra folgte ihnen mit den ersten Frauen und Kindern, während die übrigen Krieger den Trupp nach hinten absicherten.
Eine Frau mit zwei Kindern auf den Armen stolperte und geriet in Gefahr, in die Tiefe zu stürzen. Rasch griff Moíra zu und fing sie auf. »Gib mir eines der beiden Kleinen, damit du eine Hand frei hast!«
Die Frau reichte ihr ein Kind und ging weiter. Die wenigen Fackeln vermochten kaum den Weg zu erhellen, doch Moíra wagte nicht, weitere anzünden zu lassen.
»Habt ihr etwas von unseren Verfolgern bemerkt?«, fragte sie einen Krieger, der bis jetzt zur Nachhut gezählt hatte, nun aber seiner Frau und seinen drei Kindern beim Hinabsteigen half.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Seit drei Stunden haben wir nichts mehr gehört. Ein paar Burschen sind zurückgeblieben, um uns zu warnen, falls der Feind aufholen sollte.«
Auch er wunderte sich, weshalb die Franzosen, in deren Diensten sie, ihre Väter und Großväter gestanden hatten, auf einmal Feinde sein sollten. Es musste mit dem Tod von Moíras Bruder Aodh und mit dem ihres Verlobten zusammenhängen. Es hieß, ein Edelmann hätte die beiden jungen Männer in eine Falle gelockt und umbringen lassen. Bei dem Gedanken spie der Mann aus. Die O’Briains hatten drei Generationen lang für Frankreichs Könige gekämpft und es nicht verdient, so miserabel behandelt zu werden.
»Gleich haben wir das Ufer erreicht. Aber die Boote sind noch unterwegs«, meldete Aindriú seiner Nichte.
Moíra hatte es nicht anders erwartet. Sie ging noch ein paar Schritte weiter, sah dann das Wasser des Rheins wie ein breites, schwarzes Band vor sich und blickte nach Osten. Hier im Tal herrschte noch Düsternis, während es über den Hügeln, die das andere Stromufer begrenzten, langsam hell wurde.
»Jedes Boot muss voll beladen werden!«, befahl sie. »Du, Onkel Aindriú, wirst mit dem nächsten Boot hinüberfahren und drüben das Kommando übernehmen. Auch wenn ich nicht annehme, dass Louis Quatorzes Soldaten dort auf uns lauern, müssen wir auf alles vorbereitet sein.«
»Solltest nicht besser du fahren?«, fragte Aindriú.
»Ich bin die Anführerin des Clans und werde dieses Ufer als Letzte verlassen!«
Moíra klang so scharf, dass ihr Onkel nichts mehr einzuwenden wagte. Daher war er erleichtert, als die Boote zurückkehrten. Er sorgte dafür, dass die Frauen und Kinder rasch einstiegen und sich die Kräftigsten an die Ruder setzten. Ein Dutzend Krieger reichten ihre Musketen, Stiefel und Mützen in die Boote, dann stiegen sie ins Wasser, um hinüberzuschwimmen.
»Dreißig Mann bleiben hier, bis alle anderen hinübergeschafft worden sind!«, erklärte Moíra und nahm eine ihrer Pistolen zur Hand, auch wenn kein Feind in Sicht war.
Obwohl am Ufer wenig Platz war, ging alles rasch. Die Männer und Frauen waren gewohnt, ihrem Clanoberhaupt zu gehorchen, mochte es auch ein Mädchen wie Moíra Ní Briain sein. Aindriú erreichte mit der nächsten Gruppe das andere Ufer, und weitere Frauen, Kinder und Männer bereiteten sich vor, ihnen als Nächste zu folgen.
Moíras Blick streifte wieder den östlichen Himmel. Nun erhellten bereits die ersten Sonnenstrahlen den Horizont, und es hatte nicht einmal die Hälfte über den Strom gesetzt.
»Heiliger Pádraig, hilf uns!«, flehte sie und hörte im nächsten Augenblick einen Ruf.
»Da kommen die Schiffer!«
Als Moíra sich umdrehte, sah sie bei den Häusern am Ufer, wo ihre Leute die Boote weggeholt hatten, mehrere Männer stehen. Angesichts der Gruppe, die sich kaum mehr als einen Steinwurf von ihnen entfernt versammelt hatte, wagten sie jedoch nicht, näher zu kommen. Ein paar strebten sogar in die Gegenrichtung. Wenn sie allerdings auf ihre Verfolger trafen oder jemanden informierten, der diese holen konnte, sah es schlimm für die Fliehenden aus.
Moíra winkte ihnen zu, und als das nichts half, ging sie am Ufer entlang, bis sie den Platz vor den Häusern erreicht hatte. »Gute Leute, wir tun euch nichts! Ihr bekommt eure Boote wieder«, rief sie auf Französisch. »Ich gebe euch auch Geld dafür!«
Rasch steckte sie die Pistole weg, öffnete ihren Beutel und zog mehrere Münzen hervor.
Inzwischen war es auch hier im Tal hell geworden. Die Männer sahen daher das goldene Funkeln in ihren Fingern, wussten aber nicht, was sie von dem Ganzen halten sollten. Inzwischen waren die Boote zurückgekommen, und die nächste Gruppe stieg an Bord. Die Frauen sahen mit langen Röcken, Kopftüchern und Hauben so aus, wie die Einheimischen es gewohnt waren. Aber die Männer in ihren grünen Röcken, die die nackten Waden frei ließen, wirkten fremdartig. Vor allem aber hielt jeder der Fremden eine Muskete in der Hand.
Einer der Einheimischen redete auf die anderen ein. Anscheinend war er des Französischen mächtig genug, um Moíras Worte übersetzen zu können. Ein paar Männer schüttelten den Kopf, doch er wies auf Moíra und sprach ein Wort, das Moíra anhand seiner Ähnlichkeit mit dem Begriff in der englischen Sprache verstand.
»Gold!«
Sofort hob sie die Münzen in die Höhe. »Das bekommt ihr für das Verleihen der Boote!«, rief sie.
Die Einheimischen unterhielten sich erneut. Schließlich trat der, der ein wenig Französisch konnte, auf sie zu. »Ihr Boote nicht wegnehmen?«, fragte er stockend.
Moíra schüttelte den Kopf. »Ihr bekommt eure Boote wieder! Wir müssen nur so schnell wie möglich über den Strom!«
»Du geben uns Geld?«
Diesmal nickte Moíra. »Hier sind fünf Louisdors! Ihr bekommt sie, wenn ihr uns in Ruhe über den Strom lasst und niemandem etwas sagt!«
Erneut wandte der Mann sich seinen Gefährten zu und sprach eifrig auf sie ein. Dabei wies er immer wieder auf die funkelnden Münzen in Moíras Hand. Für einfache Stromschiffer waren fünf Louisdors ein Vermögen. Selbst wenn sie das Geld unter sich aufteilten, erhielt jeder mehr, als er in einem Vierteljahr harter Arbeit verdienen konnte.
Wenig später kamen die Männer zu einem Entschluss. Ihr Sprecher trat erneut auf Moíra zu und erklärte, dass seine Freunde sieben Goldmünzen haben wollten. Da Moíra nicht feilschen mochte, zog sie zwei weitere Louisdors aus ihrem Beutel und reichte dem Mann das Geld.
»Wir bekommen unsere Boote wieder?«, fragte er misstrauisch.
Moíra nickte. »Ihr bekommt sie zurück! Wenn ihr uns helft, lege ich sogar noch einen Louisdor drauf.«
Das Angebot war zu verlockend. Rasch winkte der Mann seine Gefährten heran und redete auf sie ein. »Wir helfen«, erklärte er.
Die Dorfbewohner brachten sogar weitere Boote, die Moíras Späher nicht entdeckt hatten. Zudem konnten sie besser rudern als die Iren und schafften die Flüchtlinge in der Hälfte der Zeit über den Strom, als diese benötigt hätten.
Als Letzte stiegen Moíra und die gerade noch rechtzeitig erschienenen Männer der Nachhut in die Boote. Die Pferde, unter denen sich auch Moíras Stute Peata befand, mussten neben ihnen herschwimmen.
Aindriú atmete auf, als er seine Nichte ans Ufer steigen sah. »Wir haben es geschafft, Maighdean!«, rief er erleichtert.
»Das haben wir!«, antwortete Moíra und reichte aus einem Impuls heraus dem Schiffer, der mit ihr gesprochen hatte, noch eine Münze.
»Merci bien! Ihr habt uns sehr geholfen.«
Der Mann nickte nur, steckte das Geld weg und forderte seine Freunde auf, abzulegen und zum eigenen Ufer zurückzukehren. So ganz traute er Moíra und ihren Männern doch nicht.
Auch Aindriú machte sich Sorgen. »Vielleicht hätten wir die Boote zerstören sollen. So könnten Verfolger sie benützen!«
»Sie brauchten nur in den nächsten Ort zu gehen, um sich andere zu besorgen. Außerdem hätten wir uns die Schiffer zum Feind gemacht und liefen Gefahr, dass sie uns an die Franzosen verraten«, antwortete Moíra und wandte sich an den Anführer der Nachhut.
»Wie weit sind unsere Verfolger noch entfernt?«
Der Mann grinste sie fröhlich an. »Auf jeden Fall weiter, als ihnen lieb sein kann, Moíra Ní Briain. Es hat sich bezahlt gemacht, dass wir in der Nacht in die Irre gelaufen sind. Die Franzosen sind weiter in die falsche Richtung geritten und werden erst im Lauf des Tages merken, dass sie unsere Spur verloren haben. Danach ist es für sie zu spät, uns noch abzufangen.«
»Das ist eine gute Nachricht!« Erleichtert atmete Moíra auf und gab den Befehl zum Weiterziehen.
»Wir sollten eine Rast einlegen. Alle sind total erschöpft«, wandte ihr Onkel ein.
»Das werden wir auch, aber erst in zwei Stunden. Wenn wir am Strom blieben, könnten feindliche Späher uns entdecken. Doch sobald wir hinter den Hügeln verschwunden sind, wird keiner der Feinde wissen, wohin wir uns gewandt haben. Für so mutig, uns auf gut Glück auf diese Seite des Rheins zu folgen, halte ich sie nicht. Setzt die, die nicht mehr laufen können, auf die Pferde. Peata kann drei Kinder tragen und Onkel Aindriús Hengst zwei Frauen.«
Mit diesen Worten brach Moíra auf. Die anderen folgten ihr, und auch ihr Onkel machte sich auf den Weg. Doch kaum lag das Ufer hinter ihnen, schloss er zu seiner Nichte auf.
»Ich hoffe, du hast alles gut bedacht, Moíra Ní Briain. Die Nachricht, dass Reichsgraf Joseph von Berrinsburg Söldner anwirbt, um gegen die Franzosen vorzugehen, die Oppingen besetzt halten, ist schon etliche Wochen alt. Nicht, dass dieser Feldzug bereits beendet ist und der Berrinsburger uns nicht mehr braucht.«
Einen Augenblick verspürte Moíra Angst vor dem, was das Schicksal noch für sie und ihren Clan bereithalten mochte, schüttelte dann aber vehement den Kopf. »Ich bin sicher, dass der Kampf noch nicht zu Ende ist, Uncail. Sonst hätten wir davon gehört! Daher auf nach Berrinsburg! Möge der heilige Pádraig uns beistehen, auf dass wir Rache nehmen können für den heimtückischen Anschlag, der Aodh und Cuolán das Leben gekostet hat.«
»Das gebe Gott!«, antwortete Aindriú O’Briain und hoffte inbrünstig, dass seine Nichte recht behalten möge.
Im österreichisch-berrinsburgischen Heerlager vor Oppingen starrte Jette mit wachsendem Entsetzen auf die blutüberströmten Männer, die sich aus der Dunkelheit herausschälten. Jeder schien verletzt zu sein. Einer hielt sich den Arm, Türck hatte sich notdürftig eine Binde um den Kopf gewickelt, die im Schein der Lagerfeuer rot glänzte, und zwei, drei weitere hinkten stark. Der Österreicher Erkenwaldt, der mit den Letzten im Feuerschein auftauchte, wirkte unverletzt, zog aber eine Miene, als wären ihm sämtliche Felle davongeschwommen.
Als Jette die Männer zählte, fehlten vier. Ihr Herz verkrampfte sich. Einen Augenblick später aber atmete sie auf, denn nun trat Sixten Stakke in den Kreis aus flackerndem Licht. Ihm folgten Martin von Hallberg und Haro von Starzin, die beiden jüngsten Offiziere im Heer. Nur Hinggendorffs Stückmeister fehlte und würde Stakkes Miene zufolge wohl auch nicht mehr zurückkehren.
»Was ist passiert?«, fragte Jette. »Wir haben Kanonensalven gehört und dachten, unsere Kriegslist wäre gelungen.«
»Es waren nicht unsere Kanonen, sondern die der Franzosen«, antwortete Stakke nach einem wüsten schwedischen Fluch.
»Aber wie konnte das geschehen?« Gundobert von Hinggendorff, der Kommandeur des Heeres, hatte sein Zelt verlassen und sah seinen Feldwachtmeister Erkenwaldt fragend an. Anders als die Soldaten und Offiziere, die nicht zu dessen Kommandotrupp gehört und nur rasch Hemd und Hose übergezogen hatten, war Hinggendorff vollständig angekleidet und trug sogar die rot-weiß-rote Schärpe eines Obristen des kaiserlichen Heeres über dem Rock. Auch die Federn auf seinem Hut waren in diesen Farben gehalten.
Erkenwaldt spie aus, als wolle er den Schrecken über das, was geschehen war, auf diese Weise loswerden. »Auf irgendeine Weise müssen die Franzosen davon Kenntnis bekommen haben, dass wir auf dem Gereonshügel eine Artilleriestellung errichten wollten, und haben uns erwischt, kurz bevor wir die Oppinger Hafenfestung unter Feuer nehmen konnten. Wäre es nur eine halbe Stunde später geschehen, hätten wir eine Bresche geschlagen, die uns morgen den Sturm auf die Stadt ermöglicht hätte. Stattdessen sind unsere schweren Kaliber zerstört und der Stückmeister tot.«
»Aber was sollen wir jetzt tun?«, fragte Hinggendorff in seinem weichen Wiener Dialekt. »Ich hatte die Hoffnung, dass diese lästige Bataille morgen siegreich beendet werden könnte. Langsam gehen uns die Vorräte aus, und die Soldaten haben seit zwei Monaten keinen Sold mehr erhalten.«
»Es wird langsam Zeit, dass Geld kommt!«, rief Urs Markbein in aufrührerischem Tonfall.
Er und die anderen Söldner mochten die Österreicher und Ungarn nicht, die unter Erkenwaldts Kommando standen und knapp ein Viertel des Heeres stellten. Diese hatten sich an den letzten Nachschublieferungen weitaus stärker bedient, als ihnen zustand, so dass für Stakkes Söldner und das Berrinsburger Aufgebot, welches immerhin den größten Teil des Heeres bildete, nur Reste geblieben waren.
Jette fühlte, wie das Grauen vor dem Kommenden in ihr aufstieg. Lange würde Hinggendorff die unzufriedenen Söldner nicht mehr hinhalten können. Dabei war weniger der ausstehende Sold das Problem als die schlechte Versorgungslage. Ohne Geld konnten die Männer eine gewisse Zeit auskommen, aber wenn sie nicht bald etwas Handfestes zu essen bekamen, würde hier der Teufel los sein. Sie hatte bereits erlebt, was passieren konnte, wenn Söldner außer Kontrolle gerieten. Zumeist wurden die Frauen die ersten Opfer der entfesselten Wut.
»Was den Sold betrifft, kann ich Euch beruhigen«, erklärte Hinggendorff gelassen. »Seine Kaiserliche Majestät hat einen seiner Emissäre geschickt, und dieser müsste inzwischen Rippweiler erreicht haben. Ihr, Erkenwaldt, werdet morgen dorthin reiten und den Emissär abholen. Danach schauen wir zu, dass wir General de Vallier so richtig einheizen. Auf ewig wird der Franzose Oppingen nicht halten können. Es liegt doch ein bisserl weit von Frankreich weg.«
Zwei Offiziere lachten pflichtschuldig, doch Martin von Hallberg, der nur zwei Tagesreisen von Oppingen entfernt in der Reichsgrafschaft Berrinsburg aufgewachsen war, schüttelte kaum merklich den Kopf. Die belagerte Stadt lag nördlich von Koblenz am Rhein, und das meiste Land in der Umgebung gehörte dem Fürstbischof von Trier und den Herren der Nassauer Teilfürstentümer. Diese Herren würden den Teufel tun, den französischen Nachschub zu behindern, der auf Mosel und Rhein bis hierher verschifft wurde. Eher machten sie dem hier liegenden kaiserlichen Heer das Leben schwer.
Im nächsten Augenblick fiel Stakkes Hand schwer auf seine Schulter. »Ich seh’s Euch an der Nasenspitze an, dass Euch die Sache nicht gefällt. Mir im Übrigen auch nicht. Hätte ich noch Wein, würde ich mich jetzt besaufen, um die verdammten Franzosen zu vergessen.«
»Wein findest du im ganzen Lager keinen mehr«, erklärte Jette, die zu den beiden getreten war.
Martin senkte den Kopf. »Ich habe noch etwas übrig. Meine Mutter hat ihn mir geschickt.«
Es klang schuldbewusst, denn so willkommen ihm die Gaben seiner Mutter auch waren, so reichten sie nur für ihn und ein paar Freunde aus. Die Soldaten, die nicht auf Weinflaschen, Brot und geräucherten Schinken hoffen konnten, verhöhnten ihn bereits als Muttersöhnchen. Obwohl Martin klar war, dass Neid der Grund für den Spott war, hätte er sich lieber mit der Wassersuppe begnügt, die im Lager gekocht wurde, und dafür etwas mehr im Heer gegolten.
»Dann wollen wir Euren Wein auf das Wohl des Stückmeisters trinken, den heute der Teufel geholt hat«, erklärte Stakke und drückte Jette kurz an sich. »Wenn dieser Kriegszug vorbei ist, gebe ich das Soldatenhandwerk auf und sehe zu, dass wir beide ein hübsches Plätzchen finden, an dem wir uns niederlassen können.«
»Ein Offizier und eine Marketenderin! Wie soll das gutgehen?«, fragte Jette zweifelnd. Auch wenn sie seit mehreren Jahren die Geliebte des Schweden war, so hatte sie nie ernsthaft daran geglaubt, dass er ein dauerhaftes Verhältnis mit ihr eingehen wolle.
Stakke winkte ab. »Mein Vater war ein Knecht aus Dalarna, den Gustav Adolf zu den Waffen geholt hat. Beim Feldzug gegen die Polen war er noch einfacher Soldat, bei Lützen bereits Wachtmeister, und er beendete seinen Dienst schließlich als Hauptmann einer eigenen Kompanie. Meine Mutter war ein Dalarna-Mädel, das als Marketenderin mit dem Heer gezogen war. Weshalb also soll ich keine Marketenderin heiraten?«
Unterdessen war Martin in sein Zelt geeilt und rief nach seinem Burschen. Jupp erschien sofort und schüttelte den Kopf, als er den Dreck und das Blut sah, die bei dem Beschuss durch die französischen Kanonen auf Martins Rock gespritzt waren.
»Ihr solltet etwas vorsichtiger sein, Herr Martin. Es dürfte der Frau Gräfin gar nicht gefallen, dass Ihr Euch so viel mit diesem Schweden abgebt. Stakke ist kein Umgang für Euch! Er ist ein Ketzer, und Ihr wisst, dass seine Landsleute im Großen Krieg das Gut Eurer Familie verwüstet und Euren Großvater umgebracht haben.«
»Bei Gott, Jupp, das ist mehr als vierzig Jahre her! Stakke war damals gewiss nicht dabei, es sei denn als Wickelkind.«
»Ihr solltet Euch trotzdem in Acht nehmen! Es tut nicht gut, wenn Ihr so oft seine Gesellschaft sucht. Er bringt Euch unnötig in Gefahr!« Jupp wollte noch mehr sagen, da hob Martin die Hand.
»Es ist gut jetzt! Ich bin Offizier in diesem Heer und Stakke der Anführer der von unserem Landesherrn angeworbenen Söldner. Wir beide haben ein Ziel, und das lautet, die Franzosen aus Oppingen zu vertreiben. Das geht nur mit Kampf, und der bringt nun einmal Gefahren mit sich. Bring jetzt den Rest Wein in Stakkes Zelt. Wir wollen den Ärger über unseren Rückschlag hinunterspülen.«
»Die Frau Gräfin würde das gar nicht gerne sehen«, wandte Jupp ein. »Außerdem ist es bald Mitternacht! Ihr solltet Euch hinlegen und schlafen.«
»Ich kann jetzt nicht schlafen«, fuhr Martin ihn an. »Und nun mach schon!«
»Wir haben keinen Wein mehr«, gab Jupp kleinlaut zu. »Hinggendorffs Diener hat mich, nachdem Ihr mit Herrn von Erkenwaldt und den anderen aufgebrochen seid, um etwas Wein für seinen Herrn gebeten, und da habe ich ihm die letzten drei Flaschen mitgegeben.«
»Hinkefüßchen säuft meinen Wein, während ich dürsten muss?« In seiner Wut bezeichnete Martin den Feldhauptmann mit dem Spottnamen, den ihm einige Söldner angehängt hatten.
Jupp sah ihn tadelnd an. »Das war eben nicht sehr höflich von Euch!«
»Ich habe Stakke den Wein versprochen und muss nun mit leeren Händen zu ihm gehen.« Verärgert ließ Martin seinen Burschen stehen und trat aus dem Zelt.
Martin kam mit hängendem Kopf zu Stakkes Unterkunft. »Es tut mir leid, doch ich habe zu viel versprochen. Jupp, dieser Unglücksrabe, hat die letzten Weinflaschen meiner Mutter an Hinggendorffs Diener weitergegeben.«
Lachend wies Stakke auf eine große Zinnkanne, aus der Haro von Starzin sich eben bediente. »Ärgert Euch nicht drüber! Irgendwie muss Erkenwaldt an Wein gekommen sein und hat mir diese Kanne als Trost wegen unseres Fehlschlags zukommen lassen. Einer seiner Dragoner hat sie vorhin gebracht.«
»Der Österreicher?«, fragte Martin verwundert, da Erkenwaldt bislang immer dafür gesorgt hatte, dass er selbst und seine Leute bestimmt nicht zu kurz kamen.
»Manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder«, erwiderte Stakke achselzuckend. »Kommt, Starzin, schenkt auch für unseren Freund ein! Immerhin teilt er seinen Wein mit uns, wenn seine Frau Mutter ihm welchen schickt.«
Haro reichte Martin einen vollen Becher. Seinen blitzenden Augen nach musste er schon einiges getrunken haben, und Stakke war ebenfalls nicht mehr nüchtern. Auch Martin trank nun einen Schluck, stellte den Becher aber wieder zurück, denn der Wein wies einen arg bitteren Nachgeschmack auf.
»Trinkt!«, forderte Stakke ihn auf. »Es ist die einzige Möglichkeit, die beschissene Lage, in der wir uns befinden, zu ertragen.«
»Ganz so schlimm sehe ich das nicht«, wandte Haro ein. »Irgendwann müssen die Franzosen kapitulieren und uns Oppingen übergeben.«
Stakke trank einen weiteren Becher und tippte Haro dann mit dem Zeigefinger gegen die Brust. »Die Franzosen haben diese im Grunde völlig bedeutungslose Stadt vor gut einem Jahr erobert und sie trotz des letztens geschlossenen Waffenstillstands nicht zurückgegeben. Stattdessen sitzt der General Comte de Vallier mit mehr als tausend Mann in ihren Mauern und denkt nicht daran zu weichen. Ich kann Euch beiden auch sagen, warum das so ist! Wenn der nächste richtige Krieg mit den Franzosen ausbricht, werden in Oppingen genügend Truppen bereitstehen, um Köln und das gesamte Rheinland zu erobern. Damit es dazu nicht kommen kann, müssten wir de Vallier verjagen.«
»Das habe ich doch eben gesagt«, antwortete Haro mit einem übermütigen Auflachen.
»Ihr vergesst den Unterschied zwischen Absicht und Wirklichkeit, mein lieber Starzin. Der Kaiser will die Reichsstadt Oppingen von den Franzosen befreit sehen, aber wenn er ein großes Heer losgeschickt hätte, wäre der Krieg mit dem vierzehnten Ludwig prompt wieder an mehreren Fronten ausgebrochen. Was also macht der Kaiser? Er lässt hier in der Gegend anfragen, wer für ihn gegen die Franzosen vorgehen will, und der Einzige, der dazu bereit war, ist Euer Reichsgraf.«
Martin nickte mit verbissener Miene. »Um ein Heer aufstellen zu können, hat Herr Joseph nicht nur drastische Sondersteuern erhoben, sondern auch beinahe jeden Mann zwischen sechzehn und sechzig zu den Waffen geholt.«
»Und junge Burschen wie Euch, denen noch nie ein kalter Wind um die Ohren gepfiffen hat, zu Offizieren in diesem famosen Heer ernannt!« Stakke trank einen weiteren Becher leer und schüttelte den Kopf. »Ohne meine Söldner wärt Ihr ein Hühnerhaufen, der rennt, wenn de Vallier nur einmal in die Hände klatscht!«
»Ich fürchte die Franzosen nicht!«, rief Haro.
Martin gab dem Schweden insgeheim recht. Ohne dessen Söldner und die Österreicher und Ungarn, die zu ihnen gestoßen waren, hätten die Berrinsburger nichts zustande gebracht.
Martin trank noch einmal, fand den Wein aber immer noch zu bitter. Stakke hingegen goss sich bereits den siebten oder achten Becher aus der großen Kanne ein. Auch Haro hielt kräftig mit, während Martins Gedanken sich um die Belagerungsgeschütze drehten, die durch den feindlichen Beschuss zerstört worden waren.
»Glaubt Ihr, dass wir die Franzosen auch ohne die großen Kanonen zur Aufgabe bewegen können?«, fragte er Stakke.
Der Schwede war ein Veteran vieler Schlachten und konnte die Lage am besten beurteilen. Auf diese Frage hin aber wiegte er zunächst unschlüssig den Kopf.
»Wir blockieren zwar die nach Oppingen führenden Straßen, doch um den Franzosen nachhaltig schaden zu können, müssten wir den Nachschub unterbinden, den sie über den Rhein bekommen. Solange Hinggendorff uns nicht auf die Schiffe schießen lässt, die in der Nacht an uns vorbeifahren, werden de Valliers Männer nicht hungern müssen. Und selbst wenn es uns gelänge, die Franzosen von der Außenwelt abzuschneiden, würden zuerst die Bewohner Oppingens darunter leiden müssen und nicht die Besatzer.«
Stakke trank erneut und starrte durch den offenen Zelteingang in die Nacht hinaus. »Es ist ein Jammer, dass Euer Reichsgraf sich von Kaiser Leopold hat überreden lassen, diesen Krieg zu führen, ohne die Mittel dafür zu haben. Der zweitgrößte Fehler war, dass ich Narr mich von Herrn Joseph habe anwerben lassen und ihm meine Söldner zugeführt habe. Ich hätte die Männer wie geplant Urs Markbein übergeben und mit meiner Jette, wie von mir angedacht, nach Brandenburg-Preußen ziehen sollen, wo wir Vieh züchten und Rüben ernten könnten.«
»Bislang haben wir die Franzosen doch ganz gut im Griff«, erwiderte Martin, dem Stakke zu düster wurde.
»So gut im Griff, dass sie in Oppingen in warmen Stuben hocken und jede Woche eine Schiffsladung Proviant und Schießpulver erhalten, während wir uns in den zugigen Zelten bald den Arsch abfrieren werden. Aber so lange bleibe ich nicht hier.«
»Ihr wollt fort? Aber das wäre Desertion!«, rief Martin erschrocken.
Im gleichen Augenblick glaubte er, draußen ein Geräusch zu vernehmen, doch als er aufstand und ins Freie schaute, war nur Wachtmeister Ditz Hammerstock zu sehen, der zu den Pferden der Offiziere ging.
»Du erschrickst noch vor deinem Schatten!«, spottete Haro, während er sich neuen Wein einschenkte.
»Wo ist eigentlich Rambert? Ich habe ihn den ganzen Nachmittag nicht gesehen«, fragte Martin, der die Bemerkung überhörte, um nicht in Streit mit seinem Freund zu geraten.
»Der ist beleidigt, weil er nicht mit uns mitgehen durfte«, antwortete Haro lachend. »Tat er doch fast so, als müsse er nur einmal kräftig furzen, um das Stadttor von Oppingen aufspringen zu lassen. Stattdessen haben uns die Franzosen eins drüber gebraten. Was für ein Pech, dass sie ausgerechnet unsere schweren Kanonen getroffen haben.«
»Das war kein Pech, sondern Verrat! Dafür lege ich meine Hand ins Feuer«, erklärte Stakke mürrisch und füllte seinen Becher erneut bis zum Rand. Haro tat es ihm gleich und schenkte auch Martin nach. Dieser kniff nachdenklich die Augen zusammen.
»Wie kommt Ihr auf den Gedanken, Stakke?«
»Die Schüsse der Franzosen waren zu gut gezielt, als dass die Treffer Zufall hätten sein können. Zudem haben wir zur Ablenkung an mehreren Stellen Schanzarbeiten vornehmen lassen. Diese Stellen haben sie jedoch nicht beschossen.«
Stakke trank erneut in einem Zug aus und gähnte. »Ich werde langsam müde.«
»Ich auch«, sagte Haro mit schläfriger Stimme und wies auf Stakkes Burschen, der sich hinten im Zelt auf eine Decke gelegt hatte und leise schnarchte.
»Aimo schläft schon!«
Martin ging das, was Stakke gesagt hatte, nicht aus dem Kopf. »Bei allem Respekt, aber wer sollte den Franzosen die Stellung unseres schweren Geschützes verraten haben? Es wurde doch erst nach Einbruch der Nacht auf den Gereonshügel geschafft.«
»Wahrscheinlich haben wir dabei zu viel Lärm gemacht«, warf Haro ein. »Das haben die Franzosen gehört und auf gut Glück losgefeuert.«
Der Schwede winkte ab. »Nein, Ihr Grünschnäbel, das haben sie nicht! Erkenwaldt hat die Männer, die die Rohre in Stellung gebracht haben, sorgfältig ausgesucht. Hätten die auch nur einen Mucks getan, wären sie zum Spießrutenlaufen verurteilt worden! Außerdem haben die anderen Pioniereinheiten, die ich wohlgemerkt gegen den Willen unseres schlafmützigen Befehlshabers durchgesetzt habe, genügend Lärm gemacht, um das Feuer der Franzosen auf sich zu ziehen.«
»Vielleicht waren die Kanonen zu gut poliert und haben im Mondlicht geglänzt«, warf Martin ein.
»Die verdammten Rohre waren so dick mit Asche und Ruß eingeschmiert, dass sie selbst der Teufel in der Hölle nicht wiedergefunden hätte«, antwortete Stakke zornerfüllt. »Die Wachen auf den Oppinger Mauern konnten gar nichts erkennen, weder die Kanonen noch unseren Arbeitstrupp, denn wir haben uns auf der gesamten Strecke den Hügel hinauf hinter dichtem Gebüsch verborgen.« Stakke trank erneut, so als müsse er die Wut und die Enttäuschung über den missglückten Nachtangriff ertränken, und warf dann einen finsteren Blick in die Richtung, in der Oppingen lag. »General Comte de Valliers Richtschützen haben in schwärzester Nacht genau auf den Punkt gezielt, an dem die Fässer mit dem Schießpulver lagen, und bereits mit der zweiten Salve unsere gesamte Stellung hochgehen lassen. Daher bin ich überzeugt, dass die Franzosen eine exakte Kopie des Plans besessen haben, der von Hinggendorffs Stab ausgearbeitet worden ist, sonst hätten sie nicht so präzise zielen können. Ich bin froh, dass Erkenwaldt darauf bestanden hat, seinen eigenen Stückmeister an den Kanonen einzusetzen. So ist der Türck noch am Leben, wofür ich Gott danke. Sollte Euer Reichsgraf durch ein Wunder ein paar neue Geschütze auftreiben können, sind wir immer noch in der Lage, die Oppinger Hafenbefestigung samt ihrem Turm in Schutt und Asche zu legen und diese elende Stadt endlich vom Nachschub abzuschneiden. Gelingt uns das nicht, sehen wir noch im nächsten Jahr den schwerbeladenen Schiffen zu, die des Nachts in diesem Nest anlegen.«
»Aber Ihr sagtet doch, Ihr wolltet das Heer schon bald verlassen«, warf Haro spöttisch ein.
Martins Gedanken gingen andere Wege. »Wer könnte den Franzosen die Stellung unserer Kanonen verraten haben? Die kannten doch nur Ihr und die kaiserlichen Offiziere. Wir Berrinsburger wurden samt unserem Feldwachtmeister erst gestern informiert, kurz bevor es losging.«
Stakke lachte bitter auf. »Ich habe bis jetzt noch kein Feldlager gekannt, in dem die Entscheidungen der Kommandeure lange geheim geblieben wären. Spätestens nach vierundzwanzig Stunden pfeifen es die Spatzen von den Dächern.«
»Aber Spatzen fliegen nicht zum Feind hinüber und zwitschern ihm die Pläne ins Ohr.«
Martin tauchte den Zeigefinger in seinen Weinbecher und zeichnete mit der Flüssigkeit die Rheinbiegung, in der Oppingen lag, samt der Stadtmauer und dem von Turm und Mauer geschützten Hafen auf die Tischplatte. Dann setzte er den Gereonshügel und das eigene Lager hinzu.
»Ich fürchte, Major Stakke hat recht. Schau, Haro! In der Nacht ist an drei weiteren Stellen gearbeitet worden. Die Franzosen hätten trotz des Mondlichts nicht erkennen können, an welcher die Kanonen aufgestellt worden sind.«
Stakke schob Martin beiseite und vervollständigte die Zeichnung. »Seht genau her, ihr jungen Spunde! Vielleicht könnt ihr doch noch etwas lernen. Wenn de Valliers Männer den für sie gefährlichsten Platz für eine Geschützstellung beschossen hätten, wäre es hier auf dem landeinwärts gelegenen Hang gewesen, an dem der erste Zug der Österreicher Schanzarbeiten durchgeführt hat. Auch die beiden Orte, an denen die Berrinsburger geschaufelt haben, lagen innerhalb der Reichweite der französischen Kanonen. Trotzdem haben die Mistkerle auf Anhieb unsere Rohre erwischt.«
»Eigenartig ist es schon!«, gab Haro zu. »Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Comte de Vallier einen Spion im Lager hat, der einfach so in Hinggendorffs Zelt spazieren und den Plan abzeichnen konnte.«
Stakke lachte kurz auf. »Wenn der Spion kein einfacher Soldat ist, sondern einer der kaiserlichen Offiziere, kann er das jederzeit tun. Der Plan für den Nachtangriff lag drei Tage bei Hinkefüßchen herum, bis der sich endlich dazu durchgerungen hat, ihn zu genehmigen. Ich wünschte bei Gott, ich könnte dem alten Zauderer, den Kaiser Leopold Eurem Reichsgrafen als Befehlshaber für diesen lächerlichen Kriegszug aufgeschwatzt hat, einmal offen sagen, was ich von ihm, seinem Leisetreter von Beichtvater, seinem Schoßhündchen Erkenwaldt und dem ganzen aufgeblasenen kaiserlichen Gesindel halte.«
Bei Haro fochten der Respekt vor dem Offizier und der durch den Wein befeuerte Übermut einen kurzen Kampf aus, und Letzterer siegte. »Veit Rosen wird Hinggendorff sagen, das Manöver auf dem Gereonshügel sei nur deswegen schiefgegangen, weil Ihr ein gottloser, alter Ketzer seid. Immerhin hat er schon mehrfach verlangt, Euch und Aimo festzunehmen und der Autorität der Kirche zu übergeben.«
Stakke zuckte mit den Schultern und nahm einen weiteren Schluck aus seinem Becher. »Der Dominikaner ist ein übler Kerl, der in jedem Furz, den ein ehrlicher Mann lässt, ein Blendwerk des Teufels sieht. Hinkefüßchen weiß genau, dass ihm der größte Teil meiner Söldner weglaufen würde, falls er mich festnehmen lässt. Von denen ist weniger als die Hälfte katholisch, und auch der Rest hat schon seit Jahren kein Amen mehr in der Kirche gesprochen. Nur mit seinen Österreichern, den Ungarn und euch Berrinsburger Krautbauern kann er Oppingen niemals einnehmen.«
»Berrinsburger Krautbauern ist eine Beleidigung! Ich glaube, ich muss mich mit Euch schlagen, Stakke. Aber erst, wenn ich ausgeschlafen bin!« Haro gähnte ausgiebig und rutschte langsam von dem primitiven Stuhl, den Stakkes Bursche aus Aststücken zusammengenagelt hatte.
Martin sah verwundert auf seinen Freund hinab. »Den hat es aber arg erwischt!«
»So ein Ungarnwein, wie Erkenwaldt ihn mir hat zukommen lassen, der steigt zu Kopf«, antwortete Stakke mit schleppender Stimme.
»Ungarwein soll das sein?«, fragte Martin verwundert und trank probeweise noch einen Schluck. »Aber danach schmeckt er ganz und gar nicht. Außerdem hat er einen scheußlichen Nachgeschmack. Ich fürchte, Feldwachtmeister Erkenwaldt war nur deswegen so großzügig, weil er diesen Wein nicht selbst trinken wollte.«
»Unsinn!«, antwortete Stakke mit einer fahrigen Geste. »Im Augenblick sitzen auch die Österreicher auf dem Trockenen, und da wird Erkenwaldt um jeden Tropfen froh sein, den er auftreiben kann. Nicht jeder hat eine gut versorgte, einstmals reichsgräfliche Mätresse wie die Gräfin Hallberg zur Mutter.«
Obwohl Martin den Schweden mochte, ärgerte er sich über dessen Ausspruch. Schließlich konnte er nichts dafür, dass seine Mutter die räumliche Nähe zu Berrinsburg ausnutzte, um ihm immer wieder Lebensmittel und Wein zu schicken. Zudem hasste Martin es, an seine Abkunft erinnert zu werden. Als illegitimer Sohn des verstorbenen Franz von Berrinsburg war er der Halbbruder des jetzigen Reichsgrafen Joseph. Der einzige Vorteil, den er daraus zog, war die Tatsache, dass er den Titel eines Grafen Hallberg führen durfte, der in der Familie seiner Mutter erblich war.
Während Martin seinen Gedanken nachhing, gähnte Stakke noch einmal ausgiebig, ließ sich auf sein Feldbett sinken und fiel in Haros Schnarchkonzert mit ein. Das wunderte Martin, denn der Schwede galt als der trinkfesteste Mann im gesamten Lager. Gleichzeitig verspürte auch er eine starke Müdigkeit, wollte sich aber nicht wie Haro einfach auf den blanken Boden legen. Daher stemmte er sich hoch, um zu seinem Zelt zu gehen. Kaum stand er im Freien, drehte sich die Welt um ihn in einem wilden Tanz, und er stolperte über die eigenen Füße. Noch während er zu Boden sank, rebellierte sein Magen, und er würgte den Wein heraus und auch das wenige, was er zu Abend gegessen hatte.
Martins Bursche Jupp hatte trotz der späten Stunde vor dessen Zelt gewartet. Daher bemerkte er sofort, dass sein Herr drüben schwankend ins Freie trat, und legte sich einige Worte zurecht, um den Sohn seiner Herrin wegen des übermäßigen Weingenusses zu tadeln. Doch noch bevor er etwas sagen konnte, taumelte Martin und sank verkrümmt zu Boden.
Entsetzt eilte Jupp zu ihm. Im Licht der Wachtfeuer sah er jemanden hinter sich auftauchen und erschrak. Als er die Marketenderin Jette erkannte, atmete er auf.
»Ich hab befürchtet, da käme Ditz Hammerstock. Der sollte meinen Herrn besser nicht so sehen, sonst würde er ihn gnadenlos verspotten!«, erklärte er sein Zusammenzucken.
Jette beugte sich über Martin und schüttelte ihn, konnte ihn aber nicht wecken. »Den hat es ja ganz schön erwischt! Dabei dachte ich, Stakke hätte keinen Wein mehr.«
»Mein Herr wollte ihm die letzten Flaschen geben, doch die hatte ich bereits Hinggendorffs Diener übergeben, damit der Feldhauptmann gut von meinem Herrn denkt«, berichtete Jupp.
Jette schüttelte lachend den Kopf. »Meinst du, Hinggendorff erfährt, von wem der Wein stammt? Der trinkt ihn nur – und seine österreichischen Offiziere saufen mit! Aber jetzt sollten wir uns um Leutnant Hallberg kümmern. Warte, ich schaue rasch nach Stakke!«
Mit diesen Worten trat sie ins Zelt des Schweden, sah ihren Geliebten schattenhaft auf seinem Feldbett liegen und vernahm sein Schnarchen. Nicht weit von ihm entfernt lag Haro von Starzin auf dem blanken Boden. Jette wickelte den jungen Offizier mitleidig in Stakkes Rock, damit er in der Nacht nicht fror, und kehrte zu Jupp und Martin zurück.
Der Diener kniete lamentierend neben seinem Herrn und hielt ihm den Kopf, damit er nicht am eigenen Erbrochenen ersticken konnte. Anschließend versuchte er, ihn mit Jettes Hilfe auf die Beine zu stellen. Doch Martin schien sich in einen knochenlosen Sack verwandelt zu haben und fiel immer wieder in sich zusammen.
Plötzlich stand Ditz Hammerstock wie aus der Erde gewachsen vor ihnen. »Was ist denn hier los?«, fragte er grimmig.
»Leutnant Hallberg ist von einem Übel befallen«, antwortete Jette, da Jupp aus Angst vor dem riesenhaften Mann kein Wort herausbrachte.
Hammerstock begann dröhnend zu lachen und stieß Martin mit dem Fuß an. »Das Muttersöhnchen hat es ja ganz schön erwischt! Aber was muss er auch mit diesem gottverdammten Schweden um die Wette saufen. Rivitelli, Krögg! Kommt her und helft Märchlin, die besoffene Jammergestalt in sein Zelt zu bringen.«
Die beiden Wachen zögerten, denn Hammerstock hatte schon manches Mal Männer mit scheinbar harmlosen Worten hereingelegt und sie hinterher mit drakonischen Strafen belegt. Zu ihrer Verwunderung wandte der Wachtmeister sich jedoch ab und schlenderte mit einem selbstzufrieden klingenden Lachen davon.
Wilm Krögg, der ebenso wie Jupp Märchlin vom Gut der Gräfin Hallberg stammte, sah ihm misstrauisch nach. Dann drückte er Jupp seine Muskete in die Hand, kniete neben Martin nieder und schlug ihm ein paarmal leicht auf die Wangen.
»Ich weiß zwar nicht, wie das zugegangen ist, aber der junge Graf ist wirklich betrunken. Rivitelli, steh nicht rum wie ein Holzklotz, sondern hilf mir, den Leutnant in sein Zelt zu tragen. Oder hast du Angst, dass Hammerstock heimlich zurückkommt und Theater macht, weil wir unseren Posten verlassen haben?«
Der genuesische Söldner starrte immer noch auf den Punkt, an dem der Wachtmeister verschwunden war. »Zuzutrauen wäre es ihm! Aber sag mal, hast du Hammerstock jemals so gutgelaunt erlebt? Das macht mir mehr Angst, als wenn er herumbrüllen würde wie ein wild gewordener Stier.«
»Wahrscheinlich freut er sich, weil es bald wieder Sold geben soll!«, antwortete Wilm Krögg und packte Martin unter den Armen.
Die beiden Männer hoben den Offizier mit Leichtigkeit auf und trugen ihn weg, während sein schmächtiger Bursche sie wie eine besorgte Henne umkreiste. Jette sah noch einmal zu Stakkes Zelt hinüber und sagte sich, dass es wirklich besser war, wenn ihr Liebhaber seine Söldnertruppe Urs Markbein übergab und mit ihr in ein Land zog, in dem sie einen Gutshof kaufen und bewirtschaften konnten.
Nachdem Krögg und Rivitelli Martin so sanft wie möglich auf sein Feldbett gelegt hatten, warfen sie bedauernde Blicke auf die leeren Weinflaschen, die Jupp in einer Ecke gestapelt hatte.
»Sobald die Frau Gräfin neuen Wein geschickt hat, werde ich für euch eine Flasche beiseitelegen«, versprach Jupp ihnen.
Sie klopften ihm dankbar auf die Schultern und verabschiedeten sich. Doch Jupp achtete schon nicht mehr auf sie, sondern beugte sich über seinen jungen Herrn.
Da trat Jette ins Zelt. »Wie geht es Hallberg?«
»Gar nicht gut! Er schwitzt und fühlt sich gleichzeitig kalt an. So habe ich ihn noch nie erlebt«, antwortete Jupp mit einsetzender Panik.
»Weiß der Teufel, was Stakke und er getrunken haben. Wein kann es nicht sein, eher Branntwein. Hoffentlich ist es keiner von den Fuseln, die einem auf die Augen schlagen, so dass man blind wird!«, sagte Jette besorgt.
Erschrocken schlug Jupp das Kreuz. »Bei Gott, nein! Die gnädige Frau würde mir nie verzeihen, dass ich ihren Sohn nicht gehindert habe, mit dem Schweden zu saufen.«
Jette machte sich große Sorgen um Stakke, ärgerte sich aber auch über Jupp. »Der schwedische Offizier ist ein guter Mann und ein guter Soldat! Von ihm kann dein Herr mehr über den Krieg lernen als von Hinggendorffs gesamtem Stab. Außerdem ist er der Einzige, der die Söldner ruhig halten kann. Euer Reichsgraf hat den Männern verdammt viel versprochen und kaum etwas davon gehalten.«
»Dafür kann Seine Erlaucht nichts«, rief Jupp, der sich genötigt sah, seinen Landesherrn zu verteidigen. »Der Kaiser ist schuld! Der hat unserem Reichsgrafen zugesichert, ab dem dritten Monat die Kosten des Kriegszugs zu übernehmen, bislang aber weder Geld noch Vorräte geschickt. Wenigstens soll der ausstehende Sold jetzt eintreffen.«
»Hoffen wir’s! Ich glaube es allerdings erst, wenn Scheller seinen Tisch aufstellt und die Münzen austeilt«, erklärte Jette, die in den Jahren, die sie mit Heeren gezogen war, etliche böse Überraschungen erlebt hatte.
»Ich wünschte, das Geld wäre schon da«, fuhr sie nachdenklich fort. »Ich habe ein höllisch schlechtes Gefühl bei der Sache. Bisher hat sich kein einziger Händler und auch kein Geldwechsler blicken lassen. Dabei riechen die Krämer es schon Tage vorher, wenn in einem Kriegslager der Sold ausgegeben wird. Ich frage mich, warum Scheller noch keine Boten losgeschickt hat, um die Geldwechsler zu holen. Er braucht doch fassweise kleine Münzen! Mit den Goldstücken des Kaisers kann er nicht viel anfangen.«
»Vielleicht will er warten, bis der kaiserliche Emissär im Lager angekommen ist, und lässt dann erst die Wechsler holen«, wandte Jupp ein.
»Wenn er das tut, ist er ein Idiot! Es dauert Tage, bis die Kerle da sind und das Gold gewechselt haben. Auch die Händler fallen nicht vom Himmel. Glaubst du wirklich, die Männer würden tatenlos zusehen, wie das Gold im Lager herumliegt, während sie weiter Wassersuppe und einen Brei aus halb verschimmeltem Korn fressen müssen? Selbst für die kaiserlichen Offiziere gibt es nichts Besseres, und sie müssen ebenfalls Wasser trinken, weil kein Wein mehr da ist. So etwas habe ich in all meinen Jahren beim Tross noch kein einziges Mal erlebt!«
Jupp wollte etwas einwerfen, doch Jette bat ihn mit einer Geste zu schweigen. »Es ist eine Situation, wie sie nur dem Gottseibeiuns gefallen kann – oder den Franzosen! Die hohen Herren in der Umgebung wollen nicht gegen die in Oppingen stationierte Truppe des vierzehnten Ludwigs vorgehen, weil sie Angst vor dem Franzosen haben. Aber sie gönnen auch keinem anderen die Beute und behindern uns daher, wo es nur geht.«
»Ich glaube, du siehst viel zu schwarz, Jette! Sobald die Soldgelder da sind, wird es auch wieder was zu beißen geben. Dann holen wir die Franzosen aus Oppingen heraus, mag’s ihrem Ludwig gefallen oder nicht.«
»Wollen wir’s hoffen!«, antwortete Jette und verließ Martins Zelt, um noch einmal nach Stakke zu sehen. Dieser lag ebenso wie sein Bursche Aimo und Haro von Starzin in tiefem Schlaf. Als Jette zu ihrem Wagen zurückkehrte, glaubte sie Hufschläge zu vernehmen. Doch als sie lauschte, war nur das Rauschen des Rheins zu hören, und so nahm sie an, dass sie sich geirrt haben müsse.
Am nächsten Tag lastete feuchte, schwüle Luft wie Blei auf Mensch und Tier und machte jede Bewegung zur Qual. Die Nachricht, dass die Soldgelder eintreffen würden, trieb jedoch die Männer im Lager auf die Beine. Der österreichische Feldwachtmeister Erkenwaldt und Zahlmeister Scheller hatten das Lager bereits im Morgengrauen mit einem Beritt Ungarn verlassen, um dem kaiserlichen Emissär entgegenzureiten. Daher war die Anspannung im Lager schier mit Händen zu greifen. Stakkes Söldner und die Österreicher wollten endlich Geld sehen, und die von ihrem Reichsgrafen zwangsrekrutierten Berrinsburger sehnten das Ende des Feldzugs herbei, um wieder nach Hause zu Weib und Kind zurückkehren zu können.
Als zum Fassen der Morgensuppe gerufen wurde, rumorten die Soldaten beim Anblick der unappetitlichen Brühe, die in den Kesseln schwappte.
»Das sollen wir fressen?«, rief ein österreichischer Dragoner. »Das kriegen bei uns daheim nicht einmal die Säue!«
»Wenn wir wieder Geld haben, kommen auch die Händler und Bauern wieder zu uns. Bist dorthin wirst du warten können«, erklärte Ditz Hammerstock und streichelte den kräftigen Stiel seiner Hellebarde, der schon mehrfach auf den Köpfen und Rücken renitenter Soldaten getanzt hatte.
Auch Jupp kam zur Essensausgabe. Nach kurzem Schnuppern verzichtete er darauf, sich an einem der Kochkessel anzustellen, und kehrte zum Zelt seines Leutnants zurück. Dort setzte er sich wie gewohnt auf einen Holzklotz vor dem Eingang und bürstete dessen ledernes Wams und die Hosen aus. Dabei schaute er regelmäßig nach Martin, der sich stöhnend und jammernd auf seinem Feldbett wälzte.
Erst als ein Schatten auf ihn fiel, blickte er auf und erkannte Gertje, die wie Jette zu den Marketenderinnen gehörte. Die Alte verzog den fast zahnlosen Mund zu einem schiefen Lächeln.
»Den Herrn Leutnant hat’s wohl schwer erwischt, was? Was müssen die Mannsleute auch immer saufen, wenn sie nichts im Magen haben. Da wundert es keinen, dass sie kotzen wie die Reiher. Den Stakke hat es ebenfalls wie ein Schlag mit einem Kriegshammer getroffen. Jette hat ihn bis jetzt nicht wach gebracht und seinen Burschen auch nicht. Außerdem hat sie sein ganzes Zelt säubern müssen. Das hat allerdings der Starzin vollgespien. Der Krögg und der Rivitelli haben das Bürschlein vorhin in sein eigenes Zelt geschleppt, auch wenn es dem Uhlden nicht gepasst hat, weil der Starzin immer noch nach Erbrochenem stinkt.«
»Jaja!«, brummte Jupp, da ihm die Alte zu redselig wurde.
»Ich hab was für dich!«, fuhr diese grinsend fort und streckte ihm einen Becher hin, aus dem es ekelhaft bitter und scharf roch. »Das bringt deinen Herrn wieder auf die Beine. Ist nach einem alten Geheimrezept gebraut!«
Jupp begriff, dass sie dafür ein paar Pfennige haben wollte, und schüttelte den Kopf. »Nein danke! Wenn ich das dem Herrn Leutnant einflöße, wird ihm ja noch schlechter.«
»Dann kommt wenigstens alles aus dem Magen heraus, was nicht gut ist! Jette hat es vorhin bei Stakke probiert, aber der ist vom Wein noch zu betäubt, als dass sie es ihm hätte einflößen können. Weiß der Teufel, was für ein Gebräu er und die jungen Herren in der Nacht gesoffen haben. Jette sagt, so hätte sie Stakke noch nie erlebt!«
Nun kam Jupp doch ins Grübeln. »Gib her!«, meinte er. »Wenn es hilft, kannst du hinterher ein paar Groschen haben.«
»Es wird helfen! Genauso sicher, wie es bald einen gewaltigen Sturm geben wird. Ich spüre es in den Knochen, und ich habe mich noch nie geirrt.«
Jupp schüttelte ungläubig den Kopf. »Was redest du da für einen Unsinn? Es regt sich doch kein Lüftchen! Dafür knallt die Sonne vom Himmel herab, dass es kaum auszuhalten ist, und es ist weit und breit keine Wolke zu sehen, die Abkühlung verschaffen könnte.«
»Ich sage dir, es zieht ein böser Sturm auf!« Gertje sah jedoch nicht zum Himmel auf, sondern ins Lager hinein, in dem sich immer mehr Soldaten auf dem freien Platz vor den Zelten der kaiserlichen Offiziere versammelten. Für einen Augenblick schien es Jupp, als wolle Gertje noch weiteres Unheil prophezeien. Doch dann zuckte sie mit den Schultern und schlurfte davon.
Jupp verschwendete keinen weiteren Gedanken an die alte Frau, sondern trat zu seinem Herrn und rüttelte ihn. Zu seiner Erleichterung schlug Martin die Augen auf.
»Oje, mein Kopf! Was ist geschehen?«
»Trinkt das hier, dann geht es Euch rasch besser«, forderte Jupp ihn auf und reichte ihm den Becher.
Martin roch an der graugrünen Flüssigkeit, und sein Gesicht nahm beinahe die gleiche Farbe an. »Bei allen Heiligen, was ist das für eine Brühe?«
»Gertje hat sie gebracht! Ihr wisst, dass sich selbst unser Feldhauptmann von ihr schon Säfte hat mischen lassen.«
»Ja, aber gegen seine Verdauungsstörungen! Doch seit Veit Rosen behauptet hat, es seien Hexentrünke, hockt unser Hinkefüßchen wieder stundenlang auf seinem Leibstuhl. Gib her! Noch schlechter als jetzt kann es mir nicht mehr gehen.«
Jupp hielt Martin den Becher an die Lippen und achtete darauf, dass kein Tropfen verschüttet wurde. Seine Miene aber war ein einziger Vorwurf. »Ihr solltet wirklich nicht mit dem schwedischen Major um die Wette trinken, Herr Leutnant. Was würde Eure Frau Mutter dazu sagen, wenn sie Euch so sehen müsste?«
Er erhielt keine Antwort, denn kaum hatte Martin den letzten Schluck über die Lippen gebracht, da war ihm, als würde man ihm die Gedärme ausweiden. Nach einer Weile trat jedoch wieder Farbe in sein Gesicht. Er trank den Wasserkrug leer und verspürte sogar ein wenig Hunger.
»Den Fraß der Lagerküche kann ich heute nicht empfehlen«, erklärte Jupp, »doch ich habe noch ein wenig Rauchfleisch aufgehoben. Allerdings gibt es kein Brot dazu.«
»Wird schon gehen!« Martin erhob sich, stieß einmal kräftig auf und nahm das Stück Fleisch entgegen, das Jupp ihm reichte. Die Portion reichte nicht einmal für einen Mann, dennoch teilte er sie in zwei Hälften.
»Hier, das ist für dich!«
»Aber Herr, das ist nicht nötig! Ich könnte doch zur Lagerküche gehen und mir einen Napf Suppe holen«, wehrte Jupp ab. Aber der gierige Blick, mit dem er das Stück Fleisch betrachtete, strafte seine Worte Lügen.
Martin drückte ihm den Brocken in die Hand und verließ das Zelt. Da dieses unter einem dichtbelaubten Baum stand, war es drinnen schön kühl, und so traf ihn die schwülheiße Luft draußen wie ein Schlag. Es war ein Wetter, bei dem sich normalerweise jeder, der nicht unbedingt Dienst tun musste, in den Schatten verkroch.
Stunde um Stunde verging, und niemand dachte daran, die Männer zur Arbeit anzuhalten. Von Feldhauptmann Hinggendorff angefangen bis zum letzten Trossbuben warteten alle auf die Rückkehr von Scheller und Erkenwaldt. Wetten wurden abgeschlossen, ob sie es an diesem Tag noch schaffen würden oder erst am nächsten.
Da Martin sich noch immer müde fühlte, kehrte er in sein Zelt zurück, um zu schlafen. Bald aber weckten ihn die Jubelrufe und das Johlen der Soldaten, und er eilte ins Freie. Es war kurz vor der Abenddämmerung, doch es brannten keine Kochfeuer unter den Kesseln. Martin wunderte sich darüber, wurde dann aber von den Rufen abgelenkt, dass die Wachen auf dem Gereonshügel Erkenwaldts Trupp gemeldet hätten. Nun gab es für die Männer kein Halten mehr. Sie strömten vor dem Zelt des Zahlmeisters zusammen und warteten begierig auf ihren Sold.
Von dem Lärm aufgeschreckt, trat Gundobert von Hinggendorff ins Freie. Der Feldhauptmann war ein hagerer Mann knapp unter siebzig und nach Stakkes Meinung unfähig, einen Feldzug zu leiten. Auf jeden Fall gab er mehr auf die Meinung seines Beichtvaters Veit Rosen als auf die seiner Offiziere. Zunächst lächelte er erleichtert. Aber als Erkenwaldt näher kam, bemerkte er dessen vor Zorn hochroten Kopf und kniff verwundert die Augen zusammen.
»Ist etwas Besonderes geschehen, mein lieber Erkenwaldt?«, fragte er seinen Stellvertreter.
»Das kann man wohl sagen!«, antwortete Erkenwaldt mit gepresster Stimme. »Der kaiserliche Emissär Isidor Pfefferle wurde letzte Nacht ermordet und die Soldgelder geraubt.«
Einen Augenblick lang hätte man eine Nadel fallen hören können, so still wurde es. Dann ging ein Aufschrei durch die Menge, und es war deutlich zu erkennen, dass die Soldaten Erkenwaldt nicht glaubten. Dieser zog seinen Pallasch, stieß ihn aber sofort wieder in die Scheide und hob die Hand. »Ruhe! Zurück mit euch Kanaillen! Ich habe die Zeugen des Verbrechens mitgebracht. Macht Platz und lasst sie reden.«
Die Männer wichen zurück und starrten auf den einfachen Pferdewagen, der von zwei Husaren flankiert ins Lager rollte.
Jupp trat an Martins Seite und stupste ihn an. »Das ist doch Helm Schnuß, der Wirt vom Schwan in Rippweiler, bei dem Eure Frau Mutter schon übernachtet hat, als sie Euch besuchen wollte. Der andere ist Kutte, einer seiner Knechte.«
Als der Wagen anhielt, stieg der Wirt vom Bock und verbeugte sich mit ängstlicher Miene vor Hinggendorff. Dieser starrte ihn an und wandte sich dann hilflos an Erkenwaldt.
»Wer ist dieser Mensch? Sollte ich ihn kennen?«
»Es ist der Wirt, bei dem Pfefferle in der letzten Nacht eingekehrt ist. Unter seinem Dach ist der Raubmord geschehen.«
Erkenwaldt trat auf den Wagen zu und schlug die Plane zurück.
Darunter kam der wachsbleiche, blutverschmierte Leichnam eines älteren Mannes zum Vorschein, auf dessen Brust eine klaffende Wunde zu sehen war. Wer auch immer ihn getötet hatte, musste seine Waffe mit ungewöhnlicher Kraft geführt haben.
»Glaubt ihr mir jetzt?«, fragte Erkenwaldt die Soldaten. »Der Kerl, der dafür verantwortlich ist, wird sich wünschen, nie geboren worden zu sein! Es ist ja nicht nur euer Sold, der geraubt wurde, sondern auch der meine.«
Da Erkenwaldt ständig in finanziellen Schwierigkeiten steckte, gab es sogar ein paar Lacher, die jedoch schnell vom zornigen Raunen der Menge erstickt wurden.
»Soll das etwa heißen, es gibt wieder keinen Sold?«, brüllte einer der Söldner.
»Soll ich mir die Gulden vielleicht aus den Rippen schneiden?«, gab Erkenwaldt erregt zurück. »Das Geld ist weg! Und das ist noch nicht das Schlimmste, denn der Mörder ist einer der Unseren! Hört euch an, was Helm Schnuß zu berichten hat.«
Der Wirt knetete vor Aufregung seinen Hut und begann dann zu sprechen. »Das war so: Gestern Abend kam der kaiserliche Abgesandte Isidor Pfefferle mit zwölf Dragonern als Geleit zu uns in den Gasthof. Der edle Herr ließ all sein Gepäck in seine Kammer tragen. Dort musste ihm auch eine Magd das Abendessen servieren. Anschließend begab er sich zur Ruhe. Da er keine Wachen vor seiner Tür aufgestellt hatte, konnte ich nicht ahnen, welch kostbare Fracht unter meinem Dach lagerte.
Die Dragoner blieben in der Gaststube sitzen und spielten mit ein paar Stromschiffern Karten, bis ich den Zapfhahn schloss. Später gingen sie alle in ihr Quartier. Am nächsten Morgen wollte sie einer meiner Knechte wecken, doch sie waren noch immer so stark betrunken, dass er keinen von ihnen zu wecken vermochte. Das wunderte mich ein wenig, denn die Zeche war nicht sonderlich hoch ausgefallen.«
Schnuß verstummte einen Augenblick und schluckte mehrmals, um seine trockene Kehle zu befeuchten. Dann setzte er seinen Bericht mit einer wahren Leidensmiene fort.
»Da Herr Pfefferle sich nicht sehen ließ, bin ich zu seiner Kammer hochgestiegen und habe ihn herausklopfen wollen. Als ich keine Antwort bekam, habe ich an der Tür gerüttelt und festgestellt, dass sie nicht verschlossen war. Ich bin eingetreten und habe den hohen Herrn tot auf seinem Bett gefunden. Um ihn herum war alles voller Blut! So etwas Entsetzliches ist in meinem Haus noch nie geschehen! Ich habe meinen Knechten sofort befohlen, auf das Zimmer und den armen Herrn aufzupassen, und eine Magd zum Richter geschickt, um diese schreckliche Untat anzuzeigen. Da wusste ich ja noch nichts davon, dass eine Kiste mit Goldstücken geraubt worden ist. Meine Herren, glaubt mir! Niemand von uns hat von diesem Schatz gewusst, weder mein Gesinde noch ich! Wir …«
»Aber Ihr müsst doch etwas gehört oder gesehen haben! So ein Haufen Gold löst sich ja nicht einfach in Luft auf«, stieß Stakkes Stellvertreter Urs Markbein erregt aus. Ihm war klar, dass die Leute rebellieren würden, wenn sie nicht bald ihren Sold bekamen.
Erkenwaldt hob die Hand, um die aufbrandende Diskussion zu unterbrechen, und befahl dem Wirt, weiter zu berichten.
»Wir haben nichts Besonderes bemerkt!«, rief Schnuß verzweifelt. »In der Nacht steigen viele Gäste die Treppe hinauf und hinunter, um zum Abtritt zu gehen, und die sind nicht immer nüchtern. Da herrscht viel Lärm im Haus. Aber einer meiner Knechte bleibt stets bis spät in die Nacht über auf, um Gäste einzulassen und deren Pferde zu versorgen, denn unser Haus ist eine vom Fürstbischof privilegierte Poststation.«
»Und? Hat der Knecht nichts mitbekommen?«, schnauzte Markbein den Wirt an.
Erkenwaldt trat dazwischen. »Lasst den Mann reden, Markbein! Der Knecht hat etwas gesehen, und zwar etwas sehr Bemerkenswertes.«
Bei den Worten winkte er den Knecht zu sich, der neben dem Zugpferd stand und sich an dessen Mähne klammerte, als wäre der Gaul sein letzter Halt.
»Sag freiheraus, was du gesehen hast!«, befahl er. »Du brauchst keine Angst zu haben, du stehst unter meinem Schutz.«
Trotz der beruhigenden Worte starrte Kutte angstvoll in die Runde. Erst als der Wirt ihn zum Reden aufforderte, räusperte er sich und begann zu sprechen. »Bei den Pferden war ich! Ich bin nachts immer bei den Pferden. Von dort aus kann ich den ganzen Hof überblicken. Irgendwann weit nach Mitternacht klopfte es an das Tor. Da habe ich meine Laterne genommen und bin hingegangen. Es stand einer draußen …«
»Wer stand draußen?«, fragte Markbein erregt.
Erkenwaldt verzog unwillig das Gesicht. »Jetzt lass den Mann endlich reden! Das, was er zu sagen hat, ist höchst aufschlussreich. Erzähl ganz genau, Kutte, was du gesehen hast.«
»Ja, nur den Offizier«, stammelte der Knecht nervös. »Er befahl mir, ihn einzulassen, dann ist er an mir vorbei ins Haus. Soweit ich gehört habe, muss er die Treppe hochgestiegen sein und an eine Tür geklopft haben.«
»Hast du den Offizier erkennen können?«, fragte jetzt Erkenwaldt selbst.
»Sein Gesicht konnte ich nicht sehen. Die Kerze in meiner Laterne war schon fast abgebrannt, und er trug einen Schlapphut. Da waren lange Federn dran, wisst Ihr, Herr? Gewiss waren es Reiherfedern.«
»Und weiter? War der Mann groß oder klein? Was trug er für einen Rock?«
»Einen langen, blauen Rock hatte er an, Herr. Und groß war er, mindestens einen Kopf größer als ich. Und viel breiter. Ja, und blond war er auch.«
»Das war sicher ein gottverdammter Franzos!«, rief einer der kaiserlichen Dragoner. »Ein paar von denen tragen blaue Röcke.«
Erkenwaldt winkte ihm zu schweigen und wandte sich wieder Kutte zu. »Trug der Mann eine französische Uniform? Du weißt doch, wie Franzosen aussehen, oder nicht?«
»Wohl, weiß ich …«, antwortete der Knecht nach kurzem Überlegen. »Nein, das war kein Franzose …«
Der Zahlmeister Scheller schob sich neben Erkenwaldt. »Ich glaube auch nicht, dass es sich um einen Franzosen gehandelt hat. Die tragen keine langen Röcke und auch keine Schlapphüte mit Reiherfedern. Aber bei uns im Lager gibt es einen Mann, auf den diese Beschreibung haargenau passt.«
Hinggendorff schüttelte verwundert den Kopf. »Ihr meint doch nicht etwa den Stakke?«
Scheller nickte eifrig. »Kein anderer kann es gewesen sein!«