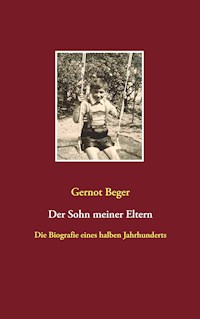
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Muss man ein bekannter Schauspieler, Politiker oder Wissenschaftler sein, um eine Biografie zu schreiben. Nein, sagt Gernot Beger. Weder er, noch seine Eltern waren oder sind berühmt. Aber auch ein normales Leben kann einzigartig genug sein, um darüber zu berichten. Insbesondere dann, wenn es, wie in diesem Buch, in einer authentischen und sehr offenen Weise erfolgt. Die Erzählung konzentriert sich auf die ersten 18 Lebensjahre des Autors und gibt auch Einblicke in das Leben seiner Eltern sowie in das politische und kulturelle Umfeld der Jahre 1920 bis 1968. Ein halbes Jahrhundert wird lebendig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Eltern Christel und Heinz Beger gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Zwischen zwei Weltkriegen
Kapitel 2: Sachse trifft Rheinländerin
Kapitel 3: Die ersten Lebensjahre
Kapitel 4: Schulzeit
Kapitel 5: Lehrjahre
Epilog
Namensverzeichnis
Vorwort
Als ich mich mit dem Gedanken beschäftigte, dieses Buch zu schreiben, erfasste mich eine angenehme Unruhe, die den Vorbereitungen auf eine ausgefallene Urlaubsreise ähnelt. Und tatsächlich handelt es sich ja um eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit. Die Kindheit wird wieder lebendig und vieles, was in den vergangenen Jahren verschüttet war, kann wieder freigelegt werden. Es ist ein Lernprozess, durch den man sich und die anderen besser verstehen lernt. Die entscheidenden Impulse für dieses Buch gab mir zum einen die Lektüre des Romans „Die Asche meiner Mutter“ von Frank McCourt. In äußerst amüsanter Form beschreibt der irische Schriftsteller darin die Not in seiner Heimat und die geballten widrigen Lebensumstände seiner Familie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mir ist klar, dass zumindest meine Kindheit im Nachkriegsdeutschland sehr viel unspektakulärer verlief. Ich denke, ich habe dafür aber andere interessante Schwerpunkte gefunden, die eine unterhaltsame Lektüre versprechen.
Ein anderer Grund, dieses Buch zu schreiben, war der Umstand, dass meine Mutter in der 2. Jahreshälfte 2012 an Alzheimer erkrankte und zum Jahreswechsel 2012/2013 einen Schlaganfall erlitt, der die Krankheit sprunghaft verstärkte. Sie war nicht mehr in der Lage, im Haus ihrer Eltern alleine zurecht zu kommen. Sie musste in ein Pflegeheim wechseln. Als ich in den Monaten danach ihren Haushalt auflöste, die über viele Jahre gesammelten Unterlagen, Dokumente und persönlichen Sachen sortierte, zog nicht nur mein Leben, sondern zum Teil auch das meiner Eltern in kurzer Zeit an meinem geistigen Auge vorbei. Ein weiterer Grund, das Geschehene und Erlebte festzuhalten.
Dieses Buch versteht sich nicht als eine Autobiografie in Form einer Dokumentation. Gleichwohl sind alle Namen und Ereignisse authentisch – man könnte auch sagen schonungslos authentisch, denn es wird sehr persönlich berichtet. Die an einigen Stellen gewählte wörtliche Rede ist sinngemäß so erfolgt oder hätte – verstehen Sie dies bitte als Zugeständnis an die schriftstellerische Freiheit – so erfolgen können.
Kapital 1: Zwischen zwei Weltkriegen
Mit etwas Pech hätte dieser Wintermorgen schlimm enden können. Der gerade 7 Jahre alte Erstklässler Karl Herbert Heinz Beger, normalerweise nur Heinz genannt, war mit vier Geschwistern auf dem morgendlichen Weg zur siebenstufigen Volksschule in Großraschütz. Es war einer der ersten bitterkalten Tage des Winters 1926/27 und es hatte frisch geschneit. Die Wegstrecke von dem bei Großenhain in Sachsen gelegenen Zschieschen Nr. 23b – der kleine Ort hatte mit seinen gerade mal 670 Einwohnern nicht mal Straßennamen – zur Schule war lang und eintönig. Nur einige Buchen reckten ihre kahlen schneebedeckten Äste in den dunklen Himmel. Die dahinterliegenden Felder bildeten eine weiße gleichmäßige, kaum wahrnehmbare Ebene. Ein am Wegrand liegender Teich, der der nahegelegenen in 1864 gegründeten Bergbrauerei im Winter als Eisstock diente, war da - her eine willkommene Abwechslung. War das Eis schon fest genug, um es zu betreten? Wenn es hielt, dann zuerst bei ihm, Heinz Beger, dem achten und jüngsten Kind des Webstuhlfabrikarbeiters Carl Richard Beger und seiner Ehefrau Anna Hulda Beger. Obwohl Heinz ein schlankes Kind war und vorsichtig versuchte, quer über den Teich zu gehen, hielt das Eis nicht. Heinz sank nach einem trockenen Klirren bis zu den Schultern ein und schrie aus Leibeskräften. Das eiskalte Wasser schmerzte, als wenn tausend kleine Nadeln auf seine Haut einstachen. Er konnte zwar stehen, nicht aber zurück ans Ufer gelangen. Das Eis brach jedes Mal unter seinem Gewicht ein, wenn er versuchte herauszuklettern. Fang den Schal, rief ihm sein Bruder Fritz zu. Fritz, mit 13 Jahren der älteste seiner Brü - der, hatte sich vorsichtig aufs Eis gelegt und Heinz seinen langen Schal zugeworfen. Nun konnte er den laut schreienden Heinz vorsichtig herausziehen. Als sie sahen, wie das eisige Wasser an seinen Beinen entlang lief und aus den Schuhen quoll, ahnten sie Schlimmes. Weniger wegen der gesundheitlichen Folgen als wegen des Ärgers, der sie erwartete. Was war jetzt zu tun? Heinz konnte unmöglich so zur Schule gehen, er würde sich eine Lungenentzündung holen. Also brachten Fritz und Walter ihren völlig durchnässten und vor Kälte und Angst zitternden jüngsten Bruder auf dem schnellsten Weg nach Hause. Heinz blieb ein gehöriges Donnerwetter und eine schallende Ohrfeige von Mutter Anna nicht erspart. Und – einmal in Fahrt – bekamen seine beiden Brüder auch ihr Fett ab. Schließlich waren sie für Klein-Heinz verantwortlich gewesen. Aber, und damit hatte die Sache für Heinz einen kleinen Vorteil, die Schule war an diesem Tag gelaufen – und zwar ohne ihn. Und er durfte den ganzen Vormittag im warmen Bett verbringen.
Zur gleichen Zeit gab es 700 km weiter westwärts im klimatisch milderen Rheinland ein Ereignis von großer Tragweite, jedenfalls für den kleinen Heinz – und auch für mich, den Erzähler! Die künftige Ehefrau von Heinz, Christel Königs, meine Mutter, wurde am 1.11.1926 in Wevelinghoven auf der Poststraße 39 geboren. Christels Eltern Franz und Maria Königs stammten beide aus dem kleinen benachbarten Ort Hülchrath und kannten sich seit ihrer Kindheit. Im Gegensatz zu meinem Vater war Christel ein Einzelkind, also Mitglied einer aus heutiger Sicht modernen Kleinfamilie. Damit sind die Akteure ins Leben gerufen, die mich zu gegebener Zeit hier auftreten lassen. Aber das dauert noch etwas. Zurück zu Klein-Heinz, dem Nesthäkchen der Familie Beger, und den Verhältnissen in Sachsen in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Die Großfamilie Beger war arm. Heinz trug zum Beispiel bei seinem unfreiwilligen winterlichen Badeausflug wie die meisten anderen Kinder seines Alters nur kurze Hosen. Auch die anderen Dorfbewohner mussten den Pfennig mehrmals umdrehen, bevor sie ihn ausgaben. Dabei war die schlimmste wirtschaftliche Nachwirkung des 1. Weltkriegs, die Hyperinflation, gebannt. Auf deren Höhepunkt im November 1923 kostete in Berlin ein Hühnerei stolze 230 Milliarden Reichsmark. Eine Straßenbahnfahrt war da für 50 Milliarden Reichsmark vergleichsweise billig. Die Preise wechselten nahezu stündlich, Briefmarken wurden ohne Aufdruck hergestellt, und die Beamten schrieben den gerade gültigen Stand per Hand ein. Der Tageslohn eines gelernten Arbeiters in Berlin betrug 3 Billionen Reichsmark. Nach Einführung der Rentenmark und der neuen Reichsmark in 1924 hatten sich die Verhältnisse wieder stabilisiert. Man musste das Geld, dass man eben erst verdient hatte, nicht gleich wieder ausgeben, um einen Wertverlust zu vermeiden. Sogar das Sparen machte wieder Sinn. Die Kaufkraft war jedoch weiterhin gering.
Die auf dem Land lebenden Begers hatten die Möglichkeit, Lebensmittel günstiger zu bekommen als die Städter. Heinz nutzte mit seinem ältesten Bruder Fritz und seiner Schwester Hilde zusammen mit den anderen Dorfbewohnern die weitläufigen Kartoffelfelder eines naheliegenden Rittergutes zur Nahrungsergänzung. Man nannte dies die tolerierte Nachbeharkung. Die bereits abgeernteten Felder wurden nochmals sorgfältig durchgearbeitet. Mit gutem Erfolg. Manchmal sammelten die Begers an einem Nachmittag einen Zentner Kartoffeln. Im Frühjahr, Sommer und Herbst suchte das Rittergut Kinder für die Feldarbeit. Da war Heinz froh, beim Rübenziehen, bei der Getreide- oder Kartoffelernte einige Reichsmark verdienen zu können. Für den Nachmittag gab es 75 Pfennige und in den Schulferien kam der kleine Schwerarbeiter auf 1,50 Reichsmark für den ganzen Tag. Das machte den Kindern Spaß, auch wenn der Rücken schon mal weh tat. Wenn es aber freitags das Geld für die ganze Woche gab, war Heinz richtig stolz. Er fühlte sich dann wie ein Erwachsener, wie ein Arbeitsmann, der die lästige Schule hinter sich gelassen hatte. Besonders erfreulich für ihn war, dass er seinen Verdienst immer für sich behalten durfte. Aber es wurde nicht nur gearbeitet. Im nahegelegenen Mülbitzbach entwickelte Heinz ein spezielles Hunde-Paddeln. Es hatte mit Schwimmen nur insoweit zu tun, als man sich damit über Wasser hielt. Fahrradfahren lernte er auf einem klapprigen Damenrad. Mit 11 Jahren kaufte er sich dann mit dem auf dem Rittergut verdienten Geld das erste eigene. Es war zwar nur gebraucht, aber er war stolz wie ein Schneekönig.
Heinz erlebte innerhalb der kleinen Verhältnisse seines Elternhauses durchaus geordnete und angenehme Kindheitstage. Sein Vater Carl erfreute sich einer festen Arbeit in der benachbarten Kreisstadt Großenhain und Mutter Anna hatte alle Hände voll zu tun, Ehemann und 8 Kinder zu versorgen. Beide Eltern hatten die Umgebung um den kleinen Ort Zschieschen, der 1961 in Großenhain eingemeindet wurde, nur wenige Male verlassen. Das Leben plätscherte hier gemächlich dahin. Bis zur sächsischen Metropole Dresden waren es immerhin mehr als dreißig und bis zur Reichshauptstadt Berlin sogar über hundertvierzig Kilometer. Vater Carl war nur wenige Male in seinem Leben in Berlin gewesen. Er hatte die politischen Veränderungen dort nach den Wirren des verlorenen Krieges mit hoffnungsvollem Interesse verfolgt. Sein Herz schlug für die Sozialdemokratie. Beherrscht wurde das öffentliche Leben jedoch von Linksradikalen. In 1919, dem Geburtsjahr von Heinz, rief die im gleichen Jahr gegründete Kommunistische Partei Deutschlands zum Aufstand, zur Revolution auf. Allerdings wurde der Aufruf zum bewaffneten Kampf gegen die von Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann geführte Reichsregierung von den Berliner Arbeitern nur mäßig befolgt und der Aufstand konnte niedergeworfen werden. Die Führer der Revolution, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, tauchten unter. Wegen der Radikalisierung der Arbeiterschaft wurde zu den Reichstagswahlen 1919 ein deutlicher Linksruck erwartet. Diese Reichstagswahl war auch aus anderen Gründen etwas Besonderes. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte nahmen Frauen an ihr teil und zum ersten Mal wurde nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Danach erhielt jede Partei nach der Prozentzahl der erreichten Stimmen Sitze in der Nationalversammlung. Die Ergebnisse der Reichstagswahl waren sensationell. Der erwartete deutliche Linksruck blieb aus. Die Deutschen, so könnte man witzeln, eigneten sich nicht für Revolutionen, nicht auf der Straße und auch nicht per Stimmzet tel. Weder die SPD erhielt bei den Reichstagswahlen 1919 die absolute Mehrheit, noch übersprangen SPD und die radikale Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) gemeinsam die 50-Prozent-Marke. Vielleicht hatten die Frauen mit ihren Stimmen hierzu maßgeblich beigetragen. Nur in Sachsen, dem Land, in dem die Begers lebten, erreichten SPD und USPD bei der Wahl zur Sächsischen Volkskammer in 1919 mit 57,9 Prozent zusammen die absolute Mehrheit.
Das Deutsche Reich zu Beginn der zwanziger Jahre zeigte sich nicht nur in der Politik chaotisch und extrem. Auch Kunst und Kultur erlebten nach den harten Jahren des I. Weltkriegs eine ungeahnte Entwicklung. Heinz’ Eltern behagte dies – sofern sie davon im kulturverlassenen Zschieschen überhaupt etwas mitbekamen – nicht immer. Befreit von der einschränkenden und spröden Moral des preußischen Militarismus schossen im ganzen Land neue Lichtspielhäuser und in den großen Städten Revuetheater aus dem Boden, entstanden neue Galerien, Zeitungen und Bücher. Oftmals mit amourösen, verrückten oder schockierenden Inhalten.
Die Soldaten des I. Weltkrieges waren durch ihre Militärzeit aus dem geordneten und oftmals behüteten zivilen Leben herausgerissen worden und erlebten während des Krieges eine neue Welt voller Schrecken und Gräuel, die sie oftmals zu körperlichen und physischen Krüppeln machte. Moralische Grundsätze gingen verloren und viele wollten nach Ende des verlorenen Krieges hauptsächlich genießen, was das Leben noch zu bieten hatte. Sogenannte Aufklärungsfilme, wie „Moral und Sinnlichkeit“, „Hyänen der Lust“ oder „Venus im Pelz“ fanden begeisterten Zulauf. Erst mit dem im April 1920 verabschiedeten neuen Reichslichtspielgesetz wurde wieder eine Zensur eingeführt, die jedoch weitaus toleranter war, als die entsprechende Regelung vor dem I. Weltkrieg. So konnte am 23.12.1920 im Kleinen Schauspielhaus Berlin Arthur Schnitzlers „Der Reigen“ uraufgeführt werden. Das Stück bestand aus einer Szenenreihe, die das amouröse Leben als Querschnitt durch die verschiedenen sozialen Milieus mit ständigem Partnertausch darstellte. Es wurde schon 1900 geschrieben, konnte aber damals noch nicht aufgeführt werden, weil es heftige Proteste gegen dessen „Unsittlichkeit“ gegeben hatte. Das Reichslichtspielgesetz war letztlich so liberal, dass es bereits Mitte der zwanziger Jahre FKK-Filme wie „Wege zu Kraft und Schönheit“ unter der Regie von Wilhelm Prager ermöglichte. Es wurde Nacktheit total gezeigt, wenngleich sich diese im Kleid von ästhetischer Gymnastik, Athletik und Tanz an die Körperkultur der Antike anlehnte. Diese Filme waren zwar Kassenschlager, wurden aber in Zschieschen, dem Wohnort der Begers, nie gezeigt.
Der tolerante Geist der Weimarer Republik sprengte viele althergebrachte Fesseln. Der Grundstein für die sogenannten Goldenen Zwanziger, also vornehmlich die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, wurde gelegt. In der Berliner Galerie Otto Burchardt eröffnete 1920 die Erste Internationale Dada-Messe. Sie wurde in der Hauptsache von Raoul Hausmann, George Grosz und John Heartfield organisiert, Mitgliedern des 1918 gegründeten Berliner Dada-Clubs. Die Ausstellung verstand sich als totale Absage an die bisherige bürgerliche Malerei. Fotocollagen, Klebebilder, Witzbilder und ausgestopfte Puppen schockierten die Besucher. Im gleichen Jahr gründete der Düsseldorfer Galerist Alfred Flechtheim die Zeitschrift „Querschnitt“, ein Kulturmagazin mit einer weltoffenen, anspruchsvollen bis snobistischen Haltung als Ausdruck des Lebensgefühls einer neuen geistigen Elite.
Auch technische Neuerungen beflügelten das Kulturleben. Als am 24.9.1923 in Berlin erstmals öffentlich ein Tonfilm aufgeführt wurde, lief dieser wochenlang vor ausverkauftem Haus und die Karteninteressenten standen sich in langen Schlangen die Beine in den Bauch. Dabei hatte der Streifen un - ter dem Titel „Das Leben auf dem Dorfe“ einen überaus beschaulichen Inhalt. Der Tonfilm ist übrigens nach einem Verfahren entstanden, dass die deutschen Ingenieure Hans Vogt, Joseph Engl und Joseph Masolle entwickelt haben. Da die deutsche Industrie das Potential dieser Innovation nicht erkannte, wurde die Entwicklung an amerikanische Investoren verkauft. Die deutsche Unterhaltungswelt in dieser Zeit wurde von Jazz und vom Shimmy, einem neuen Tanz, in Atem gehalten. Beim Shimmy werden nicht nur die Beine, sondern der ganze Körper nach Jazzmusik in wirbelnde und schüttelnde Bewegungen gebracht. Die „Berliner Illustrierte“ beschrieb diesen Rhythmus am 27.2.1927 nicht als Tanz, sondern als Fieberdelirium.
Die Berliner Mode erlaubte viel Bein. Die Röcke wurden immer kürzer. Im Mai 1927 zeigte das Titelfoto der Illustrierten „Die Dame“ sogar ein kniefreies Modell. Eine Provokation. Dabei konzentrierte sich diese Zeitschrift des Ullstein-Verlags nicht etwa auf reißerische Fotos, die nur innerhalb eines rotlichtähnlichen Milieus unter dem Ladentisch verkauft wurden. Bei der 1912 gegründeten „Die Dame“ handelte es sich um eine journalistisch erstklassig gemachte Zeitschrift, die Mitte der zwanziger Jahre als bestes Journal seiner Art auf dem Weltmarkt galt. Zur Liste der renommierten Autoren gehörten u.a. Arthur Schnitzler, Bert Brecht, Kurt Tucholsky, Stefan Zweig und Carl Zuckmayer. Die deutsche Presselandschaft spiegelte die vielseitigen und radikalen Strömungen in Politik und Kultur wider. Existierten 1918 etwa 1.850 Tageszeitungen im Deutschen Reich, so verdoppelte sich diese Anzahl innerhalb von wenigen Jahren. Allein in Groß-Berlin gab es 1922 rund 100 Zeitungen mit jeweils mehreren Ausgaben - pro Tag!
In Zschieschen wurden nicht mehr Zeitungen angeboten als man Finger an einer Hand hat. Das störte das Familienoberhaupt Carl Beger recht wenig. Er las ab und zu das Radebeuler Tageblatt, eine unabhängige bereits 1871 gegründete, täglich erscheinende Zeitung und selten einmal den „Vorwärts“, die Parteizeitung der Sozialdemokraten. Ihm fehlte es an Zeit und auch an Interesse. Sein Arbeitstag war einfach zu lang. Die Reichsregierung hatte bereits 1923 beschlossen, zur Behebung der Notlage in der deutschen Wirtschaft die Arbeitszeiten von Arbeitern auf 59 Stunden pro Woche heraufzusetzen. Schwerarbeiter und Beamte – beide Berufsgruppen wurden in dem Gesetz tatsächlich gleichgesetzt – mussten nur 54 Stunden arbeiten. Einschließlich der Wegzeiten kam Carl Beger somit auf eine tägliche Arbeitszeit von fast 12 Stunden. Andererseits hatte der gleiche Reichstag 1927 einen Beschluss gefasst, der die ausdrückliche Zustimmung von Vater Carl fand: das Gesetz für Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung. Für Carl Beger war das Gesetz ein ganz wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der sozialen Verhältnisse. Deutschland wurde damit eines der ersten Länder der Welt, das Hilfe für Erwerbslose nicht länger als karitative Fürsorge, sondern als Verpflichtung für die gesamte Gesellschaft verstand. Auch der Umstand, dass dieses Gesetz nicht von den Sozialdemokraten ausgearbeitet wurde, sondern vom langjährigen Arbeitsminister Dr. Heinrich Brauns, der dem Zentrum angehörte, machte für Carl Beger keinen Unterschied. Nach dem neuen Gesetz fiel die Bedürftigkeitsprüfung für diese Leistung weg. Jeder, der unfreiwillig arbeitslos wurde, hatte einen Rechtsanspruch auf Unterstützung durch den Staat. Die Höhe dieser Unterstützung war abhängig vom Verdienst der letzten 13 Wochen vor Beginn der Arbeitslosigkeit. Sie reichte von Wochensätzen von 6,00 bis 22,05 Reichsmark. Gezahlt wurde die Unterstützung über maximal 26 Wochen. Der Versicherungspflicht unterlagen in Deutschland etwa 16,5 Millionen Arbeitnehmer, die 3 Prozent ihres Grundlohnes in die Versicherung einzahlten. Der Arbeitgeber zahlte dann noch mal den gleichen Betrag hinzu. Mit diesem Geld konnte man keine großen Sprünge machen, aber man konnte sich – insbesondere wenn man 8 Kinder hatte wie Carl Beger – etwas abgesichert fühlen. Die beste Absicherung gegen finanzielle Not war jedoch ein sicherer Arbeitsplatz. Und den hatte Carl, zumindest im Augenblick. Er arbeitete bei der Großenhainer Webstuhl- und Maschinenfabrik AG in Großenhain, die noch zusätzliche Arbeiter einstellte. Die Textilindustrie, ja sogar die gesamte Wirtschaft florierte. Deutschland gewann nach dem verlorenen I. Weltkrieg wieder an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
In Düsseldorf, nicht weit entfernt von Wevelinghoven, dem Wohnsitz der bereits erwähnen rheinischen Kleinfamilie Königs, entstand im Geburtsjahr von Christel das größte deutsche Montanunternehmen, die Vereinigte Stahlwerke AG. Dieses Unternehmen entwickelte sich aus dem Zusammenschluss von sieben Unternehmen der Hütten- und Bergwerksindustrie, darunter die Stinnes-, Thyssen- und Phoenixgruppe und vereinte ein Viertel der deutschen Steinkohle- und ein Fünftel der Eisen- und Stahlerzeugung in Deutschland. Der Montanbereich war zu dieser Zeit wohl die wichtigste Branche für die wirt - schaftliche Erholung Deutschlands. Diese positive Entwicklung setzt sich in 1927 verstärkt fort. Die Industrieproduktion hatte eine bisher nicht gemessene Höhe erreicht und die Arbeitslosenzahlen erfreuten sich gleichzeitig mit nur 355.000 Hauptunterstützungsempfängern des niedrigsten Standes seit Einführung der Arbeitslosenversicherung. Kein Wunder also, dass die Deutschen im Rheinland, in Sachsen und im gesamten Reich mehr Geld für Konsum und Unterhaltung ausgaben. Alleine die 3.000 deutschen Kinos hatten zwei Millionen Besucher täglich. Das Rheinland hatte zudem noch einen besonderen Grund zu feiern. Am 1.2.1926 zogen die letzten englischen und belgischen Besatzungstruppen ab. Die Euphorie war so groß, dass der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer den Kölner Kindern einen schulfreien Tag gewährte.
Christels Vater, Franz Königs, ein einfacher Arbeiter, der in kleinen Verhältnissen lebte, hatte an diesen günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seinen Anteil. Sein Arbeitgeber war die 1908 gegründete International Harvester Company in Neuss, ein amerikanischer Hersteller für Landmaschinen, dem die Motorisierung in der Landwirtschaft gute Gewinne ermöglichte. Franz Königs verbrachte sein gesamtes Arbeitsleben bei dieser Firma. Als junger Mann fing er dort an, um die Firma erst wieder mit dem Renteneintritt zu verlassen. Jedenfalls hatte er einen relativ sicheren Arbeitsplatz, was der Drei-Personen-Familie einen bescheidenen Wohlstand ermöglichte. Insofern waren die Königs im Rheinland mit den Begers in Sachsen zu vergleichen.
Auch die Kommunen hatten wieder Geld in den Kassen und scheuten sich nicht, viel Geld in teure Prestigeprojekte zu stecken. Berlin ließ sich den Umbau des Opernhauses 14 Millionen Reichsmark kosten. Die städtische Kölner Messe richtete im Mai 1928 eine luxuriöse Presseausstellung, die Pressa, eine Mammutschau der Superlative, aus. An ihr beteiligten sich fast alle europäischen Staaten sowie Lateinamerika, China und Japan. Sie spannte einen Bogen von der kulturhistorischen Seite des Pressewesens bis hin zu den seinerzeit modernsten Herstellungstechniken. Die ehrgeizige Schau war schon monatelang zuvor Anlass für stolze Vorberichte. Die Stadt hatte für diese Messe einen riesigen Gebäudekomplex mit Sitzungssälen von bis zu 1.200 Plätzen gebaut. Ein 85 Meter hoher Turm war als Wahrzeichen entstanden. Die Schau galt als das Luxuriöseste, was bisher auf diesem Sektor präsentiert wurde.
Dabei hatte das Deutsche Reich die riesige Summe von 132 Milliarden Reichsmark an Reparationen zu zahlen. Dieser Betrag wurde dem Deutschen Reich am 16.8.1924 von den Siegermächten sozusagen als Schadenersatz für den verlorenen I. Weltkrieg auferlegt. In 1924 war eine Milliarde Reichsmark aufzubringen. In jährlich steigenden Raten sollte sich dann ab 1928 der Betrag auf 2,5 Milliarden Reichsmark pro Jahr belaufen. Die komplizierten Zahlungsmodalitäten wurden von dem amerikanischen Bankier und Politiker Charles Dawes ausgearbeitet. Deshalb nannte man diesen Vertrag Dawesplan. Die jährlichen Zahlungen waren allerdings deutlich zu hoch und konnten von der deutschen Wirtschaft nicht aufgebracht werden. Daher drängte das Deutsche Reich 1929 mit großem Nachdruck auf eine Revision der Reparationsmodalitäten.
Die Reichsregierung hatte jedoch enorme Schwierigkeiten, die Staaten, mit denen über eine Streckung der Reparationen verhandelt wurde, von der Notwendigkeit einer Revision zu überzeugen. Außenminister Gustav Stresemann artikulierte dieses Problem vor dem Hintergrund der kostenträchtigen Selbstdarstellung vieler Kommunen in einem Schreiben vom 24.11.1927 an den Duisburger Oberbürgermeister Karl Jarres mit den Worten: Haben Sie bitte die Güte, mir zu sagen, was ich den Vertretern fremder Mächte antworten soll, wenn sie mir sagen, dass alle diese Dinge den Eindruck machen, als wenn Deutschland den Krieg nicht verloren, sondern gewonnen hätte. Ich bin gegenüber diesen Vorwürfen mit meinem Latein am Ende.
Letztlich gelang es, einen neuen, für das Deutsche Reich günstigeren Reparationsplan auszuhandeln. Er wurde wiederum sehr wesentlich von einem amerikanischen Bankier, diesmal war es Owen D. Young, geprägt, so dass man die neue Vereinbarung Youngplan nannte. In Zahlen lautete das Ergebnis nunmehr so: Deutschland musste insgesamt 116 Milliarden Reichsmark Reparationen innerhalb von 59 Jahren, demnach also bis 1988, zahlen. Die jährlichen Verpflichtungen sollten zunächst nur 742 Millionen Reichsmark betragen, um dem Reich eine Atempause zu verschaffen. Dieser Plan verschaffte Deutschland mehr finanziellen Spielraum, außerdem entfielen sämtliche Kontrollen der deutschen Wirtschaft. Die alliierte Reparationskommission stellten ihre Tätigkeit ein. Die von Deutschland zu leistenden Zahlungen gingen an die neu zu gründende Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die die Gelder weiterverteilte. Sofort nach Bekanntwerden von Einzelheiten des Youngplanes wurden wütende Proteste und strikte Ablehnungen der extrem rechten und linken Parteien laut. Das Kabinett stimmte dem Plan zwar am 21.6.1929 zu, aber bereits 1932 sollte das ganze Vertragswerk infolge der Weltwirtschaftskrise Makulatur werden.
Im Bereich der Technik knüpfte Deutschland wieder an die Weltspitze an. Am 15.8.1928 liefen in Hamburg und Bremen zwei Ozeanriesen, „Europa“ und „Bremen“, vom Stapel. Die beiden für den Norddeutschen Lloyd gebauten Schnelldampfer waren Symbol für den Wiederaufstieg der deutschen Flotte. In Hamburg nahmen der amerikanische Botschafter und andere Prominenz an dem Stapellauf teil, in Bremen hielt Reichspräsident Paul von Hindenburg die Taufrede. Die beiden Ozeandampfer hatten je 46.000 Bruttoregistertonnen und waren damit 50 Prozent größer als die bisher größten deutschen Schiffe. Die Bremen sollte ein Jahr später, im Juli 1929, das „Blaue Band“ für die schnellste Ozeanüberquerung erringen. Sie brauchte nur 4 Tage, zwölf Stunden und 17 Minuten für die Strecke Cherbourg – New York. Den bisherigen Rekord hatte sie damit um acht Stunden unterboten. Die Trophäe wurde in Deutschland als eine Art Nationalsieg gefeiert. Sie sei, so wurde betont, ein Symbol für Deutschlands unaufhaltsamen wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Eher kurios dürfte dagegen am 1. Mai 1928 die Ankündigung des Opel-Werkes gewirkt haben, einen Weltraumflug zu unternehmen. Mit dem Kunstflieger Antonius Raab hatte es einen entsprechenden Vertrag über diesen ersten Weltraumflug abgeschlossen. In den Wochen darauf meldeten sich hunderte von Leuten, die sich als Passagiere für das Weltraumschiff zur Verfügung stellen wollten. Die Presse meldete, der Bau der Rakete, mit der ein Flug in die Stratosphäre möglich sein sollte, schreite gut voran, stellte





























