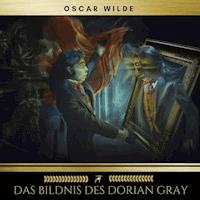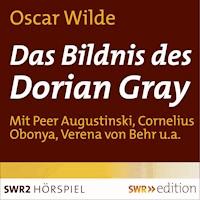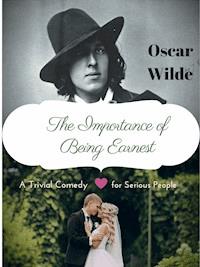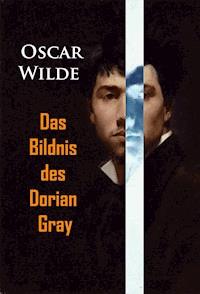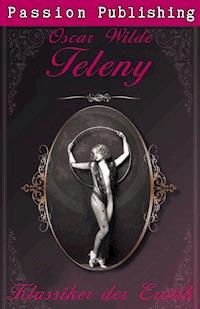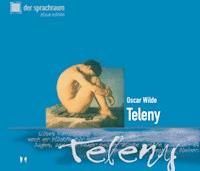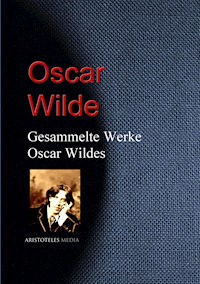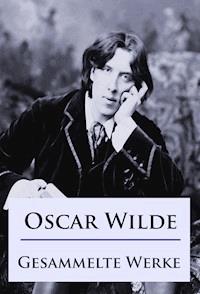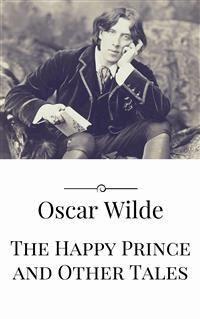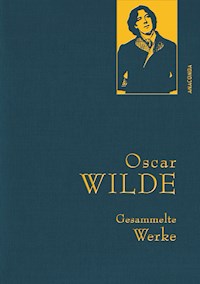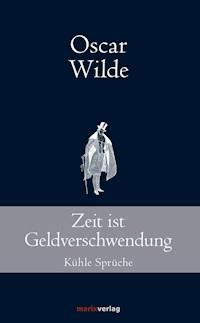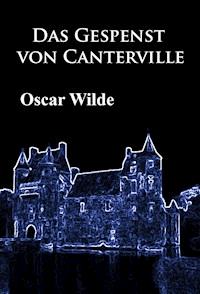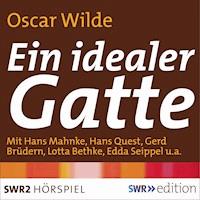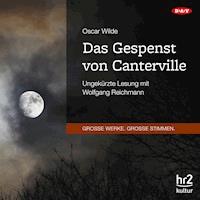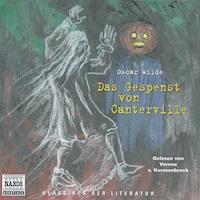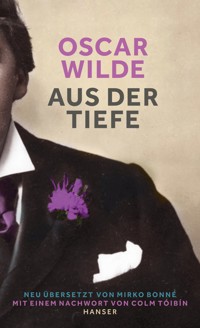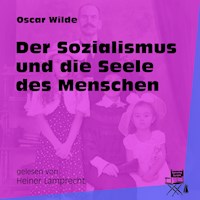
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Drehbuchverlag Audio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der weltberühmte Schriftsteller Oscar Wilde (1854–1900) entwirft in diesem Essay aus dem Jahr 1891 eine soziale Utopie, die auf einer radikalen Neudefinition von Individualismus und Sozialismus beruht. Sozialismus sollte nicht nur als politische oder ökonomische Bewegung verstanden werden, sondern auch als Voraussetzung für die vollständige Entfaltung der Persönlichkeit jedes Menschen. Wahre Freiheit kann nur in einer Gesellschaftsform entstehen, die von den Zwängen des Privateigentums und der Konkurrenz befreit ist. Wilde sieht die Rolle des Sozialismus darin, jedem Menschen materielle Sicherheit zu garantieren und ihn so von belastenden Verpflichtungen zu befreien. Karl Kraus würdigte diese Schrift 1904 in der Fackel als "das Tiefste, Adeligste und Schönste, das der vom Philistersinn gemordete Genius geschaffen" habe.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar WildeDer Sozialismus und die Seele des Menschen
Ein Essay
mit einer Einleitung von Alfred Pfabigan
Aus dem Englischen von Gustav Landauer und Hedwig Lachmann
© 2025 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
ISBN: 978-3-85371-933-6(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-551-2)
Der Promedia Verlag im Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Inhaltsverzeichnis
Über die Autoren
Editorische Notiz
Einleitung
Endzeitgefühle in Politik und Literatur
Wilde-Boykott und internationaler Ruhm
Der Text in der Biografie Wildes
Die Schrift im Kontext der englischen sozialistischen Theorie
Was verstand Wilde unter Sozialismus?
Der »Haben-Mechanismus«
Christentum und Selbstverwirklichung
Wildes Staatsbegriff
Das ungelöste Problem der repressionsfreien Arbeitsorganisation
Individualismus
Konformismus als Feind der Kunst
Pressefeindschaft
Sozialismus, Anarchismus, Utopismus
Was bleibt?
Der Sozialismus und die Seele des Menschen
Vorbemerkung von Gustav Landauer
Navigationspunkte
Cover
Table of Contents
Über die Autoren
Oscar Wilde, geboren 1854 in Dublin, war Schriftsteller und Dramatiker. Wegen seiner Homosexualität wurde er 1895 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung lebte er verarmt in Paris, wo er 1900 starb.
Alfred Pfabigan, geboren 1947 in Wien, unterrichtete Philosophie in Wien, Lancaster/USA und Czernowitz. Über Oscar Wilde und seine verhängnisvolle Beziehung zu Lord Alfred Douglas veröffentlichte er 2025 im Promedia Verlag das Buch „Jeder mordet, was er liebt“.
Editorische Notiz
Die erstmals 1904 erschienene Übersetzung des Essays »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« von Gustav Landauer und Hedwig Lachmann wurde für diese Ausgabe von Vivianne Pärli grundlegend überarbeitet und an die heutige Rechtschreibung angepasst.
Einleitung
Aus heutiger Perspektive, mit Blick auf Oscar Wildes Leben und Gesamtwerk, wirkt sein Essay »Die Seele des Menschen im Sozialismus« wie ein Fremdkörper. »Wären die Armen nur nicht so hässlich, dann wäre das Problem der Armut leicht gelöst.« (Wilde 1905, Bd. 5, 221) Dieser vieldeutige, zynisch klingende Satz aus den »Sätzen und Lehren zum Gebrauch der Jugend« passt zu Wildes gegenwärtigem Image. Der – so Bernard Shaw – »eingefleischte Snob«, Nachfolger der Dandys, Aushängeschild und Star des Schönheitskultes der diffusen »ästhetischen Bewegung« Englands, kein Vertreter der Aufklärung, sondern ein Nachfolger der Romantik, der an Magie glaubte und vor wichtigen Entscheidungen einen Hellseher konsultierte, ein Gesellschaftslöwe, der sich um aristokratische Beziehungen bemühte, ein Gegner der Demokratie (»Demokratie bedeutet lediglich, dass das Volk durch das Volk für das Volk niedergeknüppelt wird«, Wilde 2025, 49), ein dem Luxuskonsum nicht abgeneigter elitärer »Tailors Man« – hatte zu dem, was man damals als »soziale Frage« bezeichnete, kaum eine Beziehung. Was veranlasst einen Dichter mit einem solchen persönlichen Habitus, einen Essay zu verfassen, der Probleme des heute unwiderruflich mit der Arbeiterbewegung – und dazu gehören wohl auch die »Armen« – verbundenen Sozialismus behandelt und der ungeachtet der »antipolitischen« Einstellung seines Autors in der Biografik als »politisch« gilt? (Ellmann 1987, 425)
Endzeitgefühle in Politik und Literatur
»Heutzutage sind wir alle mehr oder weniger Sozialisten.« Dieser in den 1890er-Jahren weit verbreitete Ausspruch wird dem liberalen Parlamentsabgeordneten Sir William Harcourt zugeschrieben. (Kohl 2000, Fn. 62) Er sollte nicht als erste Formulierung eines sozial-liberalen Gesellschaftskonzepts verstanden werden. Die Folgen des Wildwuchses einer ungeregelten kapitalistischen Industrialisierung – grelle Armut, ein hohes existenzielles Risiko und eine unerträgliche Umwelt – beeinträchtigten nicht nur das Leben der Arbeiterklasse schwer, sondern auch das der Wohlhabenden. Spätestens seit der Wirtschaftskrise 1873 verbreitete sich das Gefühl, dass es so »nicht mehr weitergehen« könne. Systemimmanente Alternativen blieben unsichtbar, und so wurde dem »Sozialismus«, was auch immer darunter zu verstehen war, Lösungskompetenz zugeschrieben. Der Sozialismus war »im Gespräch«, und zu Wildes Öffentlichkeitsstrategien gehörte es, neue Strömungen zu »besetzen«, wenn nötig ihre Schlüsselbegriffe umzudeuten und sie so seinem ästhetizistischen Fundamentalismus anzupassen.
Das Publikum war bereit für ein solches Unterfangen. Das belegt der schnelle Erfolg zweier in zeitlicher Nähe zu Wildes Schrift im angelsächsischen Sprachraum erschienener, bis heute erfolgreicher Romane. Beide wurden als sozialistisch vermarktet und gelten in der rückblickenden Einordnung als »utopisch« bzw. als »Science-Fiction«. 1887 veröffentlichte der amerikanische Journalist Edward Bellamy den Roman »Looking Backward 2000−1887«, der auch unter den Titeln »Life In The Year 2000« und »Looking Backward: If Socialism Comes: 2000−1887« bekannt wurde. Ab 1890 erschienen mehrere deutsche Übersetzungen, unter anderem eine von Clara Zetkin, Mitgründerin der Zweiten Internationalen Arbeiterassoziation, damals noch Mitglied der SPD, später berühmte Genossin des Spartakusbundes und der KPD. Nicht nur im deutschen Sprachraum entstanden zahlreiche »Bellamy-Vereine«, und der Roman erfreute sich rasch internationaler Beliebtheit. Drei Jahre nach »Rückblick aus dem Jahre 2000« veröffentlichte der Designer, Maler und Schriftsteller William Morris, Begründer des »Arts and Craft Movements«, den Roman »News From Nowhere«. Auch »Kunde von Nirgendwo« wurde mehrfach schnell ins Deutsche übertragen; eine der Übersetzungen stammt von Natalie Liebknecht und wurde von ihrem Mann Wilhelm, Veteran der 1848er-Revolution und Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie, herausgegeben. Beide Romane hatten mit ihren umfassenden, detailreichen Beschreibungen der zukünftigen Gesellschaft einen viel diskutierten, nachhaltigen Erfolg und beeinflussten das Erwartungsbild des Publikums in Bezug auf den Sozialismus erheblich.
Sie variieren – mit unterschiedlichen Akzenten – das Thema des »Zeitreisenden«, der aus unserer Gesellschaft kommend eine neue Gesellschaftsorganisation kennenlernt und davon berichtet. Bellamys Protagonist schläft 113 Jahre lang, um im Boston des Jahres 2000 in einer idealen, auf genossenschaftlicher Basis organisierten Gesellschaft aufzuwachen, in deren Lebensform ihn seine Gastgeber einführen. In dieser Zukunftswelt erfolgt die Wertschöpfung durch die Arbeit einer industriellen Armee (»industrial service«) mit zeitlich beschränkter Zwangsmitgliedschaft. Der Gewinn wird unter der Bevölkerung aufgeteilt. Die Attraktion des Textes besteht in allerlei, den Leser/innen Bellamys unbekannten, uns heute selbstverständlichen technischen Innovationen, die das Leben erleichtern: Telefon, Kreditkarte, Zustellung erworbener Waren unmittelbar nach dem Einkauf per Rohrpost und eine Art Rundfunk, der mit einem reichhaltigen Programm die intellektuellen Bedürfnisse der Bevölkerung bedient.
Morris lässt seinen Helden ebenfalls die Periode der sozialen Transformation verschlafen und im Jahr 2102, 150 Jahre nach einer erfolgreichen Revolution, in einer idealen sozialistischen Gesellschaft erwachen. Auch hier organisiert man sich genossenschaftlich, wobei die Wertschöpfung jedoch durch den Agrarsektor und das Handwerk erfolgt. Das in Bellamys Roman so wesentliche technische Element bleibt weitgehend ausgeschaltet – man lebt in kleinen ländlichen Einheiten, in denen die gleichberechtigten Geschlechter umweltschonend in Handarbeit qualitativ hochwertige Produkte herstellen. Die industrielle Produktion, die Morris lebenslang bekämpfte, existiert nicht mehr – ebenso wie das damit verbundene Arbeitsleid. Ungeachtet seines Ästhetizismus, der ihn mit Morris die grundsätzliche Intention teilen ließ, stellte sich Wilde in diesem Konflikt eher auf Bellamys Seite und bot Ergänzungen zu dessen technisch orientiertem Konzept an.
Wilde-Boykott und internationaler Ruhm
»The Soul of Man under Socialism« erschien erstmals im Februar von Wildes Schicksalsjahr 1891 in der von seinem Freund und Biografen Frank Harris herausgegebenen FortnightlyReview. Nach Wildes Verurteilung wegen Homosexualität zu zwei Jahren Zuchthaus und dem ein Jahrzehnt dauernden Bann seines Werkes war der Essay nur in einem Raubdruck und einer auf 50 Stück beschränkten Ausgabe erhältlich. In den USA wurde er 1892 gemeinsam mit »The Socialist Ideal Art« von William Morris und »The Coming Solidarity« des Frühsozialisten William Owen veröffentlicht. In Deutschland erschien die von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer angefertigte Übersetzung 1904; 1906 folgte die Übersetzung von Paul Wertheimer in der ersten europäischen Gesamtausgabe, der 1908 die von Robert Ross herausgegebene englische Werkausgabe folgte.
Hedwig Lachmann (1865−1918) stellte eine Schlüsselfigur in der europäischen Wilde-Rezeption dar: 1901 half sie mit ihrer Übersetzung der »Salome«, die Richard Strauss als Grundlage des Librettos seiner gleichnamigen Oper verwendete, Wildes gesamteuropäischen Ruf zu begründen. 1905 publizierte sie die erste Monografie zu Wilde; allein und gemeinsam mit ihrem Gatten Gustav Landauer (1870−1919) übersetzte sie mehrere Essays und den »Dorian Gray«. (Schmidt-Bergmann 2018)
Die Mitwirkung des prominenten pazifistischen Individualanarchisten Gustav Landauer verlieh der deutschen Rezeption der Schrift ein »linkes« Image. Landauer war wegen seines Anarchismus bei der großen Säuberung der marxistisch orientierten II. Internationale 1893 ausgeschlossen worden, 1911 veröffentlichte er den weitverbreiteten »Aufruf zum Sozialismus« (siehe Wolf 1988); nach der Ermordung Kurt Eisners fungierte er in der Münchner Räterepublik ganze neun Tage als »Beauftragter für Volksaufklärung« und fiel später Mitgliedern des Freikorps Epp zum Opfer. (siehe Linse 1974)
Der Text in der Biografie Wildes
Werkgeschichtlich steht der Text nach den beiden wesentlichsten Essays Wildes, dem »Verfall der Lüge« und »Der Kritiker als Künstler« (1889). Wilde verfasste ihn während seiner ersten – und einzigen – Anstellung als Herausgeber einer Frauenzeitschrift. Diese Position nahm er ernst, einschließlich der Verpflichtung, Werbung für Büstenhalter zu machen: »So gewiss, wie die Sonne morgens aufgeht, so gewiss vergrößert und verschönert er (das beworbene Produkt, A. P.) die Büste.« (Holland 2003, 163) Im September 1890 kündigte man ihm – sein letzter publizierter Artikel widmete sich gehäkelten Spitzen. (Belford 2004, 261) Im gleichen Jahr erschien die amerikanische Ausgabe des »Dorian Gray« – Positionen, die in der Sozialismusschrift allgemein besprochen werden, finden sich im Roman zugespitzt und untergründig radikalisiert. Zuvor hatte sein Autor das eheliche Heim verlassen und lebte seit 1886 als Homosexueller. Die erste Begegnung mit dem Studenten Lord Alfred Douglas erfolgt bald nach Erscheinen des Essays – in den drei Jahren der schicksalhaften Beziehung mit dem jungen Mann erlebt Wilde seine schöpferisch fruchtbarsten Jahre; gleichzeitig bereitet sich sein Absturz 1895 vor. (dazu Pfabigan 2025) Werkgeschichtlich handelt es sich um eine Zeit des Übergangs. Die Forderung, die Grenze zwischen Kunst und Kritik aufzuheben, wurde für Wildes persönliche Praxis irrelevant, nachdem er mit »Dorian Gray« den ersten künstlerischen Höhepunkt seines Werkes erreichte; mit dem »Bunbury« bringt er eine absurde Welt auf die Bühne, die wenig mit der des Sozialismus zu tun hat.
Die Schrift im Kontext der englischen sozialistischen Theorie
Auch der englische Sozialismus befand sich in einer Übergangsperiode. Die deutsche Arbeiterbewegung hatte bereits 1869 eine erste, anfänglich brüchige Einheit gefunden. Ungeachtet der Tatsache, dass England das Mutterland der Industrialisierung war, dass der 1883 verstorbene Karl Marx hier seine Analyse des Kapitalismus verfasst hatte, dass 1864 in London die »Erste Internationale Arbeiterassoziation« gegründet worden war und Marxens »zweite Geige« Friedrich Engels unermüdlich versuchte, die Lehren des Freundes als Doktrin der Bewegung zu etablieren, blieb die englische Arbeiterbewegung – gemessen an der organisatorischen Stärke der deutschen und der russischen sowie den dort stattfindenden Debatten – theoretisch unbedarft und organisatorisch schwach. (siehe Thompson 1987)
Philanthropische und tradeunionistische Ansätze dominierten zunächst den von fortschrittlichen Bürgern getragenen Diskurs. In Fragen der Strategie und Taktik blieb der englische Sozialismus unbestimmt und einigte sich erst 1900 unter dem Namen »Labour Party« auf eine gemeinsame Organisation. 1883 gründete man die »Fellowship of the New Life«, die weitgehend lebensreformerisch agierte und das politische Feld mied – eine nicht seltene Tendenz, die in der Historiografie der Arbeiterbewegung vernachlässigt wird und der auch Wildes Text angehört. Dissidente Mitglieder der »Fellowship« gründeten 1884 die intellektuelle Bewegung der »Fabian Society«, zu deren Mitgliedern George Bernard Shaw und H. G. Wells gehörten. Im Lauf der Jahre verließen viele von ihnen die Society und schlossen sich der sozialdemokratischen »Labour Party« an.
Deren zweite Vorform zeigte ein stärkeres politisches Engagement: die 1881 gegründete »Democratic Federation«, die sich ab 1884 »Social Democratic Federation« nannte, zählte Marxens Tochter Eleanor und ihren Gatten Edward Aveling zu ihren Mitgliedern; Friedrich Engels blieb auf Distanz. Kontakte Wildes zu diesen Gruppierungen sind nicht nachweisbar. Doch Wildes Gattin Constance, Rednerin auf einer Friedenskonferenz und in der Bewegung zur Bekleidungsreform aktiv, hatte gewisse Berührungspunkte mit dem Denken der Fabier.
Eine wichtige persönliche Vermittlungsinstanz stellte George Bernard Shaw dar, ebenfalls ein Ire, der schon in Dublin die Empfänge von Lady Jane Wilde, einer bekannten Poetin, besucht hatte. Shaw verstand sich als Sozialist; sein politisches Credo legte er 1928 in dem Buch »The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capitalism« dar. Wilde besuchte 1888 einige Veranstaltungen der »Fabian Society«; dort soll er auch Vorträge Shaws gehört haben. 1889 verfasste er eine Rezension zu einem Buch mit Arbeiterliedern. Darin findet sich ein zentraler Punkt seiner späteren Schrift in einem komprimierten Satz angesprochen: »Denn die Menschen zu Sozialisten zu machen, das ist nichts Besonderes; aber den Sozialismus menschlich zu machen, das ist eine große Aufgabe.« (Ellmann 1987, 403f)