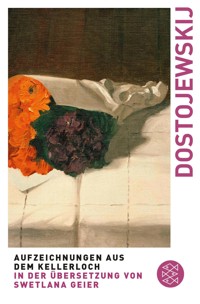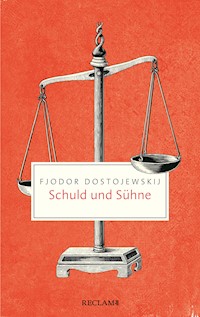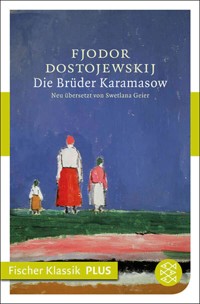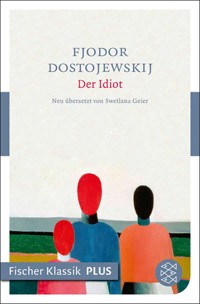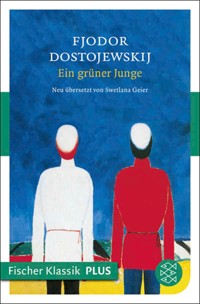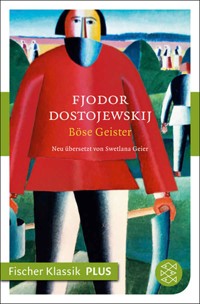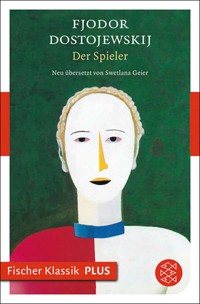
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fjodor M. Dostojewskij, Werkausgabe
- Sprache: Deutsch
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Spielen bedeutete für Dostojewskij gegen das Schicksal zu wetten. Genauso ist dieser Roman entstanden – in vier Wochen, und wäre er nicht fertig geworden, hätte er alles an einen habgierigen Verleger verloren. "Der Spieler" gelang – das rasende Porträt eines Spielsüchtigen in den mondänen deutschen Casinos der Zeit. Dostojewskijs spannendster und kürzester Roman in der gefeierten Neuübersetzung von Swetlana Geier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Fjodor Dostojewskij
Der Spieler
Aus den Aufzeichnungen eines jungen Mannes
Impressum
Covergestaltung: bilekjaeger, Stuttgart
Coverabbildung: Kasimir Malewitsch / Russisches Museum, St. Petersburg
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Unsere Adressen im Internet:
www.fischerverlage.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402032-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Anhang
Editorische Notiz
Anmerkungen
Übersetzung fremdsprachiger Textstellen
Nachwort
Daten zu Leben und Werk
Kapitel I
Endlich bin ich nach vierzehntägiger Abwesenheit zurück. Die Unsrigen waren schon seit drei Tagen in Roulettenburg. Ich hatte gedacht, sie warteten Gott weiß wie ungeduldig auf mich, aber das war ein Irrtum. Der General gab sich außerordentlich souverän, behandelte mich höchst herablassend und schickte mich zu seiner Schwester. Es war klar, daß sie irgendwo Geld aufgetrieben hatten. Es schien mir sogar, daß der General bei meinem Anblick ein wenig verlegen wurde. Marja Filippowna war außerordentlich beschäftigt und begrüßte mich nur flüchtig; das Geld allerdings nahm sie in Empfang, zählte nach und hörte meinen ausführlichen Rechenschaftsbericht an. Zu Tisch wurde Mesenzow erwartet, der Franzose und ein Engländer; wie üblich, kaum ist Geld da, sofort ein Gastmahl nach Moskauer Art. Polina Alexandrowna sah mich, fragte, wo ich so lange geblieben sei, und ging weiter, ohne die Antwort abzuwarten. Es war wohlbedacht, das versteht sich. Wir sollten uns wirklich aussprechen. Es ist manches zusammengekommen.
Man wies mir ein kleines Zimmer im vierten Stock des Hotels an. Hier weiß man, daß ich zum Gefolge des Generals gehöre. Man merkt an allem, daß sie es erst vor kurzem fertiggebracht haben, sich ins rechte Licht zu setzen. Der General wird hier von allen für einen steinreichen russischen Magnaten gehalten. Noch vor Tisch hat er mir aufgetragen, zwei Tausend-Francs-Noten wechseln zu lassen. Ich tat das an der Rezeption. Jetzt werden wir als Millionäre angesehen, wenigstens eine ganze Woche lang. Ich wollte Mischa und Nadja holen und mit ihnen spazierengehen, aber schon auf der Treppe wurde ich zum General beordert; er hatte es für nötig befunden, zu erfahren, wohin ich mich mit ihnen bewegen möchte. Dieser Mann kann mir einfach nicht offen in die Augen sehen; er hätte es wohl sehr gerne getan, aber ich entgegne ihm jedes Mal mit einem derart aufmerksamen, das heißt respektlosen Blick, daß er verlegen zu werden scheint. In hochtrabender Rede, eine Phrase auf die andere türmend, bis er den Faden völlig verloren hatte, gab er mir zu verstehen, daß ich mich mit den Kindern irgendwo, möglichst weit vom Kurhaus, im Park, aufhalten möge. Schließlich wurde er richtig heftig und bemerkte schroff: »Sonst wären Sie imstande, die Kinder ins Kurhaus, an das Roulette zu führen. Sie müssen mich schon entschuldigen«, fügte er hinzu, »aber ich weiß, daß Sie noch ziemlich leichtsinnig und möglicherweise fähig sind zu spielen. Ich bin zwar nicht Ihr Mentor und wünsche diese Rolle keineswegs auf mich zu nehmen, habe aber immerhin das Recht zu wünschen, daß Sie mich nicht kompromittieren …«
»Aber ich habe ja kein Geld«, antwortete ich gelassen; »um etwas zu verspielen, muß man es vorher haben …«
»Sie werden es unverzüglich bekommen«, antwortete der General leicht errötend, öffnete den Sekretär, schlug ein Notizbuch auf und stellte fest, daß ich rund einhundertzwanzig Rubel von ihm zu erhalten hatte.
»Aber wie wollen wir das verrechnen?« begann er. »Es muß in Taler umgerechnet werden. Hier, nehmen Sie erst einmal einhundert Taler, eine runde Summe – der Rest geht Ihnen natürlich nicht verloren.«
Ich nahm das Geld schweigend entgegen.
»Nehmen Sie mir meine Worte bitte nicht übel, Sie sind so empfindlich … mit meiner Bemerkung wollte ich Sie, sozusagen, nur warnen, und dazu, glaube ich, habe ich ein gewisses Recht …«
Als ich gegen Mittag mit den Kindern zurückkam, begegnete uns eine ganze Kavalkade. Die Unsrigen waren ausgeritten, um irgendwelche Ruinen zu besichtigen. Zwei hervorragende Kutschen, herrliche Pferde! Mademoiselle Blanche in einer Kutsche mit Marja Filippowna und Polina; der Franzose, der Engländer und unser General hoch zu Roß. Die Fußgänger blieben stehen und staunten; der Effekt war erreicht; aber mit dem General würde es ein böses Ende nehmen. Ich hatte überschlagen, daß sie mit den viertausend Francs, die ich gebracht hatte, plus der Summe, die sie offenbar inzwischen aufgetrieben hatten, sieben- oder achttausend Francs besitzen konnten; zu wenig für Mademoiselle Blanche.
Mademoiselle Blanche logiert ebenfalls in unserem Hotel, mit ihrer Mutter; ebenso unser Franzose. Die Lakaien sprechen ihn »Monsieur le comte« an, die Mutter von Mademoiselle Blanche läßt sich »Madame la comtesse« nennen, was soll’s, vielleicht sind sie wirklich Comte und Comtesse.
Ich habe es ja im voraus gewußt, daß Monsieur le comte mich bei Tisch nicht wiedererkennen würde. Der General dachte nicht einmal daran, uns bekannt zu machen oder mich wenigstens vorzustellen, und Monsieur le comte war selbst durch Rußland gereist und wußte, daß jemand, den sie einen outchitel nennen, kein rarer Vogel ist. Übrigens kennt er mich sehr wohl. Aber ich muß gestehen, daß ich ungebeten bei Tisch erschienen war; offenbar hatte der General vergessen, seine Anordnungen zu treffen, denn andernfalls hätte er mich an die Table d’hôte geschickt. Ich erschien aus eigenem Antrieb, so daß der General mir einen mißbilligenden Blick zuwarf. Die gute Marja Filippowna wies mir sofort einen Platz an; aber die Begegnung mit Mister Astley rettete mich, meine Zugehörigkeit zu ihrer Gesellschaft war nolens volens legitimiert.
Diesen wunderlichen Engländer hatte ich schon in Preußen kennengelernt, in einem Eisenbahnabteil, wo wir einander gegenübersaßen, als ich den Unsrigen nachreiste; dann traf ich auf ihn bei meiner Einreise nach Frankreich und schließlich in der Schweiz; im Laufe dieser beiden Wochen zweimal – und nun trafen wir einander in Roulettenburg. In meinem ganzen Leben bin ich noch nie einem schüchterneren Menschen begegnet; er ist bis zur Torheit schüchtern und weiß es selbst, denn er ist keinesfalls töricht. Übrigens, ein sehr liebenswerter, stiller Mensch. Ich hatte ihn schon bei unserer ersten Begegnung in Preußen zum Reden gebracht. Er ließ mich wissen, daß er im vergangenen Sommer am Nordkap gewesen sei und die größte Lust habe, den Jahrmarkt in Nischnij Nowgorod zu besuchen. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen er den General kennengelernt hat, aber mir scheint, daß er unsterblich in Polina verliebt ist. Als sie den Raum betrat, wurde er feuerrot. Er freute sich sehr, daß ich mich zu ihm gesetzt hatte, und hält mich, scheint es, schon für einen engen Freund.
Bei Tisch führte der Franzose das große Wort; er gab sich arrogant und lässig. In Moskau aber, ich erinnere mich, ließ er eine Seifenblase nach der anderen steigen. Da hatte er sich sehr ausgiebig über Finanzen und russische Politik verbreitet. Der General erkühnte sich hin und wieder zu einem Widerspruch, aber sehr bescheiden, höchstens so weit, um nicht seine Würde endgültig einzubüßen.
Ich war in einer wunderlichen Stimmung; selbstverständlich hatte ich während der ersten Hälfte des Essens gerätselt, mir meine übliche und immerwährende Frage gestellt: “Warum gebe ich mich mit diesem General ab und bin ihnen allen nicht bereits längst davongelaufen?” Hin und wieder warf ich einen Blick auf Polina Alexandrowna; sie nahm von mir nicht die geringste Notiz. Es endete damit, daß ich, erbost, mich entschloß, dreist zu werden.
Mir nichts, dir nichts, mischte ich mich laut und unaufgefordert in die allgemeine Unterhaltung ein. Ich hatte es vor allem auf den kleinen Franzosen abgesehen. Ich wandte mich an den General – und bemerkte plötzlich laut und deutlich, wobei ich ihm anscheinend ins Wort fiel, daß es für einen Russen in diesem Sommer nahezu unmöglich geworden sei, an einer Table d’hôte zu speisen. Der General richtete einen erstaunten Blick auf mich.
»Ein Ehrenmann«, fuhr ich unaufhaltsam fort, »setzt sich in jedem Fall Schmähungen aus und wird etliche Nasenstüber in Kauf nehmen müssen. In Paris und am Rhein, sogar in der Schweiz, wimmelt es von kleinen Polen und mit ihnen sympathisierendem Franzosenvolk, es ist unmöglich, sich auch nur einmal zu äußern, wenn man Russe ist.«
Ich hatte Französisch gesprochen. Der General sah mich verdutzt an, sichtlich im Zweifel, ob er in Zorn geraten oder sich nur wundern sollte, daß ich mich derart vergessen konnte.
»Das bedeutet, daß irgend jemand Ihnen irgendwo eine gehörige Lektion erteilt hat«, ließ der Franzose nachlässig verlauten.
»Ich bin in Paris zuerst an einen Polen geraten«, antwortete ich, »und darauf an einen französischen Offizier, der zu dem Polen hielt, und dann erst wechselten die übrigen Franzosen auf meine Seite, und zwar als ich erzählte, daß ich einem Monsignore in den Kaffee spucken wollte.«
»Spucken?« fragte der General gravitätisch und blickte sogar erstaunt um sich. Der Franzose musterte mich argwöhnisch.
»Jawohl, so war es«, antwortete ich. »Da ich ganze zwei Tage überzeugt war, daß ich möglicherweise in unserer Angelegenheit ganz kurz nach Rom würde fahren müssen, begab ich mich in die Kanzlei des Heiligen Vaters in Paris, um mir das Visum in den Paß stempeln zu lassen. Dort empfing mich ein Abbé von ungefähr fünfzig Jahren, dürr und mit eisiger Miene, der mir höflich zuhörte, aber außerordentlich trocken bat, mich zu gedulden. Ich war zwar in Eile, nahm aber Platz, um zu warten, zog die ›Opinion Nationale‹ hervor und stieß sogleich auf einen gräßlichen Artikel gegen Rußland. Dabei hörte ich, wie durch das Nachbarzimmer jemand zum Monsignore vorgelassen wurde; ich sah meinen Abbé sich eifrig verbeugen. Ich wandte mich abermals mit meiner Bitte an ihn; er bat, noch trockener, mich zu gedulden. Kurz darauf erschien ein weiterer Unbekannter, aber geschäftlich – ein Österreicher; dieser wurde angehört und sofort hinaufgeleitet. Das verstimmte mich sehr; ich stand auf, trat vor den Abbé, wies ihn mit Nachdruck darauf hin, daß, wenn Monsignore bereits empfange, er sich auch meiner Sache annehmen könne. Plötzlich wich der Abbé vor lauter Erstaunen vor mir zurück. Er konnte einfach nicht begreifen, wie ein nichtswürdiger Russe so dreist sein könne, sich auf eine Stufe mit den Gästen des Monsignore zu stellen? In allerunverschämtestem Ton, sichtlich zufrieden, mich beleidigen zu können, musterte er mich von Kopf bis Fuß und fuhr mich an: ›Glauben Sie etwa, Monsignore würde Ihretwegen seinen Kaffee stehenlassen?‹ Da brüllte auch ich, aber lauter als er: ›Sie sollen wissen, daß ich auf den Kaffee Ihres Monsignore spucke! Und wenn Sie meinen Paß nicht augenblicklich bearbeiten, werde ich ihn persönlich aufsuchen!‹
›Wie! Ausgerechnet jetzt, da Seine Eminenz, der Kardinal bei Ihm ist!‹ rief der Abbé, fuhr entsetzt zurück, stürzte zur Tür und pflanzte sich mit ausgebreiteten Armen davor auf, um zu demonstrieren, daß er eher sterben als mich durchlassen würde.
Darauf erwiderte ich, ich sei ein Häretiker und Barbar, ›que je suis hérétique et barbare‹, und daß mir alle diese Erzbischöfe, Kardinäle, Monsignori und so weiter und so weiter völlig Schnuppe seien. Kurz, ich gab deutlich zu verstehen, daß ich nicht weichen würde. Der Abbé warf mir einen unendlich bösen Blick zu, riß mir den Paß aus der Hand und ging mit ihm nach oben. Eine Minute später kam er mit dem Visum zurück. Hier, wünschen Sie es zu sehen?« Ich zog den Paß aus der Tasche und zeigte das römische Visum.
»Sie haben das allerdings«, begann der General …
»Es war Ihre Rettung, daß Sie sich als Barbar und Häretiker vorgestellt haben«, bemerkte der kleine Franzose mit maliziösem Lächeln. »Cela n’était pas si bête.«
»Soll man sich etwa an unseren Russen ein Beispiel nehmen? Sie hocken hier – wagen nicht zu mucksen und sind womöglich bereit zu verleugnen, daß sie Russen sind. Jedenfalls wurde ich in meinem Hotel in Paris wesentlich zuvorkommender behandelt, nachdem ich allen von meinem Zusammenstoß mit dem Abbé erzählt hatte. Der wohlbeleibte polnische Pan, mein erklärter Feind an der Table d’hôte, zog sich in den Hintergrund zurück. Die Franzosen ertrugen es sogar, daß ich erzählte, wie ich vor zwei Jahren einen Mann kennenlernte, auf den im Jahre zwölf ein französischer Chasseur geschossen hatte – einzig und allein, um das Gewehr zu entladen. Dieser Mann war damals ein zehnjähriges Kind, dessen Familie Moskau nicht rechtzeitig verlassen hatte.«
»Ausgeschlossen!« brüllte der Franzose auf. »Ein französischer Soldat schießt nie auf ein Kind!«
»Indessen war es so«, antwortete ich. »Ein ehrenwerter Kapitän außer Dienst hat es mir erzählt, und ich habe mit eigenen Augen die Narbe auf seiner Wange gesehen, die von der Kugel stammte.«
Der Franzose begann wortreich und lebhaft zu widersprechen. Der General wollte ihm schon Beistand leisten, aber ich empfahl ihm, wenigstens auszugsweise die »Aufzeichnungen« des Generals Perowskij zu lesen, der sich im Jahre zwölf in französischer Gefangenschaft befunden hatte. Endlich mischte sich Marja Filippowna ein, um unserer Unterhaltung ein Ende zu machen. Der General war äußerst unzufrieden mit mir, denn der Franzose und ich hatten einander beinahe angeschrien. Mister Astley dagegen schien an meinem Streit mit dem Franzosen großen Gefallen zu finden; als man sich vom Tisch erhob, schlug er vor, gemeinsam ein Glas Wein zu trinken. Abends gelang es mir, eine Viertelstunde mit Polina Alexandrowna zu sprechen. Unsere Unterhaltung fand auf einem Spaziergang statt. Alle promenierten durch den Park zum Kurhaus. Polina ließ sich auf der Bank gegenüber dem Springbrunnen nieder und erlaubte Nadenjka, mit anderen Kindern in ihrer Nähe zu spielen. Ich meinerseits schickte auch Mischa an die Fontäne, und endlich waren wir alleine.
Zuerst ging es natürlicherweise um die Geschäfte. Polina Alexandrowna geriet außer sich vor Zorn, als ich ihr nur siebenhundert Gulden aushändigte. Sie war überzeugt gewesen, daß ich ihr aus Paris, wo ich ihren Brillantschmuck versetzt hatte, mindestens zweitausend Gulden bringen würde, vielleicht sogar mehr.
»Ich brauche Geld, um jeden Preis«, sagte sie, »dieses Geld muß beschafft werden; sonst bin ich einfach verloren.«
Ich begann sie auszufragen, was sich während meiner Abwesenheit ereignet hätte.
»Nichts Besonderes, außer den beiden Nachrichten aus Petersburg: zuerst, daß es der Großmutter sehr schlechtgehe, und zwei Tage später, daß sie wohl schon gestorben sei. Diese Nachricht kam von Timofej Petrowitsch«, setzte Polina hinzu, »einem zuverlässigen Mann. Wir warten auf die endgültige Nachricht.«
»Also fiebern hier alle vor Erwartung?« fragte ich.
»Natürlich; alle und alles; ein ganzes halbes Jahr; seit einem halben Jahr ist es die letzte Hoffnung.«
»Auch Ihre Hoffnung?« fragte ich.
»Ich bin mit ihr gar nicht verwandt, ich bin nur die Stieftochter des Generals. Aber ich weiß mit Sicherheit, daß sie mich in ihrem Testament nicht vergessen wird.«
»Sie werden, scheint es mir, sehr reichlich bedacht«, sagte ich zuversichtlich.
»Ja, sie mochte mich; aber wieso scheint es Ihnen?«
»Sagen Sie«, fragte ich, statt zu antworten, »unser Marquis scheint gleichfalls in alle Familiengeheimnisse eingeweiht zu sein?«
»Und wieso interessieren Sie selbst sich dafür?« bemerkte Polina mit einem strengen und kalten Blick.
»Das liegt auf der Hand; wenn ich mich nicht irre, hat der General ihn bereits angepumpt.«
»Ihre Vermutung trifft zu.«
»Also, hätte er denn Geld geliehen, wenn er nicht über Babulenka Bescheid wüßte? Ist es Ihnen bei Tisch nicht aufgefallen, daß er zwei oder drei Mal, als die Rede auf die Großmutter kam, von la baboulenka gesprochen hat? Was für enge und freundschaftliche Beziehungen!«
»Ja, Sie haben recht. Sobald er erfährt, daß auch ich etwas testamentarisch geerbt habe, wird er mir umgehend einen Heiratsantrag machen. Das war es doch wohl, was Sie hören wollten, nicht wahr?«
»Wird er ihn erst dann machen? Ich dachte, er geht schon lange auf Freiersfüßen.«
»Sie wissen genau, daß dem nicht so ist!« sagte Polina heftig. »Wo haben Sie diesen Engländer kennengelernt?« fuhr sie nach minutenlangem Schweigen fort.
»Ich habe es ja gewußt, daß Sie sich nach ihm jetzt erkundigen werden.«
Und ich erzählte ihr von meinen früheren Begegnungen unterwegs mit Mister Astley. »Er ist schüchtern, begeisterungsfähig und natürlich schon in Sie verliebt?«
»Ja, er ist in mich verliebt«, antwortete Polina.
»Übrigens ist er natürlich zehnmal reicher als der Franzose. Wie ist es, hat der Franzose wirklich irgendwas? Kein Zweifel?«
»Kein Zweifel. Er ist Besitzer eines Châteaus. Erst gestern hat mir der General davon erzählt. Mit großer Gewißheit. Genügt Ihnen das?«
»Ich würde an Ihrer Stelle unbedingt den Engländer nehmen.«
»Warum?« fragte Polina.
»Der Franzose sieht besser aus, ist aber niederträchtiger. Und der Engländer ist nicht nur ein anständiger Mensch, sondern auch zehnmal reicher«, antwortete ich kurz und klar.
»Stimmt. Aber dafür ist der Franzose ein Marquis und gescheiter«, antwortete sie in aller Gelassenheit.
»Aber stimmt es auch?« Ich ließ nicht locker.
»Haargenau.«
Polina mißfielen meine Fragen, und ich sah, daß sie mich durch den Ton und die Ungereimtheit ihrer Antworten herausforderte; ich sagte es ihr sofort.
»Nun, was soll’s, mir macht es tatsächlich Spaß, Sie wütend zu sehen. Allein die Tatsache, daß ich Ihnen gestatte, solche Fragen und Vermutungen auszusprechen, werden Sie zu bezahlen haben.«
»Ich halte mich wirklich für berechtigt, Ihnen verschiedene Fragen zu stellen«, antwortete ich gelassen, »gerade deshalb, weil ich bereit bin, dafür zu büßen, und mein Leben jetzt nicht besonders hoch schätze.«
Polina lachte laut:
»Sie haben mir das letzte Mal auf dem Schlangenberg gesagt, Sie seien auf ein einziges Wort von mir bereit, sich in den Abgrund zu stürzen, und dort ist es, glaube ich, tausend Fuß tief. Ich werde dieses Wort eines Tages aussprechen, einzig und allein um zu sehen, wie Sie Ihre Rechnung begleichen, und Sie können sicher sein, daß ich mir treu bleiben werde. Sie sind mir verhaßt, gerade deshalb, weil ich Ihnen so viel durchgehen ließ, und erst recht sind Sie mir verhaßt, weil ich auf Sie so angewiesen bin. Aber solange ich auf Sie angewiesen bin – muß ich Sie schonend behandeln.«
Sie machte Anstalten, sich zu erheben. Sie sprach gereizt. In der letzten Zeit beendete sie jedes Gespräch mit mir boshaft und gereizt, wirklich boshaft.
»Erlauben Sie noch eine Frage: Was ist Mademoiselle Blanche?« fragte ich, weil ich nicht wünschte, sie unversöhnt gehen zu lassen.
»Sie wissen doch selbst, was diese Mademoiselle Blanche ist. Seit damals ist nichts Neues dazugekommen. Mademoiselle Blanche wird bestimmt Frau Generalin, falls das Gerücht von Babuschkas Tod sich bestätigt, weil sowohl Mademoiselle Blanche als ihre Frau Mutter, als auch ihr Vetter dritten Grades, der Marquis, alle sehr gut wissen, daß wir ruiniert sind.«
»Und der General ist hoffnungslos verliebt?«
»Jetzt geht es um etwas anderes. Hören Sie zu und merken Sie sich: Nehmen Sie diese siebenhundert Florin und gehen Sie spielen, gewinnen Sie für mich beim Roulette so viel wie möglich; im Augenblick brauche ich Geld um jeden Preis.«
Nach diesen Worten rief sie Nadenjka und ging mit ihr in Richtung des Kurhauses, wo sie sich unserer Gesellschaft anschloß. Ich dagegen bog in den erstbesten Weg nach links ein, nachdenklich und verblüfft. Ich war nach dem Befehl, Roulette zu spielen, völlig benommen. Sonderbar: Ich hatte manches bedenken müssen, indessen gab ich mich der Analyse meiner Gefühle zu Polina hin. In der Tat, in den zwei Wochen meiner Abwesenheit war mir leichter zumute gewesen als heute, am Tag meiner Rückkehr, wiewohl ich unterwegs wie ein Wahnsinniger gelitten, wie ein Erstickender nach Luft gerungen und selbst im Schlaf sie dauernd vor mir gesehen hatte. Einmal (es war in der Schweiz) war ich im Waggon eingenickt und hatte, wie es scheint, mich laut mit Polina unterhalten, womit ich alle Mitreisenden zum Lachen brachte. Und jetzt fragte ich mich wieder: Liebe ich sie etwa, liebe ich sie wirklich? Und wieder, das heißt, zum hundertsten Mal hatte ich keine Antwort, das heißt, zum hundertsten Mal antwortete ich mir, daß sie mir verhaßt war. Ja, sie war mir verhaßt. Es gab Minuten (und zwar jedesmal nach unseren Unterhaltungen), daß ich mein halbes Leben gegeben hätte, um sie zu erwürgen! Ich schwöre, daß ich, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ein spitzes Messer in ihrer Brust zu versenken, es mit Lust, wie mir schien, geführt hätte. Und trotzdem, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, daß ich, wenn sie auf dem Schlangenberg auf dem beliebten Aussichtspunkt gesagt hätte, »Springen Sie«, auf der Stelle gesprungen wäre, sogar mit Lust. Das wußte ich. So oder so, eine Entscheidung war unvermeidlich. Das alles ist ihr bewundernswert klar, und der Gedanke, daß ich mir, über alle Zweifel erhaben, ihrer Unerreichbarkeit für mich und der Unerfüllbarkeit aller meiner Träume völlig bewußt bin – dieser Gedanke, davon bin ich überzeugt, bereitet ihr eine außerordentliche Lust; könnte sie sonst, umsichtig und klug, wie sie ist, mir so vertraulich und offenherzig gegenübertreten? Mir scheint, ich war für sie nichts anderes als der Sklave jener antiken Kaiserin, die sich vor ihm entkleidete, alldieweil sie ihn nicht zu den Menschen zählte. Ja, sie hat mich öfters nicht zu den Menschen gezählt …
Allerdings hatte ich jetzt ihren Auftrag – koste es, was es wolle, im Roulette zu gewinnen. Ich hatte keine Zeit, darüber zu spekulieren: wozu und wie schnell ich zu gewinnen hatte und welche neuen Absichten in diesem ewig abwiegenden Kopf entstanden waren. Außerdem müssen in diesen zwei Wochen eine Menge neuer Tatsachen dazugekommen sein, von denen ich nicht die geringste Ahnung hatte. All das galt es zu ergründen, und zwar so schnell wie möglich. Einstweilig hatte ich keine Zeit dazu: Ich mußte an den Spieltisch.
Kapitel II
Ich gestehe, es war mir unangenehm; ich hatte zwar beschlossen zu spielen, aber ich hatte keinesfalls vor, es für jemand anderen zu tun. Das brachte mich sogar einigermaßen aus dem Konzept, und ich betrat die Spielsäle ziemlich verdrossen. Auf den ersten Blick ging mir dort alles gegen den Strich. Ich kann diese Lobhudelei der Feuilletons der ganzen Welt und vornehmlich unserer russischen Zeitungen nicht leiden, in denen die Journalisten fast jedes Frühjahr von zwei Dingen berichten: erstens von der unerhörten Pracht und dem Luxus der Spielsäle aller Roulette-Städte am Rhein, und zweitens – von den Bergen an Gold, die angeblich auf den Spieltischen herumliegen. Sie werden dafür nicht bezahlt; es wird einfach geschwafelt aus uneigennütziger Beflissenheit. Von Pracht kann in diesen schäbigen Sälen nicht die Rede sein, und was das Gold betrifft – es ist kaum zu sehen, geschweige denn als Berge auf den Tischen. Freilich, hin und wieder taucht im Laufe der Saison plötzlich ein Sonderling auf, ein Engländer oder ein Asiate, in diesem Sommer, zum Beispiel, ein Türke, und verspielt oder gewinnt auf einmal sehr viel; alle anderen setzen wenige Gulden, üblicherweise liegt auf dem Tisch sehr wenig Geld. Als ich den Spielsaal (zum ersten Mal in meinem Leben) betrat, konnte ich mich geraume Zeit nicht zum Spiel entschließen. Außerdem störte mich das Gedränge. Aber auch wenn ich alleine gewesen wäre, auch dann, glaube ich, wäre ich lieber gegangen, als mit dem Spiel anzufangen. Ich gestehe, daß ich heftiges Herzklopfen hatte und keineswegs kaltblütig war. Ich wußte definitiv seit langem schon, daß ich Roulettenburg nicht so verlassen würde, wie ich gekommen war; daß in meinem Schicksal unbedingt etwas Radikales und Endgültiges eintreten würde. So mußte es sein, und so würde es kommen. Mag es auch komisch sein, daß ich so viel von dem Roulette erwarte, aber die landläufige Meinung, es handle sich beim Spiel um etwas ausgesprochen Törichtes und Absurdes, scheint mir noch komischer. Warum soll das Spiel schlechter sein als jede beliebige andere Art des Gelderwerbs, etwa der Handel? Stimmt, es gewinnt von Hunderten ein einziger. Aber – was geht das mich an?
Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, mich zuerst umzusehen und an diesem Abend nichts Ernsthaftes zu versuchen. An diesem Abend, auch wenn sich etwas ereignet hätte, wäre es zufällig und flüchtig geschehen ganz nach meinem Wunsch. Zuerst galt es ja den Ablauf des Spiels zu erforschen; weil ich, ungeachtet der Unzahl von Beschreibungen des Roulettes, die ich stets mit solcher Gier verschlungen hatte, nichts von seinem eigentlichen Funktionieren begreifen konnte, solange ich es nicht mit eigenen Augen sah.
Zuerst schien mir alles so schmutzig – irgendwie moralisch übel und schmutzig. Ich meine damit keineswegs die gierigen und erregten Gesichter, die zu Dutzenden, sogar zu Hunderten die Spieltische umringen. Ich kann an dem Wunsch, möglichst schnell und viel zu gewinnen, nichts Schmutziges sehen; der törichte Gedanke eines wohlgenährten und wohlbestallten Moralisten kam mir schon immer sehr dümmlich vor, der auf einen Rechtfertigungsversuch, »man würde ja mit den kleinsten Einsätzen spielen«, erwidert: »um so schlimmer, weil es sich um eine kleinliche Gier handelt«. Als ob kleinliche Gier und großspurige Gewinnsucht nicht dasselbe wären. Es ist nur die Frage der Proportion: Was für einen Rothschild kleinlich ist, ist für mich üppig, und was Gewinn und Habgier angeht, so pflegen die Menschen nicht nur beim Roulette, sondern überall nichts anderes zu tun, als einander etwas abzugewinnen, sich gegenseitig zu übervorteilen und aneinander zu profitieren. Ob Habgier oder Profit an und für sich verwerflich sind – das ist eine andere Frage. Aber an dieser Stelle will ich mich damit nicht befassen. Da ich selbst von dem Wunsch zu gewinnen völlig besessen war, kamen mir diese ganze Gewinnsucht und dieser ganze habgierige Schmutz beim Betreten des Spielsaals irgendwie willkommen und vertraut vor. Gibt es denn etwas Schöneres, wenn man voreinander keine Umstände macht, sondern offen und unverblümt handelt? Und wozu sollte man auch sich selbst etwas vormachen? Ein völlig unsinniges und unrentables Verhalten. Besonders abstoßend in dem ganzen Roulettegesindel, zumal auf den ersten Blick, war jene nahezu ehrerbietige Haltung, mit der alle sich um die Tische drängten. Deshalb wird hier genau unterschieden, welches Spiel als mauvais genre gilt und welches für einen anständigen Menschen erlaubt ist. Es gibt zwei Arten von Spiel, die eine gilt als gentlemanlike, die andere als plebejisch, gewinnsüchtig, das Spiel des Gesindels. Auf diesen Unterschied wird genau geachtet – und wie gemein ist genaugenommen diese Unterscheidung! Ein Gentleman kann hier zum Beispiel fünf oder zehn Louisdor setzen, selten mehr, sollte er allerdings sehr reich sein, auch tausend Francs, aber einzig und allein spaßeshalber, eigentlich nur, um den Prozeß von Gewinn und Verlust zu beobachten; aber er hat sich nicht im mindesten für den eigentlichen Gewinn zu interessieren. Hat er gewonnen, kann er zum Beispiel kurz auflachen, eine Bemerkung an seinen Nachbarn richten, er kann sogar wieder setzen und noch ein Mal mit doppeltem Einsatz, aber einzig und allein aus Neugier, aus Interesse für die Chancen, um irgendwelche Berechnungen anzustellen, keineswegs aus dem plebejischen Wunsch nach Gewinn. Mit einem Wort, er hat diese ganzen Spieltische, dieses Roulette und trente et quarante nicht anders zu betrachten als eine Unterhaltung, einzig und allein zu seinem Vergnügen. Die Habsucht und die Fallen, die zur Einrichtung einer Spielbank gehören, hat er nicht einmal zu vermuten. Es wäre sogar keineswegs verkehrt, wenn es ihm schiene, daß auch alle anderen Spieler, dieses ganze Gesindel, das um jeden Gulden zittert, ebenso reich und ebenso gentlemanlike wären wie er selbst und einzig und allein zu ihrer Zerstreuung und Unterhaltung spielten. Diese absolute Wirklichkeitsferne und diese naive Meinung von den Menschen würden natürlich als äußerst aristokratisch gelten. Ich habe gesehen, wie manche Frau Mama ihre unschuldigen, stilvollen fünfzehn- und sechzehnjährigen Misses, ihre Töchter, vor sich an den Tisch lancierte, ihnen einige Goldmünzen in die Hand drückte und ihnen erklärte, wie man setzt. Eine von den jungen Damen gewann oder verlor das Spiel, lächelte in jedem Fall und ging sehr zufrieden davon. Unser General trat würdevoll und selbstbewußt an den Tisch; der Diener stürzte mit einem Stuhl herzu, aber er übersah den Diener; er brauchte sehr lange, um das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen, brauchte sehr lange, um dem Portemonnaie dreihundert Francs in Gold zu entnehmen, setzte auf Schwarz und gewann. Er rührte den Gewinn nicht an und ließ ihn auf dem Tisch. Er setzte wieder. Es kam wieder Schwarz; auch diesmal ließ er den Gewinn stehen, aber als beim dritten Mal das Rot kam, hatte er auf einen Schlag eintausendzweihundert Francs verloren. Er entfernte sich lächelnd, er bewahrte Haltung. Ich bin überzeugt, daß er sich grämte und daß er, wäre der Einsatz doppelt oder dreimal so hoch gewesen, die Contenance nicht hätte bewahren und die Erregung unterdrücken können. Freilich war ein Franzose, der in meiner Gegenwart an die dreißigtausend Francs zuerst gewonnen und dann verloren hatte, gleichmütig gutgelaunt und ohne die leiseste Aufregung geblieben. Ein Gentleman darf, auch wenn er sein ganzes Vermögen verspielt, keine Aufregung zeigen. Das Geld muß so tief unter seiner Würde als Gentleman sein, daß es kaum seiner Sorge wert ist. Gewiß, es wäre ausgesprochen aristokratisch, das Schmutzige dieses ganzen Gesindels und der Umgebung einfach zu übersehen. Gelegentlich jedoch ist die umgekehrte Haltung nicht weniger aristokratisch, nämlich dieses ganze Gesindel sehr wohl zu bemerken, das heißt, in Augenschein zu nehmen, sogar zu fixieren, zum Beispiel durch ein Lorgnon: aber nicht anders, als daß man jene Menschen und jenen Schmutz als eine abstoßende Zerstreuung besonderer Art nimmt, als ein Schauspiel, das zur Unterhaltung der Gentlemen aufgeführt wird. Es ist denkbar, sich unter die Menge zu mischen, aber in der unübersehbaren Attitüde eines Beobachters, der keineswegs zu ihr gehört. Übrigens wäre eine eingehende Beobachtung unangemessen: Sie wäre nicht gentlemanlike, weil das Schauspiel einer allzu eingehenden Beobachtung eines Gentlemans keineswegs würdig ist. Im allgemeinen sind Schauspiele, die eine eingehende Beobachtung eines Gentlemans verdienen, sehr selten. Indessen schien es mir persönlich einer eingehenden Beobachtung durchaus wert zu sein, eben für jemand, der nicht allein deswegen gekommen ist, sondern sich selbst ehrlich und offen zu diesem ganzen Gesindel rechnet. Was jedoch meine innersten moralischen Überzeugungen angeht, so haben sie in meinen gegenwärtigen Überlegungen keinen Platz. Mag es auch so bleiben, ich sage es nur, um mein Gewissen zu erleichtern. Aber ich möchte noch folgendes hinzufügen: In letzter Zeit war es mir ungemein zuwider, meinem Handeln oder Denken einen moralischen Maßstab anzulegen. Es war etwas anderes, was mich bestimmte …
Das Gesindel spielt in der Tat sehr schmutzig. Ich kann mich sogar des Gedankens nicht erwehren, daß hier am Spieltisch sehr oft auf die gewöhnlichste Weise gestohlen wird. Die Croupiers, die an den Schmalseiten der Spieltische sitzen, die Einsätze verfolgen und abrechnen, haben furchtbar viel zu tun. Auch so ein Gesindel! Es sind größtenteils Franzosen. Übrigens, wenn ich hier meine Beobachtungen mache und Erfahrungen sammle, so tue ich es keineswegs, um das Roulette zu beschreiben; ich brauche das alles für mich selbst, um zu wissen, wie ich mich künftig verhalten soll. Ich habe mir zum Beispiel gemerkt, daß es nichts Außergewöhnliches ist, wenn plötzlich sich von hinten ein Arm über den Tisch streckt und das nimmt, was Sie gewonnen haben. Ein Streit bricht aus, oft wird gebrüllt, aber wie sollen Sie, bitte sehr, beweisen und Zeugen dafür finden, daß es Ihr Einsatz gewesen ist!
Anfangs war für mich dieses ganze Treiben völlig undurchsichtig; ich habe nur geraten und mehr schlecht als recht entschieden, daß man auf Zahlen setzt, auf Gerade, Ungerade und auf Farben. Aus dem Geld von Polina Alexandrowna wollte ich an diesem Abend probeweise einhundert Gulden wagen. Den Gedanken, daß ich mit dem Spielen nicht für mich selbst anfing, empfand ich als störend. Es war eine äußerst unangenehme Empfindung, und ich wäre sie am liebsten so schnell wie möglich losgeworden. Immer wieder schien es mir, daß ich, indem ich für Polina spielte, mein eigenes Glück untergrübe. Sollte es denn wahr sein, daß man nur an den Spieltisch treten braucht, um sofort vom Aberglauben angesteckt zu werden? Ich begann damit, daß ich fünf Friedrichsdor aus der Tasche holte, also fünfzig Gulden, und sie auf Gerade setzte. Das Rad drehte sich und blieb auf der Dreizehn stehen – ich hatte verloren. Mit einem schmerzlichen Unbehagen, einzig, um ein Ende zu machen und zu gehen, setzte ich weitere fünf Friedrichsdor auf Rot. Rot kam. Ich setzte alle zehn Friedrichsdor auf Rot – wiederum Rot. Nachdem ich vierzig Friedrichsdor erhalten hatte, setzte ich zwanzig auf die zwölf mittleren Zahlen, ohne zu ahnen, was daraus werden sollte. Man zahlte mir das Dreifache aus. Auf diese Weise besaß ich statt der zehn Friedrichsdor plötzlich achtzig. Eine ungeahnte und sonderbare Empfindung bemächtigte sich meiner, und ich beschloß zu gehen. Mir schien, daß ich ganz anders gespielt hätte, wenn es für mich gewesen wäre. Ich setzte alles auf Gerade. Diesmal kam die Vier; man schob mir weitere achtzig Friedrichsdor zu, ich strich den ganzen Haufen von hundertsechzig Friedrichsdor ein und machte mich auf den Weg, um Polina Alexandrowna zu suchen.
Sie promenierten alle irgendwo im Park, und ich konnte sie erst beim Souper treffen. Diesmal war der Franzose nicht dabei, und der General hatte das Feld für sich allein: Unter anderem hielt er es abermals für nötig, mich wissen zu lassen, daß er mich keineswegs am Spieltisch zu sehen wünsche. Sollte ich einmal zuviel verlieren, würde es ihn, seiner Meinung nach, sehr kompromittieren; »selbst wenn Sie sehr viel gewinnen sollten, würde ich mich kompromittiert fühlen«, fügte er mit Nachdruck hinzu. »Natürlich habe ich kein Recht, über Ihr Verhalten zu bestimmen, aber Sie werden selbst zugeben …«, und er brach gewohnheitsgemäß ab. Ich antwortete darauf trocken, daß ich sehr wenig Geld zur Verfügung hätte und folglich nicht in der Lage sei, auffallend viel zu verlieren, selbst wenn ich spielen wollte. Als ich oben war, gelang es mir, Polina ihren Gewinn zu übergeben und zu erklären, daß ich kein zweites Mal für sie spielen wollte.
»Warum nicht?« fragte sie beunruhigt.
»Weil ich für mich spielen will«, antwortete ich, indem ich sie erstaunt betrachtete, »und das stört mich.«
»Sie sind also nach wie vor unerschütterlich davon überzeugt, daß das Roulette Ihr einziger Ausweg und Ihre Rettung ist?« fragte sie spöttisch. Ich antwortete immer noch sehr ernst, daß dem so sei; was meine feste Zuversicht zu gewinnen anbelange, so mag sie noch so komisch sein, aber »man möge mich damit in Ruhe lassen«.
Polina Alexandrowna beharrte darauf, daß ich von dem heutigen Gewinn die Hälfte behalten müsse, und wollte mir die achtzig Friedrichsdor unbedingt aufdrängen mit dem Vorschlag, auch das Spiel unter derselben Bedingung künftig fortzusetzen. Ich wies diese Hälfte entschieden und ein für allemal zurück und erklärte, daß ich für andere nicht spielen könne, nicht, weil ich nicht wolle, sondern weil ich gewiß verlieren würde.
»Eigentlich hoffe auch ich, wie töricht es sein mag, einzig auf das Roulette«, sagte sie nachdenklich, »und deshalb müssen Sie unbedingt mit mir auf Halbpart weiterspielen und werden das, selbstverständlich, auch tun.« Mit diesen Worten ließ sie mich stehen, ohne meine weiteren Einwände abzuwarten.