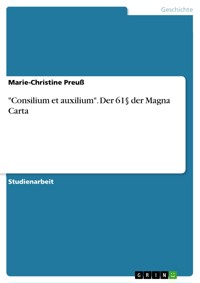29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,0, Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Philologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Mit den Worten „es ist normal verschieden zu sein“ eröffnete der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Juli 1993 eine Ansprache bei der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte. Heute sind diese Worte das Motto zahl-reicher Vereine für Menschen mit Behinderung und Vereine für Lebenshilfe. Vor allem sind diese Worte aber ein Leitsatz für ein Konzept, welches diese Verschiedenheit als grundlegendes Element ansieht. Die Sprache ist von der Inklusion. Dieses Konzept, welches auch als Lebensstil angesehen werden könnte, sieht die Diversität nicht als Problem, dass gelöst werden muss, sondern als Chance für die Gesellschaft. Um das Zitat von Richard von Weizsäcker zu erweitern, ist es also nicht nur normal verschieden zu sein, sondern sogar wünschenswert. Schließlich setzt die Inklusion voraus, dass sich Menschen in ihrer Verschiedenheit gegenseitig bereichern. Dieser Grundsatz soll in Zukunft auch zunehmend in der schulischen Bildung verankert werden. Seit dem die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen im Jahr 2009 auch in der Bundesrepublik in Kraft getreten ist, stehen alle Bundesländer sowie die Kommunen der Bundesrepublik Deutschland in der Pflicht, die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu unter-stützen. Im Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention ist festgeschrieben, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf Bildung haben. Für das Bildungswesen bedeutet dies konkret, dass ein inklusives Schulsystem aufgebaut werden muss, in dem förderbedürftige Schüler in einem gemeinsamen Unterricht mit den Regelschülern zusammen lernen. „Eine Schule für alle“ ist in der Inklusionsdebatte das Stichwort. Was zunächst einmal einfach klingt, dass eben alle Schüler eines Ortes eine gemeinsame Schule besuchen, ist in der Realität schwer umzusetzen und gerade für das deutsche Schulsystem, welches bisher eher auf Selektion und Homogenität gesetzt hat, eine große Herausforderung. Doch nicht nur die strukturelle Umsetzung bringt Probleme mit sich. Ganz oft wird in der Forschung die Ebene der Fachdidaktik vergessen. Zwar gibt es Konzepte und Vorschläge zu einem inklusiven Unterricht als solchen, aber selten wird konkret über den Fachunterricht berichtet. Die folgende Arbeit untersucht vor allem den Deutschunterricht als Sprachunterricht im Fokus von Inklusion. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
I. Einleitung
II. Theoretische Grundlagen
1. Begriffliche Erklärung von Inklusion in Abgrenzung zur Integration
2. Rechtliche Grundlagen schulischer Inklusion
3. Prinzipien und Strukturen inklusiver Bildung
3.1 Heterogenität
3.2 Teilhabe und Zugehörigkeit
3.3 Teamteaching
3.4 Innere Differenzierung
III. Fragestellung und Zielsetzung dieser Arbeit
IV. Qualitative Studie zum Thema: Sprachunterricht im Fokus von Inklusion
1. Qualitative Forschung und Ziele dieser Studie
2. Sampling, Feldzugang und Durchführung
3. Erhebungsmethode
3.1 Das Leitfadeninterview als problemzentriertes Interview
3.2 Instrumente des problemzentrierten Interviews
3.3 Begründung der Methodenwahl
V. Auswertung der Interviews
1. Formale Charakteristika des Materials und Transkriptionsregeln
2. Auswertungsverfahren: Die Qualitative Inhaltsanalyse
3. Einzelauswertung der Interviews (Zusammenfassung und Explikation)
3.1 Interviewgruppe I
3.2 Interviewgruppe II
3.3 Interviewgruppe III
4. Strukturierung und Kategorisierung
4.1 Interviewgruppe I
4.2 Interviewgruppe II
4.3 Interviewgruppe III
5. Gesamtauswertung
VI. Fazit und Ausblick
VII. Literaturverzeichnis
VIII. Anhang
1. Transkriptionen Interviewgruppe I
1.1 Interviewgruppe I – Interview A
1.2 Interviewgruppe I – Interview B
1.3 Interviewgruppe I – Interview C
1.4 Interviewgruppe I – Interview D
1.5 Interviewgruppe II – Interview D
2. Transkription Interviewgruppe II
2.1 Interviewgruppe II – Interview A
2.2 Interviewgruppe II – Interview B
2.3 Interviewgruppe II – Interview C
2.4 Interviewgruppe II - Interview D
2.5 Interviewgruppe II – Interview E
3. Transkription Interviewgruppe III
3.1 Interviewgruppe III – Interview A
3.2 Interviewgruppe III - Interview B
3.3 Interviewgruppe III - Interview C
3.4 Interviewgruppe III – Interview D
3.5 Interviewgruppe III – Interview E
4. Strukturierung und Kategorisierung: Tabellen
4.1 Interviewgruppe I
4.2 Interviewgruppe II
4.3 Interviewgruppe III
I. Einleitung
„Es ist normal verschieden zu sein“
(Richard von Weizsäcker, 1993)
Mit den Worten „es ist normal verschieden zu sein“ eröffnete der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Juli 1993 eine Ansprache bei der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte. Heute sind diese Worte das Motto zahlreicher Vereine für Menschen mit Behinderung und Vereine für Lebenshilfe. Vor allem sind diese Worte aber ein Leitsatz für ein Konzept, welches diese Verschiedenheit als grundlegendes Element ansieht. Die Sprache ist von der Inklusion. Dieses Konzept, welches auch als Lebensstil angesehen werden könnte, sieht die Diversität nicht als Problem, dass gelöst werden muss, sondern als Chance für die Gesellschaft. Um das Zitat von Richard von Weizsäcker zu erweitern, ist es also nicht nur normal verschieden zu sein, sondern sogar wünschenswert. Schließlich setzt die Inklusion voraus, dass sich Menschen in ihrer Verschiedenheit gegenseitig bereichern. Dieser Grundsatz soll in Zukunft auch zunehmend in der schulischen Bildung verankert werden. Seit dem die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen im Jahr 2009 auch in der Bundesrepublik in Kraft getreten ist, stehen alle Bundesländer sowie die Kommunen der Bundesrepublik Deutschland in der Pflicht, die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu unterstützen. Im Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention ist festgeschrieben, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf Bildung haben. Für das Bildungswesen bedeutet dies konkret, dass ein inklusives Schulsystem aufgebaut werden muss, in dem förderbedürftige Schüler in einem gemeinsamen Unterricht mit den Regelschülern zusammen lernen. „Eine Schule für alle“ ist in der Inklusionsdebatte das Stichwort.
Was zunächst einmal einfach klingt, dass eben alle Schüler eines Ortes eine gemeinsame Schule besuchen, ist in der Realität schwer umzusetzen und gerade für das deutsche Schulsystem, welches bisher eher auf Selektion und Homogenität gesetzt hat, eine große Herausforderung. Doch nicht nur die strukturelle Umsetzung bringt Probleme mit sich. Ganz oft wird in der Forschung die Ebene der Fachdidaktik vergessen. Zwar gibt es Konzepte und Vorschläge zu einem inklusiven Unterricht als solchen, aber selten wird konkret über den Fachunterricht berichtet. Die folgende Arbeit untersucht vor allem den Deutschunterricht als Sprachunterricht im Fokus von Inklusion. Wie muss die Fachdidaktik reagieren und was muss verändert werden, damit ein inklusiver Deutschunterricht für alle Schüler und Schülerinnen erfolgreich ist. So konzentriert sich die vorliegende Arbeit mit dem Thema „Der Sprachunterricht im Fokus von Inklusion“ und die qualitative Studie, welche dieser Arbeit zugrunde liegt vor allem auf die folgende Fragestellung:
„Wie muss sich der Sprachunterricht in der Regelschule verändern, damit er inklusiven Standards entspricht?“
Die vorliegende Arbeit versucht zu klären, inwiefern der Deutschunterricht und insbesondere der Rechtschreibunterricht sich verändern muss, um inklusiven Standards zu entsprechen. Da die Literatur und die Forschung zu diesem Thema nicht sehr weit fortgeschritten sind, muss innerhalb dieser Arbeit eine Basis geschaffen werden, auf welcher die Forschungsfrage beantwortet werden kann. Dazu wird eine qualitative Erhebung mithilfe des problemzentrierten Leitfadeninterviews durchgeführt.
Um der Fragestellung und der qualitativen Forschung gerecht zu werden, ist der Aufbau der vorliegenden Arbeit folgendermaßen gegliedert:
Im zweiten Kapitel dieser Arbeit werden theoretische Grundlagen vorgelegt. Diese tragen nicht nur zum besseren Verständnis des Problems bei, sondern ermöglichen auch die theoretische Sensibilität, welche innerhalb von problemzentrierten Interviews vorausgesetzt wird. Schließlich sollte der Interviewer als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen werden. Die theoretischen Grundlagen wurden innerhalb dieser Arbeit in drei Teile gegliedert. Der erste Teil setzt sich mit der begrifflichen Erklärung von Inklusion auseinander und versucht das Konzept in Abgrenzung zur Integration näher zu erläutern. In dem zweiten Teil der theoretischen Grundlagen werden die rechtlichen Grundlagen schulischer Inklusion dargestellt. Neben der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen wird auch ein Gesetzentwurf des Landes Nordrhein-Westfalens vorgestellt, da die Daten, die der Arbeit zugrunde liegen auch alle im Land Nordrhein-Westfalen erhoben wurden. Im dritten und letzten Teil des theoretischen Rahmens sollen letztlich Prinzipien und Strukturen einer inklusiven Bildung dargestellt und erläutert werden. Natürlich gibt es diesbezüglich viele verschiedene Ansätze und Meinungen. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich jedoch auf die Heterogenität, die Teilhabe und Zugehörigkeit sowie auf das Teamteaching und die innere Differenzierung als grundlegende Elemente inklusiver Bildung.
Das dritte Kapitel erläutert die Forschungsfrage im Detail und führt die verschiedenen Zielsetzungen der qualitativen Forschung dieser Arbeit auf.
Im nächsten Kapitel wird schließlich konkret die qualitative Studie zum Thema Sprachunterricht im Fokus von Inklusion erläutert. Dieses Kapitel besteht aus fünf verschiedenen Teilen. Im ersten Teil wird die qualitative Forschung als solche und die Ziele der konkreten Studie zum Thema erläutert. In einem nächsten Schritt geht es um das Sampling, den Feldzugang und die Durchführung der Studie. Als Nächstes wird das Leitfadeninterview als problemzentriertes Interview vorgestellt, welches in dieser Arbeit als Erhebungsmethode genutzt wird. In einem weiteren Schritt werden die Instrumente des problemzentrierten Interviews detailliert erläutert und aufgeführt, um in einem letzten Schritt dieses Unterkapitels die Methodenwahl zu begründen.
Das fünfte Kapitel der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich schließlich mit der Auswertung der erhobenen Daten. In einem ersten Schritt werden die formalen Charakteristika des erhobenen Materials dargestellt und die Transkriptionsregeln erläutert, welche der Transkription der Interviews zugrunde liegen. In einem zweiten Teil dieses Kapitels geht es um die qualitative Inhaltsanalyse, welche als Auswertungsmethode für die vorliegende Forschungsarbeit genutzt wurde. Im dritten Teil dieses Kapitels werden die Interviews einzeln ausgewertet. Um einen besseren Überblick zu gestalten, wurden die Interviews in ihren Gruppen gegliedert. Im Kapitel V.3.1 werden alle Interviews der Gruppe I ausgewertet, in Kapitel 3.2 die der Interviewgruppe II und die Interviews der Gruppe III werden im Kapitel 3.3 ausgewertet. Im vierten Teil desselben Hauptkapitels werden die erhobenen Daten schließlich strukturiert und kategorisiert. Das heißt, die verschiedenen Interviewgruppen werden zusammengefasst und die Ergebnisse anhand von Kategorien dargestellt. Diese Strukturierung und Kategorisierungen wurden anhand von Tabellen durchgeführt, welche im Kapitel vier des Anhangs zu finden sind.
In einem letzten Schritt der Datenauswertung soll nun in einer Gesamtauswertung versucht werden die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit mithilfe der Ergebnisse zu beantworten. Dabei wird auch in den Blick genommen, wie sinnvoll die Umsetzung eines inklusiven Unterrichts letztlich überhaupt ist.
II. Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit soll das Phänomen Inklusion zunächst theoretisch erläutert werden. Diese theoretischen Grundlagen und der aktuelle Forschungsstand, der im Folgenden skizziert werden soll, sollen schließlich der Ausgangspunkt für die anschließende qualitative Studie zum Thema sein. Selbstverständlich ist Inklusion ein Konzept, dass nicht nur die Schule und den Unterricht betrifft. Vielmehr ist Inklusion eine Lebensform, die die ganze Gesellschaft auf allen Ebenen und Dimensionen angeht. Die vorliegende Arbeit verfolgt jedoch das Ziel, Inklusion auf schulischer Ebene zu untersuchen und zu erklären. So sind auch die theoretischen Grundlagen der Zielsetzung dieser Arbeit angepasst und beziehen sich überwiegend auf Inklusion in der Schule und dabei vor allem auf den Sekundarbereich des deutschen Schulsystems.
1. Begriffliche Erklärung von Inklusion in Abgrenzung zur Integration
Das Wort Inklusion kommt vom lateinischen Wort inclusio und bedeutet Einschließung. Damit ist die Einbindung eines Individuums in die Gesellschaft gemeint. Somit ist die Inklusion ein gesellschaftlicher Prozess, der auf allen Ebenen danach strebt, die Vielfalt der Menschen zu würdigen.[1]
Nun ist Einschließung ein Begriff, der auch auf die Integration zutrifft. Werden Schüler und Schülerinnen mit Behinderung, die in eine Regelschulklasse integriert werden, nicht auch gesellschaftlich in das Schulsystem eingebunden? Um den Begriff der Inklusion von dem der Integration abzugrenzen, eignen sich zwei Ansätze. Zum einen das Stufenmodell von Alois Bürli und zum anderen die Gegenüberstellung von der Praxis der Integration und der Praxis der Inklusion durch Andreas Hinz.
Letzterer hat verschiedene Aspekte der beiden Konzepte gegenübergestellt, von denen hier aber nur die wichtigsten aufgeführt werden. In der Praxis der Integration sollen Kinder mit bestimmten Bedürfnissen in die allgemeine Schule eingegliedert werden. Inklusion hingegen setzt das Lernen und Leben von allen Kindern in der allgemeinen Schule voraus. Dieses Privileg soll also nicht nur den geeigneten Schülern und Schülerinnen zustehen, sondern allen, unabhängig der Behinderung. Weiter steht ein individuumzentrierter Ansatz in der Praxis der Integration einem systemischen Ansatz in der Praxis der Inklusion gegenüber. Das heißt konkret, dass sich im Zuge der Integration der Schüler den Gegebenheiten in der Regelschule anpassen muss und der Schüler sozusagen auf die Schule zu geht. Inklusion bedeutet hingegen, dass das System dahingehend verändert wird, damit es den Ansprüchen aller Schüler und Schülerinnen entspricht.[2] Ein weiterer wichtiger Aspekt der Inklusion in Abgrenzung zur Integration ist das gemeinsame und individuelle Lernen für alle. Das heißt, im Zuge der Inklusion sollen nicht mehr nur Schüler und Schülerinnen mit Behinderung speziell gefördert werden, sondern es gilt die besondere und individuelle Förderung aller Schüler und Schülerinnen. Auch die Umverteilung der Ressourcen ist ein wichtiger Aspekt, den Hinz in seiner Gegenüberstellung aufgenommen hat. So kommen in der Praxis der Integration die Ressourcen vor allem den Kindern mit Behinderungen zugute. In einem inklusiven Schulsystem hingegen sind die Ressourcen für das System, das heißt für die Schule und somit für alle Schüler und Schülerinnen. Alle lernen gemeinsam und haben die gleichen Bildungschancen. Ein letzter wichtiger Punkt in der Gegenüberstellung, der hier noch hervorgehoben werden soll, ist das differenzierte System je nach Schädigung in der Praxis der Integration, welches dem umfassenden System in der Praxis der Inklusion gegenübergestellt wird. Das heißt vorliegend, dass das System nicht mehr nach den verschiedenen Förderschwerpunkten und nach den verschiedenen Leistungsniveaus gerichtet werden soll. Vielmehr soll es ein umfassendes System geben, welches den Bedürfnissen aller Schüler und Schülerinnen entsprechen soll. Somit fiele auch die Etikettierung der behinderten Schüler und Schülerinnen weg. Diese müssen nun nicht mehr entsprechend der verschiedenen Förderschwerpunkte kategorisiert werden, um in ein System zu passen.[3] Letztlich hat Hinz festgestellt, dass Integration schon ein großer Schritt in Richtung der Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ist, es allerdings immer noch Ziele gibt, welche die Integration nicht verwirklichen konnte. Die folgenden Punkte, die Hinz diesbezüglich aufzählt, sollen schließlich innerhalb der Inklusion umgesetzt werden. Hinz ist der Meinung, dass es der Integration nicht gelungen sei, sonderpädagogische Etikettierung und Kategorisierung zu überwinden. Innerhalb der Inklusion ist es nicht mehr notwendig, dass Schüler und Schülerinnen einen speziellen Förderschwerpunkt aufweisen müssen, um besonders gefördert zu werden. Vielmehr betrifft die individuelle Förderung von nun an alle Schüler und Schülerinnen und soll auch innerhalb eines gemeinsamen Unterrichts praktiziert werden. Weiter führt Hinz aus, dass es der Integration nicht gelungen sei, zu einem komplexeren Verständnis von Heterogenität beizutragen. Diesem Kritikpunkt wirke die Inklusion schon allein damit entgegen, dass Heterogenität und Vielfalt Grundbausteine seien, auf denen die Inklusion basiert. Drittens verweist er darauf, dass die Integration die sonderpädagogische Rolle nicht neu definieren konnte. Hier steht auch die Inklusion vor einer großen Herausforderung. Zuletzt bemerkt Hinz noch, dass es innerhalb der Integration nicht gelungen sei, die Vorstellung von zwei Gruppen innerhalb einer Klasse zu überwinden. Anders soll dies bei der Inklusion der Fall sein, in der es keine Einzelintegration von Schülern und Schülerinnen mehr geben soll, sondern vielmehr eine Klassengemeinschaft verschiedener Schüler und Schülerinnen, die gemeinsam lernen.[4] Insgesamt wird bei Hinz deutlich, dass es sich bei Inklusion vermutlich um eine Weiterentwicklung der Integration handelt.
Im Stufenmodell der Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik nach Alois Bürli ist Inklusion in Abgrenzung zur Integration die höchste Stufe der Entwicklung und wird als Ideal betrachtet. Integration ist in diesem Modell die Vorstufe der Inklusion und unterscheidet sich wie die Inklusion erheblich von der Exklusion, also der Ausschließung der behinderten Schüler und Schülerinnen vom System. Trotzdem sind die Inklusion und die Integration zurecht in eine eigene Stufen eingeteilt. Das Stufenmodell ist des Weiteren eine gute Unterstützung, um kurz die Entwicklung der Sonderpädagogik zu skizzieren. So kann anschließend ein besserer Zugang zur Begrifflichkeit der Inklusion und zu ihren Strukturen geschaffen werden:
Abbildung 1: Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik nach Alois Bürli[5]
Hans Wocken erklärt dieses Modell und damit auch die Entwicklung der Sonderpädagogik folgendermaßen: Exklusion bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen mit Behinderung vollständig aus dem Schulsystem ausgeschlossen werden und somit auch von der Schulpflicht befreit sind. So kommt es, dass bildungsfähige Kinder in Anstalten aufgenommen werden oder bei ihren Familien zu Hause fern ab von Bildung bleiben. Die nächste Stufe hin zum Ideal der Inklusion ist die Separation. Die Entwicklung dieser Stufe hat sich Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit der Einführung der Schulpflicht für Behinderte ausgebildet. Sie zeichnet sich durch den Zugang zur Bildung für Behinderte im separierten Sonderschulwesen aus. Das heißt, behinderte Schüler und Schülerinnen haben zwar das Recht auf Bildung, indem sie der Schulpflicht unterliegen, allerdings werden sie in speziellen Schulen abseits von den Regelschulen unterrichtet. Dem liegt die „Zwei-Schulen-Theorie“ zugrunde, wie sie auch heutzutage oftmals noch die Regel ist: Sonderschulen für behinderte Kinder und Regelschulen für nicht behinderte Kinder.[6] Bei der Vorstufe der Inklusion ist die Regelschule mehr oder minder offen und nimmt auch bestimmte Kinder mit Behinderung auf. Durch diese Stufe der Integration wird die „Zwei-Schulen-Theorie“ von der „Zwei-Gruppen-Theorie“ abgelöst. Zum Teil werden die behinderten Kinder mit den nicht behinderten Schülern und Schülerinnen zwar in einer Schule unterrichtet, aber trotzdem werden zwei Gruppen gebildet. Das heißt, Behinderte sind als behindert etikettiert und diagnostiziert. Somit unterscheiden sie sich also von der Gruppe der nicht-behinderten „normalen“ Kinder.[7] Die Aufhebung dieser Theorie ist ein wichtiger Aspekt der letzten Stufe, nämlich der Inklusion. In dieser Stufe, die dem Ideal Bürlis entspricht, sollen die Schüler und Schülerinnen mit Behinderung nämlich ihren besonderen Status der Andersartigkeit verlieren. Wie das vorliegende Modell der Entwicklungsstufen schon zeigt, werden die Schüler und Schülerinnen mit Behinderung nicht mehr ausgegliedert, weder in Gruppen noch in Schulen. Vielmehr soll es nur noch eine Schule für alle geben, an der alle Schüler und Schülerinnen unabhängig ihrer Ausgangsvoraussetzungen gemeinsam lernen sollen.[8]
Die Gegenüberstellung von Inklusion und Integration verdeutlicht, wie weit unsere Gesellschaft mit der Verwirklichung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen schon fortgeschritten ist. Dies zeigt jedoch gleichzeitig auf, welche Ziele noch nicht verwirklicht wurden und welche Aspekte in Zukunft berücksichtigt werden, damit Menschen mit Behinderung aktiv am gesellschaftlichen Leben, insbesondere an der allgemeinen und gemeinsamen Bildung teilhaben können. Letztlich darf jedoch nicht vergessen werden, und darauf verweist besonders Hans Wocken, was die Integration in den letzten Jahren schon geleistet hat. Es besteht immer die Gefahr, dass die Integration durch die Inklusion eine Abwertung erfährt. Nach Wocken sei es falsch, wenn die Integrationspädagogik nun kritisiert wird. Vielmehr sollte die Inklusionspädagogik auf die Erfolge der Integration aufbauen.[9]
2. Rechtliche Grundlagen schulischer Inklusion
Im Dezember 2008 hat die Bundesrepublik Deutschland die Behindertenrechtskonvention der UN unterzeichnet und sich damit verpflichtet Inklusion, innerhalb des deutschen Schulsystems umzusetzen. So gilt seit 2009 auch in der Bundesrepublik Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Diese Konvention hat es sich zur Aufgabe gemacht, für alle Lebensbereiche Ziele zu formulieren, die den Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern. Ein weiteres Ziel der Konvention ist natürlich, der Diskriminierung von behinderten Menschen entgegen zu wirken.[10] Für die vorliegende Arbeit, welche sich mit Inklusion im Bereich der Bildung beschäftigt, ist vor allem der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention von Bedeutung:
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.[11]
Dieser erste Absatz des Artikels 24 der Behindertenrechtskonvention wird im zweiten Absatz noch einmal erläutert. Konkret bedeutet dieser erste Absatz, dass Menschen mit Behinderungen in Zukunft nicht mehr vom allgemeinen Regelschulsystem ausgeschlossen werden dürfen. Menschen mit Behinderungen haben von nun an ein Recht darauf „gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft“[12] unentgeltlich zu lernen. Der Artikel fordert dazu auf ihnen Unterstützung zu gewähren und entsprechende Vorkehrungen für die Bedürfnisse, Einzelner einzunehmen, damit die Betroffenen erfolgreich am Schulsystem teilnehmen können. Im dritten Absatz wird gesagt, dass die Vertragsstaaten dafür Sorge zu tragen haben, dass Menschen mit Behinderungen lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen erwerben, um ihnen die Teilhabe an der Bildung und die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft zu erleichtern. Der vierte Absatz geht, wie zum Teil schon der zweite Absatz, auf die Maßnahmen ein, die getroffen werden müssen, um Inklusion zu ermöglichen. Der letzte Absatz des 24. Artikels stellt sicher, dass den Menschen mit Behinderung „ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen“ ein Zugang zur allgemeinen Bildung ermöglicht wird.[13]
Hans Wocken ist der Meinung, dass diese Konvention mit ihrem 24. Artikel einen historischen Wandel in der Geschichte des Behindertenwesens markiert. Erstmals werden nicht bestimmte Rechte für Behinderte formuliert, sondern die Konvention fordert die allgemeinen Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung ein.[14] Somit hat die Inklusion durch die Behindertenrechtskonvention eine rechtliche Grundlage erhalten. Nun ist laut Volker Weide nicht mehr die Frage, ob Inklusion wünschenswert ist, sondern wie die Grundbedingungen gestaltet werden müssen, sodass allen Schülern und Schülerinnen das Recht auf allgemeine Bildung ermöglicht wird.[15] In Deutschland wurde durch die UN-Behindertenrechtskonvention sowohl eine fachliche als auch eine rechtliche Diskussion entfacht, wie solch ein inklusives Bildungssystem, wie es gefordert wird, überhaupt gestaltet werden soll und mit welchen Maßnahmen eine solche Gestaltung umgesetzt werden kann.[16]
Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt insbesondere die Länder der Bundesrepublik Deutschland vor eine große Aufgabe. Schließlich ist der Bildungsbereich die Angelegenheit der Länder. Da die vorliegende Arbeit sich überwiegend auf das Land Nordrhein-Westfalen bezieht und die zugrunde liegenden Interviews auch innerhalb Nordrhein-Westfalens durchgeführt wurden, soll hier noch auf die Gesetzgebung des Landtags Nordrhein-Westfalens zur Inklusion eingegangen werden. Diese Gesetzgebungen stellt die rechtlichen Grundlagen für die Lehrer und Lehrerinnen des Landes Nordrhein-Westfalen dar. Das erste Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen wurde im März 2013 von der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalens entworfen. In dem Gesetzesentwurf wird unter Punkt A das Problem geschildert und noch einmal die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention erläutert. Dass Inklusion dort wortwörtlich als Problem aufgeführt wird, lässt vermuten, dass die Landesregierung nicht unbedingt mit der Entscheidung zufrieden ist. In einem zweiten Punkt B wird aber schließlich eine Lösung angeboten:
„Inklusive Bildung und Erziehung in allgemeinen Schulen werden im Schulgesetz NRW (SchulG) als Regelfall verankert. In Umsetzung dessen haben die Eltern grundsätzlich das Recht, dass ihr Kind mit Behinderung eine allgemeine Schule besucht. Die sonderpädagogische Unterstützung in einem inklusiven Schulsystem wird weiterentwickelt. Dies fügt sich in den grundsätzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ein, Schülerinnen und Schüler nach ihren speziellen Bedürfnissen, Lernerfordernissen und Kompetenzen zu fördern.(…)“[17]
Kontrovers wird vor allem der Punkt diskutiert, dass die Eltern in Zukunft entscheiden, welche Schule ihre Kinder besuchen. Das elterliche Wahlrecht ist neu. Vorher wurden die Kinder sonderpädagogisch von Experten getestet, um ihnen eine angemessene Bildung zu ermöglichen. Der Lösungsvorschlag beinhaltet zudem, dass die jeweiligen Kreise in Zukunft entscheiden dürfen, ob sie auf Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache verzichten möchten. Ein weiterer Punkt innerhalb des Gesetzentwurfes wird den Kosten gewidmet, welche Inklusion verursacht. Dort wird unter anderem aufgeführt, dass zusätzliche Lehrkräfte für Formen des gemeinsamen Lernens zur Verfügung gestellt werden sollen. Ein weiterer Artikel verspricht begleitende Fortbildungen, insbesondere für die Lehrkräfte an allgemeinen Schulen.[18] Ein letzter Punkt, der hier noch genannt werden soll, ist der Punkt der Befristung. Dieser beinhaltet eine Berichtspflicht des Ministeriums für Schule und Bildung gegenüber dem Landtag bis zum 31. Dezember 2018. Das heißt konkret, dass das Land Nordrhein-Westfalen bis Ende des Jahres 2018 die Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt haben sollte.[19]
3. Prinzipien und Strukturen inklusiver Bildung
Wie der Vergleich von Inklusion und Integration verdeutlicht, lässt sich Inklusion als die ultimative Integration ansehen. Inklusive Pädagogik verzichtet darauf, Schüler und Schülerinnen gleichzuschalten und zu normalisieren. Das heißt, die Kinder werden nicht mehr der Schule angepasst, vielmehr passt sich die Schule umgekehrt den Schüler und Schülerinnen an. Die Schulen haben von nun an, im Zuge von Inklusion, also die Aufgaben sowohl den Lernstoff, die Aufgaben, die Lernwege als auch die Ziele auf die verschiedenen Schüler und Schülerinnen anzupassen.[20] Bevor nun einzelne Aspekte der Inklusion erläutert werden, soll Gottfried Biewer zitiert werden, der Standards der Inklusion wie folgt in einer kurzen Definition zusammengefasst hat:
„Inklusive Pädagogik bezeichnet Theorien zur Bildung Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf strukturelle Veränderungen der regulären Institutionen zielen, um der Verschiedenheit der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzer/innen gerecht zu werden.“[21]
3.1 Heterogenität
Zwar ist die Homogenität einer Lerngruppe sowieso ein selbstauferlegtes Ideal, das niemals erreicht wird, wenn man schon alleine die verschiedenen kulturellen Wurzeln aber auch die Voraussetzungen der Schüler und Schülerinnen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Letztlich gibt es keine homogenen Lerngruppen, jedoch ist in der aktuellen Forschungsliteratur immer noch die Rede von einer homogenen Lerngruppe, obwohl Heterogenität eine bekannte Tatsache ist. Trotzdem ist gerade im bestehenden deutschen Schulsystem das Ziel, die Schüler und Schülerinnen so zu selektieren, dass sie in hochdifferenzierten Einrichtungen möglichst homogene Gruppen bilden.[22] Das heißt konkret, dass die Schüler und Schülerinnen nach der Grundschulzeit in verschiedene Schulformen eingegliedert werden, damit diese Schulformen nach Möglichkeit Lerngruppen beschulen, welche in etwa die gleichen Ausgangsvoraussetzungen mitbringen. So suggerieren unterschiedliche Schulformen, dass Schüler und Schülerinnen passgenau aufgeteilt werden müssen, um Gruppen zu erhalten, die anschließend im Gleichschritt lernen. Dieser Gleichschritt lässt sich sowohl in Lehrplänen als auch in der Lernzeit und den Lernwegen wiederfinden. Das deutsche Schulsystem basiert also auf dem Konstrukt der homogenen Lerngruppe.[23] Dieses Phänomen zeigt, dass Heterogenität eher als Problem angesehen wird, welches es, beispielsweise durch Selektion, zu beseitigen gilt. In inklusiven Bildungseinrichtungen soll Heterogenität jedoch als Bereicherung und Chance für die Gestaltung eines Bildungsangebotes angesehen werden, das sich an alle Schüler und Schülerinnen richtet. So verzichten inklusive Bildungseinrichtungen von vornherein auf jegliche Form von Aussonderung. Vielmehr ist die Heterogenität, also die unterschiedlichen Lernbedürfnisse, die unterschiedlichen Interessen sowie die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Schüler und Schülerinnen, die Ausgangsbedingung inklusiver Bildung.[24]
Die Inklusion wendet sich der Heterogenität einer Lerngruppe positiv zu. Heterogenität bedeutet demnach nicht, dass verschiedene Schüler und Schülerinnen mit dem Ziel beschult werden, irgendwann eine homogene Lerngruppe zu werden. Vielmehr wird gerade die Vielfalt, die eine solche heterogene inklusive Klasse mit sich bringt, begrüßt. So erwartet eine inklusive Schule nicht, dass die Schüler und Schülerinnen reif für eine bestimmte Schulform werden und sich dieser anpassen. Sondern stellt sich die inklusive Schule mit einem inklusiven Konzept auf den Entwicklungsstand eines jeden Kindes und auf die Verschiedenheit aller Schüler und Schülerinnen ein.[25] Um also wirklich Inklusion durchzuführen, muss Homogenität überwunden werden. Denn Inklusion bedeutet auch, dass niemand ausgeschlossen wird.[26] Oft wird in der Inklusionsdebatte vergessen, dass Inklusion nicht nur Heterogenität auf Ebene der körperlichen und geistigen Bedingungen betrachtet. Vielmehr bemüht sich die Inklusion, alle Dimensionen von Heterogenität in den Blick zu nehmen. Dazu zählen auch unter anderem Geschlechterrollen, ethnische Herkunft, Nationalitäten, Erstsprachen, Religionen und weltanschauliche Orientierungen.[27] Aber auch ganz banale Merkmale wie Interesse, Alter, Lerntyp und andere Persönlichkeitsfaktoren tragen zu einer Vielfalt in den Klassen bei und dürfen neben den Behinderungen, welche oftmals in inklusiven Debatten im Mittelpunkt stehen, nicht unterschätzt werden.[28]
Befürworter der Inklusion wie Werning merken an, dass sich die Heterogenität positiv auf das Lernen auswirken kann. So sollen lernschwächere Schüler und Schülerinnen von dem Anregungspotenzial der stärken Schüler und Schülerinnen profitieren. Umgekehrt können aber auch leistungsstärkere Schüler und Schülerinnen profitieren. Schüler und Schülerinnen mit umfangreicherem Vorwissen können Schwächere unterstützen und durch die Reflektion neue Aspekte dazulernen und lernen ihr Wissen umzustrukturieren. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die inklusive Lerngruppe sinnvoll zusammengesetzt und die Zahl der Leistungsstärkeren hinreichend groß ist. Auch hochbegabte Schüler und Schülerinnen benötigen eine besondere Förderung und tragen zur Heterogenität bei.[29]
3.2 Teilhabe und Zugehörigkeit
Ein weiteres grundlegendes Element der Inklusion in der Schule ist die Teilhabe an Bildung. Damit einhergeht die Zugehörigkeit zum allgemeinen Bildungswesen. Zugehörigkeit bedeutet in bestimmter Art und Weise dazu gehören. Sozial gespiegelt könnte das in Form von Anerkennung geschehen. Das heißt, benachteiligte Menschen müssen Anerkennung in der Gesellschaft durch ihre Mitmenschen erfahren. Im Fall der schulischen Inklusion wäre das die Anerkennung inkludierter Schüler und Schülerinnen durch die anderen Schüler und Schülerinnen der Lerngruppe. Doch Anerkennung allein reicht nicht aus. Die Schüler und Schülerinnen sollten aktiv am Geschehen teilnehmen und kollektives und soziales Handeln erfahren. Damit ist vor allem auch die Einbindung in zwischenmenschliche und soziale Zusammenhänge gemeint.[30] Nun stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, ob eine Teilhabe am allgemeinen Bildungsangebot für alle Schüler und Schülerinnen zu realisieren ist. Jene Schüler zum Beispiel mit erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen können sich nur selten aktiv an schulischer Bildung beteiligen. So ist Theo Klauß der Meinung, dass sich der Anspruch auf Teilhabe für einen bestimmten Teil der Schüler und Schülerinnen auf soziale Zugehörigkeit reduzieren wird. Dazu zählen soziale Kontakte aber eben auch die Akzeptanz innerhalb einer Gruppe.[31] Teilhabe bedeutet im Umkehrschluss, auch die Verhinderung jeglicher Ausgrenzung. Dazu müssen laut Rohrmann jedoch erst ausgrenzende Systeme und Strukturen und damit eben auch Aussonderungen im allgemeinen deutschen Schulsystem überwunden werden.[32] Das heißt, dass unser derzeitiges Schulsystem für alle Schüler und Schülerinnen geöffnet werden müsste, damit Inklusion und somit auch eine Teilhabe an der Bildung möglich werden. Inklusive Bildung setzt demnach die Aufhebung lernbehinderter und ausgrenzender Strukturen und Bedingungen im allgemeinen Schulsystem voraus.[33] Einher mit der Teilhabe und der Zugehörigkeit geht auch die Wertschätzung eines jeden Schülers. Zum einen die Wertschätzung seiner Leistungen, zum anderen aber auch die Wertschätzung des individuellen „Soseins“. Die Wertschätzung muss auf allen Ebenen erfolgen. Die Schüler und Schülerinnen müssen sich gegenseitig wertschätzen, aber auch durch den Lehrer wertgeschätzt werden und umgekehrt. Natürlich muss die Wertschätzung aber auch über die Räumlichkeiten der Schule hinaus beibehalten werden. Ohne Wertschätzung, Teilhabe und Zugehörigkeit kann Inklusion nicht funktionieren. So muss im Zuge von Inklusion ein wertschätzendes, diskriminierungsfreies Lernumfeld geschaffen werden, dass den Schülern und Schülerinnen in ihrer Verschiedenheit die Teilhabe an der Bildung und die Zugehörigkeit zur Gesellschaft ermöglicht.[34]
3.3 Teamteaching
In Deutschland sind Lehrer bisher, zumindest an Regelschulen, Einzelkämpfer gewesen. Das heißt, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin in der Regel alleine vor einer Klasse steht und unterrichtet. Die Zusammenarbeit beschränkt sich meist auf wenige Absprachen in Lehrerkonferenzen. Da die Umsetzung von Inklusion vorsieht, dass zumindest ein Teil des Unterrichts in Kooperation mit einem zweiten Pädagogen durchgeführt wird, kommt es zu einer Veränderung der Rolle des Lehrers.[35] Teamteaching ist eines der grundlegenden Elemente von Inklusion. Der sogenannte Methodenpool der Universität Köln definiert Teamteaching folgendermaßen:
„Teamteaching ist eine kooperative Lehrmethode, bei der zwei oder auch mehr Personen gemeinsam eine Lerngruppe unterrichten. Die Methode sollte idealtypisch sowohl das Lehrerteam als auch die Lernenden mit einbeziehen. Sie ist besonders geeignet, um den Unterricht mit mehr Perspektivenvielfalt, größerer Methodenvielfalt und unterschiedlichen Anregungen zu erweitern, da sie die Fixierung auf einen Lehrenden verhindert. Sofern diese Stärken bewusst eingesetzt werden, kann die Methode das Lernen und Lehren mit größerer Offenheit und mit mehr Differenzierungsmöglichkeiten fördern.“[36]
Den Lehrern und Lehrerinnen wird demnach die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit anderen Lehrern ihren Unterricht zu planen und zu gestalten. Im besten Fall bekommen Regelschullehrer[37] im Falle von Inklusion einen Sonderpädagogen zur Unterstützung zugeteilt, der vor allem in Hinblick auf die förderbedürftigen Schüler und Schülerinnen tätig wird. Durch die Teamarbeit der beiden Pädagogen sollen flexible Formen der Differenzierung und individuellen Förderung im Schulalltag umgesetzt werden.[38] Jedoch sollte vermieden werden, dass sich der Sonderpädagoge ausschließlich um die Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf kümmert und die Regelschullehrkraft um die Regelschüler und Regelschülerinnen. Dies wäre nicht im Sinne der Inklusion. Vielmehr sollen die Pädagogen ihre jeweiligen didaktischen Erfahrungen austauschen und gemeinsam an einem inklusiven Unterricht arbeiten, in dem beide Lehrkräfte alle Schüler und Schülerinnen individuell fördern. Für die Regelschullehrer und Regelschullehrerinnen dürfte dieses Prinzip gewöhnungsbedürftiger sein als für Förderschullehrer[39] und Förderschullehrerinnen, die es in der Regel aus der Förderschule kennen in einem Team zu unterrichten. Jutta Schöler hat den Eindruck, dass manche Regelschullehrkräfte mehr Angst vor dem zweiten Erwachsenen in der Klasse haben als vor dem behinderten Kind.[40] Doch auch, wenn das sogenannte Zwei-Pädagogen-Prinzip, wie es in den meisten Schulen im Zuge von Inklusion praktiziert wird, erst einmal eine Umstellung für die meisten Lehrer bedeutet, bringt es doch einige Vorteile mit sich. Es entlastet die einzelnen Lehrer und Lehrerinnen in vielerlei Hinsicht. Zum einen kann die Planung des Unterrichts zusammen oder aber auch geteilt stattfinden. Zum anderen ermöglicht Teamteaching den Lehrern und Lehrerinnen, sich in bestimmten Unterrichtsphasen auf die Beobachtungen des Schülerverhaltens konzentrieren zu können. Zudem verlangt gerade eine heterogene Schülerschaft nach der Zuwendung eines Erwachsenen, welche durch zwei Pädagogen eher gewährleistet werden kann, als durch eine einzelne Lehrkraft, die alleine für die Klasse zuständig ist. Damit das individuelle Lerntempo und die verschiedenen Interessen von Schülern berücksichtigt werden können, müssen auch verschiedenartige Unterrichtsmaterialien herangezogen werden. Ein einzelner Lehrer wäre mit dieser Aufgabe überfordert. Zudem bietet es sich an, dass die Förderschullehrkraft Materialien für die schwächeren Schüler aus seinem Förderschulrepertoire beisteuert und die Regelschullehrkraft die Materialien aus seinem Materialienpool aus der Regelschule einbringt. Ebenfalls für die Beurteilung und für Elterngespräche ist es von Vorteil, wenn differenzierte Beobachtungen geschildert werden.[41] Außerdem dient Teamteaching auch der persönlichen Entwicklung des jeweiligen Lehrers. Schließlich kann jeder Lehrer bei Bedarf ein Feedback nach jedem Unterricht erhalten. Weiter werden bei Förderschullehrern die fachlichen Kompetenzen erweitert und bei Regelschullehrern bilden sich die sozialen Kompetenzen weiter aus.
Insgesamt handelt es sich beim Teamteaching und der Methode des Zwei-Lehrer-Prinzips also um eine kooperative Art von Unterricht, die sowohl für die Schüler und Schülerinnen als auch für die Lehrer und Lehrerinnen gewinnbringend sein kann, wenn sie kooperativ praktiziert wird.
3.4 Innere Differenzierung