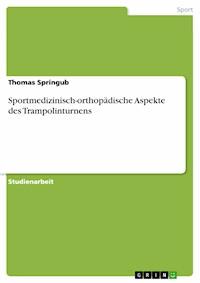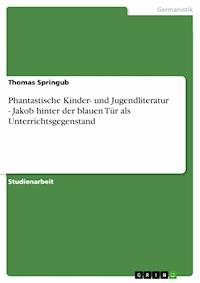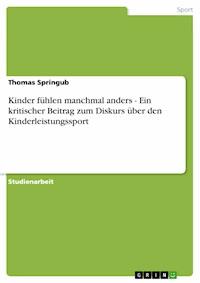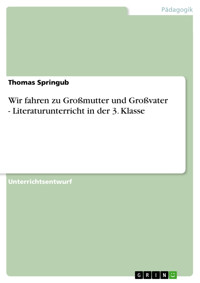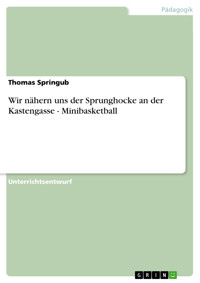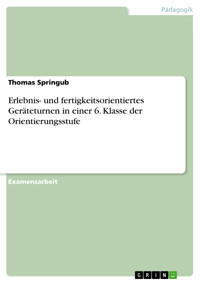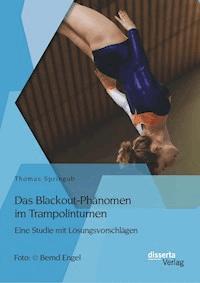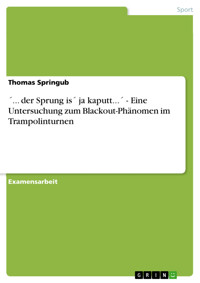
´... der Sprung is´ ja kaputt...´ - Eine Untersuchung zum Blackout-Phänomen im Trampolinturnen E-Book
Thomas Springub
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich Sport - Bewegungs- und Trainingslehre, Note: 1, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Fachbereich Sport), Veranstaltung: 1. Staatsexamen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Trampolinturnen ist eine recht junge und seit kurzem auch olympische Sportart. Im Spitzenbereich gehören Dreifachsalti mit eingebauter Längsachsendrehung bereits zum Standard-Repertoire. Die Wettkampfübungen des Leistungssports bestehen aus zehn verschiedenen Sprüngen; Mehrfach-Vorwärts- und -Rückwärtssalti zumeist mit Mehrfach-Schrauben. Um auf zehn verschiedene und dennoch schwierig und ästhetisch wirkende Elemente zu kommen, muß der Springer die Bewegungen in unterschiedlicher Körperhaltung (gebückt, gestreckt, gehockt) und v.a. die Schrauben zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Bewegung turnen. Dennoch sehen die Sprünge für den Laien `irgendwie alle gleich´ aus, und so werden Spitzenspringer manchmal gefragt: „Wie schaffst du das nur? Kommst du da nicht auch ´mal durcheinander?“ Leider muss die Antwort mancher Athleten hierauf "Ja" lauten. Plötzlich können Sprünge, die zuvor schon viele hundert Male geturnt wurden, nicht mehr abgesprungen werden. Nicht selten werden andere Sprünge geturnt, als der Athlet sich vorgenommen hatte (z. B. Salto mit zwei Schrauben, anstatt Schraubensalto). Oder die Bewegung beginnt normal, wird aber mittendrin abgebrochen. Manchmal kann ein Turner keine Ansprünge mehr machen, ohne ständig einen Salto rw zu turnen. In der Fachsprache des Trampolinturnens hat sich für diese Erscheinungen der Begriff Blackout durchgesetzt. Obwohl im englisch-amerikanischen Bereich auch der Begriff `Lost-Skill-Syndrome´ kursiert, bevorzuge ich in dieser Arbeit die Bezeichnung Blackout (BO) - nicht nur, weil er inoffiziell schon ein Fachbegriff ist, sondern auch weil mir für ein derart komplexes Thema dieser relativ offene Begriff angebrachter erscheint. Da nicht nur ich, sondern noch viele anderer Leistungssportler mit diesem Phänomen mehr oder weniger in Konflikt geraten sind und noch werden - einige geben deswegen den Sport sogar auf - und, weil es in der Literatur bislang so gut wie gar nicht behandelt wurde, möchte ich mich nun damit auseinandersetzen. Ich denke, daß es dringend notwendig ist, etwas Licht in das Dunkel des Blackout-Phänomens zu bringen, und daß der Schleier der Neurose von den Betroffenen genommen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2001
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Bewegungstheoretischer Bezugsrahmen
1.1 Abgrenzung von der Kybernetik
1.1.1 Die Entstehung unterschiedlicher Bewegungsauffassungen
1.1.2 Digitaler Mensch ?
1.1.3 Kybernetik und Regelkreise
1.2 Ganzheitlicher Ansatz
1.2.1 Der Bewegungsbegriff
1.2.2 Bewegungshandlungen als Beziehung zwischen Mensch und Welt
1.2.3 Die Bewegung als Gestalt
1.2.4 Der Gestaltkreis
1.2.5 Innere Bilder
1.2.6 Lernen und Üben in schöpferischer Freiheit
1.3 Bewegungsformen im Trampolinturnen
1.3.1 Translations- und Rotationsbewegungen
1.3.2 Bewegungsformen des Wettkampfsports
1.3.3 Bewegungs- bzw. Sprungphasen
2. Das Phänomen des Blackout im Trampolinturnen
2.1 Definition und Schilderung
2.1.1 BLACKOUT
2.1.2 Abgrenzung zu ähnlichen Erscheinungen
2.1.3 Erscheinungsarten des Blackout
2.2 Versuch einer theoretischen Eingrenzung - motorische Handlungsfehler
2.2.1 Merkmale des motorischen Handlungsfehlers
2.2.2 Entstehungsmöglichkeiten von Handlungsfehlern
3. Untersuchung
3.1 Fragestellung
3.2 Methode
3.3 Durchführung
3.3.1 Die geplante Voruntersuchung
3.3.2 Die narrativen Interviews
3.4 Ergebnisdarstellung und -interpretation
3.4.1 Beschreibung der Fälle
3.4.2 Bezug der spezifischen Situation im Training zur Entstehung des BO
3.4.3 Zusammenhang zur allgemeinen Lebensituation
3.4.4 Die Rolle der Ichhaftigkeit bei ersten Fehlversuchen
3.4.5 Die Rolle der Ichhaftigkeit bei der Entwicklung eines BO
3.4.6 Zusammenhang zu den allgemeinen Trainingsbedingungen und den Lehr- und Lernmethoden
3.4.7 Innere Vorgänge
3.4.8 Die Ähnlichkeit der Bewegungen und das Problem der trennscharfen Codierung
4. Fazit
4.1 Zusammenfassende Erklärungsversuche
4.1.1 Die ersten Fehlhandlungen
4.1.2 Die Verfestigung
4.1.3 Die Erweiterung
4.2 Folgerungen für die Trainingspraxis
4.2.1 Prophylaxe
4.2.2 Rehabilitation
5. Schluß
6. Anhang
0. Einleitung
Das Trampolinturnen ist eine recht junge und seit kurzem auch olympische Sportart, welche Bewegungserfahrungen ermöglicht, die in kaum einer anderen Sportart gemacht werden können. Man kann für einen Augenblick die Schwerkraft überwinden und sich dabei mit viel Übung auch noch in verschiedene Richtungen drehen und überschlagen. Im Spitzenbereich gehören Dreifachsalti mit eingebauter Längsachsendrehung bereits zum Standard-Repertoire. Die Wettkampfübungen des Leistungssports bestehen aus zehn verschiedenen Sprüngen; Mehrfach-Vorwärts-und-Rückwärtssalti zumeist mit Mehrfach-Schrauben. Um auf zehn verschiedene und dennoch schwierig und ästhetisch wirkende Elemente zu kommen, muß der Springer die Bewegungen in unterschiedlicher Körperhaltung (gebückt, gestreckt, gehockt) und v.a. die Schrauben zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Bewegung turnen. Dennoch sehen die Sprünge für den Laien `irgendwie alle gleich´ aus, und so werden Spitzenspringer manchmal gefragt: „Wie schaffst du das nur? Kommst du da nicht auch ´mal durcheinander?“
Auch ich selber habe Trampolinturnen als Leistungssport betrieben. Ich möchte nun von drei Begebenheiten, die mir in dieser Zeit widerfuhren, erzählen. Als ich gerade 13 Jahre alt war, hatte ich mich für einen großen internationalen Jugendwettkampf qualifiziert. In der Vorbereitung studierte ich eine neue Übung ein, die jedoch relativ unsicher blieb. Immer wenn ich den richtigen Absprungpunkt für den Beginn der Kür nicht fand, stoppte ich mit einem Salto rw das Anspringen. Als ich dann im Finale des Wettkampfes stand, fand ich meinen Absprung wieder nicht und machte den Salto rw, obwohl ich genau wußte, daß dies nicht erlaubt war und als Übungsbeginn gewertet werden würde (was ich natürlich nicht wollte). Keiner verstand mein Verhalten, am wenigsten ich selber. Im Training danach passierte es mir immer wieder, daß ich bei den Ansprüngen unbeabsichtigt einen Salto rw machte. Einige Wochen später war ich mir plötzlich `unsicher´ beim Schraubensalto. Ich wußte nicht, wie ich es anstellen sollte, diesen Sprung, den ich schon nahezu 1000mal gemacht hatte, zu turnen. Ich konnte ihn scheinbar grundlos nicht mehr und mußte ihn wieder ganz neu lernen. Wiederum einige Wochen danach passierte es mir einmal, daß ich anstatt Barani (Salto vw gestreckt mit halber Schraube) einen 1 ¾ Salto vw mit Landung auf dem Rücken machte. Das geschah dann immer öfter, bis ich überhaupt nicht mehr in der Lage war, einen Barani zu turnen, und stattdessen immer 1 ¾ Salto vw machte. Und das war noch nicht alles! In der schlimmsten Phase machte ich bei jedem Versuch, einen der verschiedenen einfachen Vorwärtssalti zu turnen, mindestens 1 ¾ Saltodrehungen. Gelegentlich machte ich dann sogar Doppelsalto rw anstatt einen einfachen Salto rw zu turnen. Es ist leicht nachzuvollziehen, daß ich in dieser Phase kein sehr glücklicher Mensch war. Was war da mit mir los?
In der Fachsprache des Trampolinturnens hat sich für diese Erscheinung der Begriff Blackout durchgesetzt. Obwohl im englisch-amerikanischen Bereich auch der Begriff `Lost-Skill-Syndrome´ krusiert, bevorzuge ich in dieser Arbeit die Bezeichnung Blackout (BO) - nicht nur, weil er inoffiziell schon ein Fachbegriff ist, sondern auch weil mir für ein derart komplexes Thema dieser relativ offene Begriff angebrachter erscheint.
Da nicht nur ich, sondern noch viele anderer Leistungssportler mit diesem Phänomen mehr oder weniger in Konflikt geraten sind und noch werden - einige geben deswegen den Sport sogar auf - und, weil es in der Literatur bislang so gut wie gar nicht behandelt wurde, möchte ich mich nun damit auseinandersetzen. Ich denke, daß es dringend notwendig ist, etwas Licht in das Dunkel des Blackout-Phänomens zu bringen, und daß der Schleier der Neurose von den Betroffenen genommen wird.
Um dem Problem wirklich auf den Grund zu gehen, halte ich es für unerläßlich, das Empfinden und die Meinung der Betroffenen genauer zu betrachten. Aus diesem Grund habe ich mit Sportlern und Trainern gesprochen bzw. narrative Interviews geführt, die mit dem Blackout in Berührung gekommen sind. Damit der Interpretation dieser Gespräche ein fundierter theoretischer Bezugsrahmen zugrunde gelegt werden kann, werde ich im ersten Schritt der Arbeit ausführlich über die für den Untersuchungsgegenstand wichtigen Punkte einer qualitativen Bewegungslehre referieren. In diesem Ansatz wird die Bewegung auf in der Sportwissenschaft nicht ganz übliche Weise betrachtet. „Sie erscheint nicht nur als `Tatbestand in der Welt´, sondern ebenso als von menschlicher Subjektivität in seiner Bedeutung hervorgebracht.“ (Prohl/ Seewald 1995, 7) Dem Leser mag der Umfang dieses Teils der Arbeit bei einem Blick in das Inhaltsverzeichnis überproportional vorkommen, allerdings halte ich dieses Ausmaß für notwendig, damit die Begriffe bei der Interpretation der Untersuchungsergebnisse nicht noch extra erklärt werden müssen. Außerdem werden hier bereits Aussagen der Befragten für die Beschreibung trampolinspezifischer Vorgänge einbezogen. Bevor ich dann zur Untersuchung und der Ergebnisinterpretation komme, werde ich das Phänomen Blackout noch einmal näher beschreiben und zudem eine eventuell nützliche Theorie zu motorischen Handlungsfehlern ansprechen. Im letzten Abschnitt werde ich dann versuchen, die Ergebnisse noch einmal zu einer allgemeinen Theorie zusammenzufassen und daraus Hinweise für den Umgang mit Blackoutproblemen im Training abzuleiten.
1. Bewegungstheoretischer Bezugsrahmen
Jeder Wissenschaftler betrachtet seinen Untersuchungsgegenstand von einer bestimmten Position. Dabei existieren in der heutigen Forschung zur menschlichen Bewegung v. a. zwei Positionen.
Da ist zum einen der Standpunkt des außenstehenden Beobachters, bei dem die Bewegung des Körpers im Mittelpunkt des Interesses steht. Durch die Eingliederung anderer Wissenschaften werden dann die Phasenstruktur oder andere sichtbare qualitative Merkmale der Bewegung möglichst objektiv betrachtet. Die Physik und die Biomechanik untersuchen Orts- und Lageveränderungen des Körpers und seiner Teile und dabei auftretende Kräfte, während die Physiologie und die Motorikforschung ihr Zustandekommen zu erklären versuchen.
Von einem anderen Standpunk aus wird besonders das Erlebendes sich-bewegenden Menschen betrachtet. Dabei ist besonders seine Wahrnehmung von Bedeutung. Es wird danach gefragt, wie und warum der Mensch welche (Bewegungs-) Handlungen in seiner Umwelt vollzieht. Seine Absichten, Entwürfe, Erwartungen, Gedanken u. a. werden dann mit der Körperbewegung behandelt..
1.1 Abgrenzung von der Kybernetik
Im folgenden wird es darum gehen, wie diese beiden Standpunkte - es gibt sicherlich viele Schattierungen und Mischformen, die davon abgeleitet werden können, hier jedoch nicht besprochen werden - zustande gekommen sind, welchen ich in dieser Arbeit nicht einnehmen werde und Gründe dafür.
1.1.1 Die Entstehung unterschiedlicher Bewegungsauffassungen
In einem Beitrag während eines Symposiums zur Sportmotorik[1]beschrieb Jan W.I. Tamboer die „Entstehungsgeschichte des Bewegungsproblems“ (vgl. 1997, 23ff.), die ich nun versuche nachzuzeichnen.
Um die Entstehung unterschiedlicher Auffassungen bezüglich der menschlichen Bewegung herzuleiten, ging der Autor weit in die Geschichte der Philosophie zurück; zu Aristoteles. Dem Griechen zufolge (und im Gegensatz zu seinem Lehrer Plato) „setzen sich alle Dinge aus zwei Prinzipien zusammen: `Form´ und `Materie´. Mit dem Form-Prinzip meinte er das teleologische Prinzip, ohne das `Materie´ keine Realität darstellt und dem sie ihr Ziel und ihre Bestimmung entlehnt“ (a.a.O., 24) (Hervorhebungen vom Autor). Von besonderer Bedeutung ist hierbei, daß Aristoteles die Form nicht gesondert von der Materie, d. h. nicht außerhalb des Subjekts betrachtete, sondern für ihn war sie eine dem Wesen innewohnende Sinnbezogenheit. V. a. bei Menschen und Tieren kommt zu dieser Sinnbezogenheit eine starke Spontaneität, so daß sie in der Lage sind, sich selbst zu bewegen. „Spontane Aktivität, Zielgerichtetheit und `Bezogenheit zu etwas´ sind im aristotelischen Denken [...] inhärente Merkmale der lebendigen Wirklichkeit“ (ebd.). In dem Form-Prinzip des griechischen Philosophen ist das wiederzufinden, was mehrere hundert Jahre später in den Humanwissenschaften - und auch bei einigen wenigen Bewegungswissenschaftlern - durch den Begriff Intentionalität beschrieben wird.
Bereits zum Ende des Mittelalters wurde diese Auffassung zugunsten der entstehenden Naturwissenschaften verworfen. Durch Männer wie Galilei, Kepler oder Newton entstand ein mechanistisches Weltbild, das bestimmt war durch kausale Zusammenhänge und die Isolierbarkeit aller Teile. Tamboer spricht hier von einer „Substantialisierung der Wirklichkeit“ (a.a.O., 25), welche besonders durch Descartes mit dem Menschen in Beziehung gebracht wurde. Er eröffnete den Weg des Dualismus von Subjekt und Welt, wenn er behauptete, „daß `Zielgerichtetheit´ und `Sinngebung´ nur noch zugeteilt werden könnten an eine separate Substanz [...], die vom materiellen Körper strikt getrennt gedacht“ werden muß (ebd.). Der Franzose ist auch dafür mitverantwortlich zu machen, daß es zu einer „radikalen Spaltung des `sinnvollen Verhaltens´ in eine `subjektive Innen-Welt´ und eine `objektive Außenwelt´“ (ebd.) kam, und daß das maschinenanaloge Körperbild sich gegen das ursprüngliche, anthropomorphe durchsetzte.
So entstanden zwei unterschiedliche Traditionen in den Humanwissenschaften, die sich auch in der Bewegungswissenschaft niederschlugen. Allerdings ist hier die „aristotelische Tradition“ (a.a.O., 26), die sich auf Intentionalität, Sinn und Bedeutung im Zusammenhang zur Einheit von Mensch und Welt beruft, mit ihrem hermeneutischen Untersuchungsansatz nicht zu großer Bedeutung gelangt. Vielmehr ist es die „galileische Tradition“ (ebd.), welche die Analysierbarkeit (durch Isolation) und Gesetzmäßigkeit (kausale Zusammenhänge) aller Geschehnisse voraussetzt und somit auf einem substantiellen Wirklichkeitsbild basiert, die die Wissenschaft der Bewegung heute mit einer empirisch-analytischen Vorgehensweise bestimmt. Häufig liegt den aktuellen Forschungsansätzen folglich ein Körperbild mit eher substantiellem Charakter zugrunde, denn „man glaubt, den Körper unabhängig von der Umgebung beschreiben zu können. Eine Trennung von Mensch und Welt ist mit diesem Körperbild direkt verbunden“ (a.a.O., 26f.). Dieses Körperbild hat eine Auffassung von Bewegung zur Folge, in der menschliches Sich-Bewegen reduziert wird auf die Veränderung von Ort und Lage des Körpers bzw. seiner Teile; auf Körperbewegung. Das Verhältnis zur Umwelt gilt dabei als „extrinsisch“ und wird erst in die Überlegungen einbezogen, wenn es um die Erforschung der Ursachen oder Wirkungen solcher Körperbewegungen geht. Unabhängig davon versucht man der Regelung und Steuerung der Bewegung näher zu kommen, und beschreibt diese dann kybernetisch, in Form von Regelkreismodellen in verschiedenen Ebenen.
Bevor ich auf diese Anschauungen näher eingehe, möchte ich noch einmal auf das hinter ihnen stehende Menschenbild zurückkommen. Tamboer kommt zu der Folgerung, „daß der Körper als Instrument oder Bewegungsapparat ins Blickfeld kommen kann. Besonders die Verwendung von Maschinenmetaphern wie `Uhrwerk´, `Dampfmaschine´, `Radio´ und `Computer´ ist in diesem Rahmen verlockend“ (a.a.O., 27). Da wir im Computerzeitalter leben und u. a. deshalb die Computermetapher wohl am geläufigsten ist, möchte ich diese zunächst in Frage stellen.
1.1.2 Digitaler Mensch ?
M. E. kann eine Maschine - und ein Computer ist nunmal eine - nicht ernsthaft mit einem lebenden Organismus verglichen werden, und schon gar nicht mit dem höchstentwickelten. Hierzu möchte ich nun hauptsächlich drei Gründe anführen.
Der vornehmliche Grund, aus dem ein Vergleich von Computer und Mensch irreführend ist, ist die Intentionalität des Menschen, die dem Computer (und allen anderen Maschinen) fehlt. Diesem Unterscheidungsmerkmal können viele andere untergeordnet werden.
Ein Automat[2]kann sich nicht aus freiem Willen[3]und aus der Situation heraus für oder gegen etwas entscheiden. „Wie zahlreich und wohlgestaltet sie auch sein mögen, alle Verzweigungsmöglichkeiten von Computerprogrammen sind unveränderlich festgesetzt“ (Glaser 1997, 27), und zwar vom Menschen. Für ihn bzw. für uns haben die Dinge Bedeutungen, wir handeln aus einem ureigenen Sinnzusammenhang heraus. Wir deuten bestimmte Situationen als Probleme und entwickeln daraus Aufgaben. „Eine Maschine kann zwar Probleme lösen, aber keine Probleme stellen, hat Einstein zu Recht gesagt“ (Buytendijk 1967, 187).
Das zweite Hauptunterscheidungsmerkmal des Menschen zur Maschine, das ich hier nennen möchte, ist sein Bewußtsein (s. auch 1.2.5.0). Ein Computer ist sich wohl kaum bewußt, was er tut, und weiß nichts über sich, er hat nur Daten.
„Das Bewußtsein ist mehr als ein bloßer Datenfilter. Wäre ein Computer fähig, zu jedem Zeitpunkt eine kleine Auswahl der von ihm gerade bearbeiteten Daten sinnvoll zu einem Gedanken zusammenzufügen, so würde dies ohne Zweifel als außergewöhnliche Intelligenzleistung gelten. Bewußtsein wäre ihm deswegen noch nicht zuzubilligen. -- Denn im Hirn ist alles Bewußte zwangsläufig mit Empfindungen versehen. Sie färben jeden Gedanken, jede Wahrnehmung und jedes Urteil, ein Phänomen, das sich in rätselhafter Weise der objektiven Beschreibung zu entziehen scheint“ (Der Spiegel 1996, 196).
In dieser Aussage wird auch der dritte wesentliche Kontrast des Menschen zum Computer deutlich; die Emotionalität. Alles, was wir denken oder tun wird mitbestimmt durch Empfindungen und Emotionen.
Weitere Unterschiede - wie z. B. bezüglich der Informationsspeicherung (Computer: seriell - Mensch: parallel), der Informationskontrolle (Computer: zentral - Mensch: verteilt) oder der Leistung (Computer: schnell/ genau - Mensch: langsam/ störanfällig) (vgl. Daugs 1994, 24f.) - sollen hier nicht näher beschrieben werden, denn ich denke, es ist durch die drei von mir als wesentlich erachteten Unterscheidungsmerkmale bereits klar geworden, daß eine Analogie zwischen Mensch und Computer unhaltbar ist. Nun aber zurück zu den Folgen eines solchen Menschenbildes.
1.1.3 Kybernetik und Regelkreise
Schon bei Plato taucht das Wort Kybernetik auf, das er für die Fähigkeit des Herrschens, also für die Steuerung der Staatsgeschicke, gebrauchte. Als wissenschaftlichen Begriff für die Lehre von Regulationen im allgemeinen festigte Wiener Kybernetik 1958, wobei er diese Regulierungen sowohl Organismen, als auch Maschinen in gleicher Weise zuschreibt (vgl. Buytendijk 1967, 183). Sie enthält verschiedene Gebiete: Informationstheorie, Informationsverarbeitung, Speichern von Instruktionen, Verschlüsselung von Instruktionen, Programmieren, Aufnehmen von Wahrscheinlichkeitsverhältnissen in ein Programm, u. a. (vgl. ebd.). All diese Gebiete tauchen sowohl in der Sinnesphysiologie, als auch in der Genetik, der Neurophysiologie, der Verhaltenslehre, u.a. als Erklärungshilfe auf. „Die Kybernetik wurde `eine Brücke zwischen den Wissenschaften´“ (a.a.O., 184). Die Physiologen beispielsweise erstellen „durch die Untersuchung der Prozesse in den morphologischen Strukturen de[n] Vergleich mit mechanischen und maschinellen Verhältnissen [...]. Überzeugend zeigt sich dies in den Versuchen, eine neurophysiologische Erklärung der Verhaltensweisen, Wahrnehmungen, Erinnerungen usw. zu geben“ (Buytendijk 1967, 182). Dazu sagt Volger: „Der kybernistischen Auffassung unterliegt ein naturwissenschaftlich-technologisches Wissenschaftsverständnis, mit dem der Verlust des Subjekts verbunden ist“ (1990, 110). Auch Buytendijk ist der Meinung, daß die Kybernetik die Subjektivität des Menschen „formalisiert“. Begriffe wie Verhalten, Beschließen, Ausführung, Störung und v. a. Plan, Information, Programm, Regulation, Steuerung, usw. sind von dieser Formalisierung stark betroffen.
„Die Kybernetik ist eine moderne und allgemein anerkannte Art der Formalisation von Lebensäußerungen, wobei diese als Prozesse verstanden werden, die in ihrem gesetzmäßigen Verlauf in der physikalischen Zeit organische Regulationen, Verhaltensweisen von Tier und Mensch nachahmen“ (1967, 185).
Der erfolgreiche Einzug der Kybernetik in die Sportwissenschaft fand v. a. durch Meinel und Schnabel statt. Sie entwickelten ein Regelkreismodell mit einem „Geflecht von inneren und äußeren Regelkreisen“ (Trebels 1993, 24), welche die Koordination der Bewegung ermöglichen (sollen). Hierbei sind die Rückmeldungen der Sinnesorgane, von Meinel/ Schnabel Analysatoren genannt, besonders wichtig. Sie liefern sensorische Rückmeldungen, welche dann über einen Ist-Soll-Wert-Vergleich zur Verbesserung bzw. Genauigkeit der Bewegung führen (sollen) (vgl. ebd.). „Den Analysatoren rechnet Schnabel sensorische Zentren in verschiedenen Hirngebieten des Projektionsfeldes der Hirnrinde zu, in denen aufbereitend Information verarbeitet wird“ (Volger 1990, 113). Genau an dieser Stelle wird das Modell `baufällig´, denn die wichtigste Frage, was die Verarbeitung ist oder wie sie sich vollzieht, bleibt ungeklärt. Auch die Rolle der Analysatoren selbst ist kritisierbar. „Wenn Schnabel nähmlich die neurophysiologischen Funktionen der Analysatoren für identisch hält mit dem mentalen Ereignis der Körper- und Bewegungswahrnehmung, so zeigt sich darin eine radikal materialistische Auffassung von mentalen Phänomenen“ (a.a.O., 111). Im gleichen Zusammenhang hält Trebels es für nicht zulässig, „Wahrnehmungen auf das Aufsammeln vorgegebener `objektiver´ Sinnesdaten zu reduzieren. [...] Unsere Sinne sind - wie unser Verhalten - durch intentionale Gerichtetheit mitbestimmt“ (1993, 24). Pathetischer drückt sich Leist bei der Frage aus; „Wie konnte man in der Kommunikations- und Lerntheorie[4]die Begriffe Signal und Information verwechseln ?“ (1997, 4) Gemeint ist, daß in der Welt vorgefundene Signale nicht objektiv aufgenommen werden, sondern subjektiv mit Bedeutung belegt, ausgewählt und erst dann als Information dienlich werden.
Weiterhin lassen sich folgende Aspekte - zusammengefaßt - nicht mit dem Regelkreismodell und anderen kybernetischen Erklärungsversuchen der menschlichen Selbstbewegung vereinbaren.[5]
Beim Menschen bleibt die Variabilität des Verhaltens trotz der Auswertung früherer Erfahrungen erhalten. „Während jedoch der Automat [...] zunehmend festgelegt wird - er kann dann z. B. nicht mehr zugleich gut, schlecht oder falsch“ agieren (Ennenbach 1989, 67).
Der Mensch hat ein Wissen um die eigene Bewegungsgeschichte und das aktuelle Bewegungsniveau. Dieses Metawissen beeinflußt sein Verhalten zu jedem Zeitpunkt, was bei Maschinen nicht der Fall sein wird.
Das menschliche Bewegungsverhalten wird mitbestimmt durch ein Wertbewußtsein (Christian[6]), was jedoch nicht heißt, daß die Bewegung nach technischen Analysen, wie sie Maschinen erstellen würden, `wertvoll´ sein muß.
Der sich-bewegende Mensch folgt einer subjektiven Zeitstruktur, die transzendent ist zur physikalischen Zeit.[7]Diese subjektive Zeitstruktur wird bestimmt durch die Bedeutung von bereits Geschehenem (retrospektiv) und Erwartetem (prospektiv).
Der Mensch kann völlig Neues lernen, während z. B. Computer nur in ihrem Programm präziser werden. Das Besondere am Menschen ist, „daß dieser Kenntnisse und Methoden in großer Zahl erwirbt, nicht nur durch Anwendung und Auswertung vorhandener Programme [...], sondern auch durch Neukonstruktion. Er läßt sich z. B. in ungewohnte Denk-Bewegungen ein und sieht plötzlich neue, überraschende Zusammenhänge, die nicht `programmiert´ waren, vorher nie `gezogen´ wurden. Der Computer dagegen kann immer nur bereits `Gezogenes´ oder im Programm sonst noch Vorgesehenes verwerten“ (Ennenbach 1989, 68).
Buytendijkund Christian bringen die Problematik der Gleichstellung von Mensch und Maschine in der Kybernetik (und damit auch in Regelkreismodellen) auf den Punkt:
„Wer nicht gerade dem dogmatischen Physikalismus verfallen ist, weiß, daß nur das Lebewesen - also ein `Selbst´ von positionalem Charakter - `sich´ verhalten kann und nicht ein biophysikalisch erklärtes Nervensystem [...]. Es ist ferner unmöglich, das Erleben auf Vorgänge im Nervensystem zu reduzieren, und schon die Tatsache, daß ein physisches Geschehen nie als intentionales Bewußtsein gedacht werden kann, läßt uns fragen, wieweit müssen wir der Idee einer grundsätzlichen Analysierbarkeit der Lebensvorgänge mittels technischer Begriffe und Vorstellungen entgegenkommen“ (1963, 97, Hervorhebungen vom Autor)
1.2 Ganzheitlicher Ansatz
1.2.1 Der Bewegungsbegriff
Wie auch Ingeborg Heidemann möchte ich nun zunächst „die Frage nach dem Begriff der Bewegung“ (1965, 395) stellen, um den Bewegungsbegriff, der dieser Arbeit zugrunde liegt, zu verdeutlichen.
Der Begriff der Bewegung wird sehr vielfältig verwendet. Er wird nicht nur für Gegenstände oder Lebewesen gebraucht, sondern auch das Gemüt kann bewegt werden, sowie das Wollen oder das Denken.
„Diese Frage [die nach der Bewegung] ist nicht damit zu beantworten, daß die Bewegung physikalisch bestimmt wird: als Veränderung des Orts oder der Lage eines Körpers. Sie ist aber auch nicht damit zu beantworten, daß wir sie als Urphänomen setzen, allem Lebendigen eigen, so daß Leben Bewegung ist und die Gesetze der Bewegung die Gesetze des Lebens sind“ (ebd.).
Zwischen diesen beiden extremen Positionen gibt es sicher noch viele abgemilderte Auffassungen von Bewegung, die mehr zur einen oder zur anderen Position tendieren. Wenn der Begriff der Bewegung[8]in manigfaltiger Weise und in unterschiedlichen Bereichen (Politik, Geschichte, Sport, Musik, Leben, Arbeit, Maschinen, u.v.a.m.) benutzt wird, so braucht wohl jeder Bereich einen eigenen Bewegungsbegriff, allerdings darf dieser nicht in sich geschlossen sein, sondern muß offen bleiben für allgemeine, umfassende Aspekte des ursprünglichen Begriffs. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Bewegungsbegriffen sind also fließend.
Der Begriff der Bewegung des Menschen muß antithetisch verstanden werden (vgl. Heidemann a.a.O., 396). Er beinhaltet sowohl das objektive Geschehen, die Welt, als auch das subjektive Handeln, den Menschen. „Menschliche Bewegung ist Bewegtwerden -menschliche Bewegung ist Selbstbewegung“ (ebd.). Klages überbrückt diesen scheinbaren Widerspruch, indem er die Einheit von Mensch und Welt in der Bewegung treffend beschreibt: „äußeres Geschehen induziert inneres Geschehen, und dieses induziert die Eigenbewegung“ (1960, 1047).
Die äußerlich sichtbare Bewegung ist Anzeichen für eine innerliche, welche wiederum ihren Ursprung in der vom Menschen gedeuteten Umwelt hat. Menschliches Bewegen ist immer auch `Verhalten´, und dieses „schließt einen `wer´ (Subjekt), der sich verhält, ein, und eine `Welt´ (Situation), auf die das Verhalten bezogen ist“ - so entsteht „ein Dialog zwischen Mensch und Welt“; eine Beziehung (Tamboer 1979, 15). Das Gelingen bzw. die Vollkommenheit einer Bewegung kann nur gemessen werden an der Situation und der Aufgabe, wobei die Aufgabe im Menschen selber entsteht und dabei bezogen ist auf seine Deutung der Situation. Sowohl die Aufgabe als auch die Situation bestimmen also die innere Zusammensetzung der Bewegunggestalt. Ihre Zusammensetzung ist deshalb aber keineswegs von vornherein festgelegt und variiert auch von mal zu mal, denn es kommt darauf an, daß die einzelnen Teile zu einer Gestalt geordnet sind und im Gleichgewicht stehen. Zu dieser Ordnung tragen innere Kräfte bei, die im Menschen ursprünglich vorhanden sind.
Menschliche Bewegung kann also als Beziehung und als Gestalt aufgefaßt werden.
„In ihren Erscheinungen sind Bewegungen prägnante, von der Zeit bestimmte Wahrnehmungsgestalten, ihrem Wesen nach sind sie Beziehungen zwischen dem Ich und der Welt. Der innere Drang zum Bewegungskönnen, der im freiwilligen Üben sich zeigt, ist nichts anderers als der Wunsch, im Dialog mit der Welt die eigene Beziehung zur Welt zu harmonisieren“ (Volger 1990, 126).
Hierzu läßt sich noch ihre Betrachtung als Form ergänzen[9](vgl. Volger 1995, 157). Bewegung als Form bezieht sich auf ihre äußerlich sichtbare Ausführung, also die Orts- und Lageveränderungen des Körpers und/ oder seiner Teile. Sie beschreibt die Technik der Bewegung und wird z.B. durch die Biomechanik erforscht. Jede Form einer Bewegung ist ursprünglich entstanden aus einer Idee. Schon Aristoteles sprach von der Idee als Form, die durch die Erfahrung des Menschen in seinem Geiste entsteht und so überdauernd wird (vgl. Gaarder 1993, 130f., sowie Volger 1996, 5). Die Idee ist gekennzeichnet durch gewisse Eigenschaften, die den jeweiligen Formen gemein sind. Der Salto rw ist also eine im menschlichen Geiste vorhandene Idee, die durch ihre Verwirklichung - das Turnen eines Salto rw - kurzfristig zur Form des Saltos wird. Oftmals werden solche Ideen von Bewegungen als homologe, starre Formen und als Ausführungsdoktrinen mißverstanden. „Die Form kann aber auch als gelungene Schöpfung, als Vollendung einer Idee gesehen werden, deren Nacherfinden und Beleben eine bereichernde ästhetische Erfahrung verspricht“ (Volger 1996, 5).
Mit diesem Teil des Bewegungsbegriffes[10]werde ich mich später im Zusammenhang mit der Bewegung als Gestalt mehr beschäftigen. Zunächst möchte ich jedoch den Bewegungsaspekt `Beziehung´ näher betrachten.
1.2.2 Bewegungshandlungen als Beziehung zwischen Mensch und Welt
„Bewegungen können auch als Beziehung gedacht werden. Damit ist die Beziehung des Menschen zur Welt gemeint [...].“(Volger 1995, 157)
Die Anschauung der Bewegung als Beziehung, wie sie hier schon mehrfach angesprochen wurde, ist u. a. aus der „handlungstheoretischen Perspektive“ Tamboers (1997, 28ff.) herauszulesen. Er faßt die menschliche Bewegung als Handlung auf und spezifiziert sie als `Bewegungshandlung´. Diesem Begriff steht der Begriff `Körperbewegung´ gegenüber (vgl. auch Tamboer 1994). Letzterer beschreibt lediglich die objektiv sichtbare Art und Weise der Bewegung, also Orts- und Lageveränderungen des Körpers, oder die Form der Bewegung. Während den Körperbewegungen ein substantielles Körperbild zu Grunde liegt, gilt für die Bewegung als Handlung ein relationales Körperbild. In diesem relationalen Körperbild wird auch die Bewegung als Beziehung manifestiert, denn es beschreibt die „intrinsische Relation des menschlichen Leibes mit der Welt“ (Tamboer 1997, 29), oder anders ausgedrückt geht es um die Intentionalität des Menschen bzw. seine Bezogenheit auf die Welt. Diese Intentionen bzw. Absichten des Menschen werden durch seine Handlungen verwirklicht.
Allerdings sind nicht alle Handlungen gleichzeitig Bewegungshandlungen. Was muß also gegeben sein, um von Bewegungshandlungen sprechen zu können? Tamboer nennt drei „notwendige Voraussetzungen [...]:
1. Es muß sich um eine primär auf Ortsverändern gerichtete Intentionalität handeln [wobei `Ortsverändern´ als eine spezifische zeit-räumliche Veränderung im Hinblick auf die Umgebung aufgefaßt wird];
2. die Umgebung wird in für das Ortsverändern relevanten Begriffen bezeichnet werden müssen [zum Beispiel etwas, um damit zu rollen, um darin oder darauf zu klettern, um davon hinunter zu springen];
3. die Art des Ortsveränderns wird in Begriffen von zeit-räumlichen Verhältnissen näher spezifiziert werden müssen [zum Beispiel langsam, schnell, nach oben, nach unten, vorwärts, seitwärts und so weiter]“ (1994, 47).[11]