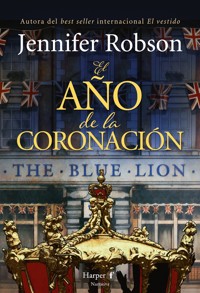4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kleid, das ein ganzes Land zum Träumen bringt ...
London 1947: Das ganze Land fiebert der Hochzeit von Kronprinzessin Elizabeth entgegen – allen voran die beiden Freundinnen Ann und Miriam. Sie sind überglücklich, dass sie als Stickerinnen am Kleid der zukünftigen Königin mitarbeiten dürfen. Doch ihr Glück ist nicht von Dauer ...
Toronto 2016: Nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter Ann findet die Journalistin Heather kunstvolle Stickereien, die dem Blumenmuster auf dem Hochzeitskleid der Queen entsprechen. Was hat es damit auf sich? Und warum hat Ann nie über ihr Leben in England gesprochen? Heather begibt sich auf Spurensuche nach London und stößt auf eine dramatische Geschichte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
London 1947: Das ganze Land fiebert der Hochzeit von Kronprinzessin Elizabeth entgegen – allen voran die beiden Freundinnen Ann und Miriam. Sie sind überglücklich, dass sie als Stickerinnen am Kleid der zukünftigen Königin mitarbeiten dürfen. Doch ihr Glück ist nicht von Dauer … Toronto 2016: Nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter Ann findet die Journalistin Heather kunstvolle Stickereien, die dem Blumenmuster auf dem Hochzeitskleid der Queen entsprechen. Was hat es damit auf sich? Und warum hat Ann nie über ihr Leben in England gesprochen? Heather begibt sich auf Spurensuche nach London und stößt auf eine dramatische Geschichte …
Autorin
Jennifer Robson hat Literatur und Geschichte studiert und anschließend in Oxford promoviert. Nach mehreren Jahren in der Verlagsbranche konzentriert sie sich inzwischen ganz auf das Schreiben von Romanen. Sie lebt mit ihrer Familie in Toronto und teilt ihr Arbeitszimmer mit einem Schäferhund und zwei Katzen.
JENNIFERROBSON
Der Stoff der Träume
ROMAN
Aus dem Englischen von Anne Fröhlich
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Gown« bei William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Jennifer Robson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
LS · Herstellung: ik
Satz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, München
ISBN: 978-3-641-25284-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
In Gedenken anRegina Antonia Maria Crespi1933–2017Immigrantin, Näherinund über alles geliebte Großmutter
Schlaf ruhig, wirf keinen Blick
Zurück; nur vorwärts, Träume, zögert nicht
(Hinter euch in der Wüste steht, als Zeichen
des Zweifels, eine Salzsäule).
Schlaf, Vergangenheit, und erwache, Zukunft,
Und geh unverzüglich durch die offene Tür.
Doch ihr, meine verzagten Zweifel, dürft weiterschlafen,
Erwachen müsst ihr nicht – nie mehr.
Mit Bomben kommt das neue Jahr; es ist zu spät,
Den Toten gut gemeinte Ehrung zu erteilen:
Wenn du noch Ehre übrig hast, gib sie den Lebenden;
Wie 1938 sind die Toten tot.
Schlaf beim Geräusch von fließendem Gewässer,
Das morgen durchquert wird, und sei es tief.
Dies ist kein Fluss der Toten, kein Lethe,
Heute Nacht schlafen wir
An den Ufern des Rubikon – die Würfel sind gefallen.
Es wird noch Zeit sein, die Konten zu prüfen,
Später, bei Sonnenlicht, später,
Und dann wird die Gleichung aufgehen.
Louis MacNeice
Autumn Journal, Teil XXIV
Erstes Kapitel
Ann
Barking, EssexEngland31. Januar 1947
Es war schon dunkel, als Ann um Viertel vor sechs von der Arbeit aufbrach, und noch dunkler, als sie heimkam. Normalerweise machte ihr der Fußmarsch von der Bahnstation nach Hause nichts aus. Es war nur eine halbe Meile und nach dem langen Arbeitstag eine willkommene Gelegenheit, einen klaren Kopf zu bekommen. Doch an diesem Abend war es kein angenehmer Spaziergang. Sie zitterte, die Winterkälte kroch ihr unter den Mantel, und ihre Schuhe waren so durchgelaufen, dass sie ebenso gut hätte barfuß gehen können.
Aber morgen war Samstag. Wenn ihr nach dem Schlangestehen beim Metzger noch Zeit bliebe, könnte sie beim Schuster vorbeigehen und fragen, was der dazu meinte. Für neue Schuhe hatte sie nicht mehr genügend Bezugsscheine, und diese alten hatte sie schon zwei Mal neu besohlen lassen. Vielleicht ließe sich ja auf der nächsten Tauschbörse vom Women’s Institute ein halbwegs anständiges gebrauchtes Paar auftreiben.
Sie bog in die Morley Road ein – schon lange fand sie den Weg auch bei Dunkelheit. Erst in ein paar Tagen würde wieder der Mond am Himmel stehen. Nur noch ein paar Meter, dann war sie an der Eingangstür. Sie schob sich durch den Vorhang, den sie aufgehängt hatten, damit die kalte Luft nicht eindrang, drückte auf den Schalter für die Wandleuchte und war erleichtert, als im Flur das Licht anging. Am Abend zuvor war um acht Uhr der Strom ausgefallen und erst am nächsten Morgen wieder da gewesen.
»Milly? Ich bin’s!«, rief sie ihrer Schwägerin entgegen. Das Wohnzimmer war kalt und dunkel, aber aus der Küche drang ein verlockender Duft.
»Du kommst spät!«
»Ich glaube, es sind weniger Züge als sonst gefahren. Wahrscheinlich, um Treibstoff zu sparen. Und die wenigen waren völlig überfüllt. Ich musste ewig warten, bis ich mich in einen hineinzwängen konnte.«
»Hast du gehört, dass es morgen schneien soll? Stell dir vor, wie es dann erst mit dem Zugverkehr aussehen wird.«
»Daran will ich gar nicht denken. Jedenfalls nicht, bevor ich aufgetaut bin.« Ann hängte ihren Mantel an den wackeligen Garderobenständer hinter der Tür und zog ihre Schuhe aus. »Hast du meine Pantoffeln gesehen?«
»Ich habe sie mit in die Küche genommen, damit sie schon mal warm werden.«
Ann machte das Licht aus, nahm ihre Tasche und ging durch das Wohnzimmer in die Küche.
Milly stand am Herd vor einer kleinen Pfanne. »Ich wärme nur die Kartoffeln und das Gemüse von gestern auf, zusammen mit dem letzten Stück geräucherten Schinken.« Sie wandte den Kopf und lächelte ihr flüchtig zu, dann bückte sie sich, um die Ofentür zu öffnen. »Hier«, sagte sie und reichte Ann die Pantoffeln. »Schön warm und nicht mal angebrannt.«
»Du bist ein Schatz. Oh, das fühlt sich wunderbar an.«
»Das dachte ich mir. Was hast du da?«
Ann wickelte am Spülbecken vorsichtig einen kleinen Tontopf aus einem Stück Zeitungspapier. Sie wischte ein paar Erdkrümel fort, die an seinem Rand klebten, und hielt den Topf so, dass Milly die Pflanze darin sehen konnte. »Das ist Heidekraut. Von der Queen.«
»Die Queen hat dir einen Topf Heidekraut geschenkt?«
»Nicht nur mir. Wir alle haben einen bekommen. Jedenfalls alle, die an den letzten Kleidern mitgearbeitet haben. An denen, die die Königin und die Prinzessinnen mit nach Südafrika nehmen. Es gab so viele mit Perlenstickereien, und eins – das die Queen auf dem Ball zum einundzwanzigsten Geburtstag der Prinzessin tragen wird – bestand nur aus Pailletten. Aus Millionen davon, jedenfalls kam es mir so vor. Deshalb hat sie uns aus Schottland die Pflanzen schicken lassen – als Dank.«
»Sieht ein wenig kümmerlich aus.« Milly rümpfte die Nase.
»Hast du noch nie Heidekraut gesehen, wenn es blüht? Es ist wirklich hübsch. Und das hier ist weißes. Das bringt Glück, hat eins der Mädchen gesagt.«
Milly drehte sich wieder zum Herd und rührte weiter. »Ich glaube, jetzt ist das Essen warm. Kannst du den Tisch decken?«
»Natürlich, und ich mache das Radio an. Dann können wir das Unterhaltungsprogramm und die Sieben-Uhr-Nachrichten hören.«
Die Königsfamilie war an diesem Tag nach Südafrika aufgebrochen, und ihr Abschied würde bestimmt unter den ersten Meldungen sein. Als Königspaar stieg man nicht einfach mit zwei Koffern in ein Taxi. In der Zeitung hatte gestanden, die königliche Reise würde mit einer Wagenparade beginnen, vom Buckingham Palace zur Waterloo Station. Dort würden der König, die Königin, die Prinzessinnen und Dutzende Bedienstete in den Zug nach Portsmouth steigen, natürlich erst nach einer offiziellen Abschiedszeremonie mit wichtigen Honoratioren. Und die Kleider, Kostüme und Roben, an denen Ann mitgearbeitet hatte, würden mit auf diese denkwürdige Reise gehen.
Sie war schon seit elf Jahren bei Mr Hartnell angestellt. Eigentlich lange genug, um kein Herzklopfen mehr bei dem Gedanken zu bekommen, dass die Queen von ihr gefertigte Kleidungsstücke trug. Ihre Freunde und Verwandten ließen sich längst nicht mehr davon beeindrucken. Manche, so wie Milly, stöhnten sogar nur noch, wenn Ann voller Begeisterung und mit leuchtenden Augen nach Hause kam und davon erzählte.
Aber sie konnte es nicht ändern, es war nun mal aufregend. Sie war ein einfaches Mädchen aus Barking. Mädchen wie sie arbeiteten normalerweise ein paar Jahre in einer Fabrik oder einem Laden, bevor sie heirateten und ein Leben als Ehefrau und Mutter begannen. Doch durch irgendeine Laune des Schicksals war sie bei einem der berühmtesten Modeschöpfer Englands gelandet, hatte es in seiner Stickerei zu einer der höchsten Positionen gebracht und half bei dem Entstehen von Kleidern, die Millionen Menschen bewunderten.
Es war aber auch wirklich ein Zufall gewesen. Als sie mit vierzehn mit der Schule fertig gewesen war, hatte sie kein Geld für eine Sekretärinnenschule oder dergleichen gehabt und war deshalb zur Arbeitsvermittlung gegangen. Dort legte ihr eine grauhaarige Frau eine Liste von freien Stellen vor, die sie alle schrecklich fand: Lehrling in der Textilfabrik, Kindermädchen, Kellnerin. Sie drehte das Blatt um, wollte schon aufgeben, als sie es sah:
Ausbildung:
Lehrstelle als Stickerin
im Zentrum von London
»Das hier«, sagte sie schüchtern und deutete auf den Eintrag. »›Lehrstelle als Stickerin‹. Was bedeutet das?«
»Genau das, was da steht. Lass mich mal die Kennzahl sehen. Richtig … Das ist bei Hartnell, wo die Queen ihre Kleider nähen lässt.«
»Die Queen?«
»Ja«, sagte die Frau, jetzt in schärferem Ton. »Bist du nun interessiert oder nicht?«
»Das bin ich. Nur … ich kann nicht besonders gut nähen.«
»Aber lesen kannst du, oder? Da steht ›Ausbildung‹.« Die Frau schrieb eine Adresse auf und schob ihr den Zettel über den Schreibtisch. »Ich rufe dort an und sage Bescheid, dass du kommst. Sei morgen um halb neun da. Pünktlich. Und achte darauf, dass deine Hände sauber sind.«
Sie tanzte förmlich nach Hause, voller Freude über die großartigen Neuigkeiten – London! Die Queen! – , aber ihre Mutter seufzte nur. »Du, Stickerin? Du kannst ja kaum einen Faden in eine Nadel einfädeln. Sie werden bald merken, was für ein Schlamassel du anrichtest, und dann setzen sie dich vor die Tür. Lass es dir gesagt sein.«
»Aber ich habe einen Termin, und die Frau bei der Arbeitsvermittlung wird mir keine weiteren Adressen geben, wenn ich nicht hingehe. Bitte, Mum. Sonst bekomme ich Schwierigkeiten.«
»Wie du willst. Aber danach kommst du sofort wieder nach Hause. Es passt mir gar nicht, dass du einen ganzen Tag in London herumspazierst, wenn es hier so viel zu tun gibt.«
Am nächsten Morgen brach sie in der Dämmerung auf, weil die frühen Züge einen Sixpence weniger kosteten, und saß dann in den Berkeley Square Gardens auf einer Bank, bis Big Ben von Westminster her Viertel nach acht schlug. Dann setzte sie ihren Weg fort, der an einem Hinterhaus in einer ruhigen Straße in Mayfair endete, und drückte mit zitternden Fingern auf die Klingel.
Ein Mädchen in ihrem Alter öffnete ihr die Tür. »Guten Morgen.«
»Guten Morgen. Ich komme wegen der Stelle. Als Stickereilehrling?«
Das Mädchen lächelte, nickte und erklärte, dass sie hier richtig sei, und dann führte sie Ann nach oben zur Leiterin der Stickerei.
Miss Duley sah sie prüfend an und erkundigte sich nach ihrer Erfahrung, was das Sticken betraf, und Ann antwortete ängstlich, aber ehrlich, dass sie keine habe. Aus irgendeinem Grund schien das Miss Duley zu gefallen. Mit leisem Lächeln und einem Kopfnicken teilte sie Ann mit, sie könne am kommenden Montag anfangen und würde in der Woche sieben Shilling bekommen.
»Sieben Shilling?«, spottete ihre Mutter später, obwohl das mehr war, als Anns Freundinnen in ihren neuen Anstellungen als Ladengehilfinnen oder Stenografie-Lehrmädchen verdienten. »Die werden schon für die Zugfahrt draufgehen.«
Am folgenden Montag fing Ann bei Hartnell an, und die ersten Monate vergingen wie im Flug. Später erfuhr sie, dass Miss Duley sie genommen hatte, gerade weil sie noch nichts konnte und deshalb auch keine Gewohnheiten hatte, die sie ablegen musste. Bei Hartnell tat man alles auf eine ganz bestimmte Weise, und zwar auf dem höchsten Niveau. Alles, was nicht perfekt war, wurde nicht akzeptiert. Eine Perle oder ein Stich am falschen Platz oder gar eine Paillette, die weniger glänzte als die anderen – nichts entging Miss Duleys scharfem Blick. Dann hob sie leicht die linke Augenbraue und lächelte auf ihre gütige Art, als wollte sie sagen, dass auch sie einmal ein Lehrmädchen gewesen sei und so manchen Fehler gemacht habe.
Es war schwer, sich Miss Duley als vierzehnjähriges Mädchen vorzustellen – oder überhaupt als etwas anderes als diese zierliche und doch irgendwie alle überragende Persönlichkeit, die in den Werkräumen der Stickerei herrschte. Sie hatte helle blaue Augen, die alles sahen, sprach mit einem leichten südenglischen Akzent und strahlte eine Ruhe und Gelassenheit aus, die Ann als höchst wohltuend empfand.
»Konzentriert euch auf eure Arbeit, dann findet sich alles andere von selbst«, pflegte sie zu sagen. »Lasst eure Sorgen draußen und denkt nur an Mr Hartnells Entwurf.«
Die letzten Jahre waren schwer gewesen, und so manchen Tag – manches Jahr – war es beinahe unmöglich gewesen, Miss Duleys Rat zu befolgen und die Sorgen draußen zu lassen. Anns Mutter war im Sommer 1939 überraschend gestorben. Das Herz, hatte der Doktor gesagt. Dann der Krieg, die Luftangriffe und die schreckliche Nacht, in der ihr Bruder getötet wurde. Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, hatte man ihnen gesagt, sogar sein Ehering sei geschmolzen gewesen.
Und schließlich die endlosen Jahre des Elends, in denen sie langsam zu der Überzeugung gelangt war, dass sie nie etwas anderes kennenlernen würde als das Haus in der Morley Road, die Arbeitsräume bei Hartnell und die namenlosen Orte dazwischen. Dieses Leben, bestehend aus trostlosen Tagen, kalten Nächten und schmerzlichen Verlusten nahestehender Menschen, war alles gewesen, was Ann sich eine Zeit lang hatte vorstellen können.
Die Uhr im Wohnzimmer schlug sieben und riss Ann aus ihren Gedanken. Mit dem Besteck in der Hand stand sie am Tisch und bemühte sich, Appetit auf Millys Abendessen zu bekommen. Was nicht einfach war, denn der Schinken war kaum mehr als ein Stück Fett und das Gemüse zu einem grauen Brei verkocht. Sogar die Schulmahlzeiten ihrer Kindheit hatten besser geschmeckt.
»Wolltest du nicht das Radio anmachen?«, erinnerte Milly sie.
Das Radio, ein großes, altmodisches Modell mit einem Gehäuse aus Nussholz, stand im Wohnzimmer neben dem Kamin. Ann schaltete es ein und deckte dann schnell den Tisch, wobei sie die Tür zwischen den beiden Räumen offen ließ. Wenn sie fertig gegessen und den Abwasch erledigt hätten, würde es vielleicht so warm sein, dass sie vor dem Zubettgehen noch eine Stunde hier sitzen könnten.
Sie hatten kaum Platz genommen, als die unaufdringliche Musik des Unterhaltungsprogramms der BBC verstummte und die Nachrichten begannen.
»Am letzten Tag des kältesten Januars, den London seit Jahren erlebt hat, sind Ihre Majestäten, der König und die Königin und die beiden Prinzessinnen, zur ersten Station ihrer Reise nach Südafrika aufge…«
»Ich kann kaum etwas verstehen«, sagte Milly plötzlich. »Lass es mich lauter drehen.«
»Jaja. Schsch …«
»… am Straßenrand versammelt, um der Königsfamilie zum Abschied zuzuwinken, und jeder Einzelne in dieser halb erfrorenen Menge wünschte sich an diesem bitterkalten Januarnachmittag, selbst in den warmen Sonnenschein Südafrikas reisen zu können …«
»Ich würde mich niemals dort hinstellen, um ihnen zuzuwinken«, murmelte Milly. »Nicht bei diesem Wetter.«
Als würde er Milly antworten, wendete sich der Nachrichtensprecher nun ebenfalls dem frostigen Thema zu.
»Die Temperaturen in London sind um Mitternacht auf minus drei Grad gestiegen, womit es über zehn Grad wärmer war als am Wochenanfang. Und auch im weiteren Verlauf der Nacht, als es in weiten Teilen der Stadt schneite, sind die Temperaturen kaum gefallen. Aber der Winter holt schon zum nächsten Schlag gegen die englischen Hausfrauen aus: Wäschereien im ganzen Land werden schließen müssen, wenn die Kohlelieferungen nicht raufgesetzt werden.«
Das Wasser kochte, und Ann ging zum Herd, um Tee für sie beide aufzugießen. Nur ein knapper Löffel Teeblätter für die ganze Kanne, denn die Dose war beinahe leer. Und kein Zucker. Sie hatten sich schon daran gewöhnt, ohne diesen kleinen Luxus auszukommen.
»Ich frage mich, ob diese Mädchen wissen, wie gut sie es haben«, meinte Milly.
»Die Prinzessinnen? Das sagst du immer. Jedes Mal, wenn sie in den Nachrichten sind.«
»Ist doch wahr. Schau dir nur an, wie sie leben. All diese Kleider und Juwelen, dabei müssen sie niemals auch nur einen Finger rühren. Ich an ihrer Stelle würde mich glücklich schätzen.«
»Sie arbeiten. Nein – mach nicht so ein Gesicht. Das tun sie wirklich. Stell dir nur mal vor, wie diese Reise für sie ablaufen wird. Jeden Tag die gleichen langweiligen Gespräche mit fremden Menschen. Überall werden sie angestarrt. Ich bezweifle, dass sie auch nur ein einziges Mal einen Strand zu sehen bekommen, geschweige denn schwimmen gehen.«
»Ja, aber …«
»Und egal, wie heiß es ist, wie sehr ihnen die Füße wehtun und wie sehr sie sich langweilen, immer müssen sie lächeln und so tun, als gäbe es nichts Schöneres, als ein Band durchzuschneiden und in irgendeiner winzigen Stadt irgendwo im Niemandsland zu verkünden, dass eine Brücke oder ein Park nun den Namen ihres Vaters trägt. Wenn das keine Arbeit ist, dann weiß ich nicht, wie ich es sonst nennen soll. Jedenfalls würde ich um nichts in der Welt mit ihnen tauschen wollen, nicht für … nun, für allen Tee, alle Kohle und alle Elektrizität dieser Welt.«
»Natürlich würdest du das, Dummchen. Du wärst verrückt, wenn du nicht gerne so reich wärst wie sie.«
»Ich hätte nichts dagegen, reich zu sein. Aber zu dem Preis, dass jeder meinen Namen kennt und irgendetwas von mir erwartet? Mich auf Schritt und Tritt beobachtet? Das wäre einfach nur schrecklich.«
»Vermutlich.«
»Von den Ankleidedamen und den Verkäuferinnen bei der Arbeit habe ich so einiges gehört: Die reichsten Kundinnen sind oft die unhöflichsten. Über die Maßen anspruchsvoll, und niemals bekommt man einen Dank von ihnen, geschweige denn ein Lächeln, und ganz bestimmt schicken sie keine Geschenke an die Stickerinnen und Näherinnen, die in den Ateliers arbeiten. Und im Vergleich zur Queen und den Prinzessinnen haben die es im Leben leicht.«
»Nun gut«, lenkte Milly ein. »Dann werden wir eben Millionärinnen und verbringen den Winter in Südfrankreich oder Italien. Und dort lassen wir uns von der Sonne bräunen, bis man uns mit amerikanischen Filmstars verwechselt.«
Bei der Vorstellung, irgendjemand könnte sie oder Milly für einen Filmstar halten, musste Ann lächeln. »Wäre das nicht schön? Einfach auf ein Schiff oder in einen Zug steigen und in irgendein exotisches Land fahren …« Durch das Zugfenster einmal andere Dinge sehen als den grauen Himmel, rußgeschwärzte Backsteinwände und trostlose winterliche Gärten.
»So weit müsste es gar nicht sein. Ein paar Tage am Meer würden mir schon genügen.«
Das Gespräch verstummte, als sie sich ans Aufräumen machten, wobei Milly den Abwasch übernahm, damit Anns Hände nicht rissig wurden. Es war kaum halb acht, als sie fertig waren.
»Meinst du, wir können im Wohnzimmer ein Feuer machen? Nur für eine Stunde?«, fragte Milly.
»Einverstanden. Aber nur ein kleines. Ich habe heute Morgen nach der Kohle geschaut; es ist kaum noch welche da. Und es steht in den Sternen, ob der Kohlenmann diese Woche vorbeikommt.«
»Dann eben ein ganz kleines Feuer. Wir setzen uns ganz nah ran, und ich lese dir etwas vor. Ich bin auf dem Heimweg beim Kiosk vorbeigegangen und habe die neue People’s Friend mitgebracht.«
Millys Feuer war wirklich sehr bescheiden, aber es erwärmte das Wohnzimmer um ein oder zwei Grad. Es war eine angenehme Art, die Woche zu beenden: mit geschlossenen Augen in dem bequemen Sessel, die Füße endlich warm und einer der romantischen Kurzgeschichten lauschend, die ihre Schwägerin so liebte.
Milly war zu jung für ein solches Leben. Sie und Frank waren nur ein paar Monate verheiratet gewesen, als er gestorben war, einen dieser schrecklichen, sinnlosen Tode bei einem Luftangriff. Ann war immer noch erschüttert, wenn sie sich erlaubte, darüber nachzudenken. Ihr Bruder war Brandwächter gewesen, kein Feuerwehrmann, aber als die Fabrik am anderen Ende der Straße getroffen wurde, hatte er nicht gezögert. Er war hingegangen, um nach Überlebenden zu suchen, und nicht zurückgekehrt.
Milly war erst sechsundzwanzig und damit nur ein Jahr älter als Ann. Bevor sie und Frank geheiratet hatten, war sie freitagabends gern ins Kino oder zum Tanzen gegangen. Über einen Vorleseabend am Kamin hätte sie nur die Nase gerümpft.
Wie lange war es eigentlich her, dass Ann selbst ausgegangen war? An Gelegenheiten mangelte es nicht, denn beinahe jeden Freitag verabredete sich eine Gruppe von Mädchen von Hartnell zu einer der Tanzveranstaltungen im West End. Immer luden sie Ann ein mitzukommen, und stets antwortete sie: »Nein danke, vielleicht ein andermal.« Die Gewohnheit stammte noch aus der Zeit, als ihre Mutter lebte, denn die hatte auf ihre seltenen Bitten um einen Ausgehabend immer mit dem gleichen vorwurfsvollen Vortrag reagiert.
»Da kannst du das Geld genauso gut gleich zum Fenster rauswerfen. Kleider, Schuhe, Schminke, Essen und Getränke, die dir zu Kopf steigen oder auf den Magen schlagen«, pflegte sie an ihren schwieligen Fingern abzuzählen. »Und ohne dass irgendetwas dabei herauskommt. Wozu? Nur um mit anderen gewöhnlichen Mädchen Zeit zu verplempern?«
Ihre Mum hatte solche Sachen natürlich nicht gesagt, um sie zu kränken. Sie hatte nur gewollt, dass Ann härter wurde. Dass ihr bewusst wurde, wie erbarmungslos das Leben sein konnte, besonders für »gewöhnliche« Mädchen. Und sie hatte recht gehabt, natürlich. Die Chance, dass irgendjemand sich ernsthaft für Ann interessierte, war gering, und es wäre dumm und egoistisch gewesen, sich ihrer Mutter zu widersetzen.
Aber für Milly galten andere Regeln, denn sie war hübsch und noch nie in ihrem Leben als »gewöhnlich« bezeichnet worden. Nichts sprach dagegen, dass sie ausging und Spaß hatte. Alles, was sie brauchte, war etwas zum Anziehen und eine kleine Ermunterung von Ann.
Die Frauen, die bei Hartnell arbeiteten, durften zum eigenen Gebrauch Schnittmuster ausleihen und sogar Reste von Stoffen und Bordüren verwenden, die die Leiterinnen der Werkstätten ihnen überließen. So hatte Ann von Zeit zu Zeit genügend Material zusammen, um den Kragen einer Bluse zu erneuern oder ein paar Knöpfe neu zu beziehen.
Das würde sie tun. Bei der nächsten Tauschbörse würde sie nach einem Kleid für Milly suchen, das sie mithilfe des ergatterten Materials aufpeppen könnte, und dann würde sie ihr gut zureden, mit ein paar Freundinnen tanzen zu gehen. Vielleicht fand Milly ja dann einen neuen Liebsten. Vielleicht stand ihr eine Zukunft bevor, die ein paar Grad wärmer war als dieses schwach flackernde Feuer und mehr bereithielt als die People’s Friend.
Die Kaminuhr schlug. Es war neun Uhr, vom Feuer waren nur noch ein paar glühende Krümel übrig, und plötzlich fühlte Ann sich so müde, dass sie kaum wusste, wie sie die Treppe zu ihrem Schlafzimmer hinaufkommen sollte. Wenigstens müsste sie am nächsten Morgen nicht bei Tagesanbruch aufstehen.
»Geh nur in dein Zimmer«, sagte sie zu Milly. »Ich bringe dir noch eine Wärmflasche hoch, damit die Laken nicht so klamm sind.«
Allein in der Küche, während sie auf das Pfeifen des Wasserkessels wartete, bewunderte Ann das Heidekraut, das sie mitgebracht hatte. Im Frühling würde sie es draußen einpflanzen, denn ihr Haus hatte einen winzigen Garten, der zwischen Schuppen und Kohlenlager gerade genug Platz für ein Blumenbeet bot. Während des Krieges war er die meiste Zeit für praktischere Zwecke genutzt worden: um Bohnen, Karotten und Kartoffeln anzupflanzen. Aber im Juni nach der Befreiung hatte sie eine Handvoll Samen ausgesät, die ihr ein Nachbar, Mr Tilley, geschenkt hatte, und im folgenden Frühjahr hatten die Ringelblumen geblüht. Nach und nach hatte sie immer mehr Blumen in das kleine Beet gesetzt, bis auch der letzte Flecken Erde mit Pflanzen bedeckt war, die keine andere Daseinsberechtigung hatten, als sie zu erfreuen.
Milly mochte darüber spotten, aber das Heidekraut war eine Kostbarkeit. Ein Geschenk von der Queen persönlich, als Anerkennung für die Arbeit, die Ann geleistet hatte. Sie würde es den ganzen restlichen Winter über hegen und pflegen. Und wenn dann endlich der Frühling käme, würde sie in ihrem Garten ein Plätzchen dafür finden. Von Balmoral nach Barking war es eine weite Reise gewesen, aber ihr Garten war ein angemessener Zielort.
»Dort wird es dir gefallen«, sagte sie zu der Pflanze, während sie mit den Fingerspitzen über deren zarten Stängel strich. Dann schämte sie sich ein wenig für ihre Träumerei und füllte schnell die Wärmflaschen, bevor sie das Licht in der Küche ausschaltete und nach oben ins Bett ging.
Zweites Kapitel
Miriam
LondonEngland3. März 1947
Ihr erster Eindruck, an den sie sich immer erinnern würde, war das Grau überall. Es war schon spät, und die Sonne stand tief, halb von Wolken verdeckt. Schneeregen peitschte gegen die Zugfenster. Draußen konnte sie eine öde, bleifarbene Landschaft erkennen, deren brachliegende Felder und einsame Cottages langsam, beinahe widerwillig, den zusammengedrängten Häusern und verzweigten Straßen einer Stadt wichen. Der Stadt. London selbst.
Der Zug wechselte das Gleis, dann noch einmal, während er langsamer wurde und sein Rattern immer tiefer und düsterer klang. Rußgeschwärzte Backsteinwände rückten nun in ihren Blick, nur kurz abgelöst von fließendem Wasser, als sie einen Fluss überquerten. Die Themse, vermutete sie. Der Zug wurde noch langsamer, rumpelte schwerfällig vorwärts, bis er mit einem letzten, zitternden Ruck das Ende des Bahnsteigs erreichte, mit einem wütenden Schnauben Rauch und Dampf ausstieß und stehen blieb.
Die Leute um sie herum griffen sich Gepäckstücke, zogen Handschuhe an und wickelten sich ihre Schals eng um den Hals. Sie folgte ihnen, als sie den Bahnsteig entlangeilten, versuchte, mit ihnen Schritt zu halten. Es fiel ihr nicht schwer, denn ihr Gepäck war leicht.
Sie erreichte die Absperrung und sah, dass die Reisenden vor ihr ihre Fahrkarten dem Kontrolleur oder dem Wachmann zeigten, wie auch immer die richtige Bezeichnung in England für ihn war. Sie beobachtete ihn, während er die Tickets lochte, und spürte Erleichterung, als er den Fahrgästen zulächelte, die unsicher oder ängstlich wirkten.
Sie hielt ihren Fahrschein schon in der Hand, hatte damit gerechnet, dass sie ihn noch einmal brauchen würde, wartete aber, bis alle anderen sie passiert hatten. Sie wollte nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem sie die Warteschlange aufhielt. Über die Engländer und ihre Warteschlangen hatte sie schon einiges gehört.
»Guten Abend«, sagte sie zu dem Mann.
»Guten Abend, Miss.« Er nahm ihr Ticket, stanzte ein kleines Loch in eine Ecke und gab es ihr zurück. Als wäre es ein Andenken, das sie aufbewahren wollte. An die Reise, die sie aus Frankreich – fort von allem, was ihr vertraut war – an diesen fremden, kalten und so hoffnungslos heruntergekommenen Ort geführt hatte.
»Bitte entschuldigen Sie, aber könnten Sie mir sagen, wie ich zum Hotel Wilton komme? Es sollte nicht weit vom Bahnhof entfernt sein.« Vor ein paar Wochen hatte sie so lange in den Auslagen der bouquinistes entlang der Seine gestöbert, bis sie einen Stadtführer von London gefunden hatte. Der darin enthaltenen Beschreibung nach war ihr das Wilton als eine gute und preiswerte Unterkunft erschienen.
»Es ist überhaupt nicht weit, Miss. Gehen Sie einfach hier durch die Türen und nach rechts. Dann kommen Sie direkt zur Wilton Road. Das Hotel ist gleich hinter dem Victoria Theatre auf der anderen Straßenseite. Wenn Sie die Gillingham Street überqueren, sind Sie schon zu weit gelaufen. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck? Ich könnte einer Träger suchen, der …«
»Ich komme schon zurecht. Aber vielen Dank für Ihr Angebot.«
Es war genau so, wie er es beschrieben hatte, und schon ein paar Minuten später stand sie vor dem Eingang des Hotels. Die schäbige Fassade, beleuchtet von einer einzigen schwachen Glühbirne über der Tür, hatte sicher schon bessere Tage gesehen, und drinnen roch es nach Moder, Kohl und Zigarettenrauch.
Ein Mann saß hinter dem Empfangstresen, das Kinn in die Hand gestützt, die Augen geschlossen. Sein Jackenkragen war ausgefranst, seine Schultern von feinen weißen Schuppen übersät. Als sie ihn ansah, zuckte sein Mundwinkel kurz, als würde ihn etwas amüsieren. Vielleicht träumte er von glücklicheren Zeiten.
»Ähem«, machte sie und wartete darauf, dass er sich rührte. Nichts. »Entschuldigen Sie«, sagte sie mit etwas mehr Nachdruck.
Er fuhr hoch. »Tut mir leid. Ich habe, äh, meinen Augen eine kleine Pause gegönnt.«
»Das ist überhaupt kein Problem. Haben Sie noch ein Zimmer frei?«
Stirnrunzelnd beugte er sich über das Buch mit den Reservierungen. »Für wie viele Nächte, Miss?«
»Das weiß ich noch nicht genau. Erst einmal für zwei oder drei. Darf ich fragen, wie hoch der Zimmerpreis ist?«
»Zehn Shilling, sechs Pence mit Frühstück oder fünfzehn Bob mit Vollpension. Bad und Toilette sind auf dem Gang, das Zimmer wird einmal täglich sauber gemacht, die Bettwäsche wechseln wir wegen der Kohleknappheit nur wöchentlich.«
Ihr London-Reiseführer hatte einen kurzen Artikel über die merkwürdige englische Währung enthalten, dennoch fiel es ihr schwer, sie zu verstehen. Ein Bob war vermutlich ein Shilling? Ein Pfund hatte zwanzig Shilling, was bedeutete, dass eine Nacht in diesem erstaunlich teuren Hotel sie an die zweihundertfünfzig Francs kosten würde. Zu viel auf die Dauer, aber im Moment graute ihr bei der Vorstellung, noch weiterzusuchen, um etwas Billigeres zu finden.
»In Ordnung. Ich nehme ein Zimmer mit Frühstück, zunächst einmal für drei Nächte.«
»Gute Entscheidung. Dann brauche ich jetzt Ihren Ausweis.«
Sie reichte ihn dem Mann und unterdrückte einen Anflug von Panik, als er ihn hochhielt und ihr Gesicht mit dem auf dem Foto verglich. Er war nicht von der Polizei und auch nicht vom Militär oder von der Gestapo. Er würde ihre Passnummer aufschreiben und mehr nicht.
»Sind Sie im Urlaub, Miss … Dassin?«
»Nein. Ich ziehe hierher. Aus Frankreich.«
»Ich sage es ungern, aber Sie hätten sich keine schlechtere Zeit aussuchen können. Es war der seit Menschengedenken kälteste Winter, es gibt nicht genügend Kohle zum Heizen, und die Rationierungen sind schlimmer denn je. Jetzt werden schon Kartoffeln rationiert, können Sie sich das vorstellen? Kartoffeln!«
Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Wir haben beide den Krieg überlebt, nicht wahr? Und bald kommt der Frühling.«
»Ich hoffe, Sie haben recht«, sagte er, und dieser Gedanke, oder die Erinnerung an vergangene Frühlinge, brachte auch ihn zum Lächeln. »Wir können alle ein wenig Sonnenschein gebrauchen.«
Schließlich kritzelte er etwas in ein anderes Buch und gab ihr den Pass zurück. »Wenn Sie länger als ein oder zwei Wochen hierbleiben – in England, meine ich, nicht unbedingt im Hotel – , dann brauchen Sie ein Bezugsscheinheft. Aber in Restaurants können Sie problemlos auch ohne Marken essen. Frühstück gibt es von halb acht bis halb neun, nur damit Sie Bescheid wissen. Oh, und hier ist Ihr Schlüssel«, fügte er hinzu. »Dritter Stock, ganz hinten. Wir haben einen Aufzug, aber der ist außer Betrieb, Sie müssen also die Treppe nehmen. Warmwasser ist bis morgen früh abgestellt. Und damit auch die Zentralheizung. Tut mir leid.«
»Das macht nichts. Ich bin Kälte gewohnt. Darf ich fragen … Wäre es möglich, in Ihrer Wäscherei Bügeleisen und Bügelbrett auszuleihen?«
Die einfache Frage schien ihn zu verwirren. »Ich weiß nicht. Ich … Nun, ich glaube schon. Normalerweise schicken die Gäste alles, was gebügelt werden muss, nach unten.«
»Natürlich, nur liegt mir dieses eine Kleidungsstück besonders am Herzen. Es wäre mir … unangenehm, es jemand anderem anzuvertrauen. Ich hoffe, Sie verstehen das.« Bei diesen Worten senkte sie die Stimme, sodass sie kaum mehr war als ein Flüstern, und bedachte ihn mit ihrem gewinnendsten Lächeln, zurückhaltend und ein wenig schüchtern. Es hatte ihr während der letzten sieben Jahre gute Dienste erwiesen.
»Ich bin sicher, dass ich das für Sie arrangieren kann, Miss Dassin.« Da er die Hälfte ihres Namens verschluckte, klang es wie »Dass’n«.
Sie unterdrückte einen instinktiven Schauder und lächelte erneut. »Kann ich die Sachen heute Abend benutzen? Ich habe morgen einen wichtigen Termin und werde nicht schlafen können, wenn ich nicht vorher mit allem fertig bin.«
»Selbstverständlich«, sagte er und errötete ein wenig. »Ich werde beides auf Ihr Zimmer bringen. Brauchen Sie mich, um Ihnen das Gepäck hochzutragen?«
»O nein – es ist überhaupt nicht schwer. Nur das Bügeleisen mit dem Brett. Vielen Dank. Sie sind sehr freundlich.«
Sie hätte viel für einen funktionierenden Aufzug gegeben, denn ihre Koffer, so leicht sie auch waren, fühlten sich doch schwer an, als sie das oberste Stockwerk des Hotels erreichte. Ihr Zimmer befand sich am Ende des Ganges, wie der Mann gesagt hatte, und sie hoffte, dass es ruhig sein würde. Wäre es still genug, könnte sie vielleicht schlafen.
Sie schloss die Tür auf, knipste das Licht an und stellte ihr Gepäck ab. Dann stand sie mit geschlossenen Augen reglos da. Atmete tief durch und wartete, bis der Schmerz in ihren Armen nachließ. Was hatte der amerikanische Arzt gesagt? Gutes Essen, Ruhe, maßvolle Bewegung und vor allem viel Geduld, dann würde sie eines Tages wieder wie früher sein.
Der Arzt war ein freundlicher Mann gewesen, zutiefst erschüttert über das Leid, das er gesehen hatte. Er hatte sein Bestes getan, um zu helfen, aber er hatte sich getäuscht. Denn weder frische Luft noch nahrhaftes Essen oder schöne Spaziergänge bei Sonnenschein würden ihr jemals zurückbringen können, was sie verloren hatte.
Nachdem sie ihre Entscheidung getroffen hatte, hatte sie an ihre einzige Freundin geschrieben, die sie gut genug kannte, um sie zu verstehen. Am folgenden Tag hatte Catherine geantwortet.
20. Februar 1947
Meine liebe Miriam,
findest du noch Zeit, um mich zu besuchen, bevor du abreist? Nicht weil ich dich umstimmen möchte – ich versichere dir, dass ich deine Gründe nachvollziehen kann. Nur damit wir uns richtig Lebewohl sagen können. Donnerstagabend um sechs Uhr? Dann bin ich bei Tian in seinen neuen Geschäftsräumen. Ich werde dem Personal sagen, dass du erwartet wirst. Wenn dir diese Zeit nicht passt, lass es mich wissen.
Mit herzlichen Grüßen
Catherine
Tian war niemand anders als Christian Dior, der Christian Dior, dessen erste Kollektion die Welt vor wenigen Wochen in Aufruhr versetzt hatte. Sie hatte ein paar von diesen Kleidern bestickt, denn Maison Rébé war Monsieur Diors bevorzugtes atelier de broderie, aber den Designer nie getroffen. Und niemals hätte sie ihre Freundschaft mit Catherine benutzt, um ein solches Treffen zu provozieren.
Es fühlte sich sehr merkwürdig an, die Räumlichkeiten von Dior durch den Haupteingang zu betreten, als wäre sie eine feine Dame, die herkam, um ein Kleid anzuprobieren. Aber Catherine hätte es erfahren, wenn sie versucht hätte, sich durch den Personaleingang hineinzuschleichen. Miriam wurde in einen exquisit ausgestatteten Raum geführt und überaus zuvorkommend behandelt. Man bot ihr jede erdenkliche Erfrischung an, und erst nachdem sie versichert hatte, nichts zu wollen, ließ man sie allein. Nur für einen kurzen Moment, bevor die Tür aufging und Catherine hereinstürmte.
»Meine liebe Miriam – es ist eine solche Freude, dich wiederzusehen. Komm und setz dich zu mir. Möchtest du etwas trinken? Kaffee? Tee?«
»Nein danke, Mademoiselle Dior«, sagte Miriam, plötzlich eingeschüchtert. Ob Freundin oder nicht, Catherine war die Schwester eines der größten Modeschöpfer der Welt.
Aber ihre Freundin schüttelte den Kopf und nahm Miriams Hände. »Für dich bin ich Catherine. Ich bestehe darauf. Und jetzt sag: Was ist passiert?«
»Der Prozess hat letzte Woche begonnen. Ich habe dir doch davon erzählt.«
»Vom Nachbarn deiner Eltern? Dem Polizisten?«
Miriam nickte. Am ersten Tag der Verhandlung war sie zum Gericht gegangen. Sie dachte, es sei wichtig, dabei zu sein und sich anzusehen, wie Recht gesprochen wurde. Adolphe Leblanc hatte in der Straße ihrer Eltern gewohnt, solange sie denken konnte, der Ortspolizist mit seiner großen, weit verzweigten und erzkatholischen Familie. In all den Jahren hatte er sie kein einziges Mal gegrüßt, sich kein einziges Mal nach ihrem Befinden erkundigt, ihr kein einziges Mal erlaubt, mit seinen Kindern zu spielen. »Dreckige Jüdin«, hatten die sie genannt, und sie hatte gelernt, sich vor ihnen und ihrem rotgesichtigen, lauten Vater in Acht zu nehmen.
Er hatte dazu beigetragen, dass ihre Familie festgenommen wurde, ein eifriges Rädchen im Getriebe der menschlichen Todesmaschinerie, die sich beinahe über ganz Europa ausgebreitet hatte. Trotzdem war er noch vor dem eigentlichen Prozessbeginn freigesprochen worden.
»Sie haben ihn freigelassen, zusammen mit der Hälfte all der Männer und Frauen, die vor Gericht standen«, erzählte sie Catherine. »Die Richter sagten, sie hätten ihre Verbrechen wiedergutgemacht, indem sie die Résistance unterstützt haben.«
»Dieser Dreckskerl. Wahrscheinlich hat er keinen Finger gerührt, bis klar war, wie alles ausgehen würde«, schnaubte Catherine.
»Er ist an mir vorbeigelaufen, als er hinausging. So nah, dass unsere Ärmel einander berührt haben. Ich weiß, dass er mich erkannt hat.«
»Er war nicht so verrückt, dich anzusprechen, oder?«
»Nein.«
Sie hatte gehofft, ein Anzeichen von Scham oder Schuldgefühl in seinem Blick zu erkennen. Aber alles, was sie darin gesehen hatte, war Hass gewesen. Glühender, lodernder Hass, und sie hatte sich im Gerichtssaal umgeblickt und in den Augen der anderen das Gleiche erkannt.
»Aber er hat etwas getan, das dich durcheinandergebracht hat. Das merke ich doch.«
Miriam schloss die Augen und versuchte, die Bilder aus ihrem Gedächtnis zu vertreiben. »Er hat gelächelt. Gelächelt und genickt. Dabei ist mir klar geworden, dass er es wieder tun würde, wenn er könnte. Maman, Papa, Grand-père. Er würde sie ein zweites Mal in den Tod schicken, wenn es möglich wäre.«
»Nicht alle von uns sind so voller Hass«, flüsterte Catherine, ihre Stimme flehend.
»Ich weiß. Aber jetzt fürchte ich mich. Er hat mich an meine Angst erinnert.«
»Das verstehe ich. Wirklich.«
»Ich wollte dir Lebewohl sagen und dir für deine Hilfe danken. Ohne dich hätte ich nicht überlebt.«
»Und ich nicht ohne dich«, sagte ihre Freundin nur, und es genügte, dass sie beide davon wussten und sich daran erinnerten. »Kannst du einen Moment hier warten? Ich möchte dir jemanden vorstellen.«
Bevor sie antworten konnte, hatte Catherine schon den Raum verlassen. Ihre Freundin wollte ihr jemanden vorstellen? Aber doch sicher nicht …
Sie kam zurück, und bei ihr war ein großer Mann mit schütterem Haar, den Miriam sofort erkannte. »Monsieur Dior«, sagte sie und sprang auf.
Er schüttelte ihr die Hand, als wäre sie ihm gesellschaftlich ebenbürtig, und ein zurückhaltendes, warmes Lächeln erhellte seine ernsten Züge. »Mademoiselle Dassin. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Meine liebe Schwester hat mir erzählt, wie freundlich Sie während Ihrer gemeinsamen Gefangenschaft zu ihr waren, und auch zu vielen anderen. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine Dankbarkeit auszusprechen.«
»Sie war, äh … auch sehr freundlich zu mir«, stammelte Miriam. »Wir haben einander geholfen zu überleben.«
Es stimmte, dass Miriam Catherine geholfen hatte, aber nur so, wie Gefangene oft einander halfen. Sie hatte ein paar seltene Brocken Brot für sie ergattert, als die Freundin nicht in der Lage gewesen war, die verdorbene Suppe, die ihre Mahlzeit sein sollte, bei sich zu behalten. Sie hatte einer anderen Gefangenen ein paar Stofffetzen abgebettelt, um Catherines Füße zu verbinden, als sie entzündet waren. Nachts, wenn ihre Freundin der Verzweiflung nahe gewesen war, hatte Miriam sie an schöne Dinge erinnert. Seidenkleider, blühende Blumen, Momente des Trosts und der Liebe.
Nach ihrer Befreiung waren sie im selben Flüchtlingszug nach Hause, nach Frankreich, gefahren, und Catherine hatte Miriam den Aufenthalt in einer Klinik bezahlt, damit sie wieder zu Kräften kam. Sie hatte gewusst, dass Miriam keine Familie mehr hatte, die sich um sie kümmern konnte.
»Catherine hat mir gestern erzählt, dass Sie nach England auswandern, und mich gefragt, ob ich Ihnen einen Empfehlungsbrief schreibe. Das habe ich natürlich mit Freuden getan, da ich glaube, dass Ihre Arbeit einige meiner neuesten Kreationen schmückt. Jedenfalls sagt das Monsieur Rébé.«
»Das stimmt, Monsieur Dior, aber ich würde niemals erwarten, dass …«
»Ich habe auch eine Liste mit Personen für Sie zusammengestellt, bei denen Sie sich um eine Stelle bewerben können. Es gibt in London einige Modeateliers, deshalb schlage ich vor, dass Sie die Designer selbst aufsuchen. Unter ihnen empfehle ich besonders Monsieur Norman Hartnell. Wenn ich mich recht erinnere, leisten seine Stickerinnen hervorragende Arbeit. Bitte nehmen Sie das, zusammen mit meinen besten Wünschen.« Mit diesen Worten reichte er ihr einen Umschlag, schüttelte ihr noch einmal die Hand und verließ das Zimmer durch die immer noch offen stehende Tür.
Sobald er fort war, wandte Miriam sich an ihre Freundin. »Das hättest du nicht für mich tun müssen. Ich hätte es niemals von dir verlangt.«
»Das weiß ich. Aber ich will dir helfen, und wir wissen beide, dass Tians Name eine Menge Türen öffnen kann. Versprich mir, dass du es mich wissen lässt, wenn du in irgendwelche Schwierigkeiten gerätst.«
»Ich verspreche es.«
Zu dem Zeitpunkt hatte Miriam noch nicht bemerkt, dass der Umschlag schwerer war als zwei Blatt Papier. Erst später, nachdem sie sich umarmt und voneinander verabschiedet hatten und sie in ihre Wohnung zurückgekehrt war, um ihre letzten Dinge einzupacken, hatte sie die englischen Geldscheine gefunden. Fünf Zwanzig-Pfund-Noten hatte Monsieur Dior in das Kuvert gesteckt. Die hatte sie jetzt dabei, eingenäht in das Futter ihres Mantels, eine Rücklage für schwere Zeiten.
Sie öffnete die Augen und sah sich in ihrem Hotelzimmer um. Noch immer bewegte sie sich nicht von der Stelle. Es war sauberer, als sie erwartet hatte, aber in dem schummrigen Licht der einzelnen Glühbirne, die von der Decke herabhing, konnte man auch wenig erkennen. Es gab ein Fenster, eher klein und mit Blick auf die Feuerleiter des Nachbarhauses. Ein schmales Bett war rechts an die Wand gerückt, sein Überwurf war an einigen Stellen geflickt, das Kopfkissen abgewetzt. Neben dem Bett stand ein Schrank mit einem Spiegel an der Tür. In der hinteren Ecke befand sich ein Waschbecken mit einem zusammengefalteten Handtuch über dem Rand. Zu ihrer Linken ein kleiner Schreibtisch und ein Stuhl. Eine Lampe stand darauf, und sie ging hin und schaltete sie ein. Nichts. Die Glühbirne war durchgebrannt.
Hinter ihr klopfte es an der Tür. »Hallo? Miss Dass’n?«
»Ja. Bitte kommen Sie rein.«
Nachdem der Hotelangestellte das Bügeleisen auf dem Schreibtisch abgestellt hatte, versuchte er, das Bügelbrett aufzuklappen, durchschaute aber anscheinend den Mechanismus nicht.
»Bitte machen Sie sich keine Umstände«, sagte sie. »Ich werde schon damit zurechtkommen.«
»Tut mir leid. Es gibt nur diese eine Steckdose im Zimmer, hier beim Schreibtisch. Sie müssen zuerst den Lampenstecker rausziehen.«
Sie nickte. Nach einem Ersatz für die defekte Glühbirne würde sie ihn erst morgen fragen. Es wäre unklug, an diesem ersten Abend noch mehr von ihm zu verlangen. »Vielen Dank. Soll ich Ihnen das Brett und das Bügeleisen zurückbringen, wenn ich fertig bin?«
»Nicht nötig. Ich werde das Zimmermädchen darum bitten, wenn es sich morgen oder übermorgen um Ihr Zimmer kümmert. Falls die Wäscherei die Sachen vorher braucht, schicken sie schon jemanden vorbei.«
»Sie sind sehr freundlich.« Sie wünschte, sie könnte sich ein kleines Trinkgeld für ihn leisten. Stattdessen schüttelte sie ihm die Hand und sah ihm lächelnd und in der Hoffnung in die Augen, dass er verstand.
»Nicht der Rede wert«, sagte er in herzlichem Ton, also vermutete sie, dass er wirklich begriffen hatte. Oder in England wurde Trinkgeld nicht unbedingt erwartet. Das musste sie in ihrem Reiseführer nachlesen. »Also, gute Nacht.«
Die Tür fiel mit einem leisen Klicken hinter ihm zu. Sie schloss ab, wartete, bis seine Schritte verklungen waren, und konnte dann zum ersten Mal an diesem Tag befreit atmen. Allein. Ohne Fremde um sie herum und ohne sich das Hirn nach halb vergessenen Wörtern oder Sätzen zermartern zu müssen. Befreit von dem inneren Bedürfnis, immer eine möglichst unbewegte Miene aufzusetzen.
Das Wichtigste zuerst. Sie klappte das Bügelbrett auf, rückte es nah an den Schreibtisch und steckte das Bügeleisen ein. Während sie darauf wartete, dass es heiß wurde, legte sie den größeren ihrer beiden Koffer auf das Bett und holte ihr bestes Kostüm und eine Bluse hervor. Obwohl sie die Kleider sorgfältig eingepackt hatte, waren sie zerdrückt. Das Bügeleisen sah altmodisch und nicht sehr vertrauenerweckend aus, aber nachdem sie es vorsichtig an der Innenseite ihres Rocks ausprobiert hatte, zeigten sich keine Brandspuren, also machte sie sich daran, die schlimmsten Falten aus den Kleidungsstücken zu entfernen.
Sie war zu müde, und ihr war zu kalt, um sich mit irgendeiner Art von Abendtoilette aufzuhalten. Nachdem sie ihre Kleider ausgezogen und aufgehängt hatte und in ihr Nachthemd geschlüpft war, schaltete sie das Licht aus und ging ins Bett. Obwohl sich die Laken leicht feucht anfühlten, dauerte es nicht lange, bis sie aufhörte zu zittern und sich in dem weichen, sicheren Bett entspannte.
Sobald sie die Augen geschlossen hatte, tauchte das Bild auf: elfenbeinfarbene Seide, in der Nachmittagssonne glänzend, fest über einen Rahmen gespannt. Ihr Stickrahmen, direkt neben dem Fenster in der Stickerei von Maison Rébé, genau da, wo sie ihn zurückgelassen hatte.
Sie dachte an die einzelnen Arbeitsschritte: Der Entwurf, ein Blumenkranz, war beinahe fertig; er hatte ihr inneres Auge schon viele Nächte beschäftigt. Die Bourbon-Rosen waren bereits gestickt, mit blassen und zarten Blüten, dazu Geißblatt, das sich zwischen ihren Stängeln wand. Heute Nacht würde sie mit der ersten Pfingstrose beginnen.
Im Garten ihrer Eltern hatte ein alter Pfingstrosenstrauch gestanden – schon lange bevor sie in das Haus gezogen waren, hatte ihn jemand gepflanzt – , der jedes Jahr im Mai unzählige Blüten trieb, manche so groß wie Kuchenteller, von Zartrosa bis Kirschrot. Er war Mamans Lieblingsstrauch gewesen, und ihrer auch.
Letztes Jahr hatte sie sich ein Herz gefasst und war hingegangen. Um zu sehen, ob ihre Familie Spuren hinterlassen hatte, ob es etwas gab, das von ihrem Leben geblieben war. Die Leute, die jetzt in ihrem Elternhaus wohnten, sagten, dass sie nichts wüssten. Sie wollten sie nicht hineinlassen, deshalb bat sie darum, den Garten anschauen zu dürfen. Fünf Minuten im Garten, dann würde sie wieder gehen.
Sie hatten die Pfingstrose zerstört. Die Blumen ihrer Mutter ausgegraben und einen Gemüsegarten angelegt. Alles Schöne und Lebendige, das ihre Mutter gepflanzt hatte, hatten sie vernichtet. Sie hatten …
Die Pfingstrose lebte in ihrer Erinnerung weiter. Sie konnte sie deutlich vor sich sehen, ihre Blütenblätter, schimmernd und perfekt. Unverändert. Vollständig und lebendig.
Sie blinzelte die Tränen zurück. Sie fädelte den Faden in ihre Nadel ein. Sie berührte mit den Fingerspitzen den geisterhaften Stoff. Und dann begann sie von Neuem.
Drittes Kapitel
Heather
Toronto, OntarioKanada5. März 2016
Heather? Ich bin’s, deine Mutter. Ich habe schon mehrmals angerufen.«
»Tut mir leid. Ich habe das Klingeln nicht gehört. Was ist los?«
»Wo bist du?«
»Im Supermarkt an der Kasse. Bin gleich mit dem Einkaufen fertig. Hier ist die Hölle los. Ein typischer Samstagmorgen. Warum?«
»Es geht um Nan.«
Die Geräusche um sie herum – Menschen redeten und schimpften, Einkaufswägen wurden mit lautem Scheppern geschoben, aus den knisternden Lautsprechern schallten Oldies – verstummten plötzlich. Stattdessen dröhnten in ihren Ohren Trommelschläge, dumpf und beharrlich, immer lauter – ihr eigener Herzschlag.
»Heather?«
»Was ist mit Nan?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort schon kannte.
»Ach, Schatz. Es tut mir so leid, dir das sagen zu müssen. Sie ist heute Morgen gestorben.«
Die Warteschlange bewegte sich, und Heather schob automatisch ihren Einkaufswagen vorwärts. Es war schwierig, ihn mit nur einer Hand zu steuern. Sie umklammerte den Griff so fest, dass ihr die Finger wehtaten.
»Aber …«, begann sie. Ihr Mund war trocken. Sie schluckte, leckte sich über die Lippen, versuchte es noch einmal. »Aber Nan ging es doch gut, als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe.«
Wie lange war das her? Normalerweise rief sie Nan jeden Sonntag an, aber in letzter Zeit war sie so mit der Arbeit beschäftigt gewesen. Nicht im positiven Sinne, sondern nur mit hirnlosem Kleinkram, und am Wochenende war sie dann immer so müde gewesen und …
»Heather? Bist du noch dran?«
Sie schob den Einkaufswagen noch ein Stück weiter. »Ich verstehe das nicht. Du hast mir nicht erzählt, dass sie krank war.«
»Ich habe sie am Mittwoch gesehen, und da schien es ihr ganz gut zu gehen. Aber du weißt ja, wie ungern sie es zugegeben hat, wenn sie nicht ganz auf der Höhe war.«
»Stimmt«, flüsterte Heather.
Etwas kitzelte an ihrer Wange. Sie fuhr sich über das Gesicht, und ihre Finger wurden feucht von den stillen, heimlichen Tränen. Sie wischte sie mit dem Ärmel ihres Wollmantels weg. Dieser dumme Mantel, der nicht einmal Taschen hatte. Vielleicht war in ihrer Handtasche noch ein Taschentuch.
»Was ist passiert?«
»Als sie nicht zum Abendessen kam, hat eine ihrer Freundinnen aus dem Heim nach ihr gesehen. Sie war in ihrem Sessel eingeschlafen – in dem, der in ihrem Zimmer am Fenster steht – , und ihre Freundin hatte Mühe, sie aufzuwecken. Also haben sie den Notruf gewählt und dann uns angerufen. Der Arzt sagte, es sei eine Lungenentzündung. Von der Art, die als harmlose Erkältung anfängt und dann schlimmer wird. In ihrem Alter, weißt du, da kann man nicht viel machen. Wir hatten zuvor schon einige Male mit ihr darüber gesprochen und wussten, dass sie das nicht gewollt hätte. Viel Wirbel, meine ich. Deshalb sind Dad und ich bei ihr geblieben, bis …«
Die ganze letzte Nacht hatte Nan im Sterben gelegen, und sie hatte es nicht einmal gewusst. »Warum habt ihr mich nicht angerufen?«
»Heather. Schatz. Du weißt, sie hätte nicht gewollt, dass du sie so siehst. Sie hat geschlafen, als wir ankamen, deshalb …«
Ein Schluchzen stieg aus Heathers Kehle auf, es war peinlich laut. Die Kunden in ihrer Nähe schauten einen Augenblick alarmiert zu ihr herüber, wandten sich dann aber wieder geflissentlich ab oder beugten sich über ihre Mobiltelefone. Sahen sie aus Rücksicht oder aus Gleichgültigkeit weg?
Noch ein Schluchzen, noch lauter, als würde ein Damm brechen.
»Heather? Hör mir zu. Vergiss die Einkäufe. Ich möchte, dass du deinen Wagen jetzt zum Serviceschalter schiebst, oder wie das heißt, und den Leuten dort sagst, dass du nach Hause musst. Sag ihnen, es ist ein Notfall. Hörst du mich?«
»Ja, Mum. Ich höre.« Sie zog den Einkaufswagen zur Seite, vorsichtig, um nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Der Kundenservice war nicht weit weg.
»Kann Sunita oder Michelle nachher kommen und deine Einkäufe bezahlen und abholen?«
»Wahrscheinlich schon.«
»Gut. Dann sag demjenigen, der da am Schalter steht, dass deine Freundin wegen der Einkäufe noch mal vorbeikommt. Gib ihm oder ihr deinen Namen und deine Telefonnummer.«
Die Frau hinter dem Tresen war damit beschäftigt, Lotterielose in einen Aufsteller zu sortieren. Als sie aufblickte und Heathers tränenverschmiertes Gesicht sah, wurde ihr Lächeln verkrampft.
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich, äh …«
»Gib ihr das Telefon, Heather. Ich rede mit ihr.«
Die Frau nahm das Handy, und ihr fragendes Stirnrunzeln wich einem Ausdruck von Mitgefühl, während sie zuhörte.
»Hallo? Ja? Oje. Das tut mir leid. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Kein Problem. Okay. Nein, ich lege nicht auf.« Sie reichte das Handy zurück. »Alles klar. Ihre Mutter hat mir alles erklärt. Das mit Ihrer Großmutter tut mir leid.«
Heather versuchte ein Lächeln, merkte aber selbst, dass es nicht überzeugend war. »Danke. Eine Freundin kommt nachher vorbei.«
Sie wandte sich in Richtung Ausgang, das Handy immer noch am Ohr. Ein paar Augenblicke später war sie bei ihrem kleinen Auto. Dem Auto, das früher Nan gehört hatte.
Es war ein alter Nissan Kombi. Schon ihre Großmutter hatte ihn vor zehn Jahren gebraucht gekauft, er verfügte »über keinen Schnickschnack«, wie Nan immer gesagt hatte. Keine Klimaanlage, keine Musikanlage außer einem Radio, keine Servolenkung. Die Fenster musste man runterkurbeln. Aber es war Nans Auto, und deshalb würde sie es behalten, bis es auseinanderfiel.
Heather ließ sich auf den Fahrersitz sinken, schaltete das Handy laut, warf es auf das Armaturenbrett und legte den Kopf auf das Lenkrad.
»Bist du noch da?«
»Ja, Mum.«
»Bist du sicher, dass du jetzt fahren kannst? Du bist viel zu aufgewühlt.«
Tief einatmen. Und wieder aus. Sie würde noch einen Moment warten, vielleicht würden ihre Hände dann aufhören zu zittern und sie könnte wieder normal atmen, ohne dieses schreckliche Gefühl, als würde ihr jemand die Kehle zusammendrücken.
»Es geht gleich wieder«, sagte sie nach einer Weile. »Ich muss nur nach Hause.«
»Natürlich. Atme noch ein paarmal tief durch. Und lass das Fenster runter, damit frische Luft reinkommt. Kannst du gut sehen? Wisch die Tränen weg. Ich liebe dich, Süße.«
»Ich dich auch.«
»Rufst du mich an, wenn du zu Hause bist?«
»Versprochen.«
Es knisterte in der Leitung, dann war es still.
Noch einmal trocknete Heather sich die Tränen ab, dann ließ sie den Motor an und wendete den Wagen, um nach Hause zu fahren.
Nan war nicht mehr da.
Nan war tot.
Wie war das möglich?
Nan war Heather nie alt vorgekommen. Erst mit achtzig war sie in den Ruhestand gegangen. Sie hatte den kleinen Laden in der Lakeshore Avenue, den sie fünfzig Jahre zuvor eröffnet hatte, verkauft und dann, fünf Jahre später, auch ihren Bungalow. Sie war in eins dieser Apartmenthäuser für Senioren gezogen, das Elm Tree Manor, das einen medizinischen Bereitschaftsdienst anbot und einen Speisesaal für diejenigen Bewohner hatte, die nicht selbst kochen wollten. Außerdem wurden dort so viele Aktivitäten, Treffen und Ausflüge organisiert, dass Nan an den meisten Wochenenden mehr vorhatte als Heather.
Heather musste zugeben, dass Nan in letzter Zeit ein wenig kürzergetreten hatte. Sie hatte das Autofahren aufgegeben, ihre ehrenamtliche Arbeit reduziert und Erkältungen nicht mehr, so wie früher, nach ein oder zwei Tagen überwunden. Aber bis jetzt hatte sie sich immer wieder erholt. Immer.
Anhaltendes Hupen ließ sie hochschrecken. Die Ampel war auf Grün gesprungen, und sie hatte es nicht gemerkt. Entschuldigend hob sie die Hand in Richtung des Fahrers hinter ihr, den Blick starr auf die Straße vor sich gerichtet, in Erinnerungen an Nan versunken.
Sie bog links ab und parkte vor ihrem Haus, aber anstatt hineinzugehen, rührte sie sich nicht vom Fleck, die Hände am Steuer, und betrachtete die Gärten auf der anderen Straßenseite – der Sonnenseite, wo der Boden wärmer war und schon einige Blumen blühten. Schneeglöckchen und Krokusse und sogar ein paar frühe Narzissen. Sie war sich nicht sicher, ob der Anblick sie froh oder traurig stimmte.
Nan hatte sich auf den Frühling gefreut. Als Vorsitzende des Gartenkomitees von Elm Tree Manor war sie für die Topfpflanzen im Innenhof vor dem Speisesaal verantwortlich gewesen. Beim letzten Besuch hatte Nan ihr die einjährigen Pflanzen gezeigt, die sie aus Samen gezogen hatte. Ringelblumen, Steinkraut, Kosmeen und Petunien, alle in ordentlichen Reihen in sauber ausgespülten Joghurtbechern auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers.
Was würde jetzt mit Nans Pflanzen passieren? Sie musste unbedingt dafür sorgen, dass jemand sie goss.
Heather stellte den Motor ab, holte ein paarmal tief Luft und nahm dann den kurzen Weg zu ihrer Wohnung in Angriff. Sie schaffte es nur bis zu der Bank im Flur, dann gaben ihre Knie nach, und ihre Handtasche rutschte an ihrem Arm hinunter und landete auf dem Fliesenboden.
Der Flur war schmal und hatte zwei Türen: Die eine führte über eine Treppe zu ihrer kleinen Wohnung nach oben, die andere zu der im Erdgeschoss, in der Sunita und Michelle wohnten. Als ihre Freundinnen das Haus gekauft hatten, war es in zwei Wohneinheiten unterteilt worden. Eines Tages würden sie wahrscheinlich die obere Etage zurückhaben wollen, aber bis jetzt waren sie zufrieden damit, sie ihr für wenig Geld zu vermieten.
»Sunita?«, rief sie. »Michelle?«
»Suni ist nicht da«, tönte es ihr entgegen. »Du musst dich mit mir begnügen. Was ist los?«
»Ich habe einen Anruf von meiner Mutter bekommen, als ich beim Einkaufen war.«
»Und was machen deine Eltern diese Woche? Verreisen sie wieder?«
»Nein. Es ging um Nan. Sie hat wegen Nan angerufen.«
»Alles in Ordnung mit ihr? Ist sie wieder gestürzt?«
Noch ein tiefer Atemzug. Und noch einer. »Nein«, hörte Heather sich sagen. »Nein. Sie ist gestorben. Sie ist tot.«
Ein metallisches Scheppern ertönte, als wäre etwas ins Spülbecken gefallen, dann Schritte, die eilig näher kamen. Einen Augenblick später fand sie sich in einer warmen, nach Vanille duftenden Umarmung wieder. Natürlich. Es war Samstagvormittag, also war Michelle am Backen.
»Oh, Süße, nein. Was für eine schreckliche Nachricht! Komm mit in die Küche. Du brauchst eine Tasse Tee.«
»Du … klingst wie Nan«, war alles, was Heather sagen konnte, bevor sie wieder in Tränen ausbrach.
Sie blieb sitzen, während Michelle ihr den Mantel abnahm und ihr die Stiefel auszog, dann ließ sie sich von ihr in die Küche führen.
»Setz dich. Ich mache Tee. Willst du einen Muffin?«
»Nein danke. Ich glaube nicht, dass ich jetzt etwas essen kann.«
Sie legte den Kopf auf den Küchentisch, und die alte Resopalplatte fühlte sich wunderbar kühl an. »Wo ist Sunita?«, fragte sie, ohne hochzublicken.
»Im High Park joggen. Müsste jeden Moment zurückkommen.«
»Ich habe alle meine Einkäufe im Laden gelassen. Ich konnte nicht mehr klar denken, also hat meine Mutter mir gesagt, was ich tun soll. Ich habe Bescheid gegeben, ich würde jemanden schicken, der die Sachen holt.«
»Das mache ich schon. Oder Suni, wenn sie wieder da ist.«
Heather schloss die Augen und versuchte, an nichts zu denken. Der Kessel begann zu pfeifen, und Michelle machte sich an der Teekanne zu schaffen. Was Teekochen anging, war sie eigen.
»Hier, setz dich auf. Mit Zitrone und Honig. Genau so, wie Nan ihn immer für dich gemacht hat.«
Heather streckte ihren Rücken durch. Wärmte sich die Hände an der Keramiktasse. »Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht.«
»Hat deine Mutter erzählt, was passiert ist?«
»Nichts Dramatisches. Nur eine Erkältung, die sich verschlimmert hat. Ich weiß, sie war beinahe vierundneunzig, und Menschen leben nicht ewig. Aber sie kam mir immer so vor wie jemand, der ewig leben könnte.«
»Ich weiß, was du meinst. All die Menschen, die den Krieg überlebt haben. Man denkt, sie wären aus Stahl.«
Der Timer des Backofens piepte. Michelle stellte ihn aus, zog ein Blech mit Muffins heraus und legte sie auf ein Abkühlgitter. »Okay. Das waren die Letzten. Ich fahre jetzt zum Supermarkt. Warst du bei Loblaws in der Dundas Street?«
»Ja. Vielen Dank. Warte – willst du meine Kreditkarte?«
»Schon in Ordnung. Das können wir später regeln. Bleib einfach hier sitzen und trink deinen Tee. Und ich rufe von unterwegs gleich Suni an und sage es ihr. Dann musst du nicht alles noch mal erzählen.«
Die Eingangstür fiel hinter ihrer Freundin ins Schloss, und Heather war allein im Haus. Sie sollte nach oben in ihre Wohnung gehen, ihre Mutter anrufen und sich eine Weile hinlegen. Mit Seymour neben sich, um sich von ihm in den Schlaf schnurren zu lassen. Aber sie war unfähig, sich von dem harten Holzstuhl zu erheben und die Küche mit ihren Gerüchen nach Zitrone und Gewürzen zu verlassen.
Es war zwei Wochen her, dass sie Nan zuletzt gesehen hatte. Am letzten Wochenende hatte sie eigentlich zu ihr fahren wollen, aber dann hatte sie auch eine Erkältung bekommen und Nan nicht anstecken wollen. Außerdem war sie so müde gewesen, dass sie es den ganzen Sonntag kaum aus dem Bett geschafft hatte.
Bei ihrem letzten Besuch hatten sie Tee getrunken und Scones von der schottischen Bäckerei gegessen, die ihre Großmutter so liebte. Sie unterhielten sich über den neunzigsten Geburtstag der Queen und den Wirbel, den die Leute darum machten. Dann klingelte das Telefon, und Nans Freundin Margie erinnerte sie daran, dass der Tai-Chi-Kurs in zehn Minuten anfing.
»Es tut mir leid, meine Liebe«, sagte Nan. »Mir kommt es vor, als wärst du gerade erst gekommen.«
»Ich war eine Ewigkeit hier. Wir haben uns nur so gut unterhalten. Soll ich dich in ein paar Tagen anrufen?«
Sie umarmte ihre Großmutter, und obwohl Nan sonst ein zurückhaltender Mensch war, erwiderte sie wie immer ihre Umarmung. Heather ging den Flur entlang, und Nan wartete – ebenso wie immer – an der Tür, bis der Aufzug da war.
Sie war in den Lift gestiegen und hatte Nan noch eine Kusshand zugeworfen, und dann hatten sich die Türen geschlossen, und Heather hatte den restlichen Sonntag mit Erledigungen verbracht, an die sie sich jetzt nicht mehr erinnerte. Sie hatte sich von ihrer Nan verabschiedet, ohne es zu wissen. Es gab noch so viel, was sie ihr sagen musste. Und nun war es nicht mehr möglich.
Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass es ein endgültiger Abschied gewesen war.
Viertes Kapitel
Ann
10. März 1947
Ann war schon wach, als ihr Wecker um sechs Uhr läutete. Fast immer öffnete sie die Augen ein paar Sekunden vor dem Klingeln. Bevor sie es sich anders überlegen konnte, schlug sie den Berg von Decken zurück, setzte sich auf und schwang die Beine über die Bettkante. Dann erst stellte sie den Wecker aus.
Ihre Pantoffeln standen neben ihrem Bett auf dem Boden; normalerweise dachte sie daran, sie unter die Decke zu stecken, bevor sie einschlief. Obwohl sie Socken trug, schnappte sie nach Luft, als sie in die Hausschuhe schlüpfte. Die verräterischen Atemwolken vor ihrem Mund taten nichts, um ihre Stimmung zu heben.
Sie zog ihren Morgenmantel an und machte sich auf den Weg nach unten, holte die Kanne mit halb gefrorener Milch rein, die vor der Haustür stand, und betrat die Küche. Vor dem Spülbecken hielt sie einen langen Augenblick inne, bevor sie den Wasserhahn aufdrehte. Nichts. Die Leitungen waren wieder eingefroren.