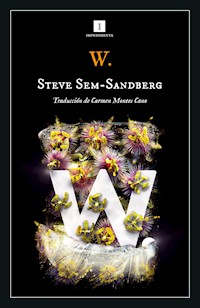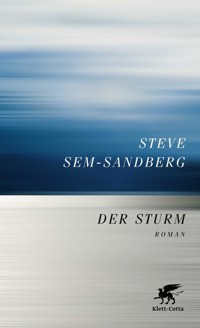
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine atmosphärisch dichte Familiengeschichte auf einer abgelegenen Insel Norwegens – mit sezierender poetischer Erzählkunst gelingt es Sem-Sandberg, das Schweigen über die Vergangenheit zu brechen. Norwegen, Ende der 1990er: Andreas kehrt zurück auf die Insel, auf der er seine Kindheit verbrachte, um das Anwesen seines verstorbenen Adoptivvaters Johannes aufzulösen. Mitten im Durcheinander findet er Spuren, die auf die bewegte Vergangenheit der Insel hinweisen und mit seiner nicht begleichbaren Schuld im Zusammenhang stehen. »Der Sturm« von Sem-Sandberg besticht durch seine einnehmende, poetische, kristallklare Sprache. Andreas war noch klein, als er mit seiner Schwester Minna zu Johannes ins Gelbe Haus kam, das auch als Totes Haus beschimpft wurde. Warum, das wusste er nicht. Es wurde ja nichts wirklich ausgesprochen auf der Insel. Aber der Argwohn nistete überall. Johannes nahm sich der beiden Kinder an, nachdem ihre Eltern auf mysteriöse Weise verschwanden. Ein Flugzeugabsturz, munkelte man. Auch Johannes erzählte ihnen stets von der Tragödie, die sich über dem Meer abgespielt haben soll. Doch Andreas forschte nach. Und wird fündig, als er Jahre später an den Ort seiner Kindheit zurückkehrt. Nach und nach erfährt er die Wahrheit über seinen Ursprung, der eng mit der Geschichte der Insel zusammenhängt, auf der die faschistische Quisling- Regierung zuließ, dass eine Kolonie für arme Kinder entstand. Dabei muss er sich auch mit seiner rebellischen Schwester auseinandersetzen, die er so sehr liebte, dass er Schuld auf sich lud, mit der er schließlich von ihr alleine gelassen wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Steve Sem-Sandberg
Der Sturm
Roman
Aus dem Schwedischen von Gisela Kosubek
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Stormen en berättelse« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm
© 2016 by Steve Sem-Sandberg
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
Für die deutsche Ausgabe
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Das Zitat auf S. 5 stammt aus: William Shakespeare’s Sämtliche dramatische Werke. Ausgabe in 12 Bänden. Erster Band. Leipzig 1839. Georg Wigand Verlag.
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP KOMMUNIKATION GMBH, MÜNCHEN
unter Verwendung eines Fotos von © plainpicture / Rolan
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98120-9
E-Book: ISBN 978-3-608-19163-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
… denn ich zeig’ ihm die frischen Quellen nicht
William Shakespeare: Der Sturm
Ich hätte nicht zur Insel zurückkehren sollen, tat es aber dennoch. Wir haben April. Wie immer, wenn es um diese Jahreszeit geregnet hat, liegen Nebelschwaden in der Luft und verdecken die beiden Schilderhäuschen am Brückenkopf und das, was vom Eisensockel des alten Schlagbaums noch übrig ist. Der Nebel lässt mich an die weißen Tüllgardinen denken, die Johannes im Sommer über die Sauerkirschen hängte, damit die Vögel nicht an die Früchte kamen, doch hinter dem Dunstschleier stehen die Bäume nach wie vor entlaubt und leer, und das Einzige, was sich im Wasser spiegelt, sind knorrige Äste und Felsen. Johannes prahlte stets damit, die Brücke mit seinen nackten Händen miterbaut zu haben. Bevor die Brücke kam, hatte es eine Gierfähre gegeben, die wenige hundert Meter weiter unten im Sund anlegte, wo sich auch Fahrzeuge hinübertransportieren ließen, selbst wenn die Wege auf der Insel zu der Zeit nicht gerade in gutem Zustand waren. Beim ersten Mal, als Johannes die Insel besuchte, hatte er sein Motorrad mit auf die Fähre genommen. Es war dasselbe Krad, mit dem man ihn später oft auf der Insel herumkurven sah, meist mit Kaufmann im Beiwagen, beide trugen Schutzbrillen und gefütterte Ledermäntel mit Gürtel und hohem Pelzkragen. Mit der Gierfähre über den Sund zu gelangen, war wahrhaftig kein leichtes Unterfangen. Wenn Wind blies, drohten die Stahlseile zu reißen, und außer dem Fährmann, der die Kurbel bediente, benötigte man zwei Mann an Land, um die Fähre sicher zum Anleger zu bringen. Dass Kaufmann am Ende gezwungen sein würde, die Insel durch eine feste Brücke mit dem Festland zu verbinden, war deshalb erwartet, und doch erstaunte der Beschluss, als er dann endlich gefasst wurde, nicht eben wenige. Kaufmann und seine Familie hatten die Inneren Inseln schon seit langer Zeit als privates Lehen besessen, das nur diejenigen betreten durften, die von ihm die Erlaubnis erhielten: die damals noch sehr wenigen Grundstückseigentümer oder die Ärzte, Krankenschwestern und Insassen des Sanatoriums draußen auf der Westinsel. Sobald die Brücke fertiggestellt war, ließ er steinerne Postenhäuschen errichten, an jedem Ende eins, und dieselben Angestellten, die zuvor die Gierfähre betrieben hatten, wurden jetzt zu Brückenwärtern. In der ersten Zeit gab es einen Schlagbaum, doch je mehr Kaufmann gezwungen war, Bauland vom eigenen Grund und Boden abzutrennen und zu verkaufen, desto sinnloser wurden die Schranken, und am Ende standen sie immer offen, und ein weiteres halbes Dutzend Jahre später montierte man sie gänzlich ab, sodass allein die Sockel übrig blieben. Wie lange konnte das her sein? Ich erinnere mich nicht mehr. Oder richtiger: Die Erinnerung nützt nichts, wenn es darum geht, die auf der Insel existierende Zeit zu messen. Als ich die gut fünfhundert Schritte über die Brücke gehe, verspüre ich genau dasselbe Gefühl wie damals, es ist, als würde ich mich mehrere Jahrhunderte in der Zeit zurückbegeben. Als würde die Landschaft um mich herum zugleich weiter und tiefer, ihre Farbe intensiver, ja als würde die Luft selbst sich verdichten. Das Klima hier draußen auf den Inseln ist ein anderes, pflegte Johannes mit jenem maßlos pedantischen Eifer, den er sich in späteren Jahren zugelegt hatte, zu erklären. Das hängt mit den milden Meeresströmungen zusammen. Du siehst es an den Quallen, die in den Sund treiben. Quallen zieht es immer in wärmere Gewässer. An dunklen Augustabenden breitete er Sternenkarten auf dem Küchenboden aus und zeigte Minna und mir ihre Konstellationen. Andromeda, Pegasus, Kassiopeia; und wenn ich den siebten Stern der Plejaden erkennen konnte, war mein Sehvermögen ungetrübt und würde es auch bleiben. Zu jener Zeit war Johannes bereits halbblind, wollte es jedoch nicht wahrhaben, sondern führte uns mit der Taschenlampe hinaus in den Garten, wo wir die Sternbilder mit eigenen Augen betrachten sollten, und ich erinnere mich, dass ich damals dachte, wenn all das, was um uns herum unentwegt zu Bruch ging, verdarb und verdreckte – Johannes, der rund um die Uhr soff und in seinen bepissten Decken schlief, der Garten, der verkam, das Haus, das der Schwamm zerfraß, Minnas Weise, die ganze Nachbarschaft mit ihrer bläkenden Teenagerstimme zu terrorisieren –, wenn all das, was unser chaotisches Zusammenleben ausmachte, gegen einen einzigen Augenblick des Friedens und der Stille ausgetauscht werden könnte, dann müsste es ein solcher sein. In dem es um uns herum endlich dunkel und still war und die Sterne reglos am Himmel standen. Und dass es danach immer so weitergehen würde, wie es jetzt gerade in der warmen Dunkelheit dort oben war. Nacht für Nacht. Dieselbe Sicherheit, dieselben festen, stets wiedererkennbaren Konstellationen. So dachte ich damals. So denkt ein Kind.
Dass einem etwas in der Erinnerung nahe ist, bedeutet nicht, dass man sich in allem wiedererkennt, am allerwenigsten in der Geografie. Statt ein Taxi zu nehmen, hatte ich es vorgezogen, zu Fuß zu gehen, was hieß, dass ich einen reichlichen Kilometer zurückzulegen hatte, obendrein mit meinem gesamten Gepäck auf dem Rücken. Weil ich nicht wusste, in welchem Zustand ich das Gelbe Haus vorfinden würde, hatte ich mich auf das Schlimmste vorbereitet. Hatte Schlafsack und Isomatte in den Rucksack gepackt, sogar einen kleinen Campingkocher und Konserven eingesteckt für den Fall, dass im Haus nichts Essbares mehr vorhanden sein würde. Ein Vorteil der Fußwanderung war jedenfalls, dass ich all diese neuen Protzbauten aus nächster Nähe betrachten konnte, die Johannes so verhasst gewesen waren. Allesamt hatten der Straße den Rücken zugekehrt, und die verglasten Terrassen und überladenen Erker wiesen aufs Meer hinaus, was in früherer Zeit undenkbar gewesen wäre. Hier ruhen sie alle in ihren eigenen Gräbern, wie Johannes es ausgedrückt hätte, mit Carports und Parabolantennen als Monumente eines neuen Reichtums ohne jedes Maß und jede Moral. Auch die Straße scheint einen anderen Verlauf zu nehmen als zuvor, oder ob das nur so aussieht, weil sie verbreitert und asphaltiert worden ist? In langen Windungen führt sie an der felsigen Strandlinie entlang bis zum schmalsten Punkt der Insel hinunter, der Landzunge, wo die westliche und östliche Seite der Insel wie bei einem Stundenglas zusammenlaufen, um anschließend die Steigung zum Kiwi-Laden auf dem Hang zu nehmen. Direkt gegenüber liegt das alte langgestreckte Holzgebäude, in dem vormals Brekkes Kolonialwarenhandel zu Hause war sowie der Eisenwarenladen, in dem Johannes seine Nägel und Gasflaschen erstand. Das Holzgebäude steht noch immer, wenn auch renoviert und ausgebaut zu etwas, was als moderner Bauernstil gelten sollte, in den Schaufenstern glänzende Prospekte einer Maklerfirma, doch was den Handel selbst betraf, hatte den nun natürlich der Supermarkt übernommen. Der Parkplatz vor dessen Eingang ist allerdings nicht mit Autos vollgestellt (es ist Sonntag), nur ein paar Einkaufswagen hat jemand anscheinend aufs Geratewohl umhergefahren und einfach stehen gelassen. Am Supermarkt beginnt der Kungsvägen, der Königsweg, so genannt, weil er die gesamte Insel auf dieser Seite der Landzunge umrundet. Vom Kungsvägen biegt das ab, was früher als einfacher Pfad den Hang zum Huvudgårdsvägen hinaufführte, und folgt man diesem, vorbei am Schild Privatweg, kommt man zu Kaufmanns Anwesen. Dort liegt es noch immer: das Kaufmannsche Gutshaus mit seinem hohen, von einer Turmspitze gekrönten Satteldach und der langgestreckten Veranda auf der einen Seite des Hofplatzes und die diversen Stall- und Wirtschaftsgebäude auf der anderen. Das alte Pumpenhaus steht ein Stück entfernt, dort, wo der Weg schon in Wiesen und Waldflächen übergeht, und rechts von ihm sieht man die Pferdekoppel und die Trainingsbahn, die Herr Carsten auf Kaufmanns Wunsch oder gegen ihn angelegt hat. In meiner Kindheit gab es direkt unterhalb des Waldrands eine seit langem kahlgefressene Koppel, auf der meist ein weißes Pferd neben einer Emaillewanne stand, die als Trinkwassertrog diente. Ich weiß noch, wie ich in den kurzen hellen Sommernächten am Fenster lag und das Pferd betrachtete, vollkommen fasziniert davon, dass es Stunde um Stunde reglos dastehen konnte. Vielleicht schlief es ja im Stehen, wie Tiere es tun: Oder das Pferd war als Einziges wach auf der Insel, während alle anderen in tiefem Schlummer lagen. Ich sehe Minna halbnackt über das Feld unterhalb der Pferdekoppel rennen. Wieder haben wir einen glutheißen Sommer, und in meinem Mund spüre ich, so wie sie in ihrem, den Geschmack der sonnenverbrannten Erde. Als sei es meine eigene Haut, spüre ich, wie ihr die kratzigen Ähren über die nackten Arme und Beine fahren. Wir rennen, ich wie immer einen Schritt zurück, oder vielleicht sitze ich ja oben auf dem Dachboden und sehe durch Johannes’ Feldstecher, wie sie rennt und dann fällt. Es ist, als gebe es mitten im Acker eine kleine Kuhle, und die Weizenähren schließen sich dicht um ihren Körper. Von hier oben aber kann ich sie trotzdem sehen: Wie sie mit dem Rücken auf der Erde liegen bleibt, das Gesicht direkt zum Himmel gewandt, verzerrt zu einem Gebrüll, das nicht zu vernehmen ist, und dann sehe ich, wie der Alte den Weg vom Hof herunterkommt, mit großen dunklen Schweißflecken auf dem Rücken, dort, wo die Hosenträger das Hemd an den Körper pressen, oder ist es vielleicht Herr Carsten? Und das ganze Bild erstarrt: Minnas regloser Körper im Feld auf dem Rücken liegend und er, der sich als dunkler Schatten außerhalb des Bildes nähert, die ganze Zeit außerhalb des Bildes. Das ist alles. Ein Traum oder eine Erinnerung: Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich beim Gelben Haus angelangt und stehe vor dessen rückwärtigem Eingang. Hinter den Bäumen ragen Johannes’ Bienenstöcke gleich viereckigen Schädeln aus dem hohen Gras, und es riecht streng und muffig nach fauliger Erde, wie es das hier immer tat: von Dingen, die zu lange im Schatten gelegen hatten. Durch den erneut dichter werdenden Dunst kommt langsam ein Flugzeug näher, taucht in die rasch ziehenden Wolken ein und wieder auf, das starke Getöse wird zum lauten Heulen, gefolgt von einem heftigen Überschallknall. Dann ist es vorbei, und das Flugzeug verschwindet mit blinkenden Flügelspitzen über dem Vogelberg hinter Kaufmanns Anwesen. Der Schlüssel hakt im Schloss. Also presse ich die Schulter gegen das Holz der Türfüllung, mit einem Splittern gibt sie schließlich nach, und ich falle hinein in die staubige Finsternis mit ihrem wohlbekannten Geruch nach schimmligem Keller und Heizungsöl. Wieder zu Hause.
Ebba Simonsen hatte angerufen und mitgeteilt, dass Johannes tot war. Die Simonsens waren schon vor dem Krieg Johannes’ Nachbarn gewesen, als die ganze Insel im Prinzip noch Kaufmann gehörte. Damals hatten sie noch keine Kinder, später aber kamen sie Schlag auf Schlag, und ich erinnere mich an Frau Simonsen aus der Zeit meiner Kindheit, sie hatte tiefe Grübchen in den Wangen und müde Augen, war ständig von schreienden Bälgern umgeben, und ihre blonden Haare hingen in nassen Strähnen über dem, was sie gerade tat: waschen oder backen. Ihr Mann – wie sein Vorname ist, weiß ich tatsächlich nicht, ich habe ihn nie anders als Simonsen genannt – war Tontechniker beim Rundfunk und von morgens bis abends auf Arbeit. Später ging er in Pension, war deshalb aber nicht öfter daheim. Obgleich Simonsen aktiv am Kampf gegen die Deutschen teilgenommen hatte (als man die Geschichte der Widerstandsbewegung schrieb, wurde der Arbeit Simonsens, der den Funkverkehr chiffrierte und Codes knackte, stets mindestens ein Kapitel gewidmet), hatte es zwischen ihm und Johannes nie irgendwelche Feindseligkeiten gegeben. Als der Krieg vorüber war, Kaufmann im Gefängnis saß und Sigrid Kaufmann samt Tochter Helga oben auf dem Gut unter einer Art halboffiziellem Hausarrest stand, gab es viele, die der Ansicht waren, auch von den ehemaligen Handlangern des alten Nazis müsse nun Gerechtigkeit eingefordert werden, was insbesondere für Johannes galt, der Kaufmann viele Jahre als Chauffeur gedient hatte. Ein Trupp von mehreren hundert aufgebrachten Männern hatte sich vor dem Gelben Haus eingefunden, um ebendas zu tun, doch da war Simonsen dazwischengegangen und hatte zu den Anwesenden gesagt, sie sollten nichts tun, was sie später bereuen würden, jeder solle stattdessen zu sich nach Hause gehen und den Lauf der Gerechtigkeit abwarten. Von da an hing stets ein Reserveschlüssel zum Gelben Haus am Haken neben dem Sicherungskasten im Flur vor Simonsens Arbeitszimmer. Als Kinder haben Minna und ich es geliebt, Simonsen in seinem Tonstudio im Keller zu besuchen. Hinter seinem Schreibtisch bewahrte er auf breiten Wandregalen seine ganze beachtliche Geräuschsammlung auf, Tausende Rollen mit Tonbändern in runden Blechschachteln. Auf den Bändern konnte man das Knacken und Knirschen kalbender Gletscher vernehmen, das plötzliche Zuklappen eines Krokodilmauls, wenn es sich um seine Beute schloss, oder lange tropische Regengüsse, die so heftig waren, dass sie nicht einmal wie ein Geräusch klangen, sondern mehr, als hätte einem jemand Watte in die Ohren gestopft. Minna und ich gingen oft abends oder am Wochenende dorthin oder überhaupt, wenn uns langweilig war, um Simonsen zu überreden, uns seine besten Geräusche vorzuspielen. Am meisten Spaß hatten wir an den lebendigen Stimmen und Tönen, die er hatte einfangen können. Auf seinen Bändern konnten wir den heiseren Doppelschrei der Fasane vernehmen, von dem Simonsen sagte, er gleiche Todesschreien – die Fasane auf der Insel waren so zahlreich, dass man sie auf den Straßen gleich feinen, sonntäglich herausgeputzten Herrschaften stolzieren sah (jedenfalls die Männchen, während die Weibchen oft am Wegrand versteckt lagen) –, und das Gebell von Brekkes Hund, wenn er sich selbst am Ende der langen Laufleine würgte, an der Brekke ihn festgebunden hielt. Wir konnten das Räuspern und Husten von Herrn Kaufmann hören, konnten Magister Norvigs komplizierter Vorlesung, wie man die Landesfahne entrollt und wieder einrollt, lauschen und kriegten mit, wie sich Herr Carsten in seinem holprigen Halbdänisch mit irgendetwas brüstete. Und die ganze Zeit, während die Insel gleichsam an unseren Ohren Revue passierte, hing der Schlüssel dort an seinem Haken neben dem Sicherungskasten. Hatten wir uns ausgesperrt oder wenn Johannes das Auto genommen hatte, um einen überraschenden Auftrag zu erledigen, konnten wir uns Simonsens Schlüssel holen, obwohl Minna es vorzog, durch irgendein angelehntes Fenster ins Haus zu gelangen. So war es viel lustiger: an Fallrohren und Gesimsen hochzuklettern. Mit diesem Schlüssel hatte sich Ebba auch nun nach dem Dreikönigstag ins Gelbe Haus Eingang verschafft. Johannes war nicht vorbeigekommen, um Frohe Weihnachten, ja nicht einmal um alles Gute zum Neuen Jahr zu wünschen, was er sonst stets tat, und der Briefkasten quoll seit langem von Werbung und Rechnungen über, die niemand hereingeholt hatte. Er musste schon ein paar Wochen tot gewesen sein, als Ebba ihn fand, und nur die Kälte im ungeheizten Haus hatte verhindert, dass der Leichengestank nicht noch schlimmer war. Er hatte in der Küche gesessen, wo er sich nach der Mahlzeit gern »ein Weilchen erholte«, im Winkel, wie er den engen Platz zwischen dem kleinen Klapptisch, den er als Esstisch benutzte, und der Speisekammer nannte, den Arm in einer unnatürlichen Drehung zur Tischplatte und Kopf und restlicher Körper nach hinten zur Wand geworfen. Von dorther, aus seinem Winkel, hatte er all die Jahre an mich geschrieben. Lange Briefe mit bis zu zehn oder fünfzehn Seiten, die zusammenzukritzeln viele Abende erfordert haben musste. Noch Mitte Dezember hatte ich einen solchen Brief erhalten, und abgesehen von den Magenbeschwerden, über die er ständig klagte und die ich darauf zurückführte, dass er sich nicht richtig ernährte, nur Brot und Konserven aß, gab es nichts in dem Brief, dem sich entnehmen ließ, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Johannes’ Briefe waren auf äußerst charakteristische Weise verfasst, vollgekritzelt mit kleinen, dicht gedrängten Versalien (er schrieb alles in Versalien) auf derbem, kariertem Papier aus Notizheften von schlechter Qualität, die er seit eh und je bei Brekke und zuvor bei Brekkes Vater erstanden hatte. Während er schrieb, riss er eine Seite nach der anderen heraus, bis nur noch der geleimte Rücken übrig blieb, den er anschließend im Aschenbecher verbrannte, bevor er mit einem neuen Heft begann. (Aus meiner Kindheit habe ich den Geruch nach verbranntem Leim noch deutlich in Erinnerung, wenn der Rücken des Hefts dann Feuer fing und zu qualmen begann: ein stechender, scheußlicher Gestank.) Mit den Jahren wurde der Ton der Briefe immer querulantischer. Je älter Johannes wurde, desto mehr bildete er sich ein, andere würden sich gegen ihn verschwören. Und immer hielt er es für notwendig, genau mir alle Beweise, die er dafür hatte, dass es sich so verhielt, vorzulegen. Johannes führte Buch über alles und alle, mit denen er im Laufe der Jahre aneinandergeriet: einen großen, schwarzen, dickbauchigen Ringordner, den er Karthago taufte. Im Karthago hatte er private Briefe abgeheftet, dazu Ausschnitte aus im Lokalblatt erschienenen Leserbriefen (eigenen und fremden), Quittungen von Banktransaktionen, Briefe an die Steuerbehörde, an Lieferanten von Heizöl, ans Elektrizitäts- und Wasserwerk oder an den Interessenverband der Insel. Letztgenannte Schreiben betrafen Streitigkeiten, die ständig darüber ausbrachen, wo die Grundstücksgrenzen verliefen, wie das Schneeräumen zu finanzieren war, wie die jährliche Gemeinschaftsarbeit durchgeführt und wie der Anlegesteg mit den festen Bootsplätzen betrieben werden sollte, über den Johannes zusammen mit den anderen aus der Gruppe, die man die zwanzig Grundstückseigner nannte, verfügte. Et cetera, et cetera. Die zwanzig Grundstückseigner waren die ersten fest auf der Insel Ansässigen, für die Kaufmann Baugrund abgeteilt hatte, und sie gerieten sich ständig in die Haare, insbesondere um die Bootsplätze gab es fortwährend Konflikte, da manche sie untervermieten wollten, während andere, beispielsweise van Diesen, so viele Bootsplätze wie möglich aufkaufen wollten, um den gesamten Anleger in eine private Marina verwandeln zu können. Das werde ich im Karthago festhalten, sagte Johannes immer, wenn etwas passierte, was ihn empörte, wie zuletzt das mit van Diesens Plänen. Oder auch: Bestimmt habe ich hier was im Karthago, was dich interessieren könnte. Letztgenanntes sagte er häufig am Telefon, und ich gestehe, oft war es die Aussicht, stundenlangen Vorlesungen aus dem Karthago ausgesetzt zu werden, die mich einen leeren Vorwand nach dem anderen vorbringen ließ, um nicht auf die Insel fahren zu müssen. Je weiter die Jahre voranschritten, desto mehr wurde Johannes von all diesen Streitigkeiten aufgefressen. Irgendwie finde ich das nicht mal im Karthago, schrieb er zuweilen über eine Angelegenheit, die seinen Zorn geweckt hatte, und ich sah ihn vor mir, wie er tagelang Schubladen und Kartons durchwühlte nach dem Beweis, der ihn letztlich freisprechen würde von was auch immer er meinte freigesprochen werden zu müssen. Eigentlich war es ein Wunder, dass Johannes überhaupt schrieb. Er fing an, schlecht zu sehen, verlegte seine Lesebrille, und manchmal vergingen Wochen, ohne dass er sie finden konnte. Auch mit dem Rücken hatte er Probleme, und nach einem Oberschenkelhalsbruch war er auf dem rechten Bein fast lahm; die letzte Zeit schleppte er sich mit Krücken vorwärts. Da es ihn nicht kümmerte, sich ordentlich zu waschen, verströmte er bald einen strengen Geruch nach Urin und essigsaurem Schweiß. Er sagte, er fürchte zu fallen, wenn er versuche, allein in die Wanne zu steigen. Als hätte das irgendeinen Sinn gehabt: Die Gemeinde war es ohnehin leid gewesen, auf all die ausgebliebenen Gebühren zu warten, und hatte ihm das Wasser ein für alle Mal abgestellt. Zum Glück war die Tonne unter dem Fallrohr fast immer mit Regenwasser gefüllt. Ich holte jedes Mal mehrere Eimer herein, wärmte auch einen großen Topf voll auf dem Herd, den er als Abwaschwasser benutzen konnte, falls ihn wider Erwarten die Lust zum Spülen überkam. Die Eimer stellte ich ins Badezimmer und half ihm, in die Wanne zu steigen. Das, was aus den Wasserhähnen kommt, hat niemand unter Kontrolle, sagte er, während ich ihm das Hemd aufknöpfte und die Hose auszog. Unsinn, erwiderte ich. Bist du es nicht gewesen, der damals gesagt hat, die Inselleute wären verrückt, als sie sich einbildeten, die Alte hätte ihnen Gift ins Wasser getan? Da hatten wir aber wenigstens unser eigenes Wasser, hier von der Insel, erwiderte er, ohne zu begreifen, dass er sich damit selbst widersprach. Mit der Alten meinte ich Frau Sigrid Kaufmann, die hier seit jeher so genannt wurde. Früher hatte er mir streng in die Augen gesehen und mich korrigiert. Frau Kaufmann, wenn ich bitten darf. Jetzt begegnete er meinem Blick nicht mehr, doch ich merkte, dass er aufgebracht war. Er zitterte, als ich ihm in die schmutzige Wanne half, stand hager und grauhaarig da, den fahlen, aufgedunsenen Bauch zwischen den Armen, die er zwischen den Knien festklemmte. Respekt, sagte er, während ich ihn einseifte, und dann noch einmal, als er sich unter dem Wasser duckte, mit dem ich ihn übergoss. Kaufmann hat nie einen Deutschen über die Brücke gelassen, sagte er. Solange der Krieg andauerte, hast du niemanden von diesem Pack hier draußen auf der Insel gesehen. Schau dir doch an, was die Leute, die jetzt hier wohnen, anschleppen, sie sind nichts anderes als Abschaum und Gesindel, irgendwelche Leute aus dem Ausland: Denken, sie haben einen Besitzanspruch, nur weil sie Geld haben! Als ich ihm das Gesicht rasieren wollte, musste ich mich gleichfalls ausziehen und zu ihm in die Wanne steigen, zwei nackte Körper, die beide bessere Tage gesehen hatten, standen sich im frostigen Licht gegenüber. Zittere nicht mit der Hand, sagte er. Wer hier zittert, bist ja wohl du, sagte ich. Es musste das letzte Mal gewesen sein, dass ich ihn lebend sah. Erst im neuen Jahr, als er auf meine Briefe und Weihnachtsgrüße nicht geantwortet hatte, fing ich an unruhig zu werden und bereitete mich gerade darauf vor, mit Lebensmitteln, Wasser und einem kleinen Kohleofen, den ich aufgetrieben hatte, wieder auf die Insel zu fahren, als Ebba anrief. Eine Todesursache wurde nie angegeben, wie üblich hieß es einfach, es sei das Herz gewesen, ich persönlich tendierte jedoch zu der Ansicht, dass der Sieg über die Behörden, der ihn so stolz gemacht hatte, auch zu seiner Niederlage wurde. Dass er schlichtweg erfroren war. Zur Beerdigung, die wenige Wochen später stattfand, brauchte ich nicht zur Insel zurückzukehren, weil er seit langem für eine Grabstelle bei Vidarudden auf dem Festland gesorgt hatte, wo auch Kaufmann und seine Familie lagen. Außer Simonsen waren nicht eben viele erschienen, Jonas Brekke, der Sohn des Ladenbesitzers, war gekommen, ebenso wie der Däne Peter Kolding mit Frau und (ältestem) Sohn, der auf dem Hügelkamm oberhalb von Simonsens wohnte, und Sigurd Hansen, der nach van Diesen den Vorsitz des Inselinteressenverbandes übernommen hatte. Hansen kam wohl hauptsächlich aus Dienstgründen, da Johannes und er nie miteinander klargekommen waren. Von den Briefen im Karthago waren die meisten genau an ihn adressiert. Viele von denen, die Jahr für Jahr hartnäckig behauptet hatten, Johannes sei ein alter Quisling, waren zu diesem Zeitpunkt schon tot, und die es noch nicht waren, blieben einfach aus alter Gewohnheit fern. Vom Gutshof oben erschien natürlich niemand. Wer hätte das auch sein sollen? Sigrid Kaufmann war seit mehreren Jahren selbst tot. Nur die Tochter vermutete man noch am Leben, doch nicht einmal dessen war man sich sicher, weil niemand auch nur eine Spur von ihr gesehen hatte. Und der Inspektor, Herr Carsten? Ihn hätte wohl niemand auf der Beerdigung haben wollen, selbst wenn er bereit gewesen wäre zu kommen, obgleich er nach wie vor mit Hund und Pferden dort oben hauste. Ebba Simonsen sah ihn oft die Straße vom Hof heruntergefahren kommen, im Schlepptau den Pferdeanhänger. Was mich anging, hätte die Beerdigung gern als Schlussstrich unter allem dienen können, doch noch gab es ja das Haus, und früher oder später würde sich jemand um die Hinterlassenschaft kümmern müssen. Und richtig: Nur ein paar Monate waren vergangen, als erneut ein Anruf von der Insel kam. Diesmal war Simonsen selbst am Apparat. Leute kommen an und fragen nach dem Haus, sagte er. Was für Leute?, wollte ich wissen. Was glaubst du wohl? Reiche Typen natürlich, Leute mit Geld. Die kriegen es nie, sagte ich. Das habe ich ihnen auch gesagt, erwiderte Simonsen. Und ergänzte: Doch in dem Fall musst du wohl selber herkommen und es ihnen klarmachen, wenn die Leute glauben, dass es eine Chance gibt, werden sie nur noch heißer auf den Braten. Das Haus ist eine Ruine, sagte ich, ist es immer gewesen. Nicht das habe ich gemeint, sagte Simonsen. Das Schweigen zwischen uns hätte Simonsen selbst auf einem seiner Bänder aufgenommen haben können. Überleg dir, was Johannes gewollt hätte, sagte Simonsen zu guter Letzt. Und deine Schwester. Es waren seine Worte über meine Schwester, die mich am Ende die Aversion überwinden ließen und mir die Gewissheit gaben, dass, wenn ich nur lange genug dort draußen bliebe, letztlich auch Minna gezwungen sein würde zurückzukehren. In irgendeiner Gestalt. Um mir zu helfen, das wenige zu retten, was es noch zu retten gab, und mich von dem Rest zu befreien.
Die Insel: Es war, als hätte es sie seit jeher gegeben, voll von klagendem, rätselhaftem Leben, noch bevor jemand seinen Fuß darauf setzte. Die Ersten, die es taten, kamen mit dem Boot über den Sund oder mit Schlitten in den seltenen Jahren, wenn das Wasser im Fjord gefror. Sie schnitten Eis aus dem See in der Inselmitte: große rechteckige Blöcke, die sie, bedeckt mit Sägespänen, zu einem der Verschiffungshäfen auf dem Festland transportierten. Nachdem die Eishändler verschwunden waren, kam der eine oder andere rührige Bauer über den Sund, mit der Absicht einen Hof zu errichten. Doch alle, die es versuchten, gaben nach einiger Zeit auf und kehrten zum Festland zurück. Die Transporte von und zu der Insel waren noch immer viel zu teuer, als dass es sich lohnte, Landwirtschaft im größeren Umfang zu betreiben. Kaufmanns Vater, der in einer der konservativen Vorkriegsregierungen Minister war, hatte Land gekauft und sich auf der felsigen Westseite der Hauptinsel ein Sommerhaus gebaut (es steht noch heute) und zugleich die Gelegenheit ergriffen, nahezu jeglichen Boden, der nicht nur auf der Hauptinsel, sondern auch auf den benachbarten Inseln der Westinsel und Notudden zu haben war, aufzukaufen und zu verpachten. Die wichtigste Anschaffung stellte der sogenannte Haupthof dar mit den umliegenden Äckern und weitgestreckten Waldgebieten, die auch den See oder Weiher, wie er genannt wurde, einschlossen. Jan-Heinz Kaufmann der Ältere war nie sonderlich an Landwirtschaft interessiert, Grund und Boden kaufte er nur, weil er wusste, wenn er es nicht tat, würde es früher oder später ein anderer tun. In der Realität war es also Kaufmanns einziger Sohn, der die Verwaltung der Pachthöfe übernahm. Auf die wenigen Familien, die zu jener Zeit dauerhaft auf der Insel lebten, musste der Anblick dieser blassen, schüchternen, doch auch merkwürdig hochmütigen Kopie von Kaufmann dem Älteren einen seltsamen Eindruck gemacht haben. Jan-Heinz war ein schlaksiger Jüngling mit langem schmalem Gesicht, hoher Stirn, spitzem Kinn und neugierigen Äuglein hinter einer Nickelbrille. Trotz seiner jungen Jahre ging er keinen Meter ohne Hut und Spazierstock, allerdings fast nie im Langmantel oder Sakko, meist nur in einem weiten kragenlosen Hemd aus derbem Leinen, mit den später so charakteristischen Hosenträgern schlaff über den noch zarten Schultern hängend. Obgleich sie sich dem Äußeren nach glichen, war Kaufmann in nahezu allem der Gegensatz seines Vaters. War der Vater ein konservativer, wirtschaftlich orientierter Pragmatiker, so war der Sohn ein Freigeist und Idealist, der sich von Utopisten und Gesellschaftsreformern des Auslandes wie Charles Fourier oder jenem George Ripley beeinflussen ließ, der die Brook Farm gegründet hatte. Mit der Zeit sollte Kaufmann auf den Inneren Inseln sein eigenes alternatives Gemeinwesen gründen, einen losen Verband reformbewusster Idealisten, der oft nur als Kolonie bezeichnet wurde. Mit Billigung des Vaters kündigte Kaufmann der Jüngere die unrentablen Pachtverträge und widmete sich einer dynamischeren Wechselbewirtschaftung des Bodens, experimentierte mit neuen und wiederentdeckten Getreidesorten wie etwa dem Emmer, der, wie sich zeigte, auf den trockneren, ungeschützteren Teilen der Inneren Inseln überraschend gute Ergebnisse brachte. Um das Erntejahr zu verlängern, ließ er dem Herbstweizen auf der Hauptinsel Raps folgen. Es war das erste Mal, dass sich jemand auf den Inseln mit dem Anbau von Ölfrüchten beschäftigte, und anfangs machte man sich über ihn lustig, doch wie sich herausstellte, hatte Kaufmann gute Kontakte, er unterzeichnete einen Vertrag mit einem Lübecker Unternehmen, das aus dem Raps billiges Speiseöl herstellte, und schon bald wurde die ganze Ernte per Schiff und Bahn nach Deutschland ausgeführt. Schon nach wenigen Jahren begann Kaufmann nach neuen Arbeitskräften zu inserieren. Jeder neue Beschäftigte erhielt eine illustrierte, vierundzwanzig Seiten umfassende Broschüre ausgehändigt mit dem Titel Über die Handhabung von Natur und Mensch, in der Kaufmann alles genauestens erläuterte, angefangen von den speziellen Anbaubedingungen, die auf den Inseln herrschten, bis zur charakterlichen Erziehung der Menschen, und um sicherzugehen, dass seine Ideen Fuß fassten, wurden die Mitarbeiter regelmäßigen Befragungen ausgesetzt. Die Kolonie nahm an Größe zu, nicht zuletzt wegen der guten Arbeitsbedingungen: Jedem neuen Beschäftigten wurde eine Wohnung nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Familie gewährt, wenn mindestens zwei Mitglieder des Haushalts an der Arbeit beteiligt waren. Anfang der 1920er Jahre ließ er auf der Westinsel ein Phalansterium errichten mit Platz für fünfundzwanzig arbeitende Familien, deren Kinder von einem Lehrer unterrichtet wurden, der jeden Morgen im Boot vom Festland kam. Kaufmann hatte auch weit gediehene Pläne für die Gründung einer eigenen Schule auf der Insel, wo der Unterricht sozusagen in seinem Geist erfolgen sollte. Eine solche aber kam nie zustande, oder besser gesagt: Er erhielt keine Erlaubnis, sie zu gründen. Zu diesem Zeitpunkt waren seine utopistischen Ideen bei den Behörden auf Misstrauen gestoßen. Satiriker stellten ihn als ungezügelten Exzentriker dar, als Sinnbild des alten Feudalherren, der allen Arbeit versprach, doch seine Beschäftigten stattdessen in erzwungener Leibeigenschaft hielt. Was der Kolonie am Ende die Auflösung brachte, war jedoch weder politischer Druck, noch waren es bürokratische Hindernisse, sondern die krasse ökonomische Realität. Nach der Weltwirtschaftskrise begann Kaufmann Baugrundstücke abzuteilen und zu verkaufen, um das erforderliche Kapital hereinzubekommen, was die Fortführung der Landwirtschaft auf den Inneren Inseln überhaupt erst ermöglichte. Zu diesem Zeitpunkt nahm er nicht mehr selbst an der Landarbeit teil, wechselte von der alten Bauernpartei zur neu gegründeten Nasjonal Samling und widmete sich mehr und mehr der Politik. Diejenigen, die auf den Inseln wohnten, lernten ihn in diesen Jahren, von 1933 an, vor allem als passionierten Botaniker kennen. Der morastige Boden und der reiche Laubbaumbestand um den See im östlichen Teil der Hauptinsel ergaben den natürlichen Nährboden für eine Vielzahl von Pflanzen, die in diesen Breitengraden nirgendwo anders zu finden sind. Kaufmann kartographierte die Arten und beschrieb ihr Vorkommen in einem Werk, das noch heute als einzigartig gilt, nicht zuletzt wegen der wundervollen Schautafeln, die er selbst koloriert hatte. Auch in anderer Hinsicht fuhr Kaufmann mit dem Ordnen, Kategorisieren, Abstecken und Einfrieden fort. Er ließ eine kleine Pumpstation neben dem Weiher errichten, von dem das dunkle Seewasser in langen freiliegenden Rohren zu den neuen Inselbewohnern geleitet wurde. Das war ein Experiment, so wie er in der Kolonie mit verschiedenen Getreidesorten experimentiert hatte, bei dem Versuch, die widerstandskräftigsten und nährstoffreichsten Arten zu finden. Alles, was wuchs, faszinierte ihn, ebenso auf welche Weise man es veredeln, verwandeln oder in eine andere Form bringen konnte. Er war so was wie ein Zauberer, pflegte Johannes zu sagen. Nur selbst verwandelte er sich nie. Er blieb sich immer gleich, ein Idealist, allerdings ohne den richtigen Schwung: immer verschlossener, launenhafter, despotischer. Dann kamen der Krieg und die Okkupation durch die Nazis, und Kaufmann wurde zum Minister im Handelsministerium ernannt. Für seine Feinde, und davon gab es damals viele, war seine Arbeit in der Quisling-Regierung nur eine Folge der elitären Ideen, die er schon bei der Gründung der Kolonie gehabt hatte. Anderen zufolge war sein Tun von purem Opportunismus gesteuert, möglicherweise auf Drängen von Kaufmann dem Älteren, der nach wie vor am Leben war (er starb 1942) und der darauf bestand, Land und Besitz in den Händen der Familie zu halten. Johannes hatte stets erklärt, dass die Behauptung, Kaufmann sei Nazi gewesen, nur üble Nachrede war. Die Kolonie, jedenfalls die sogenannte erste Kolonie, basierte auf der Vorstellung von Wohlwollen und Vertrauen zwischen Menschen, und nicht auf Misstrauen und Hass. Das würde jeder begreifen, der einen Blick in die Broschüre Über die Handhabung von Natur und Mensch warf. Johannes war der Auffassung, dass, wenn Kaufmann mit den Deutschen zusammengearbeitet hatte, dann nur, weil er meinte, keine andere Wahl zu haben. Ob er aus der Notwendigkeit eine Tugend gemacht oder aus reinem Selbsterhaltungstrieb gehandelt hatte, ist eine Frage, die jeder Einzelne entsprechend seines eigenen Gewissens beantworten musste. Auch nach Kriegsende, als das Urteil über ihn gefallen war, hatte er die Strafe auf sich genommen, wie einen Preis, der zu bezahlen war. Wer von all den Leuten, die ihn später als Landesverräter bezeichneten, hatte sich jemals gefragt, was er in dieser Zeit hingegen für sein Land getan hatte?, fragte Johannes. Es kam selten vor, dass man Johannes aufgebracht sah, doch jetzt war er es. Er hatte die Brille abgenommen, und seine Stirn glänzte rot, nachdem er sie mit den Fingerspitzen bearbeitet hatte. Als die wahren Krisenjahre anbrachen, sagte er, als unsere Häfen blockiert waren und allein Schiffe, die im Konvoi fuhren, über den Atlantik gelangten, reiste Kaufmann im Namen seiner Regierung mit einer kleinen Delegation nach Berlin, und wider Erwarten gelang es ihm, Deutschland dazu zu bringen, die Exportquote von Saatgut zu erhöhen. Das war im Herbst 1942. Die deutsche Wehrmacht siegte an allen Fronten, und das Hauptthema des Tages war, wie man die wachsende Bevölkerung des Dritten Reiches satt bekommen konnte mit Hilfe der enormen, soeben eroberten Gebiete in Weißrussland, der Ukraine und weiter im Osten. Hitler persönlich hatte sich für die Angelegenheit interessiert, und Kaufmann erhielt sogar eine Audienz beim Führer bewilligt, bei der er erläutern durfte, wie und mit welchen Methoden verschiedene Getreidesorten veredelt werden konnten und was zur Erhöhung der Produktionsmenge erforderlich war. Ich weiß noch, dass Johannes vor sich hin lächelte, als Kaufmanns Deutschlandreise zur Sprache kam, oder vielleicht auch, weil er sich erinnerte, wie stolz der Alte über seinen unerwarteten diplomatischen Sieg gewesen war. Johannes erzählte, dass er Kaufmann persönlich vom Haupthof zum Flugplatz auf der anderen Seite des Sunds gefahren hatte, wo die restlichen Teilnehmer der Delegation bereits warteten, und dass er lange genug dort verblieben war, um zu sehen, wie die DC-3 mit dumpfem Gedröhn in den Dunst aufgestiegen war. Es war im November, an einem späten Abend, als ganz Europa vor Nässe triefte. Obgleich die Arbeit im Kriegs- und Versorgungsministerium (es hieß tatsächlich so) nahezu Kaufmanns gesamte Zeit verschlang, sah man ihn auch in diesen ersten Kriegsjahren oft auf einsamen Wanderungen entlang der Pfade um den See. Seine Frau Sigrid hatte fünfzehn Jahre zuvor eine Tochter, Helga, geboren, bei der im Alter von zwei Jahren eine spinale Muskelatrophie zweiten oder eventuell dritten Grades diagnostiziert wurde, eine Krankheit, die nur allmählich voranschreiten, sie mit der Zeit jedoch gänzlich an den Rollstuhl fesseln würde. Wenn du mich fragst, sagte Johannes, war das für Kaufmann, für einen Menschen seines Geistes und seiner Natur, ein entsetzlicher Schlag. Bist du ihr jemals begegnet?, fragte ich. Der Helga?, erwiderte Johannes. Ja, mehrmals. Vater und Tochter standen einander sehr nahe, er hätte alles Erdenkliche für sie getan, um sie gesund zu bekommen, und genau das tat er auch. Wenn es ihm nicht gelungen ist, dann, weil sich einfach nichts dagegen tun ließ. Die Krankheit ist schließlich erblich. Auch er hatte die Anlagen in sich. Jetzt erinnere ich mich: Von Johannes’ Bienen waren einige aus dem Bienenstock ausgebrochen und hatten ein eigenes Nest unter dem Dachfirst gebaut, und Johannes hatte eine Leiter an die Hauswand gestellt, um sie auszuräuchern. Wieder haben wir Sommer, die Hitze bringt die staubige Luft über dem Huvudgårdsvägen zum Vibrieren, sodass das Gutshaus oben auf dem Hang mit seinen Stall- und Wirtschaftsgebäuden nur undeutlich in dem Flirren sichtbar ist. Und: Was ist dann passiert?, fragte ich. Und er: Mit Helga oder mit Kaufmann? Ich darauf: Mit allem? Und Johannes: Dann kam ja natürlich der Frieden, und die Nato erschien und ersetzte die Deutschen, wie überall; auch den Flugplatz übernahmen sie, und der zivile Luftverkehr wurde ausgebaut, sodass die Einflugschneisen direkt über der Insel lagen. Sigrid Kaufmann protestierte gegen den hohen, die Gesundheit schädigenden Lärmpegel. Doch wen kümmerte schon, was sie sagte, sie gehörte schließlich der Feindesseite an, erklärte er und stieg die letzten Sprossen der Leiter hoch, vor dem Gesicht die Maske und in der Hand den Zerstäuber. Überall um ihn und um die offenen Fenster schwirrten Insekten. Im Sommer war stets alles voller Bienen, die aus seinen schludrig geführten Stöcken ausschwärmten und sich in Baumkronen oder unter den Dachziegeln des Hauses festsetzten. Langsam hob Johannes nun die Bienenwabe mit seiner behandschuhten Hand heraus. Überall auf seinem Arm krochen Insekten, und ich erinnere mich, wie unendlich fremd mir sein vom Netz verhülltes Gesicht vorkam, als ich vom Fuß der Leiter nach oben blickte: eine Maske aus rastlos wimmelnden Insekten.
Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte,