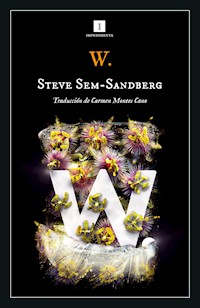19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor 200 Jahren: Johann Woyzeck ermordet Johanna Woost Am 21. Juni 1821 ersticht Johann Christian Woyzeck die Witwe Johanna Woost. Ein Verbrechen aus Leidenschaft, dessen Umstände von Georg Büchner bis Werner Herzog Generationen von Künstlern in Bann schlug. In seinem neuen großen Roman spürt Steve Sem-Sandberg dem historisch verbürgten Fall nach und entwirft eindrucksvoll das Porträt eines Mannes, in dem sich das Vexierspiel von Wahnsinn und Schuld, von innerer Zerrissenheit und Liebe offenbart. Als W. 1790 beim Leipziger Perückenmacher Knobloch in die Lehre eintritt, ist er gerade mal zehn Jahre alt; die Mutter an der Schwindsucht gestorben, der Vater ein Trinker, der Rasiermesser und Schere nicht mehr sicher führen kann. Doch nicht immer kann W. sich nur auf seine Arbeit konzentrieren, denn manchmal kommt die Stieftochter des Perückenmachers zu Besuch, und als er sie heimlich beim Waschen belauert, packt ihn zum ersten Mal das Begehren. Die Lust am Herumschleichen und Hinterherspionieren wird ihn sein Leben lang nicht loslassen. Nicht während seiner Wanderjahre, in denen er sich in diversen Stellungen verdingt, und nicht als Soldat im Krieg, der ihn durch ein versehrtes Europa treibt. Als W. Jahre später in Leipzig die mittlerweile verwitwete Johanna Woost wiedertrifft, wird es ihm zum Verhängnis. Steve Sem-Sandberg geht in seinem spektakulären Roman dem wahren Woyzeck auf den Grund. Daraus entsteht der Roman eines schicksalhaften Lebens: Woyzeck als Getriebener, als Mensch, als einer von uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Steve Sem-Sandberg
Roman
Aus dem Schwedischen von Gisela Kosubek
Klett-Cotta
Impressum
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »W.« im Verlag Albert Bonniers, Stockholm.
© 2019 Steve Sem-Sandberg. Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
Für die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: © Studio Liljemärker, Sweden
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98119-3
E-Book ISBN 978-3-608-12085-1
Inhalt
Umschlag
Impressum
I. Bei der Untersuchung des Inquisiten
BEI DER UNTERSUCHUNG DES INQUISITEN (1)
BEI DER UNTERSUCHUNG DES INQUISITEN (2)
II. Urteil und Berufung
III. Der Krieg
IV. Der Lichtmacher
V. »Bestie«
W.
BEI DER UNTERSUCHUNG DES INQUISITEN (3)
BEI DER UNTERSUCHUNG DES INQUISITEN (4)
Zitatnachweise
Erläuterungen
Autoreninfo
WOYZECK (vertraulich): Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonn in Mittag steht und es ist, als ging’ die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredt!
DOKTOR: Woyzeck, Er hat eine Aberratio.
WOYZECK (legt den Finger an die Nase): Die Schwämme, Herr Doktor, da, da steckt’s. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnt.
Georg Büchner: Woyzeck
I.
Bei der Untersuchung des Inquisiten
Würden wir eine genaue Studie vom Leben des Patienten vor der Störung seiner Psyche vornehmen, kämen wir vermutlich zu dem Schluss, dass der Grund für das Bersten von Hirn und Blutgefäßen in der verkehrten Weise zu finden steht, in der dessen Leben gelebt wurde, in seinen Exzessen und der moralischen Verwilderung.
Johann Christian August Heinroth: »Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung« (1818)
(Stich, stich die Woostin tot. Stich sie tot, tot!)
Beim Polizeiverhör, das hernach stattfand, konnte er sich nicht erinnern, woher die Worte gekommen waren oder was für eine Stimme sie gesprochen hatte, er sagte nur, es sei gewesen, als packe ihn die Hand eines Riesen bei der Brust und schleudere ihn zu Boden. Und die Kraft dieser Bewegung sei so, ja, wie sollte er sagen, so verstummend gewesen, dass es ihm danach vorgekommen sei, als wäre nicht das Geringste geschehen, als wären die Worte nicht einmal ausgesprochen worden. Er hatte mit Johanna vereinbart, sich an diesem Tag bei der Funkenburg zu treffen. Oder besser gesagt: Er hatte nicht genau gewusst, ob sie etwas vereinbart hatten. Als sie sich zuletzt sahen, war sie zu ihm gekommen, und zum ersten Mal seit Langem hatte sie ihn berührt. Auch hatte sie nach dem Namen eines Soldaten von der Stadtwache gefragt, von dem sie annahm, er kenne ihn, und hinterher hatte er gefragt, ob sie nicht auch einmal mit ihm ausgehen könne, die Abende wären doch jetzt hell und lang. Und sie hatte ihn mit ihren schrägen Wolfsaugen und mit diesem Lächeln angesehen, das sie ihm aus irgendeinem Grund so häufig zuwarf, amüsiert und zugleich etwas mitleidig, wie wenn man ein Kind ansieht, und hatte gesagt, das tue sie gern. Doch hätten sie nichts Bestimmtes vereinbart, sagte er, und die beiden Gendarmen starrten ihn verständnislos an. Der eine war ein dünnhaariger Wachtmeister, der hinter einem schweren Eichenschreibtisch saß, der andere ein bedeutend jüngerer Kollege, schmal und hoch aufgeschossen. Der Jüngere führte das Protokoll, doch statt zu schreiben, saß er nur untätig da, rieb die Daumen aneinander und befeuchtete die Lippen mit der Zunge, als wäre es ihm unbehaglich, im selben Raum mit einem Mann zu weilen, der bei der grausigsten aller denkbaren Taten ertappt worden war. W. blickte auf seine Hände hinunter. Sie zitterten nicht mehr. Das sei der Grund gewesen, sagte er schließlich, weshalb er bereits vormittags bei der Goldenen Gans vorbeigeschaut habe. Er war sich ja nicht sicher, ob sie verabredet hatten, gemeinsam hinzugehen oder nicht, ihr Wort hatte sie ihm ja nicht gegeben. Doch war sie nicht da, als er kam. Auch bei Warnecks war sie nicht oder in der Sandgasse, wo sie bei Frau Wognitz ein Zimmer mietete. Sie musste bereits frühmorgens aufgebrochen sein, oder sie war die Nacht über gar nicht daheim gewesen; das war der Moment, in dem er das erste Mal beschlossen hatte, sich hinzubegeben. Sich wohin zu begeben?, fragte der Wachtmeister. Zur Funkenburg. Dem Gartenrestaurant. Vielleicht hatte sie ja rechtzeitig da sein wollen, um sicherzugehen, einen Tisch in der Nähe der Musikkapelle zu bekommen. Ein paar am alten Brauhaus lungernde Bekannte hatten ihm jedoch mitgeteilt, dass sie früher am Morgen auf dem Brühl gesehen worden war, Arm in Arm mit dem Soldaten Böttcher, und diesen Böttcher kannte er ja schon, diesen großen, stattlichen Kerl, leicht rotgesichtig und mit borstigem Schnauzer und Wangenbart. Er hatte sie bereits mehrmals zusammen gesehen. Einmal waren sie durch Bosens Garten spaziert. Er war in geringer Entfernung an ihnen vorbeigegangen und hatte beschlossen, nicht zu grüßen. Doch was hatte das die beiden gekümmert? Sie waren Arm in Arm gegangen, und Johanna hatte nur Augen für diesen anderen, hatte ihn beim Gehen angelächelt, aber nicht so, wie sie ihn, Woyzeck, anlächelte, wie ein Kind oder einen Zurückgebliebenen, sondern freiheraus, er würde nachgerade sagen wollen dreist, und ganz gewiss war etwas an diesem Lächeln gewesen, was ihn zum Kochen brachte, denn hernach, er wusste nicht, ob noch am selben Abend oder an einem anderen Abend oder sogar erst Wochen später, war er so aufgebracht und verzweifelt gewesen, dass er nicht anders gekonnt hätte, als sie in der Sandgasse aufzusuchen, trotz ihres ausdrücklichen Verbots, und da wusste er freilich nicht, ob es dieser Böttcher war, mit dem sie erneut zusammen war, oder ein anderer, und sehen hat er es auch nicht können, denn Frau Wognitz, bei der sie zur Miete wohnte, schritt mit einem Besen ein und scheuchte ihn die Treppenstufen hinab, und hinterher stand sie am Fenster und schrie so laut, dass es überall im Viertel zu hören war: Jetzt heim mit ihm, Woyzeck, scher er sich heim: Adieu, adieu …! Der Wachtmeister hat nun endgültig die Geduld mit ihm verloren. Er will wissen, wie es sich mit der Mordwaffe verhält. Hatte er sie bereits parat, als er das erste Mal zur Funkenburg aufbrach, also schon am Vormittag? Oder erst, als er verstanden hatte, dass die Witwe Woost sich stattdessen mit diesem Soldaten, wie immer er auch hieß, eingelassen hatte? Wie hieß er noch gleich? Letzteres fragt er seinen Untergebenen, der die gemachten Aufzeichnungen hastig überfliegt und brummelnd antwortet. Böttcher, sagt er und befeuchtet die Mundwinkel mit der Zunge. Oder hat er sich die Waffe bereits früher beschafft? Wenn dem so war, wie war er ihrer habhaft geworden? W. streicht sich mit beiden Händen übers Gesicht. Er kann partout nicht begreifen, warum gerade die Waffe sie dermaßen beschäftigt. Er versucht zu erklären, dass er die Degenklinge seit Langem in Besitz hatte, doch war sie nicht vollständig, es fehlte mehr als die Hälfte, und er bewahrte sie in einem ledergefütterten Stoffbeutel auf, denn sie hatte keinen Griff. Habe er sich also schon in dem Moment zur Tat entschieden, als ihm klar geworden war, dass die Witwe Woost nicht Wort halten würde und stattdessen die Gesellschaft dieses Soldaten, wie hieß er noch gleich, Blechner, vorzog? Aber so ist es nicht gewesen. Ich habe mich nicht entschieden, sagt er so still und gelassen, wie er nur kann. Alles war bereits entschieden, verstehen Sie, Herr Wachtmeister. Es war, als packte mich die Hand eines Riesen bei der Brust, und danach war es, als wäre nichts gewesen. Ich fühlte mich leicht ums Herz, sagt er und starrt auf seine Hände hinab, die gefaltet im Schoß liegen. Sie haben wieder zu zittern begonnen. Auch der Wachtmeister hat die Hände im Visier. Wenn wir also zu den Geschehnissen des aktuellen Tages zurückkehren könnten, sagt er, seinem Kollegen einen bedeutungsvollen Blick zuwerfend. Als Sie also erfahren hatten, dass die Witwe Woost in der Gesellschaft dieses Soldaten Böttcher war, was passierte darauf? Er streicht sich mit den Händen vom Haaransatz über Stirn und Augen bis zu Kinn und Hals hinunter. Sie zittern jetzt noch stärker, der ganze Körper zittert. Er versucht sich zu entsinnen. Die Tage verschwimmen. Eigentlich hatte er in den letzten Wochen keine feste Wohnstatt gehabt, war meist umhergestreift, hatte, wo es möglich war, ein paar Groschen geliehen, hatte geschlafen, wo man ihm Logis gewährte, und an Tagen, wo er nichts gefunden hatte, im Freien. Die Nächte waren schließlich warm und trocken gewesen. Die Geduld des Wachtmeisters ist nun aber ein für alle Mal zu Ende. Habe er sie auch in dieser Zeit bei sich getragen?, fragt er und meint die Degenklinge. Und Woyzeck weiß nicht, was er antworten soll. Das müsse der Herr Wachtmeister doch verstehen, es sammle sich schließlich so einiges an, und die Degenklinge war zwar zerbrochen, aber vielleicht ließ sie sich ja eintauschen, gegen etwas Essbares zum Beispiel. Keinen Augenblick lang habe er sich jedoch vorgestellt, dass sie eine solche Verwendung finden könnte. Und irgendwann habe er überhaupt nicht mehr an sie gedacht. Ich war auf Bekannte aus dem Wirtshaus gestoßen. Der Apotheker war es und der Schlachtergehilfe Bon und Warnecks zwei Lehrjungen. Ich setzte mich eine Weile zu ihnen, weil sie im Schatten saßen, und sie wollten spendieren. Sie waren zu diesem Zeitpunkt also betrunken? Nein, nicht betrunken! Wie soll er es ihnen erklären. Es war, als befände er sich an einem Ort, an dem es keine Gedanken gab. Er erinnert sich an den Wind, der durch die hohen Linden strich, an das Licht, das Blätterschatten über die noch leeren Tische schickte, und an den Boden darunter: das Muster, das die zitternden Blätter bildeten, und wie er sich plötzlich frei fühlt von allem, was sonst stets so drückend und würgend ist. Leer, geradezu schwerelos. Die lastende Schwere anderer Körper, die sich für gewöhnlich überall bewegen, wo er ist, die Stimmen, die Schreie, all das kümmert ihn nicht mehr. Es ist, als schwebte er irgendwo zwischen Schlaf und Wachen, der Leib wie in Dämmer gesunken, gleichwohl ist er so hell und klar im Kopf, dass alles mit der Wahrnehmung ganzer Kraft auf ihn einstürzt; und manchmal hat er gedacht, dieser Zustand sei der einzig wahre. Erst als, was um ihn herum geschieht, ihn nicht länger kümmert, vermag er die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was er wirklich erinnern, woran er wirklich denken will. An Johannas Haut, da, wo sie am verwundbarsten und schutzlosesten ist, hinterm Ohr und hinunter zum Nacken, in der Halsgrube oder zwischen den Schulterblättern. An ihr tiefes, dunkles Lachen, wenn sie ihn langsam in sich einführt. In das Süße, Warme, Feuchte. Das aber kann er ihnen nicht erklären. Er löst seinen Blick vom Wachtmeister, der ihn unablässig fordernd, aber verständnislos anstarrt, und schaut auf seine Hände hinab, die er, die Handflächen nach oben gewandt, im Schoß hält. Die Mörderhände. Sie haben jetzt aufgehört zu zittern. Er erinnert sich, dass das Abendlicht noch lange nach dem Glockenläuten sichtbar blieb, als grüntoniger Kupferschein am Himmel, der von Kirchtürmen und Häuserdächern geschützt wurde. Viele Menschen sind im Freien unterwegs, es ist, als ließen sie sich unmöglich von ihren Schatten trennen. Ausgenommen sie, die keinen Schatten hat. Er sieht sie über den Roßplatz kommen, das grausträhnige Haar vom letzten Abendlicht beschienen. Sie aber geht nicht wie gewöhnlich mit schnellen, resoluten Schritten, es ist vielmehr, als stieße sie wieder und wieder gegen ein unsichtbares Hindernis und wäre gezwungen, seitlich auszuweichen, mit dem Arm in der Luft rudernd. Aber sie ist allein. Ihr Kavalier hat sie offenbar im Stich gelassen, oder er hat bereits bekommen, was er von ihr wollte. Sie läuft mit dem Blick am Boden, ihr Mund ist groß und schief, ein Mundwinkel offen, wie so oft, wenn sie getrunken hat, als wären die Lippen in Ekel und Verachtung erstarrt. Johann, sagt sie, als sie ihn bemerkt, und macht erneut einen stolpernden Schritt zur Seite, doch ohne jede Verärgerung, auch ohne Erstaunen, als fände sie es vollkommen natürlich, ihn hier zu finden. Und in dem Augenblick ist die Degenklinge in ihrem Schaft vergessen, will er dem Wachtmeister erklären. In dem Augenblick hätte er ebenso gut splitternackt vor ihr stehen können, wie er aus dem Schoß seiner Mutter gekommen war, gänzlich rein und unschuldig. Er sagt, er werde sie heimbegleiten, und fasst sie behutsam beim Ellbogen. Und sie protestiert nicht, fügt sich aber auch nicht oder lässt sich gar führen. Dennoch stellt er sich vor, sie würden zusammen gehen, so wie sie einstmals gegangen waren, wie sie gehen sollten, wie er es sich den ganzen Tag während seiner Suche vorgestellt hatte, dass sie gehen würden, untergehakt und einander leicht zugeneigt. Obgleich die Leute über ihn gelacht hatten. Rennst du wieder deinem Luder hinterher? Wo hast du jetzt deine Woostin? Und er sagt nichts davon, dass er sie den ganzen Tag gesucht hat, sagt überhaupt nichts; und alles ist wie zuvor zwischen ihnen, bis sie bei der Sandgasse anlangen und ihren Hauseingang betreten, wo sie mit einer plötzlich wütenden Bewegung ihren Arm an sich reißt, als hätte er versucht, ihn ihr zu stehlen, und mit dem Gesicht dicht vor seinem losschreit: Hör endlich auf, mich überall zu verfolgen! Erst da erinnert er sie an das, was sie gesagt hatte, dass sie versprochen hatte, in seiner Begleitung zum Tanzpavillon zu gehen und nicht mit Böttcher. Er ist ruhig und besonnen, hebt nicht einmal die Stimme. Sie aber schreit ihm weiter direkt ins Gesicht. Er will sie erneut beim Arm fassen, nun, um sie zu beruhigen – sie stehen im Torweg und auf der Straße davor haben Leute angehalten und sich umgewandt, um zu sehen, was geschieht –, als sie sich ihm noch weiter zudreht und mit beiden Fäusten auf ihn einprügelt. Er stehe ihr im Weg. Schreit sie. Er solle Platz machen. Schreit. Noch immer mit dieser schrillen, wahnwitzigen Stimme, die er nicht wiedererkennt. Und als er da die Hand nach der Degenklinge streckt, tut er es noch immer ohne den geringsten Gedanken daran, sie zu benutzen. Er will Johanna nur zur Ruhe bringen. Sie aber schlägt weiter auf ihn ein, heftig jetzt, obendrein ins Gesicht; und macht zugleich Anstalten, jemanden von denen, die auf der Straße stehen geblieben sind, herbeizurufen, damit sie ihr zu Hilfe kommen (wo er ihr doch nie etwas Böses wollte), und da ist es, als vermöge er sich nicht länger zu beherrschen. Sein Griff um den Schaft wird fester, und er dreht die Klinge aufwärts, und als Johanna sich zu ihm beugt, wie um sich an seinen Schultern besser abzustützen, führt er die Klinge mit einem kräftigen Stoß direkt nach oben. Und wenn er dann weiter zustößt, so nur, um die Klinge wieder freizubekommen und Johanna von sich zu schieben. Und ihr Blick wird groß und weit und offen, gleichsam vor Verwunderung, und mit einer vorsichtigen, nahezu vertrauensvollen Bewegung dreht sie Brust und Hals noch weiter auf ihn zu, legt ihm beide Hände auf die Schultern und lässt den Kopf in seiner Halsgrube ruhen. Da will er sie stützen, liebevoll stützen und sie tragen, doch als er ihren langsam sinkenden Leib zu fassen sucht, ist der Mund, den sie dem seinen zudreht, nicht länger ein Mund, sondern nur ein großer Schlund, aus dem dunkles, schwarzes Blut quillt. Er hat Blut auf Brust und Händen. Und draußen auf der Straße spiegelt jedes Gesicht das seine wider, verrät dasselbe Erstaunen, das er verspürt, dieselbe Bestürzung darüber, dass der Leib, den er soeben noch in seinen Armen hielt, nicht mehr die Kraft hat, sich aufrecht zu halten, und zu Boden fällt. Und da lässt sich die Degenklinge nicht länger verbergen. Er blickt auf sie, die anderen blicken auf sie; und er wirft beide Arme in die Luft und geht mit stolpernden Schritten zu ihnen nach draußen, mit einer Art Eindringlichkeit in den Bewegungen, als wollte er eine Erklärung versuchen. Sie aber sehen nur, dass er Johannas Blut an Brust und Armen hat und die Degenklinge noch immer in der Hand hält, und schrecken entsetzt zurück. Und jemand weiter weg schreit: Packt ihn!, und da beginnt er zu laufen, zunächst mit langen, gleichsam zögernden Schritten, dann immer schneller, die Sandgasse hinunter und auf den Roßplatz hinaus. Während die meisten zurückweichen, kommen andere auf ihn zugerannt, er sieht sie aus dem Augenwinkel, hört einen Gendarmen in die Trillerpfeife blasen und weiß, dass er die Degenklinge loswerden muss, und da bemerkt er den Teich und schleudert die Klinge von sich, ohne zu sehen, wo sie landet, und da bekommen sie ihn zu fassen, und es ist endlich vorbei, Frau Woost, seine Johanna, ist tot, die Frau, die er über alles liebt, ist tot, und er war es, der es getan hat, und nun ist sie tot.
Er ist allein in der Zelle, die man ihm gewiesen hat. Licht fällt durch ein vergittertes Fenster hoch oben an der Wand, und am Tag wird die heiße Luft so dick und stickig, dass er sich instinktiv in den Schatten der hintersten Ecke zurückzieht. Dort hockt er Stunde um Stunde, die Beine an die Brust gezogen, und kratzt mit den Fingernägeln an der Zellenwand, bis sie voller Schmutz und Abgeschabtem sind. An der Wand sind die Spuren all derer zu sehen, die vor ihm hier gesessen haben, obszöne Wörter und Zeichnungen, in den Stein geritzt, ohne dass er zu erkennen vermag, was sie bedeuten. Ihm kommt der Gedanke, dass die nackte Zellenwand einem Stück Haut gleicht, das langsam zerfressen wurde, der eigenen Haut der Gefangenen. Viele Stimmen drängen sich hier drinnen, wie auch weiter weg im Gang, wo die anderen Insassen sitzen, in seinem Kopf aber ist alles leer und seltsam klanglos. Auf dem Hof draußen kann er Eimer umkippen und das Rumpeln eines Pferdewagens hören, der durch den Torbogen hereingeleitet wird, kann den Ruf der Fuhrleute vernehmen, das Klirren von Halftern und Ketten, als das Pferd abgezäumt und in den Stall geführt wird. Die Geräusche werden gegen Nachmittag matter, als das Licht in der Zelle verblasst, und als die Dunkelheit hereinbricht, schlummert er, ohne es zu merken, ein und schläft die Nacht hindurch den Schlaf des Erschöpften, leer und ohne jeden Gedanken.
Bei Tagesanbruch, während in der Zelle noch immer ein dünnes, graukörniges Licht hängt, erscheint der Wärter mit dem Frühstück, füllt Wasser nach und leert den Latrineneimer. Das Frühstück besteht aus in einer Kelle Milch aufgelöstem Brot und Kaffee. Er isst und trinkt, ohne nachzudenken, verrichtet seine Notdurft in den stinkenden Eimer in der Ecke und schläft dann von Neuem ein, während das Licht wie durch ein Brennglas über die zerkratzte Haut der Zelle wandert. Als es die Pritsche, auf der er liegt, passiert hat, kommt der Wärter mit dem Mittagessen, einer Schüssel Wassersuppe mit ein paar faserigen Fleischbrocken, dazu erneut Brot. Es gibt mehrere Wärter, zu ihm kommen aber meist nur zwei von ihnen. Der eine heißt Wolf, ein hagerer, gekrümmter Mann, etwas älter, mit spitzer Nase und eingesunkenen Schläfen, der ohne den Blick vom Boden zu heben mit sicheren, geradezu schlafwandlerischen Bewegungen seine täglichen Verrichtungen in W.s Zelle vornimmt. Der andere heißt Conrad und hat ein großes, unbewegtes, offenes Gesicht mit kugelrund starrenden Augen unter kräftigen bogenförmigen Brauen. Das ganze Gesicht wirkt wie aus Holz geschnitzt. Conrad versucht mit ihm auf verschiedenste Weisen ins Gespräch zu kommen. Hat er die Wache in der Früh, hört man ihn schon lange, bevor er die Morgenkost mit schwerem, schlurfendem Schritt hereinbringt, pfeifen, summen und laut vor sich hinreden. Es ist das erste Mal, dass ich das Brot mit einem Mörder teile, sagt er beim Aufschließen der Zellentür. Er will alles wissen, noch das kleinste Detail. Hat das Mordopfer bei der Tat Widerstand geleistet? Und wenn dem so war, mit wie viel Heftigkeit? Sind aus ihrem Mund besondere Worte gekommen, als sie die tötenden Stiche trafen, man habe doch gehört, dass Menschen in ihren letzten Zügen die hellsichtigsten Dinge von sich gaben. Ja, und mit was für einer Art Frau habe er es da eigentlich zu tun gehabt, Woyzeck; alle wüssten doch, wie die Frauenzimmer seien, der Mund sagt das eine, das Herz aber etwas anderes, falls sie überhaupt ein Herz haben und nicht nur einen feuchten Schoß und sündige Gedanken. Woyzeck aber schweigt, er sitzt auf der Pritsche und blickt auf seine Hände hinunter. Die Mörderhände. Sie war das sanfteste und engelgleichste Wesen, das ich kannte, sagt er dann mit flüsternder Stimme. Sie hatte das edelste Herz und einem Armen immer ein gutes Wort oder ein Geschenk zu geben. Conrad schaut ihn mit der ausdruckslosen Miene seines hölzernes Gesichts an. Sollte er eine Meinung zu dieser Sache haben, so sagt er sie nicht, greift nur nach dem Latrineneimer und geht.
Bei seinem zweiten oder dritten Besuch hat Conrad W.s Advokat und Beichtvater im Gefolge. Wohlwollen und Pein, wie er die beiden fortan nennen wird.
Der Advokat und der Pastor sind Brüder, doch sind sie in beinahe allem der Gegensatz voneinander. Advokat Hänsel ist ein flinker und rastloser Mann. Außerstande stillzustehen, läuft er stets leicht vorgebeugt umher, so als drückte sein langer Oberkörper den Rest des Leibes zu Boden, was dem Kopf mit den blinzelnden Augen ein leicht echsenhaftes Aussehen verleiht. Sein Bruder, Pastor Hänsel, ist von Natur aus nicht groß, doch von imposanter Figur, als wären Leib und Seele durch das Amt aufgebläht. Während sein Bruder, der Advokat, das Wort ergreift, den Faden verliert, rastlos von Zellenwand zu Zellenwand marschiert, steht Pastor Hänsel nach wie vor in der Nähe der Tür, als wäre er dort stecken geblieben. Auch sein Gesicht ist stecken geblieben: denn eigentlich lässt nur sein Blick, der zwischen dem Gefangenen (W.) und der Zellentür umherirrt, in deren Luke Conrad noch immer sichtbar ist, das Unbehagen, das er verspürt, erkennen.
Advokat Hänsel dagegen ist voller Zuversicht. Nun sagt er, dass W.s alter Hauswirt, der Zeitungsbote Haase, sich persönlich für ihn eingesetzt habe. Auf dessen Betreiben hin seien Artikel in der Zeitung und Bittgesuche verfasst worden. In seinem unergründlichen Wohlwollen habe Haase obendrein beteuert, nicht nur er, auch mehrere seiner Bekannten und Freunde würden bei Bedarf bezeugen können, dass W. eine von Grund auf ruhige und friedfertige Natur sei, die eine solche Untat unmöglich anders als im Zustand äußerster Umnachtung begangen haben konnte.
Bekomme W. seine Sache nur nüchtern geprüft, würde er erleben, dass sich alles zum Besten fügt!
Während der Advokat all diese Versicherungen abgibt, ist sein Blick bereits woandershin unterwegs. Er schlägt mit dem Arm gegen die Zellentür, um die Aufmerksamkeit des Wärters zu erwecken. Conrads Gesicht aber steckt schon in der Luke, als wäre das Ganze ein Gemälde, das dort seit Jahrzehnten hängt.
Wohlwollen verlässt den Raum, doch Pein bleibt zurück.
Pastor Hänsel schaut ihn mit einem Lächeln an, das nicht groß genug ist, um den Widerwillen, den er empfindet, zu verbergen.
Hänsel (Pastor): Gegen das Unheil, das Sie über sich gebracht haben, vermag ich nichts zu tun, doch kann ich Ihnen vielleicht in Ihrer großen Verirrung beistehen.
W. hält die Hände im Schoß. Als er sie öffnet, spürt er, dass sie zwei klaffenden Wunden gleichen. Was tut man mit seinen Händen, wenn sie zu Wunden geworden sind? Man kann sie zu nichts benutzen, doch kann man sich auch nicht von ihnen befreien. Er sieht Pastor Hänsel an, und sein Blick muss ein Flehen enthalten, denn einen Moment lang scheint es, als würden die starren Gesten des Pastors ein wenig weicher.
Hänsel (Pastor): Ich bin gekommen, um Ihnen in Ihrer großen Verirrung und Unruhe Rat zu erteilen, Woyzeck. Und wenn möglich, Ihre Qualen zu lindern.
(Johanna, Johanna …!)
Hänsel (Pastor): Haben Sie sich einmal die Frage gestellt, wozu Gott Sie bestimmt hat?
Tage, Wochen vergehen auf diese Weise.
Eines Morgens erscheint Conrad in Begleitung zweier anderer Wärter, und Conrad sagt, er, Woyzeck, solle nun wirklich zusehen, dass er sich in den Griff bekomme, denn es warte vornehmer Besuch auf ihn.
Als Conrad spricht, hat er die Lippen zu einem breiten Grinsen verzogen, als meinte er in Wahrheit etwas ganz anderes, und W. durchfährt plötzlich der Gedanke, dass es zu keiner gerichtlichen Untersuchung kommen, dass er nicht einmal ein Urteil erhalten würde, sondern sie sich stattdessen seiner entledigen würden, wie man es mit verletzten und nutzlosen Tieren tut, durch einen Messerschnitt in den Hals oder einen Schuss in den Nacken. Und zum ersten Mal, seit man ihn hierhergebracht hat, spürt er etwas vom alten Zorn in sich aufsteigen, von der Schmach des stets Übervorteilten, der nie für sich selbst sprechen darf, nie Feder oder Papier erhält, um an seine Lieben zu schreiben oder überhaupt für sich einzustehen, bevor er dieses Erdenleben verlässt; und Schuld auszugleichen hat er ja, weiß Gott, genug.
Doch als er das zu sagen versucht, in erster Linie zu Conrad, der dicht neben ihm geht, schlägt ihm dieser hart auf den Kopf und dreht ihm die Arme auf den Rücken. So verbunden stolpern Gefangener und Wärter einen langen Gang hinunter, dann eine Treppe hinauf und in einen Vernehmungsraum hinein. Es dauert einen Moment, bevor er erkennt, dass es dasselbe Zimmer ist, in das man ihn ein paar Wochen zuvor geführt hatte. Diesmal aber ist es angefüllt mit Herren verschiedenster Art. Herr Richter, der Gefängniskommandant, befindet sich im Raum, wie auch die beiden Wachtmeister, die ihn beim ersten Mal verhört hatten. Ein Schreiber steht stocksteif, wie zu Tode erschrocken, hinter seinem Pult. Dann ist da noch der Gefängnisarzt, ein älterer korpulenter Mann mit borstigen Augenbrauen, den die anderen Doktor Stöhrer nennen. Auch Advokat Hänsel ist am Platz, mit seinem langen, ängstlich vorgebeugten Leib und dem flüchtigen Lächeln.
Den Mittelpunkt der Versammlung bildet jedoch keiner dieser Herren, sondern ein älterer Mann, der aufgrund seiner geringen Größe in dem Pulk uniformierter Wärter und Polizisten zunächst kaum auszumachen ist.
Herr Hofrat Clarus ist hier, um Sie zu untersuchen, sagt der Gefängniskommandant Richter, als der Tumult, den seine Ankunft ausgelöst hatte, ein wenig verebbt ist und man ihn zu dieser diminutiven Person gescheucht hat. Sie werden nun gebeten, sich Ihrer Gefängniskleidung zu entledigen. Zwei der Wachposten treten heran, um ihm die Sachen auszuziehen. Als sie ihn berühren, kriecht er instinktiv in sich hinein. Es ist der alte Instinkt, der da erwacht, derselbe, der ihm immer zusetzt, wenn um ihn herum zu viel Bewegung herrscht und er Schläge oder Schelte fürchtet. Urplötzlich kann er niemanden im Raum mehr erfassen, wie Kegel fallen sie aufeinander zu. Er zittert am ganzen Leib, die Wärter aber sind resolut. Während einer seine Hände fixiert, zieht ihm der andere seine fleckigen Beinkleider hinunter und das Hemd über Schultern und Kopf.
Sie haben jetzt einen Kreis um ihn gebildet, und er steht in der Mitte: nackt und zitternd. Wie ein Tier. Manche lachen offen, andere haben ihren Blick schamlos auf seinen Schritt geheftet, gegen den er beide Hände presst. Wieder andere schauen weg, als wäre ihnen sein Anblick in all seiner tierischen Erbärmlichkeit übermächtig geworden.
Der Einzige, der keine Augen für ihn oder überhaupt für irgendjemanden zu haben scheint, ist der diminutive Hofrat. Während der Entkleidung hat Clarus eine große schwarze Tasche mit Messingschloss geöffnet, die vor ihm auf dem Schreibtisch steht, und entnimmt ihr nun ohne sichtliche Eile die unterschiedlichsten Geräte. Dann greift er nach W.s Arm, fühlt ihm den Puls am Handgelenk und seitlich am Hals, blickt ihm in beide Augen, horcht mit einem Rohr an Brust und Rücken auf seinen Atem, drückt und presst, wo immer er kann, auch am Kopf.
Das wär’s, kann Woyzeck jetzt von den Stimmen berichten, die er nach eigenen Worten gehört hat? Mit welchem Ohr hat er sie vernommen?
Lachen im Raum.
Und was war das für eine Art Geräusch, das die Stimmen hervorbrachten?
Von Neuem Lachen, die Männer reden ausgelassen miteinander.
Klang es wie ein Rauschen, oder – ja, wie nun? – irgendwie wässriger …?
Und als er verständnislos wirkt, wiederholt Clarus jedes einzelne Wort, äußerst langsam und mit übertriebenen Gesten, als wäre er in der Tat schwerhörig.
War es mit diesem Ohr hier? Oder war es möglicherweise hier oben?
Er klopft hart gegen den Schädel, über dem linken Ohr, und als W. beide Arme um seinen Kopf schlägt, um sich davor zu schützen, fangen mehrere im Raum zu lachen an. Auch der Hofrat verzieht den Mund, vielleicht ein wenig angestrengt, wie um zu zeigen, dass er die Belustigung verstehen kann, Pflicht und Berufsehre ihn aber hindern, daran teilzuhaben. Als das Lachen verklungen ist, lässt er seine unbedeutende Länge weiter in die Höhe wachsen und räuspert sich mit ernster Miene.
Alle mögen nun den Raum verlassen, damit der Delinquent und ich eine Zeit lang unter vier Augen reden können. Der Schreiber könne bleiben.
Unter fortgesetzter Heiterkeit entfernt sich die Truppe aus dem Vernehmungszimmer, während der Schreiber zurückbleibt, ängstlich und unentschlossen steht er an seinem Pult. Der Hofrat nimmt mit einiger Umständlichkeit hinter dem Schreibtisch Platz und packt all die Untersuchungsgeräte in seine große Tasche zurück. In Reichweite hat er eine kleine Glocke stehen, die über eine Leine mit einer ebensolchen Glocke im danebenliegenden Wachzimmer verbunden ist, sodass er Hilfe herbeirufen kann, sollte der Delinquent gewalttätig werden. Allerdings sieht der Herr Hofrat nicht aus, als fürchtete er, dass so etwas eintreffen könnte. Sein Blick auf W. ist prüfend, nicht neugierig, eindringlich und gleichgültig zugleich. Am Ende zeigt sich in Clarus’ nüchternem Gesicht so etwas wie ein Lächeln. Es gleicht keinem normalen Lächeln, wirkt eher, als risse die Gesichtshaut auf, wodurch eine glatte Zahnreihe sichtbar wird.
Der Inquisit kann sich setzen, sagt der Hofrat und bedeutet W., er möge auf dem Stuhl, den man neben den Schreibtisch geschoben hat, Platz nehmen, und im selben Augenblick, als W. sich setzt, macht sich der Schreiber hinter seinem Pult bereit.
Clarus: Advokat Hänsel hatte die gute Einsicht, mir schon im Voraus mitzuteilen, dass der Inquisit von ruhiger und friedsamer Natur ist. Also im Grunde genommen. Stimmt diese Beobachtung mit der Wahrheit überein?
Woyzeck: Dazu wage ich mich nicht zu äußern, Herr Hofrat. Das müssen andere –
Clarus: Die Tat, die Sie begangen haben, muss also in einem Zustand plötzlich auftretender Besinnungslosigkeit geschehen sein. Sie müssen ganz einfach von Sinnen gewesen sein. Eine Tat von solcher Bestialität zu begehen, ohne auch nur ein Quäntchen Gewissensqualen, obendrein vor aller Augen, lässt sich auf andere Weise schließlich nicht erklären, oder was sagt der Inquisit dazu, vorausgesetzt, er war zu dem Zeitpunkt nicht betrunken, und das, so erklären die beiden Wachtmeister, die Sie ergriffen haben, seien Sie nicht gewesen, jedenfalls nicht mehr als üblich. Ist dem so? Oder standen Sie unter dem Einfluss von Rauschmitteln?
Woyzeck: Nein.
Clarus: Können wir dann ins Protokoll aufnehmen, dass der Delinquent keine Vorstellung davon hat, wie und warum er diese Tat begangen hat, und dass Rauschmittel mit der Sache nichts zu tun hatten?
Woyzeck: (…)
Clarus: Verspürt der Delinquent überhaupt irgendeine Scham oder Reue über die widerwärtige Handlung, die er begangen hat?
Woyzeck: (…)
Clarus: Kann der Delinquent so freundlich sein und mich ansehen, während er seine Antwort gibt.
Wenn es zuvor ein Lächeln in seinem Gesicht gab, so ist es jetzt verschwunden. Er taucht die Feder ins Tintenfass und schreibt. Dann läutet er die Glocke, ohne von seinen Papieren aufzusehen.
Der Wärter ist sogleich zur Stelle.
Clarus: Das war alles. Für heute kann der Delinquent gehen.
Vielleicht aber hat das, was Clarus vermutet, doch seine Richtigkeit. Die Schuld will sich nicht einfinden. Er fühlt sich leer, fast gewichtslos. Es ist eine Erleichterung, sie nicht Tag und Nacht in Gedanken haben zu müssen. Bald aber geht die Erleichterung in ein Gefühl von Unwirklichkeit über. Alles hätte ja auch anders verlaufen können. Er überlegt, wie es gewesen wäre, wenn er sich an jenem Tag nicht auf den Weg gemacht hätte, um sie zu finden, vielmehr an der Funkenburg gewartet hätte, wie er gesagt hatte, es zu tun. Und warum musste er unbedingt einen Griff für diese Degenklinge beschaffen? Und damit obendrein wie ein Narr herumrennen, verhöhnt von denen, die ihn kommen und gehen gesehen und nach ihr fragen gehört hatten, ein ums andere Mal, ohne dass er die geringste Ahnung hatte, wohin er eigentlich wollte und warum. Was wäre passiert, wenn er sich einfach beruhigt hätte und dageblieben wäre? Vielleicht wäre sie dann ja zu ihm gekommen, wie sie früher gekommen war, wenn er nicht zu bestimmen und zu befehlen versuchte. Früher oder später war sie schließlich immer gekommen. Je mehr er über die Sache nachdenkt, desto stärker wird seine Bedrückung. Allein, um dem Würgegriff zu entkommen, mit dem ihn die Angst gepackt hielt, war er wie ein Wahnwitziger umhergejagt, als wäre er eins der Tiere, die der Hetzmeister im Käfig vor sich hergetrieben hatte. Eine lange Stange hatte er besessen, dieser Hetzmeister, versehen mit einem Haken an der Spitze, sodass die desperaten, abgemagerten Tiere keine Chance hatten, ihn zu beißen, und landauf, landab fuhr Henze mit seinem Hetztheater, und überall waren die Leute verlockt, ihre letzten Groschen zu setzen, um die jämmerlichen Tiere in ihren Käfigen herumtigern zu sehen, obgleich alle wussten, dass sie viel zu wirr und ausgehungert waren, um aus eigener Kraft an die so verführerisch platzierte Beute zu gelangen. So hatte man oben in der Funkenburg gewiss auch auf ihn gesetzt, als er mit seiner lächerlichen Degenklingenhälfte durch die Gegend gejagt war. Wird es dem schnaufenden Dummkopf gelingen, sein Luder noch rechtzeitig aufzutreiben?
Er kratzt mit der Hand über die Wand bei dem Versuch, ihr Gesicht ein letztes Mal hervorzulocken. Ihr Bild aber ist weggeätzt, zerschnitten, und er selbst ist es gewesen, der es zerschnitten hat, Stück um Stück, und er schreit seine Pein heraus, wie die ausgemergelte Füchsin, das wichtigste von Henzes Hetztieren, geschrien hatte, als die Falltür sich unter ihr öffnete und sie mit dem Hals in der Klemme saß, während die Schaulustigen, brüllend vor Wut, mit Stangen und Stöcken zwischen die Käfigstäbe stießen, um das arme Tier wieder in Bewegung zu bringen.
Immer in Bewegung, niemals Ruhe.
Da rasselt es im Schloss, und jemand sagt laut seinen Namen. Das erfolgt mit so deutlich klingender Stimme, dass er sie zunächst nicht erkennt, und als er die Augen aufschlägt, erkennt er auch die Zelle nicht wieder, nur das scharfgeschnittene Gesicht des Wärters Wolf, als der sich über ihn beugt, und dessen Hände, die seine fuchtelnden Arme auf die Pritsche pressen.
Können wir ein Licht haben?, hört man eine überraschend tiefe und sanfte Männerstimme von anderswo in der Zelle sagen.
Der Gefängnispastor ist zu dir gekommen, erklärt Wolf und löst seinen Griff.
W. aber hat den Pastor schon am Talar und Hut erkannt.
Hat er hier kein Licht?, fragt der Pastor und tritt näher. Na, dann beschafft ihm sofort eins!
Wolf öffnet die Zellentür, schließt sie hinter sich, und seine schweren, schleppenden Schritte entfernen sich auf dem Gang. W. weiß nicht, welche Tageszeit es ist, ob später Abend oder früher Morgen, und die Ungewissheit erfüllt ihn mit Unbehagen. Wer hat den Gefängnispastor gerufen? Was hat er gesagt oder getan, um diesen Besuch zu veranlassen? Er erinnert sich nicht, und das Seltsame ist, dass er auch nicht weiß, was er vor dem Einschlafen getan hat, ja nicht einmal, wie lange er hier schon festsitzt, es können Tage, Wochen oder Monate sein: Die Zeit hat keinerlei Halt in ihm. Er weiß nur, dass es kalt und die Haut fast taub ist, als er mit den Fingern über sein Gesicht reibt.
Die Schatten an der Wand teilen sich, wie wenn ein Vorhang geöffnet wird, und Wolf tritt mit einem Licht herein. Er hört Stimmen anderer Gefangener, das Klappern von Gefäßen und Besteck. Also muss es früh am Morgen sein. Noch aber ist es draußen nicht hell.
Mein Name ist Pastor Oldrich, sagt der Gefängnispastor mit sanfter, dennoch durchdringend tiefer Stimme. Du weißt es vermutlich nicht mehr, aber du hast nach mir gerufen.
In dem Licht, das Wolf auf den Rand der Pritsche gestellt hat, sieht er nun, dass der Gefängnispastor sehr jung und die Haut seiner glattrasierten Wangen blank und rot vor Kälte ist. Er kann nicht älter als etwas über zwanzig sein, aber er ist hochgewachsen, einen guten Kopf größer als W.
Pastor Oldrich: Ich verstehe, dass dir das, was du getan hast, Qualen bereitet.
W.: (…)
Pastor Oldrich: Niemand wird aus eigenem freien Willen zum Mörder. So etwas würde Gott nie zulassen.
W.: Trotzdem ist es geschehen.
Pastor Oldrich: Vielleicht war es nicht aus eigenem freien Willen, dass du gehandelt hast, wie du es tatest, du warst außer dir, in den Händen von etwas, das du nicht zu beherrschen vermochtest.
W.: Ich habe Unrecht getan, habe gegen das Gesetz verstoßen, das weiß ich.
Pastor Oldrich: Ich spreche nicht vom Gesetz, Woyzeck.
W.: Es war, als packte mich die Hand eines Riesen bei der Brust.
Pastor Oldrich: Du hast gegen deinen eigenen Willen gehandelt, Woyzeck, und in diesem Sinne auch gegen die höhere Vernunft Gottes. Warum sollte Gott etwas anderes für die Geschöpfe wollen, die er selbst erschaffen hat, als das, was klug, anständig und recht ist, wonach auch arme Menschen wie du im Innersten verlangen …? Versuche das zu bedenken, Woyzeck.
W.: (…)
Pastor Oldrich: Gott öffnet seine Arme und verzeiht auch denen, die vom Weg der Vernunft abgekommen sind, verspürst du nur Schuld und Reue genug wegen deines Tuns, ist es keine Schande, das auch einzugestehen. Du bist wohl lesekundig?
Er zieht eine Bibel aus dem weiten Talar, schlägt ihn ohne Umstände beiseite, geht vor der Pritsche auf die Knie und bedeutet W., es ihm gleichzutun. Sprich mir nach, sagt er, und legt den Finger auf die erste Zeile der Seite, die er aufgeschlagen hat. Das flackernde Licht der Kerze blättert im Raum, als wäre auch der ein Buch.
Pastor Oldrich: »Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.«
W.: … Und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Pastor Oldrich: »Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.«
W.: … Und half ihm aus allen seinen Nöten.
Pastor Oldrich: »Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochnen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben.«
W.: … Und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben.
Pastor Oldrich: »Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben.«
W.: … Die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben.
Er hebt den Blick, da er glaubt, die Stunde des Gebets sei vorüber. Der Pastor aber bleibt weiter auf den Knien und drückt die Stirn gegen die Pritsche, und in dem flackernden Licht blickt W. direkt auf dessen entblößten Nacken hinunter. Die Haut unter dem Haaransatz ist seltsam weiß und allzu verwundbar, jetzt, wo er den Hut abgesetzt hat. Einst werde auch ich so knien, entblößt wie er vor Gottes Schwert, denkt W.
Amen, sagt der Pastor und erhebt sich.
Auch W. versucht sich zu erheben. Doch knicken ihm die Beine ein, und er bleibt neben dem jungen Pastor auf den Knien liegen, als würde er ihn um etwas anflehen. Der Pastor lächelt, wie man über den Streich eines Kindes lächelt, fasst ihn mit beiden Händen fest bei den Schultern und stellt ihn zurück auf die Füße.
Pastor Oldrich: Woyzeck, Woyzeck. Es war ja vielleicht nicht gemeint, dass wir hier wie seelenlose Tiere im Staub kriechen sollen! Du warst gewiss auch für Größeres bestimmt, obgleich es so böse mit dir ausging.
Dann macht er das Kreuzzeichen über ihn, und W. steht da, mit gesenktem Kopf, und nimmt den Segen entgegen. Die ganze Zeit hat Wolf in der Zelle gewartet; nun verschließt er die Tür und verschwindet mit Pastor Oldrich auf dem Gang. Inzwischen ist es heller geworden, hell genug, dass die Wände mit ihren zerschnittenen, in den Stein gekerbten Gesichtern von Neuem näherrücken.
Wenige Tage darauf wird er erneut zur Vernehmung geholt. Doktor Stöhrer und Hofrat Clarus befinden sich bereits im Raum, als der Wärter ihn einlässt. Diesmal ist es Stöhrer, der die Untersuchung vornimmt, während der Hofrat reglos hinter dem Schreibtisch sitzen bleibt. Stöhrer misst Puls und Herzschlag, lauscht, im Ohr das lange zylinderförmige Rohr, und tastet ihm den Schädel rundum und am Scheitel ab. Hierauf begibt er sich zum Hofrat und flüstert ihm etwas zu. Clarus macht sich hastig eine oder mehrere Notizen, bedeutet Arzt und Wärter mit einer Handbewegung, den Raum zu verlassen, und Woyzeck, auf dem Stuhl Platz zu nehmen, den der Wärter unter Clarus’ Aufsicht ein paar Armlängen vor dem Schreibtisch postiert hat. Noch immer ohne ein Wort der Begrüßung zeigt Clarus mit dem Federhalter auf die Schnur, die vom Schreibtisch an Wand- und Deckenleisten entlang bis zur Glocke jenseits der Tür verläuft.
Falls der Inquisit Unfug macht, sagt er. Oder auf die Idee kommt, meine Fragen nicht höflich und korrekt zu beantworten.
Clarus’ Art, den Nacken einzuziehen und den Kopf aus dem Kragen zu schieben, lässt an eine kleine Schildkröte denken. Das schrumpelige Gesicht versucht obendrein etwas, das als Lächeln gemeint sein muss, jedoch mehr einer scharfen Wundkante gleicht, hinter der eine Reihe kleiner Zähne sichtbar wird, ebenso grau wie das Gesicht. In überraschend sanftem, nahezu vertraulichem Ton erklärt er, ihr jetziges Gespräch, und auch jedes weitere, sei nicht als Verhör im eigentlichen Sinne zu betrachten, sondern hätte den Zweck klarzustellen, in welchem Gemütszustand sich der Inquisit zum Tatzeitpunkt befand. Der Inquisit soll daher wissen, dass er frisch von der Leber weg reden kann, ohne eine Rüge oder Strafe zu riskieren. Obendrein dürfte es im Interesse beider Seiten liegen, dass Selbiger die näheren Tatumstände so kurzgefasst und deutlich wie nur möglich darlegt.
Clarus: Wie verhält es sich nun mit diesen Stimmen, die der Inquisit, wie bei den beiden Polizeiverhören am 24. und 27. Juni angegeben, gehört haben will? Hat er sie unmittelbar im Anschluss an die Tat oder zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt vernommen?
Der Hofrat schaut ihn mit schräg gehaltenem Kopf und ständiger Falte zwischen den Augenbrauen an, als begegnete er jedem Wort mit Misstrauen, was den Wunsch hervorlockt, ihm zu Willen zu sein und die Sache richtigzustellen. Deshalb sagt W. nun, er hätte an jenem Tag keinerlei Stimmen gehört, und auch zuvor nicht. All das muss ein Missverständnis sein, Herr Hofrat. Es waren so viele Menschen unterwegs, und außerdem gab es da eine Musikkapelle, die spielte, vielleicht nicht gleich, aber späterhin. Und außerdem war es ein heißer Tag, und es ist ja bekannt, dass Stimmen an einem heißen Sommertag weit tragen. Überdies habe er ja viele, die ihn angesprochen haben, gekannt, sagt er und lässt sich weiter über das Thema aus. Obgleich er merkt, dass die Falte auf der Stirn des Hofrats mit jedem Wort, das er äußert, tiefer wird, bis dieser schließlich seine Hand hebt, wie um all die Beredsamkeit abzuwehren.
Clarus: Der Inquisit braucht nicht viele Worte zu machen, er möge nur kurz und ohne Umschweife über die direkten Umstände in Bezug auf diese fremde Stimme berichten.
Woyzeck: Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Clarus: Sie haben beim Polizeiverhör angegeben, eine Stimme gehört zu haben, die sagte [liest]: Stich sie tot, tot!
Woyzeck: Das mag so sein. Ich erinnere mich nicht.
Clarus: Bei welcher Gelegenheit wurden diese Worte gesprochen?
Woyzeck: Ich erinnere mich nicht, Herr Hofrat.
Clarus: Können Sie sich zumindest zu erinnern versuchen, wann Sie diese Stimmen zuletzt vernommen haben?
Woyzeck: Das muss gewesen sein, als ich beim Zeitungsboten Haase lebte. Ich hatte in seiner Bodenkammer wohnen dürfen. Die wurde in der Mitte durch einen Schornstein geteilt, und da klang etwas wie Prasseln von jenseits der Schornsteinmauer.
Clarus: Ewas wie Prasseln?
Woyzeck: Ja.
Clarus: Und kann der Inquisit näher beschreiben, wie sich dieses Prasseln anhörte?
Woyzeck: Wie das Geräusch von Ästen und Zweigen im Wind.
Clarus: Hier am Ohr meint er?
Woyzeck: Ich kann es nicht näher erklären, Herr Hofrat. Es kam wohl ein bisschen von allen Seiten zugleich.
Clarus: Vielleicht glaubten Sie, dieses Frauenzimmer sei auf dem Weg zu Ihnen, diese Chirurgenwitwe, von der Sie früher im Verhör gesprochen haben.
Woyzeck: Nein.
Clarus: Diese Geräusche, Stimmen oder Prassellaute, die Sie nach Ihren Worten gehört haben, war das immer in Verbindung mit Ihren Gedanken an die Witwe Woost, oder gab es das auch in anderen Zusammenhängen? Können Sie in diesem Fall sagen, um welche Zusammenhänge es sich handelte?
Woyzeck: Ich erinnere mich genau, dass einmal eine Stimme sagte: O, komm doch und Deine Zeit ist gekommen.
Clarus: Und wie meint der Inquisit, dass diese Worte gedeutet werden sollen? Als Aufforderung, die Tat zu begehen?
Woyzeck: Nein. Ganz und gar nicht.
Clarus: Als Aufforderung, sich selbst zu entleiben?
Woyzeck: Ich weiß nicht, wie die Worte zu deuten sind. Das ist die reine Wahrheit, Herr Hofrat.
Clarus: Ja, ja. Beruhigen Sie sich. Können Sie so kurzgefasst, wie Ihnen möglich, schildern, wann und unter welchen Umständen Selbiges aufgetreten ist?
Woyzeck: Ich erinnere mich nicht so genau, Herr Hofrat. Es kann ein paar Monate zuvor gewesen sein.
Clarus: Vor was?
Woyzeck: Vor dem, was geschehen ist, Herr Hofrat. Das, was –
Clarus: Sind Sie mit dieser prasselnden Stimme ins Gespräch gekommen?
Woyzeck: Nein, Herr Hofrat, es waren klare und deutliche Weisungen.
Clarus: Auch über das linke Ohr?
Woyzeck: Ja.
Clarus: Können Sie sagen, ob Sie die Sache ausschließlich übers Gehör vernommen haben, oder waren auch Ihre anderen Sinne beteiligt? Wie die Sehkraft, oder auch der Geschmacks- oder Geruchssinn.
Woyzeck: Ich verstehe nicht, Herr Hofrat.
Clarus: Haben Sie gleichzeitig etwas gesehen, als Sie diese Stimmen hörten?
Woyzeck: Ja, das … Ich weiß nicht … Man sieht ja wohl immer Dinge.
Clarus: Nun meine ich diese ganz bestimmte Gelegenheit.
Woyzeck: Ich weiß nicht, ob Herr Hofrat es je bemerkt hat, an manchen Tagen aber ist der Himmel voller Licht, obgleich keine Sonne zu sehen ist.
Clarus [schreibt etwas]: Ist es das, was der Inquisit bei der entsprechenden Gelegenheit wahrnahm?
Woyzeck: Jemand hat mir gesagt, es seien die Freimaurer, dass sie die Macht hätten, die Sonne vom Himmel zu holen, und dennoch sollte es hell sein wie mitten am helllichten Tag.
Clarus: Woher kommen jetzt diese Ideen über die Freimaurer?
Woyzeck: Das sind ja wohl Dinge, die man so hört, von Leuten, denen man begegnet. Einer, bei dem ich in Dienst war, übrigens ein Adelsherr, sagte, sie hätten eine solche Macht, dass sie dir nur eine Nadel ans Herz zu setzen brauchten und schon seist du tot. Mein Vater hat das auch berichtet.
Clarus: Ihr Vater?
Woyzeck: Mein Vater war ein gottesfürchtiger Mann, dessen können Sie gewiss sein, Herr Hofrat, ehrlich und rechtschaffen in allen Dingen; doch meinte er, von den Dienern des Glaubens stets mehr zu fürchten zu haben als von jenen, die nur auf Geld und Kredite sehen.
Clarus: Von der Geistlichkeit meint er? War er gegen die Geistlichkeit?
Woyzeck: Mein Vater meinte, unsere Welt sei so geschaffen, dass es jene gibt, deren Los es ist, sich zu schinden, und andere, die über höheres Wissen und Macht verfügen, dass diese Männer sich jedoch in Geheimbünden zusammenschließen, damit nichts von dem, was sie wissen, zu jemandem durchdringt, der sich dieses Wissens nicht verdient gemacht hat.
Clarus: Wirklich?
Woyzeck: Wenn du die schwarzen Engel über den Himmel kommen siehst, dann ist das das Zeichen, sagte er immer. Eines Tages habe ich das geträumt. Ich befand mich draußen auf einem großen öden Feld, es war gegen Abend, und der Himmel war noch hell; plötzlich aber ertönte so etwas wie ein gewaltiges Rauschen, und zwei schwarze Flügel schlugen über den Himmel, und es war, als würde ein Vorhang vor ein Fenster gezogen, es wurde dunkel wie in der finstersten Nacht, und am Himmel sah man drei glühende Streifen. Der in der Mitte war ein wenig größer als die beiden anderen. Das war das Zeichen.
Clarus: Was für ein Zeichen?
Woyzeck: Das Freimaurerzeichen: mit Gottvater und Jesus Christus und dem Heiligen Geist zu seinen Seiten sitzend. So begrüßen sie einander.
Clarus: Das also soll ein Begrüßungszeichen sein? Möchte er mir nicht zeigen, wie es ausgeführt wird?
Woyzeck: Das wage ich nicht, Herr Hofrat.
Clarus: Aber Sie haben es getan. Insgeheim haben Sie es getan. Zwingen Sie mich nicht, Sie der Unwahrheit zu überführen.
Woyzeck: Ja, ein Mal habe ich es getan, und das nahm dann auch ein furchtbar unglückliches Ende, Herr Hofrat. Es war in Stralsund, nachdem ich mich bei den Schweden hatte rekrutieren lassen. Ich hatte den Befehl, einen gefangenen Soldaten zum Quartier des Ortskommandanten zu bringen, dann sollte ich bis zum Eintreffen des Kommandanten an der Tür Posten beziehen. Da kam mir die Idee, statt des gebotenen militärischen Grußes das Freimaurerzeichen zu machen, um festzustellen, ob der Kommandant Freimaurer war, und als er eintraf … Ich versichere Ihnen, Herr Hofrat, es war nicht ernst gemeint und nicht vorbedacht. Der Kommandant kam an mir vorüber, und wie von selbst fuhr meine Hand nach oben, und ich machte das Zeichen. Einen Moment lang schien es, als wollte der Kommandant mich auf der Stelle zu Boden schlagen. Ich kann Ihnen versichern, Herr Hofrat, in meinem Leben nie so viel Angst gehabt zu haben. Stattdessen aber bat der Kommandant mich hinein, goss mir einen Rotwein ein und sagte, wenn man etwas wisse, müsse man es auf gute Weise sagen. Genau so fielen seine Worte. Anschließend fügte er hinzu, ich solle nun zurückgehen … Am Nachmittag stand Exerzieren auf dem Plan, und als wir damit beginnen sollten, kam der Kommandant, und ich hörte ihn zum Feldwebel sagen, er solle ihn informieren, wenn er anfinge Blut zu husten. Damit meinte er mich, Herr Hofrat; das begriff ich sofort, so wie er mich anstarrte. Und kaum hatten wir mit dem Exerzieren begonnen, spürte ich etwas wie eine scharfe Nadel an mein Herz rühren, und es war, als würde mein Blut im Körper wie in einer Flasche durchgeschüttelt, und dann war mir, als erhielte ich einen Schlag in den Nacken, und von da an erinnere ich mich an nichts mehr, nur, dass mich meine Kameraden ohnmächtig fortgetragen haben. Genau so ist es gewesen, das ist die reine Wahrheit, Herr Hofrat, ich übertreibe nicht.
Clarus aber hört ihm nicht zu. Er hat sich über den Schreibtisch gebeugt und zerrt nun mehrmals kräftig an der Schnur, die hinaus in den Wachraum führt. Dort schrillt die Glocke, und umgehend erscheint ein Wärter in der Tür.
Clarus: Wollen Sie Doktor Stöhrer bitten, hereinzukommen?
Der Arzt ist im selben Augenblick zur Stelle, als hätte er wartend hinter der Tür gestanden. Wieder wird eine große schwarze Tasche geöffnet, und wieder werden ihr Instrumente verschiedener Größe entnommen. W. erhebt sich auf des Doktors Geheiß und legt erneut die Kleidung ab, ohne jedoch zu begreifen, worum es bei dem ganzen Wirbel geht. Schweigen. Doktor Stöhrer horcht ihn mit seinem Rohr ab. Der Hofrat schreibt.
Doktor Stöhrer: An diesem Mann ist nichts zu bemängeln, Herr Hofrat.
Clarus [ohne aufzuschauen]: Na also. Dann kann der Inquisit für heute gehen.
BEI DER UNTERSUCHUNG DES INQUISITEN (1)
Dessen äußere und leibliche Gesundheit betreffend:
Blick, Miene, Haltung, Bewegungen und Rede gänzlich unverändert, Gesichtsfarbe etwas blasser aufgrund des Fehlens von frischer Luft und Bewegung; Atmung, Hauttemperatur und Zunge ohne Beanstandung.
Darüber hinaus versichert der Inquisit, dass sein Schlaf ruhig und friedlich und ohne beunruhigende Träume verläuft, dass er bei gutem Appetit und der Stuhlgang in Ordnung ist. Die beiden letztgenannten Punkte werden auch von Gefängniskommandant Richter bezeugt, der ergänzt, W. habe während seines Aufenthalts in der Zelle kein einziges Mal über Unpässlichkeit geklagt.
Im Gegensatz dazu bemerkte ich, dass das Zittern am ganzen Körper, das ich bereits während der ersten Minuten beobachten konnte, lange anhielt, in Sonderheit, wenn mein Besuch für ihn überraschend gekommen war, und dass Puls und Herzschlag zwar regelmäßig und konstant verliefen, doch nicht nur stärker und schneller erfolgten, sondern dass der Puls, wenn ich ihn im Laufe des Gesprächs untersuchte, weiterhin leicht unruhig blieb und die Herzschläge spürbarer waren und mit größerer Kraft erfolgten als unter natürlichen Umständen. Wurde er hingegen, was ein Mal der Fall war, eine halbe Stunde zuvor von meiner Ankunft unterrichtet, nahm ich derlei Veränderungen in bedeutend geringerem Umfang wahr.
Im Raum ist einzig das kratzende Geräusch zu hören, als Clarus die Schreibfeder über das Blatt Papier führt, sie ins Tintenfass taucht und mit dem Schreiben fortfährt. Dann legt er die Feder in der Federschale ab, sitzt da, die Finger unterm Kinn verschränkt, und sieht W. an, was diesen verunsichert. Was passiert hier gerade? Soll das heißen, er müsse dem Hofrat nun seine Unvernunft bekennen, oder was ist damit beabsichtigt?
An diesem Tag aber scheint Clarus für die Person des W. Interesse gefasst zu haben, und er will Fragen zu seiner Lehrlingszeit stellen. Laut Protokoll sollen Sie eine gewisse Zeit bei einem Perückenmacher namens Stein zugebracht haben. Ist das richtig?
Das war ja, nachdem Mutter gestorben war, sagt er und, gleichsam entschuldigend: Aber aus der Lehre wurde nicht viel, meist musste ich die Kinder hüten.
Und Ihr Vater?, fragt der Hofrat und schabt mit den Fingerspitzen klauengleich über den Tisch, der Mann, der sich gegen die Geistlichkeit auflehnte, ein Taugenichts wie Sie selbst, darf man vermuten!
Ja, was gibt es über diesen Vater zu sagen? Stephan Majorewsky Woyzeck, oder Woyetz, wie er es vorzog, genannt zu werden. Das klang französischer. Und französisch feingliedrig war auch sein Körper, die Bewegungen dagegen waren eher eckig, die Haltung leicht gebeugt, umso stärker, je rascher er ging. Er hatte kleine, schmale, empfindsame Hände, derselben Art, wie der Sohn sie bekommen hatte. Und etwas an ihm, ein zuvorkommender Eifer, der Wunsch, es anderen recht zu machen, weckte nicht nur das Vertrauen der Kunden, sondern sagte auch jenen zu, mit denen er sich zum Zechen traf. Er wurde der Polacke genannt und konnte zuweilen, vom Suff hochrot im Gesicht, mit gräulichen Tiraden loslegen, in der Sprache, mit der er aufgewachsen war und von der sein Sohn nur Bruchstücke beherrschte, einzelne Wörter oder Ausdrücke, wie proszȩ państwa, co u pana słychać und kurwa. (Letztgenanntes war nur einer von vielen Flüchen, die er in unbewachten Stunden von sich gab. Wusste er, andere konnten es hören oder sehen, ließ er sich nie ein gottloses Wort entschlüpfen, da gab es nur Lächeln und in den Augen einen feuchten, schöntuerischen Glanz.)
Der Vater war es, der darauf gedrungen hatte, dass die Kinder in die Schule gingen; für die Mutter war alles, außer den wirklich handfesten Dingen, ohne Interesse. Durch die Vermittlung eines einflussreichen Kunden war es Majorewsky gelungen, seine ältesten Kinder in der Ratsfreischule unterzubringen, am Fuße der Pleißenburg, der alten Festungskaserne. Tag für Tag gehen die Schwester und er gemeinsam zur Schule. Eines Morgens, als sie den Marktplatz überqueren, fällt Schnee senkrecht vom Himmel herunter und erschafft eine Art Säulenhalle um sie. Er ist fast immer furchtsam. Seine Schwester Lotte jedoch nicht, obgleich sie zwei Jahre jünger ist. Für diese Furchtlosigkeit beschenkt er sie mit einer Krone, die er eine knappe Armlänge über ihrem Scheitel schweben sieht. Eine Krone aus Schnee, durchzogen mit gesponnenen Silberfäden.
Sie sitzen allesamt im selben ausgekühlten Klassenraum, mindestens dreißig Kinder verschiedenen Alters, auch Lotte mit ihrer Krone. Ihr Lehrer ist ein junger Mann, ein armer Theologiestudent von der Universität, mit steifen, eiskalten Fingern und heiserer, halb erstickter Stimme, die wie das Knarrren einer Tür klingt, was die Kinder nachzuahmen lieben. Wenn er spricht, steht der Lehrer oft abgewandt da, als würde er sie verachten oder sich seiner selbst schämen, vielleicht auch beides zugleich. Man unterweist sie in Katechismus und Bibellehre. Und immerhin lernen sie leidlich lesen und schreiben.
Sein Verhältnis zu Wörtern und Buchstaben ist allerdings ein wenig seltsam: Für ihn sind sie wie lebendige Wesen. Gleich diesen muss man die Wörter erst dazu überreden, sich zu öffnen und ihre Bedeutung freizugeben, und haben sie es dann getan, bleiben sie wachsbleich auf dem Papier zurück, wie leere Häuser, übrig gebliebene Hülsen von etwas, das es einst gab, aber nicht mehr gibt. Es kam oft vor, dass er die leeren Worthülsen in seinem Bewusstsein herumrückte, unsicher, was er mit ihnen anfangen sollte. Das galt auch für die wenigen polnischen Wörter, die er von seinem Vater gelernt hatte und die ihm später hilfreich sein sollten, da er als Soldat durch die endlosen Sümpfe jenseits der Memel zog, wo sie nichts zu essen fanden und das Wasser, das es zu trinken gab, von verwesenden Kadavern vergiftet war und das Einzige, was half, bei Verstand zu bleiben, darin bestand, die polnischen Wörter in die große Leere hinaus zu singen.
Die Kindheit, erinnert er sich, war die erste Zeit mit diesen geheimen Zeichen. Nicht den Buchstabenzeichen, sondern diesen anderen. Eins der ersten war die Krone, die er seiner Schwester schenkte. Es gibt auch andere: etwa den schwarzen Hut des Schornsteinfegers, ein Zeichen für Gefahr; das Fensterkreuz, dessen langer Schatten sich über den sandigen Hof erstreckt und zu Gottes bleichem Namen wird; die Uhrzeiger am Rathausturm, die Zeit messen, sowohl jene, die mit den Stunden des Tages vergeht, als auch die gefährliche, die rückwärtsläuft; der rote Kamm eines Hahns; die bedrohlich angespitzte Astgabel, die vor der Tür des Abtritts steckt; das blassgeäderte Blumenmuster der Herdkacheln: dünne fasrige Stängel und Blätterstiele, denen seine Finger folgen müssen, wie sie ineinander- und auseinanderlaufen, insbesondere, wenn seine Mutter Feuer gemacht hat und die Silberfäden der Blumen seine Fingerspitzen erhitzen. Fingerblumen. Auch er hat solche. Eine Blume für jeden Finger. Er ritzt Zeichen in die Wand, zieht mit dem Messer Rillen ins Holz oder schabt mit der Ferse Muster in den Sand und Schmutz des Hofes. Er zäunt ein, er schiebt zu, er hakt fest und baut auf. Manchmal denkt er, dass sich sein ganzes Leben als eine Folge von Zeichen lesen lässt. Menschen um ihn herum oder Ereignisse, die eintreffen, werden erst dann wirklich, wenn er ihren Platz in einem Zusammenhang findet, den er zu überblicken vermag. Rücken sie auch nur eine Winzigkeit über den Umkreis seines eigenen Gedankens hinaus, versteht er sie nicht mehr. Für die Schwester ist all das selbstredend gleichgültig. Du hast deine Krone vergessen, ruft er ihr bestürzt hinterher, und Lotte wirft die Krone zu Boden, trampelt auf ihr herum und schreit mit schriller Stimme Idiot, Taugenichts, Esel!, wie sie es den Schulmeister sagen hörte. Doch spielt es keine Rolle, wie viel Schelte er auch bekommt: Die Zeichen sind beständiger als das, selbst beständiger als ihre eigenen Träger, und sie hängen noch lange in der Luft, nachdem der letzte Schlag erteilt wurde.
Wir waren arme Leute, erklärt er Clarus, meine Mutter hatte es nicht leicht mit fünf zu versorgenden Kindern. Auch mein Vater nicht, will er hinzufügen, dessen Hände vom Alkohol mit den Jahren zittrig geworden waren, sodass er Rasiermesser und Schere nicht mehr sicher zu führen vermochte.
Maria Rosina hatte früher daheim Wäsche angenommen, die letzten Jahre aber war sie bei Herrn Rossner angestellt, der obendrein eine Färberei am Grimmaischen Tor betrieb. Wo der Vater weich und gefügig war, gegenüber seinen Kunden oder jeglicher Art von Obrigkeit, da war die Mutter hart und fest, innerlich jedoch gleichsam ausgehöhlt, mit einem Willen, der nie Worte oder äußere Gesten zu Hilfe nahm, dennoch aber unumstößlich blieb. Am deutlichsten erinnert er sich an ihre Hände: von der Lauge verfärbt und schrundig vom jahrelangen Scheuern auf groben Waschbrettern. Rossners Wäscherei war nicht groß, stets aber bestand Eile, vor allem die Weißwäsche zu besorgen, entgegengenommen von vornehmen Herrschaften und Bürgern aus der Innenstadt, und überall herrschte ein Gerenne von Leuten, Packern und Lieferanten, von Wäscherinnen, die Schmutzwäsche sortierten oder mit langen Stäben in Zubern rührten, umgeben von dickem Dunst, bestehend aus Armschweiß und feuchten Wäschedämpfen.
Eines Tages haben Lotte und er der Mutter zur Wäscherei folgen dürfen, er weiß nicht mehr warum. Sie spielen Fangen zwischen Zubern und Frauenbeinen und verstecken sich in Wäschekörben, die Schwester in einem, er in einem anderen. Die Körbe sind mannshoch, im Nachhinein begreift er nicht, wie sie es schafften, dort hineinzuklettern. Es kribbelt im Bauch, denn beide wissen, bald wird jemand kommen, um die noch feuchten Laken zur Mangel zu holen. Rossners Zorn, als man sie schließlich aus den Körben fischt, ist ihm nicht in Erinnerung geblieben, auch all die Prügel nicht, die sie bezogen haben mussten (auch Lotte), ebenso wenig die tränenlose Verzweiflung ihrer Mutter, als Rossner sie vor all den anderen Frauen herunterputzte und sie ihre Anstellung verlor (Man stelle sich das mal vor, die Kinder mitzunehmen, nur um dem Alten die Wäsche zu versauen)