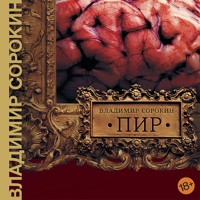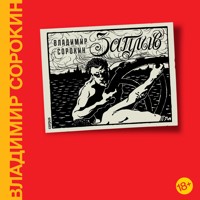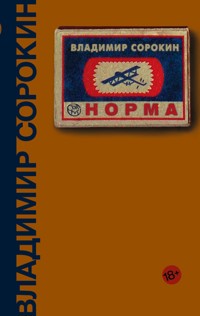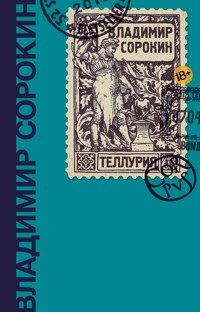Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lauscherlounge
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine erschreckend realistische Dystopie über ein Russland der nahen Zukunft, regiert von einem allmächtigen Diktator. Russland im Jahr 2027: Das Land hat sich vom Westen abgeschottet, lebt allein vom Gas- und Ölexport und wird vom »Gossudar«, einem absoluten Alleinherrscher, regiert. Dieser übt seine Macht mithilfe der Opritschniki, seiner brutalen Leibgarde, aus. »Der Tag des Opritschniks« folgt Andrej, einem Mitglied dieser korrupten Elite, durch seinen Alltag voller Gewalt, Dekadenz und Unterdrückung. Vladimir Sorokins schmerzhafte Satire entwirft eine negative Utopie, die der russischen Gegenwart beunruhigend nahekommt. Das epochale Werk blickt ins Innere jenes schwarzen Knotens, der die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, und tut dies ebenso märchenhaft zeitlos wie hochaktuell. Sorokins Romanvision aus dem Jahr 2006 ist eine schmerzhafte Satire, eine negative Utopie im Sinne von Huxley, Orwell und Burgess. Und das Erschreckende daran ist, dass sie – mit Blick auf das heutige Russland – so überaus realistisch erscheint.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vladimir Sorokin
Der Tag des Opritschniks
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vladimir Sorokin
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vladimir Sorokin
Vladimir Sorokin, 1955 geboren, gilt als der bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller Russlands. Er wurde bekannt mit Werken wie »Die Schlange«, »Marinas dreißigste Liebe«, »Der himmelblaue Speck«. Bei KiWi erschienen zuletzt die Romane »Der Schneesturm«, »Telluria«, die Literaturgroteske »Manaraga« und der Erzählungsband »Die rote Pyramide«. Sorokin ist einer der schärfsten Kritiker der politischen Eliten Russlands und sieht sich regelmäßig heftigen Anfeindungen regimetreuer Gruppen ausgesetzt.
Der Übersetzer
Andreas Tretner, geboren 1959 in Gera, übersetzt aus dem Russischen, Tschechischen und Bulgarischen. Ausgezeichnet mit dem Paul-Celan-Preis (2001) und dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt (2011).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Russland im Jahr 2027. Das Land hat sich vom Westen abgeschottet, lebt allein vom Gas- und Ölexport, pflegt Handelskontakte nur noch mit China und wird vom »Gossudar«, einem absoluten Alleinherrscher regiert. Und wie einst Iwan der Schreckliche übt dieser seine Macht mithilfe der Opritschniki, der »Auserwählten«, aus: einer Leibgarde, die vor keiner Bestialität zurückschreckt und der beinahe alles erlaubt ist.
Die Opritschniki, die »Diener des Gossudar«, sind in roten Limousinen unterwegs, mit Hundeköpfen an den Stoßstangen und Besen am Kofferraum – Symbole dafür, dass jeglicher Widerstand ausgemerzt und von der russischen Erde gefegt wird. Zu dieser brutalen und korrupten Elite gehört auch Andrej. Seinen Arbeitstag beginnt er mit der Hinrichtung eines in Ungnade gefallenen Oligarchen, dann wohnt er der Auspeitschung von Intellektuellen bei, ist der liebestollen Gemahlin des Gossudar zu Diensten und beschließt den Tag mit einer dekadenten Orgie.
Eine hellsichtige und schmerzhafte Satire, die der russischen Gegenwart beunruhigend nahekommt.
»Das epochale Werk blickt ins Innere jenes schwarzen Knotens, der die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, und es tut dies ebenso märchenhaft zeitlos wie hochaktuell.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Den’ opritschnika
© 2006 by Vladimir Sorokin
All rights reserved
Aus dem Russischen von Andreas Tretner
© 2008, 2009, 2022,Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung und -motiv: © Rudi Linn, Köln
ISBN978-3-462-30105-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Förderhinweis
Maljuta Skuratow gewidmet
Immer derselbe Traum: Ich gehe über ein Feld, so endlos groß, wie es sie nur in Russland gibt, sehe weiter vorn ein weißes Pferd, gehe darauf zu und ahne schon, dass es ein besonderes ist, ein Traum von einem Pferd, rassig, schnellfüßig, ein Zauberpferd; ich gehe schneller und kann es doch nicht einholen, lege noch einen Schritt zu, fange an zu rufen, zu schreien, denn auf einmal weiß ich, dieses Pferd ist mein Leben, mein Schicksal, mein Wohl und Wehe, ich brauche es wie die Luft zum Atmen – und ich renne, renne, renne hinter ihm her, während das Pferd ganz gemütlich wegläuft, ohne auf mich oder sonst wen achtzugeben, sich entfernt auf Nimmerwiedersehen, unwiderruflich, da läuft es und läuft und läuft …
Mein Faustkeil weckt mich:
Erst ein Peitschenhieb, dann ein Schrei.
Noch ein Hieb. Ein Stöhnen.
Nach dem dritten Hieb ein Röcheln.
Den Klingelton hat Pojarok in der Geheimen Kanzlei mitgeschnitten, als sie einen Wojewoden aus Fernost folterten. Musik, die einen Toten aufweckt.
»Komjaga«, schnaufe ich, den kalten Faustkeil ans schlafwarme Ohr gelegt.
»Heil Euch, Andrej Danilowitsch. Korostylew am Apparat«, ertönt die Stimme des alten Sekretärs der Auswärtigen Kanzlei, und im nächsten Moment schwebt neben dem Gerät auch sein besorgtes Schnurrbartgesicht in der Luft.
»Was willst du?«
»Ich darf Euch daran erinnern, dass heute Abend der Antrittsbesuch des albanischen Gesandten ansteht. Eine Zwölferkorona ist aufzubieten.«
»Weiß ich doch«, brumme ich missmutig, obwohl es mir, ehrlich gesagt, entfallen war.
»Dann entschuldigt die Störung. Ich tat meine Pflicht.«
Ich lege den Faustkeil zurück auf den Nachttisch. Wie kommt ein Sekretär von der Auswärtigen dazu, mich zur Korona zu vergattern? Ach so, ja … Die Auswärtige richtet neuerdings das Handwaschungsritual aus. Das hatte ich ganz vergessen … Mit noch geschlossenen Augen schwenke ich die Beine vom Bett, bewege den Schädel: Der brummt gewaltig vom gestrigen Abend. Ich taste nach dem Glöckchen und schüttele es. Höre, wie Fedka nebenan von der Pritsche hüpft, hin und her läuft, mit dem Geschirr klappert. Sitze da mit hängendem Kopf, der aufzuwachen sich noch weigert. Es ging wieder heiß her gestern. Und das, obwohl ich mir geschworen hatte, nurmehr mit den eigenen Leuten zu saufen und zu koksen, neunundneunzig bußfertige Verbeugungen habe ich in der Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale vollzogen deswegen und zum Heiligen Bonifazius gebetet. Einen Dreck hat’s geholfen! Aber was soll man machen. Dem Staatsrat Kyrill Iwanowitsch kann ich den Wunsch nicht abschlagen. Er ist schlau. Für weise Ratschläge immer gut. Was ich, im Unterschied zu Pojarok und Siwolai, an Menschen zu schätzen weiß – wenn sie Grütze im Kopf haben. Den allweisen Reden Kyrill Iwanowitschs könnte ich ewig lauschen. Aber ohne Koks macht der nun mal den Mund nicht auf …
Fedka betritt den Raum.
»Heil Euch, Andrej Danilowitsch.«
Ich schlage die Augen auf.
Vor mir steht Fedka mit dem Tablett. Zerknautscht, blöd dreinschauend – sein Morgengesicht. Auf dem Tablett die traditionelle Labung nach durchzechter Nacht: ein Becher heller Kwass, ein Gläschen Wodka und ein halber Becher Sauerkrautbrühe. Den leere ich als Erstes. Es kneift in der Nase und zieht die Kaumuskeln zusammen. Ich atme geräuschvoll aus und kippe den Wodka hinunter. Mir kommen die Tränen, Fedkas Visage verschwimmt. Nun fällt mir das meiste wieder ein: Wer ich bin, wo ich bin und wozu das. Ich warte noch einen Moment, ehe ich vorsichtig durchatme. Mit einem Schluck Kwass nachspüle. Ein Moment verstreicht, der Moment des Großen Innehaltens. Dann rülpse ich laut, aus tiefstem Inneren. Wische mir die Tränen aus den Augen. Und weiß auch den Rest.
Fedka stellt das Tablett ab und kniet vor mir nieder, hält mir den angewinkelten Arm hin. Ich stütze mich auf, stemme mich hoch. Morgens riecht Fedka übler als abends. Das ist die Wahrheit seines Leibes, ihr entkommt man nicht. Da helfen auch keine Hiebe. Ich recke und strecke mich unter Ächzen, trete vor die Ikonenwand, entzünde das Lämpchen, knie nieder. Ich spreche das Morgengebet, verbeuge mich ein ums andere Mal. Fedka steht hinter mir, bekreuzigt sich gähnend.
Als ich mit Beten fertig bin, erhebe ich mich, Fedka hilft mir. Ich gehe ins Badezimmer. Wasche das Gesicht mit dem bereitstehenden Brunnenwasser, auf dem Eisbröckchen schwimmen. Schaue in den Spiegel. Das Gesicht leicht aufgedunsen, die Nasenflügel blau geädert, das Haar zerrauft. Erstes Grau an den Schläfen. Ein bisschen früh für mein Alter. Aber das kommt von der Arbeit, so ist sie nun mal. Der Staatsdienst ist kein Honiglecken …
Ich verrichte meine Notdurft und steige anschließend in den Jacuzzi, schalte das Programm ein und lege den Kopf auf die Nackenstütze, die warm und bequem ist. Mein Blick geht zu dem Gemälde an der Decke: Jungfrauen beim Kirschenpflücken im Garten. Das beruhigt. Ich betrachte die Mädchenfüße, die Körbe mit den reifen Kirschen. Die Wanne läuft voll, das Wasser braust und sprudelt mir um den Leib. Der Wodka von innen und die Luftblasen von außen wecken meine Lebensgeister. Nach einer Viertelstunde hört das Sprudeln auf. Ich bleibe noch einen Moment liegen, dann drücke ich den Knopf. Fedka erscheint mit einem Laken und dem Morgenmantel. Er hilft mir aus der Wanne, wickelt das Laken um mich, hängt mir den Mantel über. Ich gehe ins Esszimmer. Dort ist Tanjuschka schon dabei, das Frühstück aufzutragen. An der gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Verlautbarungsblase.
»Nachrichten!«, sage ich vernehmlich.
Die Blase flammt auf, die blau-weiß-rote Fahne unseres Vaterlandes mit dem goldenen doppelköpfigen Adler erscheint in ganzer Breite, es ertönen die Glocken vom Großen Iwan. Ich schlürfe Tee mit Himbeeren und erfahre, was es Neues gibt: Am Nordkaukasusabschnitt der Südmauer sind neuerlich Kanzleibeamte und Landverweser des Diebstahls überführt worden, die Rohrleitung Fernost bleibt abgeschottet, bis die Japaner uns mit einem Bittgesuch zu Kreuze kriechen, die Chinesen bauen ihre Siedlungen in Krasnojarsk und Nowosibirsk aus, der Gerichtsprozess gegen die Geldschneider aus dem Uralischen Schatzhof dauert an, die Tataren errichten zum Jubiläum des Gossudaren einen raffinierten Palast, die Schlauberger aus der Akademie für Heilkunde kommen mit den Arbeiten am Alterungsgen gut voran, die berühmten Muromer Fiedler geben zwei Kremlkonzerte, Graf Trifon Bagrationowitsch Golyzin hat sein junges Weib erschlagen, für Januar sind auf dem Heumarkt im Hl. Petrograd keine öffentlichen Auspeitschungen vorgesehen, der Rubel ist gegenüber dem Yang wieder um eine halbe Kopeke gestiegen.
Tanjuschka trägt Quarkkeulchen, gedämpfte Rüben in Honig und Kissel auf. Im Gegensatz zu Fedka ist Tanjuschka eine Wohltat für Aug und Nase. Ihre Röcke knistern angenehm.
Der kräftige Tee und der Moosbeerenkissel treiben mir den nötigen Schweiß aus den Poren und bringen mich endgültig wieder auf die Beine. Tanjuschka reicht mir ein Handtuch, das sie eigenhändig bestickt hat. Ich reibe mein Gesicht ab, stehe vom Tisch auf, bekreuzige mich, danke dem Herrgott für das Mahl.
Zeit, an die Arbeit zu gehen.
Der Bartscherer Samson – ein Zugezogener – wartet schon in der Ankleidestube. Ich begebe mich dorthin. Der kleine, stämmige, wortkarge Mann platziert mich ehrerbietig vor dem Spiegel, massiert mir das Gesicht, reibt den Nacken mit Lavendelöl ein. Seine Hände sind mir, wie die aller aus seiner Zunft, unangenehm. Wobei ich grundsätzlich anderer Meinung bin als der Zyniker Mandelstam, wenn er sagt: »Macht ist so widerlich wie Hände von Barbieren.« Nein, Macht hat ihren Reiz, sie ist so verführerisch wie der Schoß einer jungfräulich zarten Goldstickerin. Anders die Hände eines Barbiers … Nicht zu ändern, Weibern ist es untersagt, uns zu rasieren. Samson sprüht mir aus einem orangefarbenen Fläschchen mit der Aufschrift Dschingis Khan Schaum auf die Wangen, den er mit übertriebener Sorgfalt verschmiert, um nicht den schmalen, schönen Kinnbart zu besudeln, greift nach der Klinge, zieht sie schwungvoll ein paarmal am Riemen ab, nimmt, sich auf die Unterlippe beißend, Maß und fängt an, das Weiß in geraden, gleichmäßigen Zügen wieder aus dem Gesicht zu schaben. Ich betrachte mich. Meine Wangen sind nicht mehr die allerfrischesten. In den letzten zwei Jahren habe ich ein halbes Pud abgenommen. Die Schatten unter den Augen sind zur Regel geworden. Wir alle leiden an chronischem Schlafmangel. Die letzte Nacht war keine Ausnahme.
Samson legt das Rasiermesser zur Seite und greift zum elektrischen Apparat. Damit stutzt er geschickt das beilförmige Ende meines Bartes.
»Guten Morgen, Komjaga!«, zwinkere ich mir selbst zu.
Die unangenehmen Hände legen ein heißes, minzegetränktes Tuch auf mein Gesicht. Sorgsam fährt Samson damit über die Haut, reibt, bis mir die Röte in die Wangen schießt, dreht das Haarbüschel auf meinem rasierten Schädel ein, sprüht Lack und anschließend reichlich Goldpuder darüber, zuletzt kommt der schwere goldene Ring mit dem Glöckchen ohne Klöppel ins rechte Ohr. An diesem Ring erkennt man uns. Kein Gemeiner, ob Landvogt, Staatsbeamter, Strelitze, Duma-Bojare, Provinzadliger oder sonst ein Gesindel, würde es wagen, sich ein solches Glöckchen anzuhängen – nicht einmal zum Weihnachtsmaskenfest.
Samson besprüht meinen Schädel mit Wildapfelessenz, verbeugt sich wortlos und geht hinaus – der Barbier hat seine Schuldigkeit getan. Sogleich erscheint Fedka, das Gesicht immer noch in Falten, aber wenigstens schon im frischen Hemd, mit geputzten Zähnen und gewaschenen Händen. Bereit, die Prozedur des Ankleidens an mir vorzunehmen. Ich lege die flache Hand an das Schloss des Kleiderschranks. Das Schloss summt, ein rotes Lämpchen blinkt, die eichene Tür fährt zur Seite. Meine achtzehn Gewänder kommen zum Vorschein. Allmorgendlich ein erhebender Anblick. Heute ist ein normaler Werktag. Also Arbeitskleidung.
»Für alle Tage«, sage ich zu Fedka.
Er nimmt die passende Kluft aus dem Schrank und beginnt mich anzukleiden: zuerst das weiße, mit Kreuzstich verzierte Unterzeug, dann die rote, nach Russenart seitlich zu knöpfende Stehkragenbluse, die Jacke aus gold- und silberdurchwirktem Brokat mit Marderbesatz, dazu Pumphosen aus Samt und die saffianledernen roten Stiefel, mit Kupfer beschlagen. Über die Brokatjacke zieht mir Fedka zu guter Letzt den wattierten Kaftan aus grobem schwarzem Tuch, dessen Schöße weit hinunterreichen.
Nach einem Blick in den Spiegel schließe ich den Schrank.
Beim Betreten des Vorzimmers schaue ich auf die Uhr: 8:03. Die Zeit drängt. Im Vorzimmer warten die, die mir das Geleit geben wollen: meine alte Amme mit der Ikone des Heiligen Georg, des Wundertäters, Fedka mit Gürtel und Mütze. Letztere, aus schwarzem Samt mit Zobelbesatz, beeile ich mich aufzusetzen, lasse mir den breiten Ledergürtel umlegen. An ihm hängt ein Dolch in kupferner Scheide, rechts davon der Rebroff im hölzernen Halfter. Währenddessen schlägt die Amme das Kreuz über mir.
»Andrjuschenka! Die Heilige Gottesmutter, der Heilige Nikola und alle Starzen von Optina mögen dir beistehen!«, ruft sie. Dabei wackelt ihr spitzes Kinn, die tränenden wasserblauen Augen schauen ergriffen. Ich bekreuzige mich und küsse die Ikone des Heiligen Georg. Die Amme schiebt mir das Gebet Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet in die Tasche, das Nonnen des Neujungfrauenklosters in Gold auf eine schwarze Schleife gestickt haben. Ohne dieses Gebet fahre ich niemals zum Einsatz.
»… und gewähre den Sieg über die Feinde«, brummelt Fedka und schlägt sein Kreuz.
Aus der Tür zur guten Stube lugt Anastassija: rot-weißer Sarafan, smaragdfarbene Augen, das blonde Haar über der rechten Schulter. Am tiefen Rot ihrer Wangen kann ich sehen, wie erregt sie ist. Die Augen niedergeschlagen, hat sie sich flink verbeugt, wobei die hohe Brust ins Schaukeln gekommen ist. Nun verschwindet sie wieder hinter dem schweren Eichenrahmen. Diese mädchenhafte Verbeugung erzeugt bei mir im Herzen sogleich eine hitzige Aufwallung. Erst vorgestern in der Dunkelheit des Dampfbades hat sie ihren Schoß für mich geöffnet, ward lebendig unter dem Liebesgeflüster an ihrem Ohr, schmiegte sich an mich in all ihrer jungfräulichen Glut, wisperte so voller Inbrunst, dass das Blut in den Adern kochte …
Doch die Arbeit geht vor.
Und Arbeit gibt es heute wahrlich nicht zu knapp. Der albanische Gesandte hat mir gerade noch gefehlt.
Ich trete hinaus in die Diele. Dort steht das ganze übrige Gesinde versammelt: Stallburschen, Hundeknecht, Koch und Beiköchin, Hausmeister, Wächter und Beschließerin.
»Heil Euch, Andrej Danilowitsch!«, rufen sie und verbeugen sich tief. Ich nicke ihnen im Vorbeigehen zu. Die Dielenbretter knarren. Die geschmiedete Tür wird mir aufgetan, ich trete hinaus auf den Hof. Der Tag verspricht sonnig zu werden, dazu eine knackige Kälte. Über Nacht hat es ein bisschen geschneit: Tannenbäume, Zaun und Wachturm sind wie gepudert. Schnee ist immer gut! Er verhüllt die Scham der Erde. Und die Seele läutert sich.
Gegen die Sonne anblinzelnd, lasse ich den Blick über den Hof schweifen: Speicher, Scheune, Schweinestall, Reitstall – alles gediegen und in Schuss. Der struppige Rüde zerrt an der Kette, die Windhunde im Zwinger hinter dem Haus winseln, im Stall kräht der Hahn. Der Hof ist sauber gefegt, Schneehaufen, akkurat wie Osterbrote. Am Tor steht mein Merin – rot wie mein Hemd, schnittig und blank. Die gläserne Kanzel blitzt in der Sonne. Daneben wartet Timocha, der Pferdeknecht, mit dem Hundekopf in der Hand.
»Bitte um Euer Einverständnis, Andrej Danilowitsch«, sagt er mit einer Verbeugung.
Dabei zeigt er mir den Kopf für den heutigen Tag vor: einen zottigen Wolfshund mit verdrehten Augen, Zunge bereift, kräftige gelbe Zähne. Kommt damit auf mich zu.
»Ist gut. Mach schon!«, sage ich. Geschickt befestigt Timocha den Kopf am Stoßfänger meines Merins. An den Kofferraum kommt der Besen. Ich lege die Hand an das Türschloss, die gläserne Kanzel fährt nach oben. Ich nehme im schwarzen Leder des Liegesessels Platz. Gurte mich an. Starte den Motor. Die hölzernen Torflügel gehen vor mir auf. Ich fahre vom Hof, fege die schmale, schnurgerade Straße entlang, verschneiter alter Fichtenwald zu beiden Seiten. Solch eine Pracht! Ein guter Ort. Ich sehe mein Anwesen im Rückspiegel kleiner werden. Ein anständiges Haus, eines mit Seele. Ganze sieben Monate wohne ich hier, und mir kommt es so vor, als wäre ich hier geboren und aufgewachsen. Früher hat dieses Gut dem Kumpanen eines Geldschneiders aus dem Schatzhof mit Namen Stepan Ignatjewitsch Gorochow gehört. Als der während der Großen Säuberungen in seiner Kanzlei in Ungnade fiel und nackent gemacht wurde, haben wir ihn uns vorgeknöpft. In dem heißen Sommer damals sind im Schatzhof viele Köpfe gerollt. Bobrow mit fünfen seiner Spießgesellen ist in einem eisernen Käfig durch Moskau gekarrt, dann ausgepeitscht und auf der Schädelstätte enthauptet worden. Das halbe Personal wurde der Stadt verwiesen und hinter den Ural verbracht. Es gab viel zu tun … Dem Gorochow haben wir damals, wie es sich ziemte, zuerst die Visage in den Mist gedrückt, dann das Maul mit Banknoten ausgestopft und zugenäht, eine Kerze in den Arsch gesteckt; schließlich wurde er am Gutstor aufgeknüpft. An der Familie durften wir uns nicht vergreifen. Aber das Gut bekam ich überschrieben. Unser Gossudar ist gerecht. Und das ist gut so.
Kurve nach rechts.
Auffahrt auf den Rubljowy Trakt. Eine gute Straße, zehnspurig, zwei Ebenen. Ich wechsle auf die Spur ganz links, die rote. Sie ist uns vorbehalten. Dem Staat. Solange ich am Leben und in Staatsangelegenheiten unterwegs sein werde, ist es meine.
Die anderen Autos, sowie sie den roten Merin eines Opritschniks sehen und den Hundekopf daran, machen Platz. Wie ein Pfeil schwirre ich durch die gute Landluft, gebe Gas. Ein Verkehrsposten grüßt ehrerbietig.
»Radio Russ!«, kommandiere ich laut.
Sogleich erfüllt eine sanfte Mädchenstimme das Innere meines Wagens. »Heil Euch, Andrej Danilowitsch. Was möchtet Ihr hören?«
Die Nachrichten kenne ich schon alle. Ein gutes Lied wäre das Richtige gegen den Kater.
»Singt mir eins. Das von der Steppe und dem Adler.«
»Kommt sofort.«
Zügig setzen die Gusli ein, Schellen rasseln im Takt, ein silberhelles Glöckchen klingt, und das Lied hebt an:
O du wilde Steppe mein,
Freies weites Land,
Fluren ohne Zaun und Rain,
Endlos aufgespannt.
Ist das nicht der stolze Aar,
Der dort droben schwebt?
Ist das nicht der Donkosak,
Der die Peitsche hebt?
Der Rotbanner-Kremlchor singt. Ein kraftvoller, guter Gesang. So schmetternd, dass einem die Tränen kommen. Mein Merin fegt in Richtung Hauptstadt. Dörfer, Landgüter fliegen vorbei. Sonnenlicht gleißt auf den verschneiten Fichten. Die Seele wird entgiftet, rappelt sich, lechzt nach neuen Höhenflügen …
Adler, flieg nur nicht zu tief,
Dass dich fängt ein Schuss!
Gib, Kosak, dem Pferd die Sporen
Nicht zu nah am Fluss!
Gern wäre ich mit diesem Lied bis ganz nach Moskau hineingerollt, doch ein Anruf kommt dazwischen. Posocha ist dran. Seine geschniegelte Fresse erscheint im schillernden Rahmen.
»Hol dich der …«, brummle ich in meinen Bart und stelle das Lied ab.
»Komjaga!«
»Was gibt’s?«
»Schuld und Sühne!«
»Was ist denn?«
»Der Einsatz beim Edelmann war ein Schuss in den Ofen.«
»Wieso?«
»Wir haben die ganze Nacht versucht, ihm was unterzuschieben, er hat nicht angebissen.«
»Seid ihr verrückt? Und wieso gibst du Schwachkopf nicht Bescheid?«
»Wir haben bis zuletzt gehofft, dass es klappt, aber er ist einwandfrei abgeschirmt. Drei Schutzzonen.«
»Weiß der Alte davon?«
»Nö … Sag du’s ihm, Komjaga, ich hab Schiss. Er ist noch wegen der Kleingewerbetreibenden sauer auf mich, da hab ich kalte Füße. Mach du es, dann verbeißt er sich nicht schon wieder in mich.«
Ich rufe den Alten an. Sein breites, rotbärtiges Gesicht erscheint rechts vom Lenkrad.
»Sei gegrüßt, Ältester.«
»Komjaga! Grüß dich. Bist du bereit?«
»Immer bereit, Ältester. Wenn’s nach mir ginge … Aber unser Trupp hat sich dämlich angestellt. Sie kriegen es nicht gebacken, eine Handhabe anzuzetteln bei dem Blaublütigen.«
»Nicht mehr nötig«, sagt der Alte und gähnt. Sein kräftiges, tadelloses Gebiss ist zu sehen. »Den können wir ohne Vorwand abräumen. Der ist jetzt nackent. Aber der Familie wird kein Haar gekrümmt, hörst du?«
»Aha. Alles klar«, sage ich und nicke, schalte den Alten ab und Posocha wieder zu. »Hast du’s vernommen?«
»Hab ich«, sagt er mit erleichtertem Grinsen. »Gott sei’s gedankt!«
»Bedank dich beim Alten, nicht beim lieben Gott.«
»Schuld und Sühne!«
»Und sieh zu, dass du pünktlich bist, Rumtreiber!«
»Bin schon vor Ort.«
Ich wechsele auf den Himmelfahrtstrakt, die H1. Hier steht der Wald noch höher als bei uns. Hundertjährige Fichten, die haben viel mit angesehen. Die könnten was erzählen: von den Roten Wirren und den Weißen Wirren und den Grauen Wirren. Von Russlands Wiedergeburt. Dem Großen Wandel. Unsereins zerfällt zu Staub, entschwebt ins Jenseits, während die stolzen Fichten weiter dastehen werden und schaukeln mit ihren majestätischen Zweigen …
Aber sieh einer an, wie das Blatt sich gewendet hat bei dieser Persönlichkeit! Nun braucht es schon nicht mal mehr eine Handhabe. Erst vorige Woche hat es mit Prosorowski das gleiche Ende genommen, jetzt mit dem da … Unser Gossudar hat sich kräftig verbissen in die feinen Leute. Und das ist gut so. Wenn der Kopf einmal ab ist, braucht man um die Mütze nicht weinen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer ausgeholt hat – der muss zuschlagen!
Vor mir sehe ich noch zweie von uns mit ihren roten Merins. Ich hole auf und bremse ab. Wir fahren in Kolonne. Biegen einer nach dem anderen ab. Nun dauert es nicht mehr lange, bis wir auf das Tor eines Anwesens stoßen. Hier wohnt Iwan Iwanowitsch Kunizyn, der besagte. Acht unserer Fahrzeuge stehen schon davor. Posocha ist da, Chrul, Siwolai, Pogoda, Ochlop, Sjabel, Nagul und Kreplo. Durchweg die alte Garde. Nicht zufällig wird der Alte sie zu diesem Einsatz kommandiert haben. Und recht getan! Kunizyn ist eine harte Nuss. Die zu knacken, braucht es Routine.
Ich stelle den Wagen ab, steige aus, öffne den Kofferraum und hole meinen Holzprügel hervor. Dann gehe ich zu meinen Leuten. Sie stehen da und warten auf einen Befehl. Der Alte ist nicht da, also hört alles auf mein Kommando.
Kurze, sachliche Begrüßung. Ich nehme den Zaun in Augenschein. Eine Kette Strelitzen aus der Geheimen Kanzlei hat sich zu unserer Unterstützung aufgebaut, zieht sich rings um das Anwesen durch den Wald. Auf Befehl des Gossudaren ist es schon seit der Nacht umstellt. Auf dass kein listig Mäuslein entkomme und kein bissig Mücklein.
Doch das Tor der Persönlichkeit hat es in sich. Pojarok schellt an der Pforte und ruft ein ums andere Mal: »Iwan Iwanowitsch, macht auf! Lasst uns im Guten ein!«
»Ohne Regierungsabgeordnete kommt ihr Schlagetots mir nicht auf den Hof!«, schallt es aus der Sprechanlage.
»So wird es nur noch ärger, Iwan Iwanowitsch!«
»Ärger kann’s für mich nimmer werden, Halunke!«
Wo er recht hat, hat er recht. Ärgeres geschähe nur in der Geheimen Kanzlei, und die bleibt Iwan Iwanowitsch erspart. Die Sache ist in unsere Hände gelegt.
Meine Leute sind auf dem Sprung. Es ist Zeit.
Ich trete vor das Tor. Die Opritschniki stehen still. Ich schlage mit dem Knüppel ein erstes Mal dagegen.
»Wehe diesem Haus!«
Dasselbe noch einmal.
»Wehe diesem Haus!«
Und ein dritter Schlag.
»Wehe diesem Haus!«
Nun kommt Bewegung in die Männer.
»Schuld und Sühne! Dran und drauf!«
»Dran und drauf! Dreck am Stecken!«
»Sack und Asche! Dran und drauf! Hopp-hopp!«
Ich klopfe Pojarok auf die Schulter: »Walte deines Amtes!«
Siwolai und er machen sich am Tor zu schaffen, bringen eine Sprengladung an. Alle treten zurück, halten sich die Ohren zu. Ein Knall, und vom großen eichenen Tor kommen die Trümmer geflogen. Prügel voran, springen wir durch die Bresche. Dahinter erwartet uns die Wache des Hausherrn mit ihren Knüppeln. Feuerwaffen anzuwenden verbietet sich von selbst, die Strelitzen ringsum mit ihren Kaltfeuerkanonen hätten im Nu alles niedergemäht. Und ein Gesetz der Duma sieht vor, dass, wer von den Untergebenen sich mit einem Stock in der Hand dem Zugriff zu erwehren weiß, der Gnade des Gossudaren teilhaftig wird.
Wir dringen vor. Das Anwesen ist solide, mit einem geräumigen Hof. Platz zum Ausholen! Die Wachen und das Gesinde harren unser, mit Knüppeln bewaffnet, auf einen Haufen gedrängt. Sie haben drei Kettenhunde dabei, die auf uns losgehen wollen. Sich mit so einer Meute anzulegen, ist ein hartes Brot. Da braucht es ein planvolles Herangehen. Das Staatsamt im gewitzten Handstreich ausüben. Ich hebe den Arm.
»Alle mal herhören! Euer Herr hat sowieso ausgespielt!«
»Wissen wir!«, brüllt die Wache. »Euch werden wir trotzdem die Krallen zeigen!«
»Moment! Lasst uns zwei Stellvertreter wählen! Obsiegt euer Mann, so könnt ihr ungeschoren abziehen mit all eurer Habe. Unterliegt er, so fällt alles an uns.«
Die Wache überlegt.
»Schlagt ein, solange wir es uns nicht anders überlegen!«, rät Siwolai ihnen zu. »Wenn erst Verstärkung eingetroffen ist, putzen wir euch weg, so oder so! Gegen die Opritschnina ist kein Kraut gewachsen!«
Die anderen beratschlagen.
»Na schön!«, heißt es dann. »Womit wird gekämpft?«
»Mit Fäusten!«, antworte ich.
Ein Duellant tritt aus der Meute hervor: so ein Hüne von Stallknecht mit Kürbisgesicht. Wirft den Schafspelz ab, zieht Handschuhe über, wischt sich den Rotz von der Nase. Für diesen Fall sind wir gewappnet: Pogoda wirft Siwolai seinen schwarzen Kaftan in die Arme, zieht sich die Marderfellmütze vom Kopf, legt die Brokatjacke ab, lässt die strammen, rotseiden umspannten Muskeln spielen und zwinkert mir zu, während er nach vorne tritt. Gegen Pogoda ist im Faustkampf selbst der wackere Maslo ein junger Spund. Pogoda ist nicht groß, aber breit in den Schultern, von kernigem Knochenbau, wendig und flink. Einen Treffer in seine glatte Visage zu landen, ist schwer. Von ihm eine gelangt zu kriegen – mittenrein ins Weiche –, umso leichter.
Mutwillig, die Augen spöttisch zusammengekniffen, schaut Pogoda seinem Widersacher entgegen, schwenkt die seidenglänzende Taille.
»Na, was ist, Plumpsack! Bist du bereit für eine Tracht Prügel?«
»Freu dich nicht zu früh, Opritschnik!«
Die beiden Kämpfer umkreisen sich, schätzen einander ab.
Ihre Kleidung, ihr Stand könnten unterschiedlicher nicht sein, sie dienen sehr verschiedenen Herren – und sind doch aus demselben russischen Holz geschnitzt. Zupackende Naturen, wie Russen nun einmal sind.
Wir stellen uns im Kreis um die beiden auf, Seite an Seite mit den Bediensteten. Beim Faustkampf ist das normal. Da sind sich alle gleich, ob Bauer oder Adelsmann, Scherge oder Beamter. Die Faust hat das Sagen.
Pogoda lacht, zwinkert dem Stallknecht zu, lässt seine strammen Muskeln spielen. Und der Kerl kann nicht länger an sich halten, kommt gesprungen, schwingt die bleischwere Faust. Pogoda duckt sich und setzt dem Stallknecht im selben Moment kurz und trocken eine in die Herzgrube. Der japst, hält aber stand. Pogoda tänzelt schon wieder um ihn herum, wiegt die Schultern wie eine züchtige Jungfer, zwinkert, zeigt seine rosa Zunge. Der Stallknecht mag solche Tänze nicht, er grunzt und holt wieder aus. Doch Pogoda kommt ihm zuvor: eine links ans Jochbein, eine rechts in die Rippen – zack! zack! –, dass es knackt. Der bleiernen Faust ist er dabei erneut ausgewichen. Der Stallknecht brüllt auf wie ein Bär, schwingt die Tatzen, von denen die Handschuhe heruntersegeln. Es hilft ihm alles nichts: Er fängt schon wieder eine in den Magen, eine gegen den Rotzkolben: krach! Davon gerät der Bursche ins Straucheln, ein besoffener Tanzbär. Jetzt hat er beide Hände verschränkt, schwingt sie brüllend durch die frostklare Luft wie eine Axt – alles umsonst: Plopp-plopp-plopp! prasseln Pogodas Fäuste auf ihn ein. Die Stallknechtvisage suppt schon, ein Auge ist blau, aus der Nase trieft es rot. Blutstropfen fliegen umher, funkelnd in der Wintersonne wie Rubine landen sie im zertrampelten Schnee.
In der Meute verdüstern sich die Mienen. Meine Männer zwinkern einander zu. Der Stallknecht schwankt, schnieft durch die zerschlagene Nase, spuckt Zahnkrümel. Noch ein Hieb und noch einer. Der Bursche weicht zurück, fuchtelt wie ein Honigbär vor den aufgescheuchten Bienen. Und Pogoda lässt nicht locker: Noch eine! Und noch eine! Hart und zielsicher landen die Schläge des Opritschniks. Meine Männer stoßen Pfiffe aus, frohlocken. Ein letzter, verheerender Schlag, und der Stallknecht fällt um. Pogoda stellt ihm den schicken Stiefel auf die Brust, zieht das Messer aus der Scheide und fährt dem Liegenden damit schwungvoll einmal quer übers Gesicht – ritsch! So muss es sein. Als Lehre. Anders darf man mit ihnen jetzt nicht umspringen.
Mit Blut geht alles wie geschmiert.
Der Kampfgeist der Meute ist erloschen. Der Plumpsack hält sich die zersäbelte Visage, zwischen den Fingern spritzt das Blut hervor.
Pogoda packt das Messer weg, rotzt auf den Besiegten. »Puh! Der blutet ja! Schöne Schweinerei!«, sagt er und zwinkert den Umstehenden zu.
Der Spruch ist bekannt. Es ist unserer. Hat sich so eingebürgert.
Höchste Zeit, einen Punkt zu machen.
Den Knüppel erhoben, rufe ich: »Auf die Knie, ihr Trampel!«