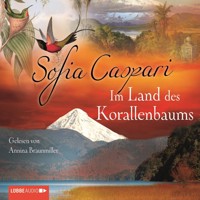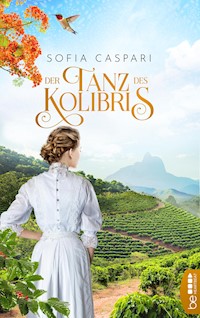
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fesselnde Familiengeschichten vor der farbenprächtigen Kulisse Brasiliens
- Sprache: Deutsch
Hat ihr Glück in der Ferne eine Chance?
Ein Dorf am Rande des Hunsrücks, 1844: Anne und Thomas lieben einander, sehen jedoch als Magd und Knecht des Großbauern Reichard keine Möglichkeit, eine Familie zu gründen. Zudem beginnt Reichard, Anne nachzustellen. Als ein Auswanderungsagent durch ihr Dorf reist und von Brasilien berichtet, beschließen Anne und Thomas, die Überfahrt zu wagen. Doch ihre Ersparnisse reichen zunächst nur für Annes Überfahrt. Sie tritt in die Dienste eines jungen Mannes, der ebenfalls nach Brasilien reist. Doch Anne weiß nicht, welche geheimen Pläne dieser verfolgt und dass dessen Rache ihr eigenes Glück mehr als bedroht.
Eine fesselnde Familiensaga vor der farbenprächtigen Kulisse Brasiliens - für Fans von Sarah Lark und Elizabeth Haran.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Fünfter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Sechster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Achter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin
Im Land des Korallenbaums
Die Lagune der Flamingos
Das Lied des Wasserfalls
Im Tal der Zitronenbäume
Inselglück und Sommerträume
Die kleine Pension am Meer
Der Duft des tiefblauen Meeres
Über dieses Buch
Hat ihr Glück in der Ferne eine Chance?
Ein Dorf am Rande des Hunsrücks, 1844: Anne und Thomas lieben einander, sehen jedoch als Magd und Knecht des Großbauern Reichard keine Möglichkeit, eine Familie zu gründen. Zudem beginnt Reichard, Anne nachzustellen. Als ein Auswanderungsagent durch ihr Dorf reist und von Brasilien berichtet, beschließen Anne und Thomas, die Überfahrt zu wagen. Doch ihre Ersparnisse reichen zunächst nur für Annes Überfahrt. Sie tritt in die Dienste eines jungen Mannes, der ebenfalls nach Brasilien reist. Doch Anne weiß nicht, welche geheimen Pläne dieser verfolgt und dass dessen Rache ihr eigenes Glück mehr als bedroht.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Sofia Caspari, geboren 1972, hat schon mehrere Reisen nach Mittel- und Südamerika unternommen. Dort lebt auch ein Teil ihrer Verwandtschaft. Längere Zeit verbrachte sie in Argentinien, einem Land, dessen Menschen, Landschaften und Geschichte sie tief beeindruckt haben. Heute lebt sie – nach Stationen in Irland und Frankreich – mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Söhnen in einem Dorf im Nahetal.
Sofia Caspari
DERTANZ DESKOLIBRIS
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Landkarte: Reinhard Borner
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Boonyachoat/iStock/Getty Images Plus; Charcom/iStock/Getty Images Plus; MarinaZakharova/iStock/Getty Images Plus; Appreciate/iStock/Getty Images Plus; Jolkesky/iStock/Getty Images Plus; KathySG/shutterstock; DragonFly/iStock/Getty Images Plus; Dewin ’ Indew/iStock/Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2179-0
be-heartbeat.de
lesejury.de
Für meine Männer –
Erster Teil
Traum von der Ferne
Erstes Kapitel
Kreuznach, 1844
Mit seiner breiten Hand packte Reichard in Annes dunklen Haarschopf und riss ihren Kopf brutal zurück. Tränen schossen ihr in die Augen. Anne wollte schreien, doch der Schmerz nahm ihr die Stimme. Lediglich ein hilfloses Gurgeln kam aus ihrem Mund. Über ihren Schädel schienen Hunderte rote Ameisen zu krabbeln.
»Komm schon«, knurrte Reichard und zerrte die junge Frau brutal mit sich.
Nur noch wenige Schritte, fuhr es ihr durch den Kopf, und ich wäre in Sicherheit gewesen, nur noch wenige Schritte, und ich hätte den Hof erreicht. Anne konnte schon die Stimmen der anderen Knechte und Mägde hören. Anweisungen wurden gerufen, Antworten fielen, jemand lachte fröhlich. Übelkeit stieg in ihr auf.
Reichard musste am Rand des Gartens geduldig auf sie gewartet haben, dort, wo Beete und Wald einander berührten. Anne mochte diesen Ort, auch wenn sie immer gewusst hatte, dass es gefährlich war, sich hier allein aufzuhalten.
»Bitte«, flüsterte sie und wusste doch, dass es nichts nützen würde. »Bitte …« Tränen erstickten ihre Stimme. Sie war kaum zu verstehen, so sehr schnürte ihr die Angst die Kehle zu. »Bitte«, flehte sie dennoch ein drittes Mal. Reichard lockerte seinen Griff etwas, aber nicht genug, als dass Anne sich hätte losreißen können. Er zwang sie, ihn anzusehen, ließ es nicht zu, dass sie seinem höhnischen Blick auswich. Seine blassblauen Augen wirkten kühl. »Herr Reichard«, bettelte Anne, »ich tue alles, was Sie wollen, wirklich alles, nur lassen Sie mich …«
»Gewiss tust du das jetzt. Das weiß ich doch.« Reichard grinste. Für einen Moment war es still. Dann fegte ein Windstoß durch das Geäst der Bäume. Anne sah Blätter von einem Ahornbaum zu Boden wirbeln. Es war Spätherbst, der Winter war nicht mehr weit. Reichard beugte sich mit einem Mal ganz nah zu ihr hin, sodass seine Lippen ihr Gesicht berührten. »Glaub nicht, dass du mir dieses Mal entkommst, meine Kleine, dieses Mal nicht.«
Anne versuchte, den Kloß in ihrem Hals hinunterzuschlucken. Sie arbeitete schon seit Jahren für den Großbauern Michel Reichard. Immer wieder war sie ihm knapp entkommen, wenn er sie belästigt hatte, doch heute … Sie hatte einen schrecklichen Fehler gemacht.
Angeekelt wich sie dem kräftigen Mann aus. Er ließ es nicht zu, erfreute sich vielmehr an ihrem hilflosen Kampf. Sie verharrte, starrte ihn nur an. Er leckte sich langsam über die Lippen, einmal, noch einmal. Erneut stieg Übelkeit in ihr hoch. Mit Mühe drängte Anne das Würgen in ihrer Kehle zurück. Dann nahm sie allen Mut zusammen. Sie räusperte sich, um sprechen zu können.
»Thomas wartet auf mich.« Es klang furchtbar zaghaft.
Reichard lachte auf. »Glaubst du das wirklich, meine süße Anne? Nein, deinen Thomas habe ich zu den Berlaus geschickt, dein Thomas kann dir nicht helfen. Heute nicht. Ja, da staunst du, nicht wahr?« Er musterte sie kurz, dann brüllte er vor Lachen. »Ich habe alles bedacht, mein Täubchen, wirklich alles.« Sein Lachen ging in ein Glucksen über. Der nasse Boden machte ein ähnliches schmatzendes Geräusch unter Reichards schweren schwarzen Lederstiefeln. Anne hatte schon gesehen, wie er damit schwächliche Küken zertreten hatte, um sie danach den Hunden vorzuwerfen. Er schien Vergnügen dabei zu empfinden zu zerstören, gar zu töten … Jetzt spuckte er aus. »Und nun komm endlich, Weib, oder soll ich dich an deinen schönen schwarzen Haaren weiterzerren? Ich tue es, glaub es mir.«
Nochmals verstärkte er seinen Griff, nochmals zerrte er an ihrem Haar. Der Schmerz kehrte mit voller Wucht zurück. Anne schluckte den Schrei hinunter.
»Bitte, Herr Reichard, bitte, Sie können mich nicht einfach …«
»O doch, ich kann, denn du bist ein Nichts, Anne, ein Niemand. Du hast keine Eltern, die dich schützen können, keinen Bruder, noch nicht einmal eine Schwester, mein süßes Kind. Und auch dein Thomas ist heute nicht da, um dir zu helfen. Niemand wird auf deine Schreie hören, niemand schert sich um dich.« Wie um seine Worte zu unterstreichen, drehte er die Hand. Anne wimmerte. Ihr Peiniger hörte es offenbar mit Genugtuung. »Du hättest mich damals nicht abweisen dürfen, du kleiner Bastard. Du hättest dich lieber glücklich schätzen sollen, denn solche wie du haben nichts vom Leben zu erwarten. Nichts, hörst du? Deine Eltern wollten dich nicht, sie haben dich ausgesetzt. Ich hätte dir alles bieten können. Ich bin stark. Das wirst du schon noch merken.«
Anne atmete tief durch. Im Garten war es still. Auch die Geräusche im Hof waren weniger geworden, jedenfalls schien es ihr so. Niemand würde ihr zu Hilfe kommen. Aber das hatte sie eigentlich auch nicht erwartet. Sie musste sich selbst helfen. Sie musste auf den geeigneten Moment warten.
Es fühlte sich immer noch so an, als krabbelten Ameisen über ihren Kopf, aber der Schmerz ließ nach.
»Bitte, lassen Sie mich los, Herr Reichard«, sagte sie mit erstaunlich fester Stimme.
Der Ton, in dem sie zu ihm sprach, ließ ihn aufhorchen. Er schaute sie kurz an, lockerte den Griff dann ein wenig.
»Wirst du auch nicht weglaufen?«
»Nein, Herr Reichard.«
Natürlich würde sie nicht weglaufen. Es war sinnlos. Hier konnte sie ihm nicht entkommen. Reichard war ihr zudem körperlich überlegen, er hatte sie in seiner Gewalt.
Warum hatte sie auch die Abkürzung durch den hinteren Teil des Gartens genommen? Sie mochte den Garten, der hier ganz verwildert wirkte, ja, und sie hatte nach ein paar letzten Brombeeren Ausschau halten wollen … Sie war leichtsinnig gewesen. Dafür bezahlte sie nun.
Werde ich Thomas wiedersehen?, schoss es ihr mit einem Mal durch den Kopf. Wo wird Reichard mich hinbringen?
Drei Jahre war es her, seit Reichard begonnen hatte, ihr nachzustellen. Sie erinnerte sich gut, es war ein Jahr nach dem Tod seiner Frau gewesen, nach der Kirchweih, auf der er sich zum ersten Mal wieder fröhlich gegeben hatte. Sie erinnerte sich so gut daran, weil Thomas, Reichard und sie gemeinsam gesungen hatten. Dann war sie vom Besitzer des zweitgrößten Gutes vor Ort sogar zum Tanzen aufgefordert worden. Der große Michel Reichard hatte mit ihr getanzt, und ja, sie hatte sich geehrt gefühlt. Zwanzig war sie damals gewesen.
Wie falsch war das gewesen, wie falsch und dumm.
Sie hatten getanzt, und er hatte gar nicht mehr aufhören wollen, und sie hatte immer noch nicht verstanden. Erst als er am nächsten Morgen im Kuhstall aufgetaucht war, die Augen blutunterlaufen, in der Kleidung vom Vortag, nach Alkohol stinkend – da hatte sie begriffen, doch da war es zu spät gewesen. Dass er noch zu betrunken gewesen war, um seinen Kuss einzuklagen, war damals ihre Rettung gewesen, aber seitdem musste sie auf der Hut sein, immer und überall.
Wo bringt er mich hin?
Zuerst liefen sie einen weichen Waldpfad entlang, dann überquerten sie einen schmalen Bachlauf. Danach war der Weg steinig. Anne wusste nicht, wo sie war. Sie wusste nur, dass Reichard sie tiefer und immer tiefer in den Wald hineinbrachte. Gewöhnlich liebte Anne das weiche grüne Licht, das durch die Bäume fiel, jetzt war sie von nichts als elender Angst erfüllt, Angst, die ihr beinahe die Kraft zum Nachdenken raubte.
Wenn Reichard sie auch nicht mehr an den Haaren hielt, war der Griff um ihr Handgelenk doch umso eiserner. O ja, sie hatte gewusst, dass sie Reichard eines Tages nicht mehr entkommen würde. Was würde ihr geliebter Thomas sagen, wenn sie zu ihm zurückkehrte? Würde sie überhaupt zu ihm zurückkehren können?
Sie versagte sich, darüber nachzudenken, was Reichard genau mit ihr vorhatte. Solche Gedanken lähmten sie nur. Sie musste klar denken, um sich zu retten, so schwer ihr das auch fiel.
Anne schaute sich verstohlen um. Bislang waren sie mehr oder weniger geradeaus gelaufen. Sie kannte den Wald. Sie musste gewiss nur ein wenig nachdenken, dann würde sie sich orientieren können.
Wenn ich weglaufe, muss ich wissen, wo ich bin.
Plötzlich stolperte sie und knickte um. Mit einem Aufschrei ging sie zu Boden. Reichard riss sie hoch.
»Weiter, Dirne. Glaub nicht, dass du mich täuschen kannst. Ich kenne deine Possen.«
Anne unterdrückte ein Stöhnen. Ihr Fuß schmerzte beim Auftreten. Reichard achtete jedoch nicht darauf, er zerrte sie einfach weiter.
Werde ich ihm jetzt überhaupt noch entkommen können?
Anne biss die Zähne aufeinander und bemühte sich, Schritt zu halten, um Reichard nicht noch mehr zu reizen. Vielleicht konnte sie ihn ja doch beschwichtigen …
Der Wald lichtete sich auf einmal. Ein kleines Haus tauchte vor ihnen auf. Erstaunt blieb Anne stehen. Reichard schaute sie forschend und gleichzeitig sehr zufrieden an. Die junge Frau räusperte sich.
»Was ist das?«
»Das kennst du nicht, was? Ich denke, du schweifst dauernd im Wald umher. Bis hierher bist du also nie gekommen?«
Anne schüttelte den Kopf. Reichard lächelte erstmals wieder, auch wenn seine Augen eisig blieben. »Das ist die alte Jagdhütte der Berlaus. Man hat sie gewiss schon mehr als zwanzig Jahre nicht mehr genutzt. Früher sind hier manchmal Feste gefeiert worden, das Jagdvieh lagerte man draußen. Heute haben die Berlaus eine neue Jagdhütte, die kennst du sicherlich.« Anne rieb sich das Handgelenk, das Reichard endlich losgelassen hatte. »Aber ich habe den Schlüssel für die alte Hütte«, fuhr er fort, »und ab und an schaue ich hier nach dem Rechten. Wir wollen ja nicht, dass sich irgendein Pack einnistet.« Er griff nach ihrem Arm. »Denk nicht daran wegzulaufen. Du würdest nicht weit kommen mit deinem verstauchten Fuß.«
Reichard zerrte sie weiter. Anne spürte, wie die Angst sie von Neuem erstarren ließ. Ich muss mich retten, hämmerte es in ihrem Kopf, doch ihr wollte nicht einfallen, wie sie das anstellen sollte. Sie saß in der Falle. Hier tief im Wald würde sie niemand hören, und niemand würde sie finden.
Er kann mich einsperren wie ein Tier und sich mit mir amüsieren. Niemand wird wissen, wo ich bin.
Würde irgendjemand nach ihr suchen? Thomas gewiss. Aber wie sollte er sie finden? Kein Mensch wusste etwas von dieser Hütte. Sie würde einfach verschwinden, wie andere junge Frauen vor ihr spurlos verschwunden waren. Jeder kannte solche Geschichten. Man würde glauben, sie wäre fortgelaufen, so oft hatte sie davon gesprochen, dass sie einmal fortgehen würde.
Sie hatten die Tür der Hütte erreicht. Reichard zerrte Anne die paar Stufen zu der Veranda hinauf, ganz offenbar fand er Vergnügen daran, dass sie Schmerzen hatte und dass sie ihm hilflos ausgeliefert war. Schaudernd blickte sie nach oben, als er auf die Haken wies, wo man einst das Wild zum Ausbluten hatte hängen lassen. Und dann zog Reichard sie in seine Arme. Anne spürte seinen warmen, feuchten Atem. Sein Geruch nahm ihr die Luft. Am liebsten hätte sie ausgespuckt, aber sie wollte ihn nicht reizen.
»Kannst du dir vorstellen, wie es hier nach Blut roch? Weißt du, damals war ich manchmal dabei. Da durfte ich Herrn Berlau zur Jagd begleiten.« Anne sah zu, wie er oben auf dem Türrahmen nach etwas tastete, dann hielt er einen großen Messingschlüssel in der Hand. Er schloss auf, drückte die Klinke hinunter. Knarrend öffnete sich die Tür. Reichard stieß sie hinein. Der kleine Raum war aufgeräumt und sauber. Ein schwerer Tisch mit gedrechselten Beinen stand dort, eine Bank, deren Polster einmal bessere Tage gesehen hatte, ein paar Stühle gab es auch. Sogar ein schmales Bett nebst Decke befand sich in einer Ecke. Daneben ein Schrank. Anne hörte Reichard lachen. »Na, ist das nicht schön hier? Ein wahres Liebesnest, nicht? Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber sei sicher, da regt sich noch etwas in meinen Lenden. Und jetzt setz dich.«
Er deutete auf das Bett. Anne gehorchte. Die Angst war furchtbar quälend, schien unbezwingbar. Ihr Herz trommelte.
»Bitte, Herr Reichard, bitte lassen Sie mich gehen. Ich werde auch niemandem etwas sagen.«
Reichard blickte auf seine Uhr. »Ruhig, ganz ruhig, meine kleine Taube. Ich tu dir doch nichts. Ich lass dir Zeit, ich werde dich doch nicht zwingen. Nein, ich werde noch ein wenig Geduld haben, verstehst du?«
Er schaute sie abwartend an, dann ging er zur Tür. Anne verstand nicht.
»Sie wollen mich hierlassen?«, fragte sie unsicher. »Bitte, Herr Reichard, Sie können mich doch nicht allein hierlassen …«
Reichard grinste. »Und ob ich das kann, meine Schöne. Ich bin mir sicher, du wirst auf andere Gedanken kommen, wenn du nur ein wenig Zeit zum Nachdenken hast. Leider kann ich dir momentan keine Gesellschaft leisten, denn die Pflicht ruft, aber du bist hier ganz sicher. Es wird niemand kommen. Fürchte dich nicht.«
Er beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. Anne war zu erstarrt, um ihn abzuwehren. Dann verließ er die Hütte, der Schlüssel drehte sich im Schloss. Es wurde auf einen Schlag dunkel. Vor den vergitterten Fenstern befanden sich schwere Läden. Nur durch ein paar Ritzen im Holz fiel etwas Licht. Anne sprang auf, öffnete eines der Fenster und drückte den Laden auf. Von draußen war Lachen zu hören, offenbar hatte Reichard diesen Moment abgewartet.
Anne spürte Tränen über ihr Gesicht laufen. Sie weinte und weinte und konnte gar nicht mehr aufhören. Was sollte sie tun? Sie war gefangen.
Thomas entlud den letzten Sack Korn vor der Mühle und lockerte die schmerzenden Schultern. Dann hielt er unwillkürlich inne. Reichard hatte ihm an diesem Tag Aufgaben aufgebürdet, die gewöhnlich von anderen übernommen wurden. Seit dem frühen Morgen war er deshalb auf den Beinen, ohne auch nur einen Augenblick auszuruhen. Sogar das Mittagessen hatte er im Stehen hinuntergeschlungen, um einen dringenden Termin in der nahen Stadt Bingen einhalten zu können. Mühsam hatte Thomas den Namen auf dem Umschlag des Päckchens, das er hatte übergeben müssen, entziffert – Dr. Rath – und sich wieder einmal darüber geärgert, dass er das Lesen und Schreiben nicht besser gelernt hatte. Jetzt, da offenbar alle Aufgaben erledigt waren und er zum ersten Mal nachdenken konnte, fühlte er Unruhe in sich aufkommen.
Wo war Anne? Eigentlich sah er sie tagsüber einige Male. Manchmal zogen sie sich dann hinter eine Hausecke zurück und stahlen sich ein paar Küsse von den Lippen. Am späten Vormittag hatte er sie das letzte Mal gesehen.
So wie Reichard im Übrigen auch. Die Unruhe wurde zu einem unguten Gefühl. Ob Reichard Anne wieder nachstellte, so wie er es immer häufiger tat seit einiger Zeit? Bislang war sie ihm stets ausgewichen, doch war ihr das auch heute gelungen?
Thomas hörte Schritte hinter sich und fuhr herum. Frieder, der kleine Gänsehirte, kam pfeifend um die Ecke, seinen Stab hinter sich durch den Staub schleifend.
»Frieder, hast du Anne gesehen?«
Der Junge schüttelte den Kopf, und Thomas fluchte leise. Er ließ die Gedanken schweifen. Hinter der Mühle erhob sich Gut Berlau vor der untergehenden Sonne. Das größte der Gehöfte dieser Gegend schien dem umliegenden Land immer ein wenig Licht zu stehlen. Obwohl sie so nah beieinanderwohnten, sahen sich die Reichards und die Berlaus nur selten. Dort war Anne also ganz sicher nicht.
Thomas entschied, zum Reichard-Gut zurückzulaufen. Ohne es zu merken, beschleunigte er sehr bald den Schritt. Als er atemlos den Torbogen erreichte, sah er zwei Mägde vor dem Haupthaus sitzen. Eine rupfte ein Huhn für Reichards Abendessen, die andere las Erbsen. Er fragte beide, aber sie hatten Anne nicht gesehen. Sie war auch nicht im Stall, wo sie sich um diese Zeit oftmals aufhielt, und nicht in der Kammer, die sie sich mit Angelika teilte.
Als Thomas Anne auch im Garten nicht fand, kroch Verzweiflung in ihm hoch. Wenig später rief bereits die große Glocke zum Abendessen, und er musste seine Suche unterbrechen. Knechte und Mägde versammelten sich um den Tisch, an dem sie ihre Grütze aßen. Michel Reichard kam vorbei, um einen gesegneten Appetit zu wünschen. Thomas spürte seinen Blick auf sich … Oder bildete er sich das nur ein?
Als er den Kopf hob, sah er, dass er sich nicht getäuscht hatte. Reichard grinste ihn herablassend an. Mit einem Mal war Thomas sicher, dass der alte Gutsbesitzer etwas mit Annes Verschwinden zu tun hatte, aber da war nichts, was er tun konnte. Er konnte ihn nicht einfach beschuldigen, er hatte keinen Beweis. Es blieb ihm nur abzuwarten, bis Reichard einen Fehler machte, bis er Thomas darauf brachte, wo Anne war. Doch Reichard verließ das Gut den ganzen Abend nicht mehr.
Anne beobachtete, wie das Licht immer mehr abnahm. Die Geräusche des Waldes veränderten sich. Eine Zeit lang horchte sie auf Schritte, doch da war nichts. Draußen war es still. Nur ein Knacken hier, ein Fiepen dort, das Rascheln von Blättern, der Ruf einer Eule. Sie legte sich auf das Bett. Eine Weile versuchte sie, wach zu bleiben. Dann irgendwann schlief sie erschöpft ein.
Als sie fröstelnd wieder erwachte, stand der Mond hoch am Himmel. Anne kroch unter die Decke, die erstaunlich frisch nach Kräutern duftete. Rasch schloss sie die Augen wieder. Sie durfte nicht zulassen, dass ihre Gedanken Karussell fuhren.
Am frühen Morgen wachte sie erneut auf. Graues Licht sickerte durch das kleine Fenster in die Hütte. Sofort fiel ihr wieder ein, was geschehen war. Anne erhob sich und begann unruhig, auf und ab zu laufen. Dann durchsuchte sie die Hütte nach etwas Brauchbarem, vielleicht einem Ersatzschlüssel oder Werkzeug, aber da war nichts. Der einzige Schrank war verschlossen, selbst durch Rütteln ließ er sich nicht öffnen. Was sollte sich auch darin befinden?
Anne fluchte leise. Es musste doch eine Möglichkeit geben, zu entkommen. Es war ganz ausgeschlossen, dass sie hier wartete wie ein Tier in der Falle, bis Reichard sie zwingen konnte, ihm zu Willen zu sein.
Sie tastete alle Fenster und die Fensterläden ab. Sie rüttelte an der Tür, an den Gitterstäben. Doch die standen zu eng beieinander, noch nicht einmal der schmale Frieder würde hindurchpassen. Unter dem Bett und in der Bank – man konnte sie aufklappen – war ebenfalls nichts. Es gab keinen Hinterausgang, keine Holzbohlen im Boden, die man herausnehmen konnte, keinen rettenden Einlass zu einem Geheimgang, von dem man vielleicht als Kind träumte.
Anne hatte sich gerade an den Tisch gesetzt, um noch einmal nachzudenken, als sie draußen Schritte hörte. Äste knackten, Blätter raschelten. Die junge Frau schaute sich panisch um, dann fiel ihr das Einzige ein, was sie tun konnte – sie musste sich verstecken. Vielleicht würde Reichard glauben, dass es ihr gelungen war zu fliehen. Vielleicht würde es ihn lange genug verwirren, damit sie tatsächlich durch die Tür entkommen konnte.
Rasch kroch sie unter das Bett. Der verletzte Fuß schmerzte nur noch leicht, Anne war überzeugt, dass ihr allein der Wille zu entkommen die nötigen Kräfte verleihen würde, es zu schaffen.
Sie versuchte, ganz ruhig zu liegen, und spähte zur Tür. Das Bett war das einzig mögliche Versteck. Anne hoffte, dass Reichard nicht als Erstes daran dachte und den Ausgang so verstellte, dass eine Flucht unmöglich war. Die Hoffnung, es zu schaffen, war groß, obwohl sie wusste, dass kaum eine Chance bestand, aber Anne wollte nicht aufgeben. Noch nicht.
Sie ballte die Hände zu Fäusten, lockerte sie dann wieder. Die Schritte draußen waren jetzt auf den Stufen zu hören. Irgendetwas war anders, war seltsam, sie wusste nur nicht, was. Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Die Tür schwang auf. Anne hätte am liebsten die Augen geschlossen, zwang sich jedoch, sie offen zu halten.
Jemand kam herein, und es war nicht Reichard. Die Person blieb vor dem Fenster mit dem offenen Laden stehen. Dann ging sie weiter und öffnete noch einen weiteren Laden. Als sie sich setzte, kam ein blaugrauer Rock in Annes Blickfeld, feine geschnürte Lederstiefel, eine Frau mit langem hellbraunem Haar, das seitlich zu einem Zopf geflochten war.
Die Tochter vom alten Berlau …
Anne bemühte sich, langsam und vorsichtig unter dem Bett hervorzukommen, damit sich die Dame nicht erschreckte, aber es gelang ihr nicht ganz. Mit einem zarten Schrei sprang Lydia Berlau von ihrem Stuhl auf und wich zurück. Sie starrte Anne an, die großen grünen Augen weit aufgerissen, den Mund leicht geöffnet, dann fing sie sich. Von einem Moment auf den anderen wirkte ihr Ausdruck verschlossen.
»Was machst du in unserer Jagdhütte?«, fragte sie spitz.
»Michel Reichard hat mich versehentlich hier eingeschlossen«, antwortete Anne, bevor sie auch nur einen Augenblick nachdenken konnte. Sie sah, wie Lydia Berlau eine Augenbraue hob, dann schaute sich die Gutsbesitzerstochter in der Hütte um, so genau, als wollte sie sich jedes Detail des Raumes einprägen. Anne schlang unwillkürlich die Arme um den Leib. »Ich würde dann gern gehen«, wagte sie endlich zu sagen.
»Gehen? Und wohin?«
»Ich … ich bin Anne Klosterfeld. Ich … ich gehöre zu Reichards Gut.«
Warum wollte Lydia Berlau wissen, wohin sie gehörte?
Das schöne, klare Gesicht Lydia Berlaus zeigte keine Regung. Einerseits wirkte sie noch recht jung, andererseits war da etwas Verhärmtes in ihrem Ausdruck. Sie hatte einen Sohn, der mit ihr auf dem Gut ihres Vaters lebte, ihr Mann war, wie manche erzählten, nach einem tragischen Unfall verstorben.
»Ich … ich war die ganze Nacht hier«, stammelte Anne weiter. »Man wird mich vermissen.«
»Die ganze Nacht warst du hier?« Lydia Berlau tauchte kurz aus ihren Gedanken auf. »Ja, geh nur«, sagte sie dann.
Ihre Stimme wirkte plötzlich müde, der Tonfall klang abweisend. Anscheinend wollte sie allein sein.
Anne zögerte nicht. Sie war gerade vor die Tür getreten, als Reichard zwischen den Bäumen erschien. Er sah kurz überrascht aus, dann beschleunigte er seinen Schritt. Anne hörte Lydia Berlaus Schritte hinter sich. Der jungen Frau stockte der Atem.
Hatte sie sich geirrt? Waren die beiden womöglich auf einer Seite?
Fünfundzwanzig Jahre zuvor …
Severin zog die fröhlich lachende Lydia hinter sich her. »Warte, warte doch«, beschwerte sie sich, »ich kann nicht so schnell.«
»Du musst, du musst einfach, ich will nicht mehr warten.« Dann hielt er doch an und nahm sie fest in seine Arme. »Wie lange musste ich dich entbehren, meine Schöne, wie lange haben wir uns nicht gesehen?«
»Du bist albern.« Lydia lachte wieder. »Gerade mal zwei Stunden! Treib keine Scherze mit mir, Severin Hellmann.«
Severin schaute die junge Frau ernst an, dann strich er ihr über das Haar, legte endlich eine breite, kräftige Hand auf ihren Hinterkopf, liebkoste mit der anderen ihre Wange.
»Wenn du nicht da bist, sind Sekunden Minuten und Minuten Stunden. Das weißt du doch.«
Sie küssten sich.
»Du bist wirklich verrückt«, stieß Lydia zwischen weiteren Küssen hervor.
»Für dich gern.« Severin zog sie weiter mit sich. »Komm mit. Ist nicht die Jagdhütte deines Vaters in der Nähe?«
»Ja«, Lydia streckte die Hand aus, »dort entlang. Ich war lange nicht mehr da. Ich hasse die Jagd zu sehr.«
Wieder blieb Severin stehen, wieder streichelte er sie.
»Meine wunderbare, süße Lydia, wenn du willst, dann gehe ich niemals wieder jagen. Niemals …«
Sie reckte sich zu ihm hoch, um ihn zu küssen. »Geh niemals wieder jagen, Severin, ich bitte dich.«
»Ich verspreche es dir.«
Sie schauten sich ernst an und reichten einander die Hände.
Über einen Waldpfad ging es weiter. Severin hob die junge Frau über eine Wurzel hinweg, als wäre sie lediglich eine Feder. Sie erreichten die Lichtung mit der Jagdhütte, die jetzt, zur Mittagszeit, in der prallen Sonne stand.
Lydia dachte an ihren Vater, der sie in kaum einer halben Stunde zum Essen erwartete. Wenn sie zu spät kam, würde sie seinen Zorn auf sich ziehen, aber jetzt, da sie mit Severin zusammen war, war ihr das gleichgültig. Sie bemerkte, dass er sie ansah.
»Was ist, Severin?«
»Ich würde dich so gern noch einmal küssen.«
»Dann tu es doch.«
Er beugte sich vor. Seine Lippen berührten ihre Wange.
»Hier möchte ich dich küssen.« Sein Mund wanderte über ihr Gesicht, küsste ihre Schläfe, dann ihr Haar. »Hier und hier und hier.« Er streifte ihr Haar vom Hals zurück und küsste sie dort, dann liebkoste er ihren Nacken. Ein Schauder durchfuhr Lydia.
»Was hast du, mein Herz? Soll ich aufhören?«
»Nein, o nein, es ist schön. Mach weiter.«
Der junge Mann ließ sich das nicht zweimal sagen. Eigentlich wusste sie, dass er aufhören, dass sie ihn aufhalten musste, aber es war zu köstlich. Wieder hielt er ihr Gesicht umfangen. Seine Hände lagen auf ihrer weichen Haut, rau und doch wunderbar. Er küsste sie auf den Mund, liebkoste ihre Lippen. Im nächsten Moment wanderte eine Hand über ihren Rücken bis zu ihrem Gesäß, das unter dem Stoff ihres Kleides sicherlich kaum zu spüren war. Er griff fest zu. Sie stellte sich vor, wie es sein würde, sich auszuziehen, nackt vor ihm zu stehen. Sie wünschte es sich und hatte zugleich wahnsinnige Angst davor. Sie musste irgendein Geräusch von sich gegeben haben. Er löste sich von ihr.
»Ich werde dich zu nichts zwingen, teure Lydia.«
Sie nickte. Sie wollte es, sie wollte die Vereinigung mit ihm, wollte jedoch nichts erzwingen, solange sie Angst hatte. Wie auf ein geheimes Wort hin, das nur sie beide hören konnten, sahen sie zur Jagdhütte.
»Lass uns hineingehen«, schlug er vor.
»Ja«, wisperte sie.
Sie zeigte ihm, wo der Vater den Schlüssel versteckte. Er schloss auf und hielt ihr die Tür auf. Dann folgte er ihr ins Innere. Lydia sah zu, wie er sich umblickte, Tisch und Stühle ansah und das schmale Bett in der Ecke.
»Ein Bett?«
»Mein Vater übernachtet hier manchmal.«
Lydia ging zu dem Schrank, der sich an der Wand gegenüber der Tür befand, und probierte, ob er sich öffnen ließ. Er war unverschlossen. Ein Buch lag darin, ein Kasten mit Kerzen, ein Feuerzeug. Sie nahm das Buch und schlug es auf.
»Er war vor einem Monat das letzte Mal hier«, merkte sie an, nachdem sie es studiert hatte. »Das ist recht lange her.«
Severin trat an ihre Seite und schaute der jungen Frau über die Schulter. »Er schreibt auf, wann er hier war?«
»Ja.« Lydia zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, warum.«
Sie schwiegen eine Weile.
»Das ist ein guter Ort«, sagte Severin dann und hielt ihr die Hand hin. »Komm, lass uns dennoch gehen, deine Eltern und Hanno warten sicher schon. Du sollst keinen Ärger bekommen.«
»Für dich stehe ich alles durch.«
»Du musst nichts durchstehen für mich, bitte, sag so etwas nicht.«
»Aber ich will es, Severin, du bist meine Liebe, mein Herz, mein Seelenverwandter.«
Severin küsste sie noch einmal, dann machten sie sich auf den Weg. Lydia wusste, dass sie an diesem Tag beinahe ihre Unschuld verloren hätte. Nicht an den Mann, den ihr Vater für sie ausgesucht hatte, sondern an den, den sie liebte. Es war nicht dazu gekommen, und doch hatten sie den ersten Schritt auf diesem Weg getan.
Zweites Kapitel
»Pünktlichkeit ist eine Tugend.« Erich Berlau schaute die Tochter unter seinen buschigen Augenbrauen hervor wütend an. »Aber offenbar zählt das heutzutage nicht mehr. Dein lieber Sohn Wilhelm ist auch noch nicht da, dabei hat er wenig genug zu tun. Es wird Zeit, dass der junge Herr lernt, was wirkliche Arbeit ist und was es heißt, ein Gut zu führen. Alt genug ist er ja.«
»Ich habe ihn heute noch nicht gesehen«, setzte Lydia an.
Erich wischte ihre Worte mit einer Handbewegung fort. »Still, ich hasse nichts mehr als Schnattermäuler bei Tisch.«
Lydia senkte den Kopf und starrte ihren Teller an. Der erste Gang war wie immer Suppe. Sie löffelte, ohne etwas zu schmecken, und verlor sich in ihren Gedanken.
Diese Frau heute in der Jagdhütte, diese Anne … Waren Michel Reichard und sie ein Paar? Reichard musste doppelt so alt sein wie die junge Frau. Nun gut, niemand konnte vorhersagen, wo die Liebe hinfiel.
Ob die beiden glücklich waren? Lydia wusste nicht, ob sie eifersüchtig oder angeekelt sein sollte. Die beiden dort zu sehen hatte in jedem Fall Erinnerungen in ihr geweckt, die sie gut in sich verschlossen geglaubt hatte. Sie hätte nicht gedacht, dass eine Wunde nach so vielen Jahren noch so schmerzen konnte.
Nichts ist verheilt.
Ohne es zu bemerken, richtete sie den Blick auf den Platz, an dem früher immer ihr jüngerer Bruder Hanno gesessen hatte.
»Was glotzt du denn so?«, herrschte Erich sie an.
Natürlich war es ihm aufgefallen. Ihm entging nichts. Lydia starrte wieder auf ihren Teller und kämpfte gegen die Tränen an.
Ach, Hanno, dachte sie, ach, Hanno, Hanno, Hanno …
Sie hatte ihren Bruder sehr geliebt. Mit ihm hatte sie sich weniger allein gefühlt. Auch jetzt noch sah sie sein rundes Gesicht vor sich, umrahmt von braunen Locken, seinen weichen rosigen Mund. Er war schlank gewesen, feingliedrig, so anders als der grobschlächtige Vater, mehr ein Ebenbild der Mutter.
Lydia seufzte. Seit so vielen Jahren durfte man nicht mehr über ihn sprechen, und doch blieb sein Platz frei. Nicht aus Liebe oder Respekt, sondern als ewige Mahnung.
»Sind Sie fertig, Frau Berlau?«
Lydia tauchte aus ihren Erinnerungen auf. Das Mädchen stand neben ihr und sah sie fragend an. Lydia hatte kaum ein paar Löffel von der Suppe gegessen und nickte doch.
Der Vater schüttelte den Kopf. »Du wirst noch ganz hager werden. Wer soll dich dann noch ansehen?«
Niemand braucht mich mehr anzusehen, schoss es Lydia durch den Kopf. Ein Teller mit Fleisch, Kartoffeln und Rotkraut wurde vor sie gestellt. Sie hasste den Geruch von Fleisch, hatte ihn immer gehasst, auch schon damals, als sie noch geglaubt hatte, die Welt müsse ihr offenstehen.
Seit sie die junge Frau dort gesehen hatte, wo sie einmal so glücklich gewesen war, war es ihr, als wäre die Wunde erst gestern geschlagen worden.
Sie war nie verheilt und würde nie verheilen. Das verstand sie jetzt.
Draußen in der Halle polterte es mit einem Mal, dann wurde die Tür aufgestoßen. Wilhelm kam herein, das Haar so blond wie das seines Vaters, die Augen ebenso hellbraun. Natürlich war ihr das schon früher aufgefallen, aber jetzt schien es ihr erstmals richtig bewusst zu sein. Es mochte daran liegen, dass Severin, als sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte, so alt gewesen war wie Wilhelm heute.
»Guten Abend zusammen«, rief ihr Sohn munter. Er machte sich keine Gedanken darum, dass er zu spät kam. Er war die wichtigste Person in diesem Haushalt, seit er geboren worden war, gehegt und verhätschelt von einem Großvater, dessen Herz ansonsten aus Stein war. »Mama!« Er kam an ihre Seite und küsste sie auf die Wange.
Er ist solch ein gut aussehender Bursche, dachte Lydia. Er ist wirklich kein Kind mehr, er ist ein junger Mann.
»Setz dich endlich«, brummte Erich.
Wilhelm nahm Platz, ließ sich von dem strafenden Blick des Hausherrn weiterhin nicht aus der Ruhe bringen. Das Mädchen brachte ihm die Suppe. Es zitterte ein wenig, als es den Teller absetzen wollte. Wilhelm fing ihn geschickt auf, bevor er kippen konnte.
»Pass doch besser auf«, herrschte Erich Berlau seine Bedienstete von der anderen Seite des Tisches her an. »Bleibst wohl besser in der Küche.«
Lydia sah, wie dem Mädchen die Tränen in die Augen schossen, wie Wilhelm es aufmunternd anlächelte und es sich sofort etwas entspannte.
»Es ist doch nichts passiert, Großvater«, sagte der junge Mann lachend und widmete sich gut gelaunt seiner Suppe.
Erich blickte immer noch wütend drein, aber er sagte nichts mehr.
Lydia ließ ihre Gedanken erneut schweifen. Die Liebe, die sie gegenüber ihrem Sohn empfand, war unfassbar. Gleichzeitig erkannte sie etwas, auf das sie vielleicht schon seit Jahren hätte vorbereitet sein müssen. Er brauchte sie nicht mehr, er war erwachsen. Bald würde er sie verlassen. Der Schmerz, der mit diesem Gedanken einherging, war überwältigend.
Angelika hatte sich neben Anne auf die Bank gesetzt. Die umklammerte mit einem Arm ihre Schüssel mit Grütze und aß mechanisch Löffel um Löffel. Hier unter den Mägden und Knechten war sie die Einzige, die auf diese Art und Weise aß. Anne hatte es sich in dem Kloster angewöhnt, in dem sie die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte, bevor die Schwestern sie an Reichard übergeben hatten, damit sie das abarbeiten konnte, was man in all den Jahren für sie aufgewendet hatte.
Auch heute noch fragte Anne sich, wofür sie wohl zu bezahlen hatte: für die ungeheizten Schlafräume und das schlechte Essen, für Holzpantinen tagein, tagaus, die einem die Füße aufscheuerten, für die grauen Kittel aus dem kratzenden Sackleinen? Trotzdem … Es hatte in dieser schweren Zeit einen Lichtblick gegeben – Schwester Donata, die den Kindern zur Seite gestanden und ihnen die Liebe gegeben hatte, die ihnen von den anderen verwehrt worden war.
Wenn es einen Gott gibt, hatte Anne später immer gedacht, dann zeigt er sich in Schwester Donata. Sie besuchte die liebenswürdige alte Frau, wann immer es möglich war.
Ohne es recht zu bemerken, hatte Anne ihre Schüssel geleert. Nun schob sie sie zurück und warf einen kurzen Blick zu Thomas hin, der am anderen Ende des langen Tisches saß und Frieder zuhörte. Als hätte er ihren Blick bemerkt, schaute er kurz auf. Sein Ausdruck war immer noch besorgt. O ja, er wusste, wie knapp sie Reichard dieses Mal entkommen war.
Anne dachte daran, wie erleichtert sie sich gefühlt hatte, als sie endlich wieder bei ihm gewesen war, wie er sie viel zu kurz in die Arme genommen hatte und sie in Tränen ausgebrochen war wie ein kleines Kind.
Sie stand auf und nahm ihre Schüssel, um sie zum Spülstein zu tragen, wo sie an diesem Tag keinen Dienst leisten musste. Angelika, die sie die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatte, folgte ihr auf dem Fuß.
»Hast du geweint?«
Anne schüttelte den Kopf. »Und wenn schon … Geht’s dich was an?«
Sie mochte Angelika nicht besonders. Die Magd, mit der sie die Kammer teilte und mit der sie zu oft Seite an Seite arbeiten musste, kannte keine Grenzen und biederte sich gerne an. Anne traute der jungen Frau nicht. Sie hatte solche Menschen im Kloster kennengelernt und war auf der Hut.
Aus den Augenwinkeln sah sie, dass auch Thomas aufgestanden war. Er näherte sich mit seiner Schüssel. Sie wollte gehen, doch Angelika hielt sie am Ärmel fest.
»Wollte dir Reichard an die Wäsche?«
Anne wunderte es nicht, dass Angelika eifersüchtig klang. Wenn der Reichard was von mir wollte, hatte sie einmal gesagt und vielsagend in die Runde gelächelt, dann wüsste ich, was ich täte. Die alte Trude hatte darüber nur den Kopf geschüttelt und den Arm schützend um Anne gelegt, aber Trude war im letzten Frühjahr ertrunken, als der Fluss nach der unerwarteten Schneeschmelze hohes Wasser geführt hatte.
Anne zerrte ihren Ärmel aus Angelikas Hand.
»Lass mich in Ruhe«, blaffte sie, drehte sich um und ging eilig davon.
Es war schon spät am Abend, als Thomas und Anne sich noch einmal unter der Weide am Fluss, ihrem geheimen Treffpunkt, einfanden. Anne hatte im Haus noch etliches zu erledigen gehabt. Piet, einer der anderen Knechte, hatte Thomas aufgehalten. Stumm hielten Anne und Thomas sich endlich in den Armen. Thomas strich sanft über Annes Haar.
»Was ist genau geschehen? Wo warst du?«
»Reichard hat mich in einer alten Jagdhütte eingesperrt, mitten im Wald.«
»Mitten im Wald? Ich wusste nicht, dass es da eine Jagdhütte gibt.«
»Ich wusste es auch nicht.«
Mit einem Seufzer, der all ihre Anspannung ausdrückte, ließ Anne sich auf den Boden sinken und klopfte auf den Platz neben sich. Thomas setzte sich. Die welken Blätter raschelten im Wind. An den Abenden war es manchmal schon empfindlich kalt. Die junge Frau kuschelte sich an Thomas und schloss die Augen. Unter dem zerschlissenen Leinenhemd konnte sie seine harten Muskeln spüren. Sie ließ eine Hand unter das Hemd gleiten und strich über seine warme Haut. Thomas küsste ihre Schläfe.
Dann erzählte Anne, was genau geschehen war, wie sie schließlich von der überraschten Lydia Berlau entdeckt worden war und Reichard hatte entkommen können.
»Wir müssen endlich etwas tun«, murmelte Thomas, als sie geendet hatte. »Es geht so nicht weiter.« Ein Moment der Stille folgte. Anne schloss die Augen und wartete. Sie hörte, wie sich Thomas räusperte. Einen Augenblick lang zögerte der junge Mann deutlich, bevor er weitersprach. »Wir müssen heiraten, Anne.«
Was hatte Thomas da gesagt? Hatte sie richtig verstanden? Anne öffnete die Augen wieder.
»Heiraten?«, fragte sie überrascht und sah Thomas an. »Sie werden es uns nicht erlauben …«
Dabei wünschte sie es sich so sehr. Ja, sie wollte Thomas heiraten! Aber sie waren Knecht und Magd, es war unmöglich. Thomas’ Hand folgte der ihren unter das Hemd. Seine Finger umschlossen sie fest und warm. Sie wich seinem Blick aus.
»Schau mich an, bitte!«
»Wie soll das gehen?«, flüsterte sie.
»Ich werde Herrn Berlau fragen.«
Die Antwort kam so rasch, dass er schon länger darüber nachgedacht haben musste. Anne, die Thomas immer noch selbstvergessen streichelte, hielt inne.
»Es ist uns verboten, Herrn Berlau zu belästigen.«
»Sagt wer?«
»Michel Reichard …«
Thomas schaute sie triumphierend an.
»Reichard«, wiederholte er. »Reichard sagt viel …« Er nahm ihr Gesicht zwischen beide Hände. »Was sagst du?«
»Ich weiß nicht.«
Anne schaute zwischen den tief hängenden Ästen der Weide hindurch auf den Fluss. An den Sommersonntagen hatten sie und die anderen Knechte und Mägde hier immer viel Spaß gehabt. Anne erinnerte sich, wie dieser Ort von ihrem Lachen erfüllt gewesen war und wie sich Thomas und die anderen jungen Männer ins Wasser hatten fallen lassen, sodass es weit gespritzt hatte. Jetzt spürte sie Thomas’ Daumen, der ihre Lippen liebkoste.
»Wir müssen es wagen, Anne. Wir haben keine andere Wahl.«
Sie nickte, aber sie hatte furchtbare Angst.
Die nächste Woche verging mit viel Arbeit. Montags war Waschtag. Anne und Angelika waren dazu eingeteilt. Angelika versuchte erneut, mehr zu erfahren, und erteilte Anne ungebetene Ratschläge, die diese ignorierte. An den kommenden Tagen wurde der Flachs weiterbearbeitet. Die Knechte reparierten die Ställe und das Dach des Wohnhauses. Anne wich Michel Reichard aus, so gut sie konnte. Die ganze Woche dachte sie darüber nach, wen sie wohl um Rat bitten konnte, doch ihr fiel nur eine Person ein, der sie vertraute: Donata. Würde die Ordensschwester ihr helfen können?
Spät am Samstagnachmittag schlich sie sich fort. Es war eine gute Stunde zu laufen bis zum Kloster. Anne beeilte sich so sehr, dass sie trotz der kühlen Luft nass geschwitzt war, als sie die Abtei erreichte. Sie klopfte und teilte ihr Begehr mit. Vielleicht hatte sie Glück. Donata verfügte über etwas mehr Freiraum und war weniger streng in die allgemeinen Tagesabläufe der Schwestern eingebunden, weil sie sich um die Kranken kümmerte. Sie versorgte nicht nur die Ordensfrauen mit selbst gebrauter Medizin, Kräuteraufgüssen und Salben, auch die Menschen aus den umliegenden Dörfern kamen zu ihr, wenn sie Not litten. Schwester Donata half jedem.
Tatsächlich führte man Anne gleich in das Besucherzimmer und brachte ihr sogar einen Becher Wasser. Anne nahm ihr Kopftuch ab, setzte sich und wartete. Der Raum war schlicht eingerichtet, die grauen Steinmauern unverputzt. Ein langer Tisch aus dunklem Holz nebst einer Bank standen in der Mitte. An einer der Wände hing ein riesiges Kreuz. Jetzt, da der Schweiß auf ihrer Haut trocknete, fröstelte Anne. Abwesend zog sie erst den einen, dann den anderen Fuß aus den Holzpantinen und massierte ihre Füße.
Endlich, sie konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, hörte sie Schritte. Eine hochgewachsene Gestalt tauchte in der Tür auf.
»Anne!«
Erstaunen klang in der geliebten, vertrauten Stimme mit, allerdings auch Freude.
»Schwester Donata!«
»Du kommst früher, als ich erwartet habe.« Anne lief zu der Schwester und knickste tief. »Aber Anne, nicht doch!« Donata zog die junge Frau sogleich wieder hoch. »Setzen wir uns. Was führt dich zu mir?«
Erst suchte Anne mühsam nach Worten, doch nachdem sie einmal angefangen hatte zu erzählen, brach es geradezu aus ihr heraus. Wie Reichard ihr nachstellte, wie sehr sie und Thomas sich liebten, wie sie verzweifelt nach einer Lösung suchten und keinen Ausweg sahen. Die Ordensfrau hörte ihr ruhig zu.
»Thomas möchte heiraten. Er plant, Berlau um Hilfe zu bitten«, beendete Anne ihre Geschichte.
»Und was denkst du? Wird er euch helfen?«
»Ich bin mir unsicher. Außerdem haben wir das Geld nicht. Berlau wird es uns kaum geben.«
Sie schaute die alte Ordensschwester an. Donata sah mit einem Mal müde aus. Gleichzeitig wirkte sie tieftraurig.
»Thomas zu heiraten ist keine Lösung – obwohl ich euch beiden von Herzen zu eurem Entschluss gratulieren möchte. Reichard wird es vollkommen gleichgültig sein, und Berlau, da hast du recht, wird euch nicht unterstützen. Selbst wenn ihr durch die Ehe verbunden seid, wird euer Leben bleiben, wie es ist.«
Anne schaute Donata fragend an. »Du scheinst sie beide gut zu kennen«, sagte sie dann nachdenklich.
Donata nickte. Ihr Blick schweifte in die Ferne, wirkte vorübergehend wie der Welt entrückt. »Ich kenne sie besser, als mir lieb ist. Mit den Berlaus bin ich aufgewachsen, Anne. Unsere Familien waren befreundet.«
»Das wusste ich nicht.«
»Ich erzähle es nicht gern.« Donata schaute die junge Frau wieder an. »Reichard kenne ich, weil er Berlau schon lange zur Hand geht, wenn der es verlangt. Und deshalb gibt es auch nur eine Möglichkeit für Thomas und dich: Ihr müsst fort von hier.«
»Fort von hier?«, echote Anne.
Donatas Blick war jetzt sehr ernst. »Ja, denn sonst werdet ihr nicht glücklich werden.«
»Aber wohin, Schwester Donata? Ich habe niemanden. Ich kann nirgendwohin und Thomas ebenso wenig. Uns fehlt das Geld, und keiner von uns hat Ausweispapiere …«
»Ich weiß, Kind …« Eine tiefe Traurigkeit zeichnete Donatas Gesicht. »Ich kann dich deshalb vorerst nur bitten, fortan die Augen offen zu halten. Ich tue es auch. Gott wird uns helfen. Ich bete für dich.«
Anne bemühte sich, ihre Enttäuschung zu verbergen. Es fiel ihr sehr schwer.
Drittes Kapitel
Lydia hörte plötzlich Stimmen und blieb stehen. Je älter Wilhelm wurde, desto mehr versuchte Erich, ihn für sich einzunehmen, und desto weniger Zeit hatte ihr Sohn für sie. Sie hatte immer gewusst, dass es einmal so weit kommen würde. Sie hatte immer gedacht, sie wäre darauf vorbereitet, aber es schmerzte sie doch, und es verstärkte das Gefühl der Einsamkeit, das ihr Leben schon seit so vielen Jahren begleitete.
»Deine Mutter ist schwach«, hörte sie die Stimme ihres Vaters. »Sie wird dich nie unterstützen können, wird immer ein Klotz an deinem Bein sein.«
»Sie ist eine Frau«, erklang gleich darauf die feste Stimme ihres Sohnes. »Sie braucht Schutz.«
»O ja, natürlich brauchen Frauen Schutz und meine liebe Lydia umso mehr, doch …«
Lydias Hand wanderte unwillkürlich zu ihrem Hals. Sie hatte wie so oft den Eindruck, dass ihr die Luft wegblieb. Was machte ihr Vater da? Versuchte er, ihren Sohn gegen sie aufzubringen, gegen die eigene Mutter? Sie wusste, wozu ihr Vater fähig war, wusste um seine Gefühlskälte. Aber vielleicht hatte er auch recht. Vielleicht war sie nur ein Hindernis für Wilhelm. An der Seite seines Großvaters würde er zukünftig immer mehr Aufgaben auf dem Gut übernehmen. Und was sollte sie tun, jetzt, nachdem sie das Kind aufgezogen hatte?
Das Kind? Wilhelm war zu einem großen, kräftigen, gut aussehenden Mann herangewachsen. Mit jedem Tag erkannte sie mehr, dass er seinem Vater nicht nur äußerlich ähnlich sah, auch vom Wesen glich er ihm.
Warum habe ich ihn verloren? Warum hat er mich verlassen? Severin war gegangen, und kurz darauf hatte sie ihre Schwangerschaft festgestellt, und dann war keine Nachricht mehr von Severin gekommen, von ihm nicht und auch nicht von Hanno, ihrem vom eigenen Vater verabscheuten Bruder.
Ach, Hanno …
»Du bist wie ein Sohn für mich«, hörte sie den Vater sagen. »Wie der Sohn, den ich nie hatte. Das warst du immer.«
Wilhelm gab keine Antwort. Durch sie wusste er zumindest von Hanno. Auch wenn Lydia nur wenig erzählt hatte, so hatte sie ihm doch nicht alles verschweigen wollen.
Lydia tastete unwillkürlich nach dem kleinen Medaillon, das sie stets an einer Kette um den Hals trug. In ihm befand sich ein Bild von Severin und eines von Hanno.
Jetzt näherten sich Schritte der Tür. Sie hatte sie zu spät bemerkt, um flüchten zu können. Die Tür wurde geöffnet, Wilhelm trat in den Flur. Er sah sie und wusste, dass sie gelauscht hatte, doch er sagte nichts.
»Gute Nacht, Großvater«, rief er in den Raum hinein.
»Gute Nacht, Wilhelm.«
Wilhelm zog die Tür ganz hinter sich zu und lächelte seine Mutter an. Sie folgte ihm wortlos zu seinem Zimmer. Unsicher blieb sie dort in der Tür stehen.
»Komm doch herein.«
»Ich will dir nicht zur Last fallen.«
»Das wirst du niemals tun, Mama.« Er zog sie in den Raum, sie leistete keinen Widerstand. »Ich liebe dich, Mama. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben«, sagte er, während er zärtlich über ihren Arm strich.
Sie ließ es zu, dass er sie zu seinem Sessel führte, und setzte sich.
»Du brauchst mich nicht mehr«, sagte sie endlich, so sachlich sie konnte.
Er lachte. »Ja, vielleicht kann ich nun allein über mein Leben entscheiden, Mama, kann in die Welt hinausziehen, aber …«, er zögerte, »… aber du wirst mir immer fehlen.«
Sie liebte das Lächeln, das jetzt auf seinem Gesicht erschien, eine Mischung aus dem Mann, zu dem er geworden war, und dem kleinen Jungen, den sie stets hatte beschützen müssen.
Ich muss ihn gehen lassen, fuhr es ihr durch den Kopf, auch wenn ich ihn noch so sehr liebe.
Die Gedanken in ihr waren scharf wie Messer, und sie rissen große Wunden, aber sie lächelte den Schmerz weg.
»Ich liebe dich auch …«, sagte sie.
Er reichte ihr den Arm. »Darf ich dich auf dein Zimmer begleiten, Mama? Nach diesem langen Tag bist du sicher müde.«
»Natürlich, nichts lieber als das.«
Sie legte eine Hand auf seinen Arm. Wie zart und schmal ihre Finger auf seinem muskulösen Unterarm wirkten. Ein seltsamer Gedanke kam ihr, der, dass sie alles, was sie jetzt tun würde, zum letzten Mal tat. Ohne es zu merken, schüttelte sie den Kopf.
»Ist etwas, Mama?«
»Nein, nein …« Sie lächelte wehmütig. »Ich glaube, es ist der Spätherbst, das Novemberwetter. Man denkt zu viel nach.«
»Woran denkst du?«
»An nichts eigentlich. Das ist es ja. Albern, nicht wahr?«
»Albern?«
Lydia hielt innerlich den Atem an, doch Wilhelm stellte keine weiteren Fragen. Er hatte solch ein gutes Leben geführt. Er kannte kein Leid. Sie hatte ihn gut behütet. Ab jetzt würde zunehmend ihr Vater seinen Einfluss geltend machen, und das bedeutete gewiss viel Leid. Erich duldete keine Gegenwehr. Sie hoffte, dass Wilhelm stark genug war.
Sie hatten die Tür zu ihrem Zimmer erreicht. Er öffnete sie. Der Raum war vom Rot der untergehenden Sonne durchflutet. Wilhelm trat zuerst ein. Lydia blieb kurz stehen und folgte ihm dann. Er schien nicht zu wissen, was er sagen sollte. Sein Blick wanderte von ihrem breiten Bett mit den vielen weißen Kissen – sie kam sich immer ganz verloren darin vor – zu ihrem schmalen Tisch mit dem Spiegel, dem Stuhl, dem Sessel …
Lydia lächelte. »Weißt du noch, dort habe ich dir immer vorgelesen.«
»Ja, Mama.«
»Und manchmal hast du dich gefürchtet.«
»Vor dem Wolf, der das Rotkäppchen verführt hat.« Er lachte.
Lydia sah ihn ernst an. »Du fürchtest dich nicht mehr, oder? Heute fürchtest du dich nicht mehr …«
Kurz schien ihr Sohn irritiert, dann schüttelte er den Kopf.
»Nein, natürlich nicht.«
Schweigend standen sie voreinander, dann gähnte Lydia unvermittelt. »Ich bin wirklich müde, lieber Sohn, ich habe in der letzten Nacht furchtbar schlecht geschlafen.«
Er nickte sofort verständnisvoll, küsste sie auf die Wange.
Ein letztes Mal, dachte Lydia, ein letztes Mal. Sie küsste ihn zurück. Als er die Tür hinter sich zuzog, musste sie weinen. Sie tat es so leise wie möglich. Dann trat sie ans Fenster. Die Sonne war ein glutroter Feuerball, der gerade hinter den Hügeln versank. Orangerot flammte der Himmel, hier und da zeigte sich eine Ahnung schwarzgrauer Nacht.
Das letzte Mal, dachte Lydia, welch ein wunderbarer Sonnenuntergang. Ich bin so dankbar.
Tagsüber hatte es geregnet, also hatte sie auch den Regen nicht ein letztes Mal missen müssen. Sie war froh darum. Er gehörte zum Leben dazu, genau wie der Sonnenschein, wenngleich sie sich manchmal weniger Regen gewünscht hatte. Nun, sie war wohl kein Glückskind, wie sie es sich in jungen Jahren vorgestellt hatte.
Lydia legte sich früh schlafen und erwachte am Morgen mit den allerersten Sonnenstrahlen. Sorgfältig zog sie sich an. Sie wählte nicht irgendein Kleid, sondern eines, das sie früher oft getragen hatte, damals, als sie einfach nur glücklich gewesen war. Dann öffnete sie die Schublade ihres Frisiertisches. Seit Wochen bewahrte sie das Pulver darin auf. Als sie es aus dem Regal des kleinen Gartenhäuschens genommen hatte, hatte sie zuerst nicht verstanden, warum, aber jetzt wurde ihr alles klar. Jetzt wusste sie, was sie schon damals vorgehabt hatte.
Lydia schenkte sich einen Becher Wasser ein, gab einige Löffel von dem Pulver hinzu, rührte um, setzte an und trank.
Anne schlief schlecht in dieser Nacht und erwachte früh am nächsten Morgen, noch bevor es ganz hell wurde, fröstelnd und steif. Es war kalt in den Dienstbotenbehausungen, wo nicht geheizt wurde.
Vorsichtig richtete sie sich auf. Angelika schlief noch tief und fest. Sie hatte die dünne Decke bis zur Nasenspitze hochgezogen und hielt sie umklammert. Selbst im Schlaf wirkte sie angespannt. Anne fragte sich, warum das so war. Sie wusste nicht viel von Angelika. Die andere war Anfang zwanzig wie sie, etwas kleiner, aber grobknochig, sodass die meisten sie für größer hielten. Ihr dichtes Haar hatte die Farbe von Butter. Anne und sie waren sich von Anfang an feind gewesen.
Anne beugte sich vor und nahm ihre Holzpantinen vom Boden auf. Manchmal – besonders, wenn sie lange unterwegs war – träumte sie davon, richtige Schuhe aus duftendem weichem Leder zu haben. Aber es war müßig, darüber nachzudenken, denn sie würde niemals welche besitzen. Leise schlich sie aus dem Raum. Bislang nur schemenhaft schälte sich die Umgebung aus dem Dunkel. Noch war keiner wach, auch wenn es nicht mehr lange dauern konnte. Am Brunnen wusch sie sich rasch, zitternd vor Kälte. Im Winter würden sie wieder das Eis zerschlagen müssen, um sich waschen und Wasser für das Haus und die Tiere schöpfen zu können … Michel Reichard ließ sein Wasser immer aufwärmen. Knechte und Mägde dagegen könnten froh sein, hatte er mehr als einmal mit meckerndem Lachen gesagt, wenn es überhaupt sauberes Wasser für sie gebe.
Sie hatte Thomas von dem Besuch im Kloster erzählt, gleich nachdem sie zurückgekommen war, doch er hatte weiterhin darauf bestanden, auf Gut Berlau vorstellig zu werden. Schwester Donata konnte ihnen schließlich nicht helfen. Anne hatte widerstrebend zugestimmt, es zumindest zu versuchen. Nun würde sie also zu Berlau gehen. Sie mussten eine Entscheidung treffen.
Die junge Frau überlief ein Schauder. Sie kannte den groß gewachsenen, breitschultrigen Erich Berlau nur vom Sehen. Gesprochen hatte er nie mit ihr. Warum sollte er auch? Sie war eine der Mägde, die auf dem Hof seines Nachbarn arbeiteten. Sie war unwichtig. Ein Nichts – das hatte Reichard kürzlich auch zu ihr gesagt. Wahrscheinlich wusste Berlau noch nicht einmal etwas von ihrer Existenz.
Anne trocknete sich das Gesicht energisch mit dem Ärmel ihrer Bluse und wischte die Hände an ihrem Rock ab. Das erste Stück ging sie zögernd, dann schritt sie entschlossener aus, als könnte sie sich so selbst Mut machen.
Nein, ich bin kein Feigling, sagte sie immer wieder stumm vor sich hin. Ich bin kein Feigling.
Als sie den Garten hinter sich gelassen und den Weg zwischen den Feldern erreicht hatte, atmete sie erleichtert auf, froh, von niemandem entdeckt worden zu sein.
Ich werde viel zu früh kommen, fuhr es ihr durch den Kopf. Ob Thomas und die anderen inzwischen aufgewacht waren? Die Tiere mussten gefüttert werden, bevor es in die Kirche ging. Erst danach war den Mägden und Knechten ihr freier Tag vergönnt. »Tiere kennen keinen Sonntag«, pflegte Reichard zu sagen.
Würde Thomas wissen, wohin sie gegangen war, und würde er ihr folgen?
Der Feldweg wurde jetzt breiter und führte auf eine befestigte schmale Straße, die auf das Haupttor von Gut Berlau zulief. Erich Berlau hatte sie lange zuvor pflastern lassen. Es war in dem Jahr gewesen, in dem sie zu Reichard gekommen war, Anne erinnerte sich gut daran.
Sie bemerkte, wie sie unwillkürlich langsamer wurde.
Hatte Schwester Donata recht? War es falsch, Herrn Berlau anzusprechen?
Aber sie hatte ja nichts zu verlieren. Anne atmete tief die kalte Morgenluft ein und schritt wieder schneller voran. In der Ferne tauchte das weiß gestrichene Tor vor ihr auf. Auf der rechten Seite der Zufahrtsstraße war eine große Viehweide mit Holsteiner Kühen, links des Weges gurgelte munter ein Bach. Bei Regen überschwemmte er manchmal die Straße. Im Winter sei es an dieser Stelle oft glatt, hatte ihr Thomas erzählt, der öfter auf Gut Berlau Dinge erledigen musste.
Ich hätte ihn mitnehmen sollen. Er kennt sich hier aus …
Anne erreichte das Tor, blieb zögernd davor stehen. Ihr Herz hämmerte in der Brust, ihr Atem ging rasend – und das nicht nur, weil sie schnell gelaufen war.
Was sollte sie Herrn Berlau sagen? Was würde er erwidern?
Anne verbot sich, weiter nachzudenken, und schob entschlossen das Tor auf. Sie würde nachdenken, wenn sie Herrn Berlau gegenüberstand. Das war früh genug. Sonst lief sie noch Gefahr, auf dem Absatz kehrtzumachen und den ganzen Weg zurückzurennen.
Auch der Weg hinter dem Tor war gepflastert. Rechts und links waren Bäume gepflanzt. Die Allee führte genau auf den Eingang des Haupthauses zu. Das Haus war so groß und prächtig und reckte sich so weiß in den Morgenhimmel, dass Anne staunend stehen blieb, den Kopf in den Nacken gelegt. Eine Magd, damit beschäftigt, die Stufen zu kehren, hielt in ihrer Arbeit inne und starrte Anne an. Ein Knecht führte gerade einen gesattelten und gezäumten Rappen aus dem Stall.
Plötzlich ließ ein gellender Schrei alle zusammenfahren. Fast zur gleichen Zeit stürzte ein großer Mann in den Hof – der Gutsbesitzer Erich Berlau …
Anne öffnete den Mund, um zu grüßen, doch er bemerkte sie gar nicht. Er rannte an ihr vorbei auf den Eingang zu. Als er die Stufen zur Hälfte hinaufgerannt war, wurde die Tür des Hauses aufgerissen. Ein junger Mann stand da, der Blick wirr, das Gesicht kreidebleich. Das blonde Haar stand ihm vom Kopf ab, als hätte er es gerauft. Seine Augen waren weit aufgerissen, doch er sah keinen von ihnen an. Ein schrecklicher, schmerzvoller Laut kam aus seiner Kehle. Er schien etwas sagen zu wollen und konnte es nicht, dann fiel er auf die Knie.
»Sie ist tot«, stieß er aus. »Sie ist tot.«
Fünfundzwanzig Jahre zuvor …
Lydia liebte es, wenn die Sonnenstrahlen durch das Frühlingsblätterdach fielen. Überall konnte man den Gesang der Vögel hören. Feine weiße Blüten bedeckten den Boden unter den Obstbäumen. Er war so weich, dass er unter ihren Füßen zu federn schien. Severin umfing sie mit seinen starken Armen und hob sie über eine große Pfütze vom letzten Regenguss hinweg. Als er sie wieder auf den Boden setzte, drückte sie sich an seine breite Brust. Sein Geruch war wunderbar. Sie liebte es, an ihm zu schnuppern.
»Komm«, lockte er sie. »Ich habe eine Überraschung.«
Sie wusste, dass es zur Jagdhütte ihres Vaters ging, aber Severin gelang es doch, sie immer wieder zu verblüffen. Sie waren den ganzen Winter über nicht dort gewesen, und nun war sie gespannt. Sie gab ihm einen Kuss.
Als sie die Waldlichtung erreichten, blieb sie stehen. Auf der obersten Stufe stand ein Windlicht, in dem eine Kerze flackerte. Beim Näherkommen erkannte sie, dass dieselben feinen weißen Blüten, die sie schon unter den Obstbäumen gesehen hatte, auf den Holzstufen verstreut waren.
Seit ihr Vater eine neue Jagdhütte hatte bauen lassen, wurde die alte nicht mehr genutzt. Diese Hütte war ihr geheimer Ort, und Severin hatte sie offenbar nur für sie geschmückt.
»Es ist wunderbar«, flüsterte sie.
»Du bist wunderbar. Du bist mein Leben«, entgegnete er ruhig.
»Wenn ich dich verliere, sterbe ich …«
Er strich ihr über die Wange. »Sag so etwas nicht. Wir werden immer zusammen sein.« Dann bückte er sich und hob das Windlicht auf. »Wollen wir hineingehen?«
Er bot ihr den Arm, und sie hakte sich ein.
Irgendwann werden wir so zu einem Ball gehen, fuhr es ihr durch den Kopf. Ja, das werden wir. Eines Tages heiraten wir, und dann …
Viertes Kapitel
Seit seine Mutter gestorben war, wusste Wilhelm, dass er noch nie so etwas wie Schmerz empfunden hatte. Dieser schreckliche Moment, als er sie gefunden hatte, am Frisiertisch zusammengesunken, den Mund im Todeskampf verkrampft, das Gesicht blau angelaufen … Zuerst hatte er nicht glauben wollen, was er sah, und eigentlich wollte er es immer noch nicht.
Gleichzeitig schämte er sich der Tränen, die er vor allen geweint hatte, die nun schon wieder mit Macht hervordrängten und ihm so weibisch vorkamen. Er presste die Lippen aufeinander, dann musterte er sich noch einmal im Spiegel, kontrollierte endlich den Sitz seines schwarzen Anzugs. Jemand klopfte an die Tür, kurz und hart. Sein Großvater …
»Herein!«
Wilhelm räusperte sich. Seine Stimme war belegt vom vielen Weinen. Ein Ausdruck des Missfallens blitzte in Erichs Augen auf, als er die rot geränderten Augen seines Enkels bemerkte. Zum ersten Mal in seinem Leben überkam Wilhelm ein Gefühl tiefer Abneigung gegenüber dem Vater seiner geliebten Mutter. Warum war ihm diese Kälte bislang nie aufgefallen? War er dafür blind gewesen, blind vor Bewunderung?
Er dachte daran, wie Erich ins Zimmer gekommen und seine tote Tochter erblickt hatte. Ohne einen Ausdruck des Schmerzes hatte er sie angesehen, als ob man ihn bei einer wichtigen Sache gestört hätte. Es war deutlich zu spüren gewesen, dass er empört war – sie hatte sich angemaßt, seine Pläne zu durchkreuzen.
Jetzt musterte er den Enkel. »Bist du bereit? Man wartet schon.«
Wilhelm nickte und folgte dem Großvater vor die Tür. Zu seinem Erstaunen war die Trauergemeinschaft groß, obgleich seine Mutter zeit ihres Lebens sehr zurückgezogen gelebt und nie viel Besuch empfangen hatte. Auch Reichard war da und mit ihm die Knechte und Mägde. Sogar eine Nonne machte Wilhelm in der Menge aus.