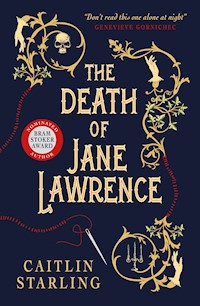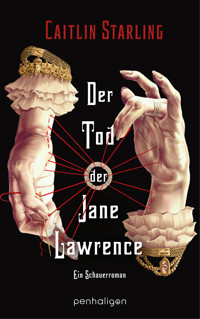
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er hütet Geheimnisse – sie seziert sie: Ein moderner Schauerroman mit Medizinsetting und übernatürlichem Twist.
London, Nachkriegszeit: Jane hat ein besonderes Faible für Mathematik. Deshalb rechnet sie sich aus, dass ihre Chancen auf persönliche Unabhängigkeit steigen, wenn sie selbst einen Heiratskandidaten bestimmt. Ihre Wahl fällt auf den in sich gekehrten und an Jane wenig interessierten Doktor Augustin Lawrence. Als dieser in die Ehe einwilligt, ihr aber verbietet, auch nur einen Fuß in sein Anwesen außerhalb der Stadt zu setzen – in dem er jede Nacht verbringt –, wird Jane klar, dass das Erlernen des blutigen Arzthandwerks nichts ist im Vergleich zu dem, was des Nachts auf Lindridge Hall vor sich geht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
London, Nachkriegszeit: Jane hat ein besonderes Faible für Mathematik. Deshalb rechnet sie sich aus, dass ihre Chancen auf persönliche Unabhängigkeit steigen, wenn sie selbst einen Heiratskandidaten bestimmt. Ihre Wahl fällt auf den in sich gekehrten und an Jane wenig interessierten Doktor Augustin Lawrence. Als dieser in die Ehe einwilligt, ihr aber verbietet, auch nur einen Fuß in sein Anwesen außerhalb der Stadt zu setzen – in dem er jede Nacht verbringt –, wird Jane klar, dass das Erlernen des blutigen Arzthandwerks nichts ist im Vergleich zu dem, was des Nachts auf Lindridge Hall vor sich geht …
Autorin
Caitlin Starlings Debüt »Die leuchtenden Toten« wurde mit dem LOHF Best Debut Award ausgezeichnet und für mehrere weitere Literaturpreise nominiert, u. a. den Bram Stoker Award. Neben dem Schreiben arbeitet sie darüber hinaus in der Videospielentwicklung und ist immer auf der Suche nach neuen Gelegenheiten, um Schlaf zu vermeiden. Mit »Der Tod der Jane Lawrence« erscheint ihr erster Roman bei Penhaligon.
Caitlin Starling
Der
Tod
der
Jane
Lawrence
Ein Schauerroman
Deutsch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Death of Jane Lawrence« bei St. Martin’s Press, New York.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2021 by Caitlin Starling
Published by arrangement with St. Martin’s Publishing Group.
All rights reserved.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sigrun Zühlke
Umschlaggestaltung: © Anke Koopmann | Designomicon nach einer Originalvorlage von St. Martin’s Press, New York
Umschlagillustration: Colin Verdi
SH · Herstellung: kw
Satz: KCFG - Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-29710-7V001
www.penhaligon-verlag.de
Gewidmet den Beobachtern.
Kapitel Eins
Dr. Augustin Lawrence hatte Blut an seinen Manschetten, und sein Mantel hatte dem unablässigen Nieselregen nicht standgehalten. Er wirkte durchnässt, elend und verängstigt.
Er hatte Angst vor ihr.
Jane Shoringfield konnte den Blick nicht von ihm wenden, auch wenn ihre ungeteilte Aufmerksamkeit ihn offensichtlich überforderte. Dies war der Mann, den sie zu heiraten beabsichtigte, wenn er sie denn haben wollte. Wenn es ihr gelang, ihn zu überzeugen.
Wie erstarrt stand er in der Tür zum Arbeitszimmer ihres Vormunds, während sie ebenso reglos hinter dem Schreibtisch verharrte. Selbst von hier aus konnte sie sehen, dass sie ein paar Zentimeter größer war als er, dass er dunkles, leicht welliges Haar hatte, an den Schläfen schon etwas ergraut, und dass seinen schlammgrünen Augen eine gewisse Sanftmut innewohnte, die im falschen Licht wohl leicht als Traurigkeit gedeutet werden konnte.
Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er gut aussehen könnte.
»Herr Doktor!«
Dröhnend hallte die Stimme ihres Vormundes durch den Korridor, und der Mann in der Tür fuhr erschrocken herum. »Mr Cunningham«, erwiderte er den Gruß. »Es tut mir leid, ich fürchte, ich habe Ihr Dienstmädchen aus den Augen verloren, und …«
»Kein Problem, kein Problem. Wie schön, dass Sie gekommen sind! Ich hatte schon befürchtet, dass Sie Ihre Entscheidung ändern.«
Jane konnte Mr Cunningham zwar nicht sehen, hatte ihn aber dennoch deutlich vor Augen: das weiße Haar sorgfältig aus der Stirn gekämmt, in einem edlen, aber bequemen Anzug, strahlend braune Augen. Klein und schmal war er, beinahe zu schmal für seine volle Stimme und sein Charisma.
»Allerdings dürfte ich im Moment wohl weder die beste noch die ansehnlichste Gesellschaft sein«, gab der Doktor zu bedenken, wobei sein Blick noch einmal verstohlen zu Jane hinüberhuschte und für einen kurzen Moment abschätzend auf ihr verweilte. »Zu viele Hausbesuche heute. Ich habe es nicht einmal geschafft, noch in der Praxis vorbeizuschauen.«
Was zumindest den Zustand seiner Manschetten erklärte, allerdings auch bedeutete, dass er keineswegs zu früh dran war. Jane sah zur Uhr hinüber und fuhr innerlich zusammen. Eine volle Stunde war vergangen, ohne dass sie es bemerkt hätte. Und sie war nicht zurechtgemacht. Sie trug noch immer ihre Lesebrille, und an der Schläfe glaubte sie einen Tintenfleck zu spüren. Mr Cunninghams Rechnungsbücher lagen aufgeschlagen vor ihr auf dem Tisch.
So hinterließ sie sicherlich keinen ersten Eindruck, der ihrem Anliegen förderlich wäre.
»Keine Sorge.« Mr Cunningham war näher gekommen, aber noch immer nicht zu sehen. »Sie werden bald feststellen, dass es bei dieser Werbung nicht auf Ihre Verführungskünste ankommt.«
Feine Röte stieg in die Wangen des Arztes. »Das ist mir klar, doch ich habe darüber nachgedacht, und ich muss …«
»Bevor Sie fortfahren«, unterbrach ihn ihr Vormund, »möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie bislang noch nicht gehört haben, was sie dazu zu sagen hat. Sie sollten sich ihre Argumente anhören.«
Es war Mr Cunningham gewesen, der letzte Woche auf ihren Wunsch hin Dr. Lawrence ihre Idee unterbreitet hatte, als dieser für eine Kontrolluntersuchung seiner Lunge ins Haus gekommen war. Die Cunninghams wollten demnächst nach Camhurst übersiedeln, in die Hauptstadt von Großbreltain, die einen Tagesritt von Larrenton entfernt lag, und wollten vorbereitet sein. Und wie auch immer ihr Vormund ihr Anliegen dargelegt haben mochte, es hatte immerhin ausgereicht, um den Doktor heute hier erscheinen zu lassen.
Blass und sichtlich nervös. Unübersehbar von Fluchtgedanken getrieben.
»Bitte, lassen Sie mich erklären«, schaltete sich nun Jane selber ein. Dankbar stellte sie fest, dass sie mehr als ein Flüstern herausbrachte. Überrascht drehte sich der Arzt zu ihr um – seine Einwände blieben vorerst unausgesprochen.
Nun erschien auch Mr Cunningham im Türrahmen und lachte. »Ah, das erklärt, warum Sie aufgehalten wurden.«
»Es tut mir leid, ich wollte nicht … spionieren«, versicherte Dr. Lawrence schwach. »Miss Shoringfield.«
»Dr. Lawrence.« Grüßend neigte sie den Kopf. »Würden Sie mir zumindest gestatten, Ihnen meine Argumentation in Gänze darzulegen?«
Nun huschte der Blick des Arztes zwischen ihr und Mr Cunningham hin und her. Er wand sich wie ein in die Ecke gedrängtes Tier.
Sie ging das alles vollkommen falsch an. Sie hätte besser auf die Zeit achten und ihn im Salon empfangen sollen, wie Mrs Cunningham es am Vorabend geplant hatte. Aber nun waren sie hier.
Retten Sie mich, schickte sie einen stummen Hilferuf an Mr Cunningham.
»Der Brandy steht auf der Anrichte«, sagte er lediglich, offenbar unempfänglich für ihren verzweifelten Gedanken.
Und zog sich dann leise lachend zurück.
Jane und der Doktor musterten sich stumm, dann zeigte Jane möglichst einladend auf einen Sessel. Nach kurzem Zögern betrat der Arzt das Zimmer, blieb aber stehen. Jane kam hinter dem Schreibtisch hervor, ging zur Anrichte und machte sich daran, ihnen einzuschenken.
Während ihre Hände die Gläser füllten, legte sie sich ihre Argumentation zurecht und wählte als Auftakt den stärksten und zugleich für ihre Situation allgemeinsten Punkt auf ihrer Liste: »Die Ehe ist im Kern viel eher eine geschäftliche Vereinbarung als eine Herzensangelegenheit«, begann sie, ohne sich umzudrehen. »Weshalb es am besten ist, sie von Anfang an in aller Offenheit zu besprechen.«
Sie hörte, wie er überrascht nach Luft schnappte.
Immer noch zu viel. Aber sie wusste einfach nicht, wie sie es sonst anfangen sollte. Die Chance auf eine sanftere Strategie hatte sie bereits vertan.
Also verschloss sie die Karaffe und fuhr, noch immer mit dem Rücken zu ihm, fort: »Ich habe unsere Optionen sorgfältig abgewogen, Dr. Lawrence. Lässt man die üblichen Tanzveranstaltungen, für die Sie sicherlich keine Zeit haben, ebenso beiseite wie Bekanntschaften aus Kindertagen, zu denen ich schon seit Jahren keinen Kontakt mehr pflege, so bleiben uns nicht viele Möglichkeiten auf dem Heiratsmarkt. Deshalb verfolge ich den Ansatz gemeinsamer Interessen.«
Sie lauschte auf hastige Schritte, die seine Flucht verraten hätten.
Doch nichts dergleichen war zu hören.
»Gemeinsame Interessen«, wiederholte er stattdessen. »Welche gemeinsamen Interessen könnten wir haben? Wir sind einander noch nie begegnet.«
Ohne jeglichen Spott stellte er das fest, ohne Herablassung. Nur leise Neugier und eine gewisse Wachsamkeit schwangen in seiner Stimme mit. Jane hielt sich daran fest, drehte sich um und streckte ihm mit respektablem Abstand sein Glas entgegen. Er wich nicht zurück, sondern nahm es entgegen, achtete aber sehr genau darauf, dass ihre Finger sich nicht berührten.
»Wir sind beide unverheiratet und haben ein Alter erreicht, in dem dieser Umstand gewisse Fragen aufwirft«, erklärte sie ihm. »Ein Mann mit Ihrer gesellschaftlichen Stellung und Ihrem Auftreten hat die freie Auswahl unter den Damen. Was Sie nicht genutzt haben. Aus irgendeinem Grund haben Sie kein Interesse an einer normalen Ehe. Und ich möchte eine solche ebenfalls nicht eingehen.«
Mit einem prüfenden Blick versuchte sie, seine Reaktion abzuschätzen. Anfangs schien beinahe so etwas wie Sehnsucht in seinen Augen aufzublitzen, doch die wurde schnell wieder von Furcht verdrängt.
Warum?
Jane nippte an ihrem Brandy, um ihre Nervosität zu kaschieren.
»Ich kann Sie nicht heiraten«, sagte er.
Der Alkohol brannte in ihrer Kehle.
»Das ist nicht im Geringsten gegen Sie gerichtet, Miss Shoringfield«, fügte er schnell hinzu. »Auch wenn Ihre Argumentation durchaus … eindrucksvoll ist, so wäre es nicht angebracht für mich, den Bund der Ehe einzugehen. Egal mit welcher Frau.«
»Aber Sie sind unverheiratet«, widersprach Jane verwirrt.
»Das ist korrekt, ich bin unverheiratet«, stimmte er zu. Er presste die Kiefer zusammen, während er sich seine nächsten Worte zurechtlegte. Die Furcht in seinem Blick wurde von etwas anderem abgelöst … einer Art distanziertem Schmerz. »Bitte, Miss Shoringfield. Mir ist bewusst, dass Sie Ihren Vorschlag sicherlich gründlich durchdacht haben, aber ich möchte Ihnen weitere vergebliche Mühen ersparen. Ich muss Ihr Angebot ausschlagen.«
Höflichkeit und die guten Sitten verlangten von ihr, sich nun zu entschuldigen, die Absage hinzunehmen und sich zu fügen. Es bei dem nächsten Mann auf ihrer sorgsam erstellten Liste zu versuchen, der ebenfalls ihren Kriterien entsprach und vielleicht etwas zugänglicher war. Sie sollte freundlich lächeln und sich setzen, doch sie musste feststellen, dass sie es einfach nicht über sich brachte.
»Dr. Lawrence.« Krampfhaft schlossen sich ihre Finger um das Brandyglas. »Bitte.«
Er zog den Kopf ein.
»Meine Eltern sind gestorben, als ich noch klein war, während der ersten ruzkischen Gasangriffe auf Camhurst.« Sie unterbrach sich. Ihre Hände zitterten. Eigentlich hatte sie ihm das nicht sagen wollen; sie sprach nie über ihre Eltern. Doch ihre Aufrichtigkeit schien etwas in ihm zu bewirken, denn er hob den Kopf und zog betroffen die Augenbrauen hoch. Also fuhr sie fort: »Sie haben mich zu Beginn des Krieges in die Obhut von Mr Cunningham gegeben und mein Auskommen durch jährliche Zahlungen gesichert. Hier in Larrenton reichte das aus, um meine Kosten zu decken, selbst als ich ins heiratsfähige Alter kam. Allerdings verfüge ich über keinerlei Aussteuer, und nun ziehen die Cunninghams in wenigen Wochen nach Camhurst.«
Es fiel ihr nicht leicht, mit ruhiger Stimme weiterzusprechen. »Sollte ich sie dorthin begleiten – worum sie mich ausdrücklich gebeten haben –, würden die Lebenshaltungskosten dort mein jährliches Einkommen weit übersteigen, selbst wenn ich mich den gesellschaftlichen Verpflichtungen weitestgehend entzöge, was bei Mr Cunninghams neu errungenem Stand als Richter so gut wie unmöglich sein dürfte.« Und sie wäre dort von ausgebombten Häusern und Neubauten umgeben, die zu ersetzen versuchten, was zerstört worden war. Nicht einmal den Gedanken daran konnte sie ertragen. Doch das war zu persönlich, um es hier preiszugeben. »Sie wären bereit, die Differenz auszugleichen, aber ich bin nicht bereit, das zuzulassen.«
Der Doktor dachte kurz nach. »Da Sie aber als unverheiratete Frau nicht allein hierbleiben könnten …«
»Ganz genau. Will ich bleiben, muss ich mir einen Ehemann suchen, sonst würde das Leben hier noch schwieriger als in der Hauptstadt.«
Er schüttelte den Kopf, dann sah er sie offen an. »Ich verstehe, in welcher Misere Sie stecken, und ich fühle mit Ihnen, Miss Shoringfield, aber Sie haben doch noch andere Möglichkeiten. Sicherlich gibt es weitere Optionen. Sie sind …« Wieder röteten sich seine Wangen, und sie musste daran denken, wie er sie vorhin gemustert hatte: voller Furcht. Furcht vor ihrem Vorschlag, der wie ein Damoklesschwert über seinem Kopf schwebte, da er doch wusste, dass er ablehnen musste. Aber vielleicht war es nicht nur Furcht gewesen. Oder vielleicht war diese Furcht von anderer Natur gewesen, als sie zunächst angenommen hatte.
Er schluckte angestrengt. »Es dürfte Ihnen doch sicher nicht schwerfallen, einen passenderen Ehemann zu finden.«
»Sie sind ein mehr als passender Ehemann für mich.« Entschlossen trat sie einen Schritt vor. Nun waren sie einander so nahe, dass sie seine Atemzüge hören konnte. Die Wachsamkeit war aus seinem Blick verschwunden. Stattdessen schien er fasziniert zu sein. »Und ich bitte Sie hier nicht um Barmherzigkeit, Dr. Lawrence. Ich verfüge über Fähigkeiten, die Ihnen äußerst dienlich sein könnten.«
»Welche Fähigkeiten wären das?«
»Ich habe die Mädchenschule in Sharpton besucht, bis ich fünfzehn war«, erklärte sie ihm. »Und ich führe Mr Cunningham inzwischen seit sechs Jahren die Bücher. Ich kümmere mich um das Kontobuch, arbeite mit den Banken, helfe ihm dabei, seine Honorarsätze festzulegen und einzutreiben. Ich gehe davon aus, dass ähnliche Aufgaben auch in einer Arztpraxis anfallen.«
Er stieß überrascht den Atem aus. »Sie meinten es also nicht im übertragenen Sinne, als Sie sagten, diese Eheschließung sei eine geschäftliche Vereinbarung.«
»Der Fonds, aus dem ich meine jährlichen Zahlungen beziehe, dürfte nicht mehr ausreichen, um einen direkten Gewinn für Sie darzustellen«, fuhr sie fort, »aber ich bringe mathematische Fähigkeiten und ein methodisch denkendes Wesen mit. Ich kann die geschäftlichen Seiten Ihrer ärztlichen Tätigkeit regeln, so können Sie sich ganz auf das Medizinische konzentrieren.«
»Sie haben keine Ahnung vom Arztberuf, weder von der geschäftlichen noch von der medizinischen Seite.«
»Ich kann lernen. Ich möchte lernen.«
Noch immer überrascht hielt er inne. Dann erwiderte er beinahe linkisch: »Das bedeutet Blut, Trauer und Angst. Ein Teil davon zu sein … ist nicht einfach.« Es klang allerdings weniger wie eine Warnung, eher wie ein Test. Eine Einladung. »Dazu muss man berufen sein, nicht nur befähigt.«
»Kontobücher und Kalkulationen sind meine Berufung, so wie die Medizin die Ihre ist. Alles andere kann ich mir aneignen, wenn die wichtigste Grundvoraussetzung erfüllt ist.«
»Es ist ein undankbarer Beruf und ich werde oft nicht zu Hause sein. Nächtliche Notrufe und …«
»Aber wenn wir es als geschäftliche Vereinbarung betrachten«, unterbrach sie ihn, »wäre es eher eine Art Angestelltenverhältnis als eine Ehe. Es würde mich nicht stören, wenn Sie oft abwesend wären. Das passt perfekt.«
Er war von den professionellen Einwänden zu den gesellschaftlichen übergegangen; also machten sie Fortschritte. Jane hielt den Atem an.
Nachdem er hastig einen Schluck Brandy getrunken hatte, blickte der Doktor angestrengt zur Decke hinauf. Schließlich sah er sie an und sagte: »Sie wären viel allein. Ich verbringe die Nächte im Haus meiner Familie, einige Meilen außerhalb der Stadt. Und eine meiner Bedingungen wäre, dass Sie mich niemals dorthin begleiten. Das ist nicht verhandelbar.«
Jane bekam weiche Knie vor Erleichterung. Er zog es tatsächlich in Erwägung. Diesmal hatte er ihr keine klare Absage mehr erteilt. Mit etwas Mühe gelang es ihr, sich auf den Beinen zu halten, und sie rang sich ein Lächeln ab. »Wie gesagt: Sie würden mir hervorragend passen.«
Aus seinem Stirnrunzeln schloss sie, dass sie ihn schon wieder überrascht hatte. »Sie wussten davon?«
»Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen.« Er hatte seine Praxis in Larrenton erst vor gut zwei Monaten eröffnet, und Jane war dem Tratsch nun wirklich nicht zugetan, aber die Cunninghams wussten immer über jeden in der Stadt Bescheid. »Es ist allgemein bekannt, dass Sie einen Laufburschen beschäftigen, der Sie zu jeder Zeit in die Praxis holt, auch wenn die meisten glauben, es läge daran, dass Sie auch nachts oft bei Hausbesuchen sind. Nur sehr wenigen ist aufgefallen, wie lang und absolut unvermeidlich die Wartezeiten in solchen Fällen sind.«
»Sie sind tatsächlich eine gute Beobachterin«, stellte er fest.
Jane lachte.
Dies bewirkte seine abschließende Verwandlung: Die Angst fiel von ihm ab, und er richtete sich ein wenig auf, während er sie aufmerksam musterte.
»Ich sollte Sie nicht heiraten«, betonte er noch einmal, aber nun wohl eher der Form halber.
»Eine Chance«, bat Jane. »Geben Sie mir nur eine Chance, meinen Wert unter Beweis zu stellen. Ich werde Ihren Bedingungen zustimmen, wenn Sie meinen zustimmen.«
Er dachte kurz nach, dann nickte er. »Also schön. Kommen Sie zu mir in die Praxis und sehen Sie sich an, was genau Sie erwartet, nicht nur in der Theorie. Erst danach fällen wir eine verbindliche Entscheidung. Es wird wahrscheinlich blutig werden, und mit Sicherheit harte Arbeit.«
»Wann soll ich kommen?«
»Morgen Vormittag. Ziehen Sie etwas an, das schmutzig werden darf. Ich werde Ihnen alle Unterlagen zeigen, die Patientenakten, die Bücher, und Sie können dabei sein, wenn Patienten kommen. Denn obwohl die Mathematik Ihre Berufung ist, werden Sie dennoch auch eine Art Krankenschwester sein müssen, falls während meiner Abwesenheit jemand in die Praxis kommt.«
»Selbstverständlich. Dann sehen wir uns morgen, Dr. Lawrence. Ich werde mein Bestes geben, um mich zu beweisen. Und Sie können Ihr Bestes geben, um mich zu vergraulen.«
Kapitel Zwei
Jane hastete durch das Stadtzentrum zu Dr. Lawrences Praxis, dicht gefolgt von Ekaterina, dem Dienstmädchen der Cunninghams. Ekaterina bestritt tapfer die ziemlich einseitige Unterhaltung. Bevor sie nach Larrenton gekommen war, hatte sie in Camhurst gelebt und war nun überglücklich, dorthin zurückkehren zu können, noch dazu in einer besseren Anstellung als zuvor. Jane konnte es ihr nicht zum Vorwurf machen: In einer Kleinstadt wie dieser begegnete man einem Mädchen aus Ruzka nicht mit sonderlich viel Vertrauen – nicht einmal so viele Jahre nach Kriegsende –, doch es gelang ihr nicht, auch nur das geringste Interesse für sie aufzubringen.
Ihre Gedanken drehten sich ausschließlich um Dr. Lawrence und seine Praxis.
Sie war am Abend zuvor vollkommen aufrichtig gewesen, als sie ihm ihre Gründe für eine Heirat dargelegt hatte. Und sie war sich auch ziemlich sicher, dass er ihr geglaubt hatte. Das war schön. Konnte man Mrs Cunningham Glauben schenken, so hätten die meisten Männer wohl vermutet, dass sie in anderen Umständen war. Außerdem wären die meisten Männer wohl nicht bereit gewesen, ihren Wunsch nach einer rein geschäftlichen Verbindung zu akzeptieren, in der die zu erwartenden Intimitäten außen vor blieben.
Und doch hatte ihn eben diese Prämisse letztlich überzeugt. Wunder über Wunder!
Als sie sich der Tatsache gestellt hatte, dass eine Ehe bald ihre beste Option sein würde, war ihr klar gewesen, dass sie nur heiraten konnte, wenn diese Distanz gewahrt blieb. Zuvorkommendes Desinteresse, das wollte sie, keine unerwünschten Berührungen und eine Horde Kinder. Für Intimität war sie einfach nicht geschaffen. Sie war geschaffen für Zahlen. Für Arbeit.
Die Cunninghams waren da anders. In ihrem Beisein hatten sie sich stets vollkommen schicklich verhalten, aber Jane bemerkte durchaus, wie Mr Cunningham seine Frau ansah, registrierte die ungezwungenen Berührungen, wenn sie sich im Korridor begegneten. Als sie Jane auf Bitte ihrer Eltern bei sich aufgenommen hatten, mitten im Krieg, ihr jüngstes Kind schon beinahe erwachsen, waren sie offensichtlich noch sehr verliebt gewesen. Jane fand das bewundernswert, war sich aber der Tatsache bewusst, dass ihre Chancen, ebenfalls etwas Derartiges zu finden, äußerst schlecht standen. Sie war einfach nicht gut darin, die emotionalen Bande zu knüpfen, die für eine derartige Zuneigung vonnöten zu sein schienen. Nein, eine normale Ehe war nichts für sie – das würde nur ihre Nerven strapazieren, sie würde sich unwohl fühlen und letzten Endes voller Missgunst sein.
Doch da die Ehe an sich eine Notwendigkeit war, hatte sie beschlossen, sich einen Mann zu suchen, der es ihr gestattete, weitestgehend sie selbst zu bleiben. Und Dr. Lawrence, der fernab der Stadt lebte und jemanden brauchte, der in seiner Praxis die Stellung hielt, war schon beinahe zu perfekt. Ein Junggeselle – obwohl er bereits Anfang dreißig war, obwohl er Arzt war, obwohl er auf seine Art durchaus attraktiv war. Ein solcher Mann musste einen ebenso guten Grund für ein solches Arrangement haben wie sie. Dadurch befanden sie sich sozusagen auf Augenhöhe und konnten zu einer Vereinbarung gelangen, die für beide Seiten von Nutzen war.
»Miss Shoringfield!«, rief Ekaterina irgendwo hinter ihr. Jane blickte über die Schulter. Offenbar hatte sie das Mädchen auf ihrem Weg durch die Straßen beinahe abgehängt. Jane machte sich für eine Entschuldigung bereit.
Lächelnd kam Ekaterina heran. »Sie scheinen sich ja richtig zu freuen, Ma’am.«
Jane spürte, wie sie rot wurde. Ekaterina war erst vor einem halben Jahr zu den Cunninghams gekommen, hatte sich aber schnell eingelebt. Für viele Frauen wäre sie vermutlich eher eine Art Schwester geworden als ein Dienstmädchen. Liebenswert genug war sie jedenfalls.
Allerdings gab es da bei Jane ein Problem: Sie wusste nicht, wie man freundlich war. Höflich und zuvorkommend, das schaffte sie, auch Gespräche über arbeitsbezogene Themen bereiteten ihr keine Mühe. Aber freundliches Geplauder war ihr immer schon schwergefallen. Freundschaften zu schließen war ihr immer schon schwergefallen.
Als sie nun in einem etwas entspannteren Tempo weitergingen, antwortete Jane: »Für dich wird es in der Praxis sicher ziemlich langweilig werden.«
»Oh, ich hatte gar nicht vor, mit hineinzugehen«, erwiderte Ekaterina fröhlich. »Stattdessen kümmere ich mich um die Einkäufe und begleite Sie dann später wieder nach Hause, wenn’s recht ist?«
»Das klingt angemessen.« Eine jüngere, reichere Frau hätte vielleicht eine Anstandsdame gebraucht, aber im Laufe der letzten Jahrzehnte hatte sich die Welt stark gewandelt. Und abgesehen davon handelte es sich hier ja um eine Geschäftsvereinbarung und keine klassische Brautwerbung.
Sie gingen zusammen weiter. Zwischen dem Haus der Cunninghams und der Arztpraxis lagen vor allem Wohnhäuser, in denen sich vereinzelt Ladenlokale befanden. Die Gebäude hier stammten fast alle mindestens aus dem letzten Jahrhundert, allerdings gab es auch ein paar neuere, aus glattem Beton gebaut anstelle von Ziegel oder Stein, ohne die ausgebleichten Figuren, die man früher zum Schutz des Hauses in den Türsturz geschnitzt hatte. Auch bei den Cunninghams prangte ein von Flügeln eingerahmtes Gesicht über dem Eingang. Als Kind war Jane von der Darstellung fasziniert gewesen. Es erinnerte sie an die Wasserspeier, die in Camhurst an den Dächern geprangt hatten, allerdings waren die nur aufgemalt gewesen. Die hiesigen Figuren waren aus Holz.
Zusammen mit Ekaterina bog sie ein letztes Mal ab und landete auf einer der Hauptdurchgangsstraßen von Larrenton, auf der bei diesem schönen Wetter bereits geschäftige Betriebsamkeit herrschte. Landarbeiter, Ladenbesitzer, ihre Kunden und Besucher von außerhalb drängten sich durcheinander. Auch wenn Larrenton klein genug war, um mit einem einzigen Arzt auszukommen, war es dennoch ein florierendes Städtchen. Auf der anderen Straßenseite stieg gerade eine kleine Gruppe schwarz gekleideter Einsegnerinnen aus einer umgebauten Konventskutsche und betrat die Eingangshalle einer Pension.
Jane beobachtete sie einen Moment lang, registrierte ihre selbstsichere Haltung, den eleganten Schwung ihrer Röcke. Hätten die Cunninghams sie nicht aufgenommen, wäre sie heute vermutlich eine von ihnen. Zwar verschrieben sie sich heutzutage keinen kirchlichen Strukturen und Ritualen mehr, aber diese Frauen hatten sich schon immer um die Toten gekümmert, und viele Waisenkinder hatten in ihrem Orden Zuflucht gefunden.
Vielleicht hätte ihr ein solches Leben gefallen.
Ekaterina jedoch war nicht stehen geblieben, um die Frauen zu beobachten, und so musste Jane sich nun beeilen, um sie einzuholen. Wenige Häuser noch, dann hatten sie die Praxis erreicht. Jane wurde immer langsamer, je näher sie der Tür kamen, und drehte sich schließlich zu dem Dienstmädchen um. »Du kommst dann in ein paar Stunden hierher zurück? Bis dahin dürfte die Arbeit erledigt sein, vermute ich.« Zumindest der Teil, den sie als Ungelernte leisten konnte.
»Jawohl, Ma’am.« Ekaterina nickte ihr noch einmal zu, dann ging sie in Richtung Hauptstraße davon. Jane blickte ihr nach, bevor sie sich der Praxis zuwandte.
Vor dem Eingang gab es keine Stufen, damit verletzte oder gebrechliche Patienten den Doktor leichter aufsuchen konnten. Die Tür selbst war sehr breit und dunkelrot gestrichen, tief eingelassen in die Ziegelmauer des zweistöckigen Hauses. Auch hier gab es Schnitzereien, ähnlich wie bei den Cunninghams, allerdings war dieses geflügelte Gesicht von eingekerbten Lorbeerranken eingefasst, und an den Seiten des Türrahmens zog sich eine verwitterte, beinahe unleserliche Inschrift entlang. Ein altes Gebäude, erbaut für einen früheren Arzt aus früheren Zeiten, geprägt durch den dazugehörigen Glauben.
Aber Dr. Lawrence war jung, hatte in Camhurst studiert und hielt vermutlich nicht viel von derlei Aberglauben. Jane fragte sich, ob er die Schnitzereien abschleifen oder übermalen lassen würde.
Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass ihr Haar unter dem schwarzen breitkrempigen Hut noch immer ordentlich hochgesteckt war, klopfte sie an die Tür.
Einen Moment später öffnete ihr der Hausdiener, ein älterer Mann, der früher vielleicht ein Lohnarbeiter oder sogar ein Preisboxer gewesen sein mochte, was sich aus seinem gedrungenen Körperbau und der blassen Narbe an seiner Wange schließen ließ, die eine Kerbe in seinen feinen Bartschatten schnitt. Ein freundliches Lächeln breitete sich auf seinen von der Kälte geröteten Wangen aus. Jane vermutete, dass ihre eigene Nase inzwischen leuchtend rot war.
»Miss Shoringfield?«, fragte er.
»Jawohl«, antwortete sie, angenehm überrascht, hier gleich mit Namen angesprochen zu werden. »Der Doktor hat mich gebeten, ihm heute behilflich zu sein.«
Der Mann trat einen Schritt zurück und bat sie herein. »Er hat oben noch etwas zu erledigen, lässt Ihnen aber ausrichten, dass Sie sich gerne umschauen können. Nur fassen Sie bitte im Operationssaal nichts an. Ich habe allerdings auch Tee aufgesetzt, falls Sie sich nicht sofort den garstigen Seiten des Geschäfts zuwenden möchten. Der Schlachterjunge hat auch ein paar Würstchen vorbeigebracht. Darf ich Ihnen Hut und Mantel abnehmen?«
Jane spürte, wie sie sein Lächeln automatisch erwiderte, wohl angesteckt von seiner Freundlichkeit. Dr. Lawrence galt als still, zurückhaltend, undurchschaubar und wenig gesellig, dabei aber durchaus freundlich und angenehm. Für seinen Hausdiener schien das ebenfalls zu gelten, was auf eine gute Menschenkenntnis des Doktors schließen ließ.
»Oh, vielen Dank, aber ich denke, ich sollte meinem Magen für den heutigen Tag nicht zu viel Munition verschaffen«, erwiderte sie, während sie das Haus betrat. Sie knöpfte ihren weinroten Mantel auf und übergab ihn zusammen mit ihrem Hut dem Hausdiener, wobei sie sich bereits neugierig umsah. Schon hier im Eingangsbereich schlug ihr ein scharfer, abgestandener Geruch entgegen, den sie zu ignorieren versuchte, auch wenn ihr Magen ihr eine leise Warnung schickte. Bücher. Mit Büchern konnte sie umgehen, aber nicht mit Blut. Immerhin konnte sie hoffen, dass die meisten Patienten wegen einer Magenverstimmung oder ähnlicher Beschwerden hierherkamen, die sich durch einen Blick in die Akten und ein kurzes Gespräch klären ließen, wenn sie erst richtig hier arbeitete. Die Schwerkranken waren ja sicher ans Haus gebunden.
Nahm sie zumindest an.
»Wie heißen Sie?«, erkundigte sie sich nun bei dem Hausdiener.
»Mr Lowell.« Er nickte grüßend.
»Und Sie holen ihn, wenn er nicht in der Stadt ist, richtig?«
»Jawohl. Außerdem gehe ich ihm zur Hand, wenn schwerere Patienten bewegt werden müssen, kümmere mich um die Vorratshaltung in der Küche, solche Dinge. Wobei ich wohl davon ausgehen kann, dass künftig auch Sie eine Hilfe in der Küche sein werden, richtig?«
Jane wurde rot. »Hat er das gesagt?«
Mr Lowell lachte leise. »Mehr oder weniger. Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass er einmal Gefallen an jemandem finden würde.«
Gefallen an ihr finden? Oh nein. Nun regte sich ihr Bauch auf ganz andere Art und Weise, und sie drückte unwillkürlich die Hand auf die Magengegend, um dem Einhalt zu gebieten.
Mr Lowells Blick folgte ihrer Hand.
Mit brennenden Wangen ließ sie den Arm sinken. So gab sie vielleicht noch Anlass zu Gerüchten über andere Umstände, und das konnte sie keinesfalls zulassen. »Nun, wenn ich ebenfalls ehrlich sein soll: Wir sind uns gestern Abend zum ersten Mal begegnet.«
»Tatsächlich?«
Wie viel sollte sie preisgeben? Er hatte nichts von dem geplanten Ehearrangement gewusst und wusste nun, dass sie nicht schwanger war – zumindest nicht vom Herrn Doktor. Ihrer Meinung nach gab es für ihn damit nicht mehr zu wissen. »Ja, merkwürdig, nicht wahr? Eigentlich hatte ich nie vor, Krankenschwester zu werden«, erwiderte sie, während sie den Flur hinunterging. Ein Themenwechsel war angebracht. »Befindet sich sein Büro auf diesem Stockwerk?«
»Ja, die erste Tür rechts.«
»Ist es mir gestattet hineinzugehen?«
»Er wünscht es sogar, da Sie sich bestimmt die Bücher ansehen möchten.«
Jane verkniff sich ein zufriedenes Lächeln. Seine Kooperationsbereitschaft war ein gutes Zeichen, außerdem fühlte sie sich dadurch hier willkommen. Hoffnungsvoll. Vielleicht deutete ja nur Mr Lowell zu viel in ihre Zusammenarbeit hinein. In jedem anderen Fall wäre es ein Zeichen von Zuneigung gewesen, wenn ein Mann sich einer jungen Frau gegenüber so zugänglich gezeigt hätte.
»Vielen Dank, Mr Lowell. Ich denke, ich werde nun gut zurechtkommen, und ich habe Sie wirklich lange genug von Ihrer Arbeit abgehalten.«
»Gar kein Problem, Miss.« Er nickte ihr noch einmal freundlich zu, dann verschwand er durch eine Tür, hinter der sie den Operationssaal vermutete. Der stechende Geruch wurde stärker, als er einen Türflügel aufstieß, um hindurchzugehen.
Jane sah sich noch einmal im Eingangsbereich um. Porträts suchte man hier vergeblich, lediglich ein oder zwei Landschaftsbilder zierten die Wand vorne an der Tür, wo offenbar der Wartebereich war. Doch es gab gerahmte Fotografien von merkwürdig anmutenden Gegenständen. Die Daguerreotypie, die ihr am nächsten hing, schien ein knorriges Holzstück abzubilden. Sie betrachtete es verwirrt, dann betrat sie das Büro.
Die Tür stand offen und dahinter befand sich ein vollkommen normaler, sauberer Raum. Dr. Lawrence verfügte über einen recht großen Schreibtisch, auf dem ein noch größeres Chaos herrschte als bei Mr Cunningham, doch abgesehen davon war hier alles blitzblank. Vor dem Tisch standen zwei Stühle und hinten am Fenster ein großer Sessel, davor ein gepolsterter Schemel, auf dem man die Füße ablegen konnte. Die Wände waren, abgesehen von einigen Bücherborden und Schränken hinter dem Schreibtisch, vollkommen kahl.
Nachdem sie ihre Lesebrille aufgesetzt hatte, verschaffte sich Jane einen Überblick über die herumliegenden Unterlagen. Auf jedem Blatt war in der rechten oberen Ecke ein Name vermerkt, und als sie die Schränke öffnete, fand sie darin ordentliche Reihen mit kleinen Akten, ebenfalls mit Namen gekennzeichnet, dazu mehrere vorgedruckte Seiten. Aha. Auch auf dem Schreibtisch fand sie einige dieser Vordrucke, teilweise mit ordentlich niedergeschriebenen Vermerken und den gleichen Namen wie auf den unbedruckten Notizzetteln. Offensichtlich war er dabei, die entscheidenden Befunde in ein ordentlicheres System zu übertragen.
Ziemlich schlau und äußerst hilfreich für sie.
Bevor sie sich allerdings in diese Lektüre vertiefen konnte, war ein wenig Organisation vonnöten. Also machte sie sich daran, die Blätter ordentlich aufzustapeln und das zusammenzusuchen, was auf den Boden gefallen war. Gerade als sie mit dem Gedanken spielte, sich nun doch den von Mr Lowell angebotenen Tee zu gönnen, räusperte sich jemand an der offenen Bürotür.
»Dr. Lawrence.« Hastig erhob sie sich von seinem Schreibtischstuhl, ein wenig schuldbewusst, als hätte sie in seinem Badezimmer herumgeschnüffelt. Er schien jedoch nicht verärgert zu sein, als er nun hereinkam und die von ihr geschaffenen Stapel musterte; eher ein wenig beschämt.
»Wie Sie sehen«, begann er, »wären Ihre Fähigkeiten hier höchst willkommen. Rein hypothetisch natürlich. Falls Sie das, was Sie hier vorgefunden haben, noch nicht zu sehr abgeschreckt hat.«
»Wohl kaum.« Sie nahm die Schultern zurück. »Wo ist denn Ihr Kassenbuch? Das Verzeichnis der eingehenden Honorare?«
»Ich habe keines.«
Stumm starrte sie ihn an, bis er abwehrend die Hände hob. »Ich will mir ja eines anschaffen, aber da ich immer erst zum Jahresende abrechne, wollte ich dann alles mithilfe meiner Notizen nachtragen.«
»So entgeht Ihnen aber eine ganze Menge Geld, das sowieso schwer einzutreiben sein dürfte. Und ganz abgesehen davon müssen Sie doch regelmäßig Ihren Bestand an Verbrauchsartikeln neu aufstocken. Mr Cunningham hat wesentlich weniger Ausgaben als Sie, und er rechnet alle zwei Monate ab. Ich verlange tägliche Arbeitsprotokolle von ihm, die alles wesentlich einfacher und genauer machen. Gegen eine minutengenaue Aufstellung hat er sich gesträubt, aber eine Liste seiner erstellten Dokumente – oder in Ihrem Fall der durchgeführten Behandlungen – ist wirklich nicht schwer zu führen.«
Einen Moment lang blickte er sie sprachlos an, dann schüttelte er verblüfft den Kopf. »Sie sind in dieser Hinsicht wirklich sehr talentiert, oder?«
»Ich habe eine Menge Übung. Sicherlich verstehen Sie den Unterschied.«
»Unterschiedlich mag beides sein, aber doch auch eng verbunden.«
Jane spürte, wie sich bei dem Kompliment ihre Wangen röteten, also begann sie, auf und ab zu gehen, um ihre Verlegenheit zu überspielen. »Haben Sie wenigstens eine Liste der Medikamente, die Sie verschrieben haben?«
»Das steht in den Patientenakten.«
»Nein, ich meine eine Bestellliste. Wie behalten Sie den Überblick über Ihren Bestand?«
Er tippte sich an die Stirn. »Mithilfe der uralten Kunst des Nachsehens.«
»Das ist absolut inakzeptabel.«
»Ohne eine helfende Hand wie Ihre sind Maßnahmen dieser Art zwar sehr klug, zeitlich für mich aber kaum machbar. Mein Ziel ist es, irgendwie über die Runden zu kommen, indem ich anderen dabei helfe, am Leben zu bleiben, Miss Shoringfield. So einfach ist das.«
»Tja, jetzt haben Sie ja mich.«
Die Worte waren ausgesprochen, bevor sie sich ihrer Bedeutung ganz bewusst war, und so presste sie nun die Lippen zusammen und straffte die Schultern, um die brennende Verlegenheit in ihrem Inneren zu kaschieren. Zu viel.
Dr. Lawrence wandte sich ab und zupfte an seinem Kragen. »Nun, Sie haben mich sicherlich davon überzeugt, dass ich Sie einstellen sollte«, sagte er. »Aber eine Heirat …«
»… ist im Grunde nichts anderes.«
»Und ob«, widersprach er. »Ich weiß ja nicht, für welche Art von Mann Sie mich halten, aber ich würde niemals … eine von mir beschäftigte Schwester … dieser Grad an Intimität … Das ist beleidigend, Miss Shoringfield.« Allerdings klang er nicht beleidigt. Er klang …
Verwirrt.
Frustriert.
Ganz offensichtlich hatte er seit ihrem gestrigen Gespräch gründlich erwogen, was eine Heirat mit sich bringen würde. Und sie hätte erleichtert darüber sein sollen, dass er ebenfalls eheliche Intimität weder für angebracht noch erstrebenswert hielt. Doch stattdessen spürte sie nun brennende Röte auf ihren Wangen. Am besten schafften sie diese Angelegenheit ein für alle Mal aus der Welt. Sie nahm ihre Brille ab und putzte sie an ihrem Ärmel. »Die Ehe müsste wohl vollzogen werden, um rechtliche Gültigkeit zu erlangen«, gab sie zu.
Mit einem erstickten Keuchen fuhr Dr. Lawrence zu ihr herum und starrte sie fassungslos an. »Vermutlich«, ächzte er.
»Doch ich bin mir sicher, dass wir einen Weg finden werden, um die gesetzlichen Erfordernisse mit unseren Vorstellungen der Ehe in Einklang zu bringen. Wenn Sie allerdings der Meinung sind, ich hätte gestern Abend irgendetwas falsch dargestellt …«
Sie wurde von einem lauten Klopfen an der Eingangstür unterbrochen, gefolgt vom Schellen der Türglocke und Mr Lowells schnellen schweren Schritten im Flur. Von draußen war ein unterdrückter Schmerzensschrei zu hören. Sofort verschwand die sorgenvolle Verwirrung aus der Miene des Arztes, sein Gesicht wurde ausdruckslos, in seinen Augen leuchtete nur noch absolute Konzentration. Er krempelte die Ärmel auf.
»Miss Shoringfield.« Auch seine Stimme klang nun vollkommen anders. »Bitte gehen Sie hinüber in den Operationssaal. Lassen Sie beide Türflügel weit offen. Sie finden dort Schürzen und Kittel, halten Sie einen davon für mich bereit.«
»Ich …«
Die Eingangstür wurde geöffnet und Jane hörte einen Schrei.
»Unverzüglich, Miss Shoringfield.«
Kapitel Drei
Jane hastete durch den Flur zum Operationssaal hinüber. Mr Lowell hatte den einen Türflügel bereits geöffnet, nun zog sie auch den zweiten weit auf. Eine helle, in panischer Hast sprechende Frauenstimme drang zu ihr herein, während sie nach den Kitteln und Schürzen suchte. Als sie sie endlich auf einem Garderobenständer in der Ecke entdeckte, zerrte sie einen Kittel vom Haken und wandte sich dann der Tür zu, durch die der Lärm nun deutlich zu hören war.
Mr Lowell und ein zweiter Mann trugen den schreienden Patienten herein, einen grobknochigen, breitschultrigen Arbeiter, der sich den Bauch hielt. »Holt es raus!«, heulte er. »Holt es raus, das wollte ich nicht!« Zwischen seinen Fingern quoll Blut hervor, lief über das bereits rot durchtränkte Hemd und tropfte auf den Boden.
Jane wurde von leichtem Schwindel erfasst, doch sie biss die Zähne zusammen, wild entschlossen, sich auf den Beinen zu halten.
Hinter dem Mann stand eine ältere Frau und krallte ihre Finger in Dr. Lawrences Unterarm. »Ich habe gehört, wie er in der Werkstatt aufgeschrien hat«, stammelte sie. »Er hatte das Messer in der Hand und hat geschnitten, ich weiß nicht …«
»Holt es raus!«, brüllte der Mann wieder und schlug wild um sich. Beinahe hätte Mr Lowell ihn losgelassen.
Dr. Lawrence wandte sich der Frau zu, sprach leise auf sie ein und deutete mit dem Kopf Richtung Tür. Dann löste er ihre Finger von seinem Arm – so langsam, dass Jane am liebsten zusammen mit dem Patienten geschrien hätte. Endlich war er frei und die Frau verschwand draußen im Flur.
Nun kam er zu ihr herüber, während Mr Lowell und der freiwillige Helfer den blutenden Mann auf den Behandlungstisch hoben.
Zitternd streifte Jane dem Doktor den Kittel über den Kopf, er drehte sich um, und sie band ihn an den Seiten zusammen. Dann nahm er ihre Hand und führte sie zu einer Schale, die bis zum Rand mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt war.
»Desinfektionsmittel. Waschen Sie sich die Hände, Miss Shoringfield, und zwar gründlich. Vergessen Sie auch die Nägel nicht.«
Sie befolgte seine Anweisung und drehte sich dann wieder zum Tisch um. Mr Lowell hatte den Patienten an Brust, Beinen und Handgelenken mit Gurten fixiert. Der freiwillige Helfer sah stumm zu, wie der Verletzte sich heulend gegen die Fesseln aufbäumte. Inzwischen nahm Mr Lowell die Schutzhaube von einem Tablett mit Operationswerkzeugen.
»Mr Rivers«, wandte sich Dr. Lawrence an den Helfer, der sich nur mühsam vom Anblick des Patienten lösen konnte. »Bitte gehen Sie hinaus. Miss Shoringfield, zu mir.« Irgendwo in ihrem Hinterkopf blitzte der Gedanke auf, dass sie sich selbst keinen Kittel angezogen hatte, doch ein Blick auf den Patienten machte deutlich, warum der Doktor sie auch nicht daran erinnerte.
Sie hatten nicht mehr viel Zeit.
Unter dem durchnässten, zerrissenen Hemd des Mannes war eine tiefe Wunde zu erkennen. Zwar hatte ihm jemand einen provisorischen Verband um den Bauch gewickelt, den aber hatte er halb abgerissen, sodass die Ränder nun auf das verletzte Fleisch drückten. Dr. Lawrence hatte die Lage in Sekundenschnelle erfasst.
»Miss Shoringfield, ich brauche Ihre Hände«, befahl er knapp. Bevor sie nachfragen konnte, packte er ihre Hand und positionierte sie an der Oberkante der Bauchwunde, die Finger um den Wundrand gelegt. Sie hielt sie dort, obwohl der Mann wieder laut aufbrüllte und die nasse, glitschige Haut ihr zu entgleiten drohte. Nun legte Dr. Lawrence ihre zweite Hand an die andere Seite der Wunde. »Halten Sie die Wunde offen. Mr Lowell, Hände waschen, dann bringen Sie mir die Spülspritze.«
Er nahm eine Schere und machte kurzen Prozess mit dem Hemd des Patienten, anschließend löste er das verbliebene Verbandsmaterial von der Wunde. Janes Finger begannen zu zittern. Blut lief über ihre Hände, drang unter ihre Fingernägel. Und es stank. Bei allen Geistern, wie es stank. Nie zuvor hatte sie so viel Blut gesehen, heiß und glitschig war es, und mit jedem verzweifelten, hektischen Herzschlag des Patienten sammelte sich mehr davon zwischen den aufklaffenden Hautlappen. Noch immer war der Mann bei Bewusstsein, noch immer schrie er, noch immer bewegte er sich. Bei jedem Atemzug hob und senkte sich das Innere der Wunde.
Mr Lowell kehrte an den Operationstisch zurück und reichte Dr. Lawrence eine Glasröhre, die an einem Ende mit einer Gummiblase verschlossen war. Durch gleichmäßigen Druck auf die Blase spritzte Dr. Lawrence Wasser in die Wunde und spülte das Blut heraus.
Darunter kamen glänzende, unterschiedlich gefärbte Stränge zum Vorschein. Sie sahen aus wie Seile oder Würste. Bittere Galle stieg in Janes Kehle auf.
Bis jetzt hatte sie nicht gewusst, wie ein Mensch von innen aussah. Wie Fleisch. Es sah aus wie grässliches, brutal zerrissenes Metzgerfleisch.
»Er hat komplett durchgeschnitten.« Dr. Lawrence schimpfte nicht, und er hielt auch nicht entsetzt inne. Vielmehr klang seine Stimme ruhig, beinahe kühl, sodass man meinen konnte, ihn interessiere das alles gar nicht. Doch in Wahrheit war es eine sorgsam vorgebrachte Feststellung, eine simple Wahrheit, die Jane in diesem Moment dabei half, einen klaren Kopf zu behalten.
Er konnte das richten.
Er musste das richten.
Der Doktor ging zum Kopf des Patienten und drückte ihm ein in Äther getränktes Tuch auf Mund und Nase. Die Dämpfe waren so stark, dass sie auch noch in Janes Nase brannten. Das wilde Aufbäumen ließ nach, und das zu einem nicht enden wollenden, stetigen Hintergrundgeräusch gewordene Geschrei verwandelte sich in ein leises, dumpfes Stöhnen. Als Dr. Lawrence das Tuch anhob, sah er Jane direkt in die Augen.
Nun wird er mich fragen, ob ich das schaffe, dachte sie. Bitte, fragen Sie nicht. Denn sollte er die Frage stellen, musste sie mit Nein antworten. Solange er aber schwieg, solange er einfach davon ausging, dass sie zurechtkam, würde sie blind seinen Anweisungen folgen.
Dr. Lawrence nickte ihr kurz zu, dann trat er wieder an ihre Seite.
»Mr Lowell, die Wundhaken.« Der Arzt sprach leise, doch im Raum herrschte nun sowieso Stille; alle hielten den Atem an. Mr Lowell reichte ihm zwei Metallinstrumente, die an einer Seite gebogen und an der anderen zu Schlaufen geformt waren. Geschickt schob der Arzt die Haken in die Wunde und drückte Janes Hände auf die Griffschlaufen. Im ersten Moment konnte sie das Metall nicht halten, es schien eisig kalt zu sein nach dem brennend heißen Fleisch des Patienten. Doch es war eine Erleichterung, kein frisches Blut mehr an den Fingern zu spüren. Jane packte zu und zog auf Anweisung des Arztes die Wundränder ein wenig weiter auseinander.
»Was zum …?«, murmelte er.
Unwillkürlich beugte sich Jane vor.
Da der Weg nun frei war, griff Dr. Lawrence in den Bauch des Mannes hinein und schob sanft die glänzenden Eingeweide beiseite. Vorsichtig tastete er sich zu einer verdickten Stelle vor, die auf den ersten Blick ebenso verschlungen zu sein schien wie der Rest. Nein, das stimmte nicht ganz. Zwar schienen die Gedärme hier ähnlich gerollt zu sein, doch an der Stelle, an der sie sich um sich selbst zu schlingen schienen, wuchsen sie offenbar in sich hinein, ohne dass eine Überlappung zu erkennen war. Das Fleisch verschmolz an dieser Stelle nahtlos, und unter der Oberfläche war ein beweglicher Schemen auszumachen, wie ein Körper unter einem Leichentuch. Jane gelang es kaum, das Bild zu erfassen, immer wieder schien es sich zu winden und ihr zu entgleiten.
»Was hast du dir nur angetan?«, flüsterte Dr. Lawrence.
Zum ersten Mal glaubte sie Unsicherheit in seiner Stimme zu hören.
Doch seine Hände waren ruhig und sicher, als er nun mit grimmiger Miene begann, das pervertierte Fleisch vom umliegenden Gewebe abzutrennen und das größere Organ freizulegen, bis es glatt vor ihnen lag. »Vielleicht war es ein Segen, dass er versucht hat, sich selbst aufzuschneiden. Wäre das unbemerkt geblieben, wäre er vermutlich innerhalb weniger Tage an einer Sepsis gestorben.« Er hob das verschlungene Gewebe aus dem Patienten heraus und legte es beinahe liebevoll beiseite. Jane starrte das Ding an, während Dr. Lawrence zu Nadel und Faden griff. Es wirkte nicht so, als wäre es abgestorben. Nein, es wirkte lebendig. Blut klebte daran, und sie glaubte zu sehen, wie es sich bewegte.
»Miss Shoringfield, bitte mehr Zug auf die Wundhaken«, mahnte Dr. Lawrence.
Sie zwang sich, den Blick wieder auf den Patienten zu richten, und beobachtete, wie der Arzt zunächst einen tiefer liegenden Riss im Gedärm vernähte und dann das befreite Darmstück durch den Schnitt, den der Patient sich selbst zugefügt hatte, wieder ins Körperinnere schob. Auf seine Anweisung hin löste sie die Wundhaken und sah dann fasziniert zu, als sich unter Dr. Lawrences präzisen Stichen erst die unteren Membranen und dann die Haut des Mannes wie durch ein Wunder wieder schlossen. Wie ein Meister seines Faches arbeitete er, wie ein Künstler, so voller Selbstvertrauen, dass sie regelrecht bezaubert war.
Als der Patient laut aufstöhnte, verflog der Zauber. Janes Körper drohte zu rebellieren.
»Nehmen Sie sich ein Tuch, tränken Sie es mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit seine Haut ab. Machen Sie ihn so sauber wie irgend möglich. Das wird die Heilung beschleunigen«, erklärte ihr der Arzt ruhig.
Arbeit. Arbeit half. Sie holte sich das Tuch und begann am unteren Rand des Brustkorbes, dann tupfte sie sanft um die Wunde herum. Als dort alles sauber war, machte sie mit den Händen des Mannes weiter, zog feine Stofffasern unter seinen kurzen Nägeln hervor. Er schlief jetzt. Schmerz und Erschöpfung zeichneten sich auf seinem Gesicht ab, doch insgesamt wirkte er recht friedlich.
Nachdem sie auch noch den Schmutz von seiner Stirn abgewischt hatte, beobachtete sie wieder den Doktor bei der Arbeit. Er war noch immer über den Torso des Patienten gebeugt und vernähte noch einige kleinere Schnittwunden. Plötzlich hob er den Kopf, als hätte er ihren Blick gespürt.
»Wir haben hier gute Arbeit geleistet«, sagte er lächelnd. »Sie haben dabei geholfen, sein Leben zu retten.«
Goldene Wärme breitete sich in ihrer Brust aus, und sie spürte, wie sie zu zittern begann – zum ersten Mal, seit sie ihre Hände auf die blutenden Eingeweide des Mannes gelegt hatte. »Oh«, sagte sie schwach.
Dr. Lawrence tränkte einen Schwamm mit frischem Desinfektionsmittel und legte ihn auf eine verbliebene Öffnung im Bauchraum des Mannes, unter der sich die Gedärme wölbten. Wenige Minuten später hatte er seine Arbeit beendet, trat vom Tisch weg und ging zum Waschbecken hinüber. Jane folgte ihm, da sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte.
»Sie waren gut«, stellte er fest, während er mit dem Ellbogen das Wasser aufdrehte und sich anschließend das Blut von den Händen wusch. »Kommen Sie, machen Sie sich sauber. Ich hätte Ihnen sagen sollen, dass Sie einen Kittel überziehen müssen, aber wahrscheinlich dachte ich, Sie würden … nun ja. Viele wären wohl bereits auf halber Strecke zusammengeklappt. Aber ich hatte Sie ja gewarnt: Es ist oft ein blutiges Geschäft.«
Wieder blickte Jane zum Tisch hinüber. Der Patient sah nun wieder beinahe unversehrt aus und schlief fest. Man hätte meinen können, Dr. Lawrences Eingriff sei pure Zauberei gewesen.
»Das war unglaublich«, sagte sie und musterte eingehend sein Gesicht, seine ruhigen Hände. »Ich wusste nicht, dass solche Operationen überhaupt möglich sind.«
»Meistens sind sie das auch nicht. Ich wurde von den besten Lehrern Großbreltains ausgebildet.« Aus seinem Mund klang das weder hochmütig noch prahlerisch.
»Was ist mit dem Mann geschehen? Dieses Ding, das sie entfernt haben, was war das?«
»Eine Fehlbildung des Dickdarms, hervorgerufen durch … irgendetwas. Ich werde einen Spezialisten kommen lassen.«
»Aber er wird doch durchkommen, oder? Nachdem Sie es nun entfernt haben, nachdem Sie …« Jane verstummte. Weder kannte sie die richtigen Worte, noch reichte ihr Wissen aus. Stumm deutete sie mit dem Kopf auf den Bauch des Mannes, auf die abgedeckte Öffnung.
»Der Schwamm soll die Flüssigkeiten aufnehmen, die aus dem Verdauungstrakt austreten. Wird die Wunde sauber gehalten, müsste sich das Gewebe mit ein bisschen Glück schließen, und er kann noch viele Jahre leben. Aber dies ist keine Amputation, wo wir genau wissen, was wir tun, und unsere Patienten in den meisten Fällen überleben. Ich hoffe aber, dass er es schafft.« Er ließ den Kopf hängen und einen Moment lang schlossen sich seine Finger krampfhaft um den Rand des Waschbeckens.
Jane ging zu ihm hinüber und unterdrückte den überraschenden Impuls, ihm tröstend die Hand auf die Schulter zu legen. »Wir haben gute Arbeit geleistet«, wiederholte sie das, was er zuvor gesagt hatte.
Mit einem schmalen, dankbaren Lächeln sah er sie an.
Ihr Herz machte einen merkwürdigen, unkontrollierten Satz.
Sie waren allein im Operationssaal. Mr Lowell war gegangen, ohne dass sie es bemerkt hatte. Sie versuchte, sich auf den Gestank von Blut und Eingeweiden zu konzentrieren, auf den scharfen Geruch des Desinfektionsmittels, den Hauch von Äther, der noch in der Luft hing. Auf alles außer ihn, denn nach diesem schockierenden Grauen war sein Lächeln plötzlich viel zu intim, regelrecht berauschend.
»Wie fühlen Sie sich? Falls Ihnen unwohl ist, hole ich einen Stuhl.« Prüfend musterte er ihr Gesicht und bemerkte dabei sicherlich ihre Verwirrung, die er wohl als Schwäche deutete. Vermutlich wartete er nur darauf, dass sie ihm mitteilte, sie könne nun doch nicht die Frau eines Arztes werden.
»Ich fühle mich …« Unangemessen. Es war unangemessen, ihn in diesem Moment so anzustarren. Doch darunter verbargen sich noch andere Gefühle. Ganz leicht fühlte sie sich, als würde sie schweben, gleichzeitig aber auch hundemüde, regelrecht ausgelaugt, und sie wusste, dass auch das Grauen sie noch nicht ganz verlassen hatte. Ihre Haut brannte, wo sie noch immer mit Blut bedeckt war.
»Sie fühlen sich lebendig«, half ihr der Doktor aus. »Was manchmal ein schier überwältigendes Gefühl sein kann. Sie sollten sich waschen und sich dann ein wenig in mein Büro setzen. Sobald der Patient im Aufwachraum ist, soll Mr Lowell Ihnen frische Sachen besorgen.«
Erst jetzt bemerkte Jane die großen, teils noch feuchten Blutflecken auf ihrem Kleid. Unter ihren Fingernägeln hatten sich dunkle Ränder festgesetzt, in den Falten ihrer Handflächen ebenfalls. Mit einem kurzen Kopfschütteln ging sie zum Waschbecken und fing mechanisch an, sich mit dem eiskalten Wasser das Blut abzuwaschen.
»Hier.« Dr. Lawrence nahm ihre Hand. Seine Finger waren ein wenig rau. Routiniert und methodisch verteilte er die Seife, sodass sie sogar unter die Fingernägel drang, und sorgte dafür, dass ihre Haut bald mehr oder weniger so aussah wie bei ihrer Ankunft in der Praxis. Jane stockte der Atem, gepackt von dem verwirrenden und drängenden Wunsch, er möge ihre Hände festhalten und sanft mit dem Daumen über ihren Handrücken streichen.
Doch er tat es nicht. Stattdessen wiederholte er die Reinigung an ihrer zweiten Hand, drehte anschließend das Wasser ab und reichte ihr ein sauberes Handtuch. Und dann verließ er sie, nachdem er seinen Kittel abgelegt und auf einen Haufen stinkender Wäsche geworfen hatte, um die Mr Lowell sich kümmern würde, wenn er mit seinen anderen Aufgaben fertig war.
Kapitel Vier
Reglos sah Jane ihm nach. Sein Büro schien Meilen weit weg zu sein, ihre gesamte Welt zusammengeschrumpft auf die vier Wände des Operationssaales und den rasselnden Atem des Patienten. Sein Brustkorb hob und senkte sich in einem leicht stockenden Rhythmus. Langsam ging Jane um den Behandlungstisch herum.
Und blieb ruckartig stehen, als sie wieder das verschlungene Darmstück vor sich sah.
Fast hatte sie erwartet, dass es verschwunden wäre, zusammen mit den blutigen Lappen und dem zerschnittenen Hemd in einem Eimer entsorgt. Doch da lag es. Das Blut an der Außenseite war geronnen, doch abgesehen davon sah es noch genauso aus wie in dem Moment, als Dr. Lawrence es entfernt hatte. Es war nicht in sich zusammengefallen, zeigte selbst jetzt noch keinerlei Anzeichen des Todes. Stirnrunzelnd beugte sich Jane darüber, zwang sich, nicht zu blinzeln. Solange sie nicht blinzelte, musste sie doch sehen, wie sich das Ding zusammenzog, im selben langsamen Takt wie das Herz des Patienten.
»Miss Shoringfield.« Mr Lowell stand in der Tür.
Mühsam wandte sie den Blick von dem Ding. »Ja?«
»Ich werde Mr Renton jetzt in den Aufwachraum bringen.«
»Kann ich Ihnen dabei irgendwie behilflich sein?«
»Nein, nein. Aber brauchen Sie vielleicht noch etwas, bevor ich ihn verlege? Tee? Brandy?«
»Oh – nein.« Jane verschränkte die Hände und schlang die Finger fest umeinander, damit sie nicht zitterten. »Ich, äh, ich gehe dann jetzt mal rüber ins Büro. Oh, und unser Dienstmädchen Ekaterina müsste bald hier sein. Bitten Sie sie einfach, mir frische Kleidung zu bringen. Sicher werden Sie hier dringender gebraucht als für irgendwelche Botengänge.«
»Ach, das ist kein Problem, aber ich werde nach ihr Ausschau halten. Vielleicht sollten Sie sich eine Schürze mitnehmen, zum Unterlegen.« Mit einem freundlichen Nicken ging er an ihr vorbei zum Operationstisch. Peinlich berührt nahm sich Jane eine der Schürzen, die sie hätte anziehen sollen, ging mit schnellen Schritten den Gang hinunter und betrat das Büro. Dr. Lawrence war nirgendwo zu sehen, sie konnte nur seine Stimme hören, allerdings so gedämpft, dass kein Wort zu verstehen war. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, sah sie sich um.
Könnte sie wirklich hier leben? Hier arbeiten? Könnte sie einen weiteren Mr Renton ertragen, entweder direkt im blutbesudelten Operationssaal oder auch nur auf der anderen Seite des Flurs, wo sie noch immer seine Schreie hören konnte? Die Gespräche mit seinen Angehörigen?
Und dann dieses Gefühl, als Dr. Lawrence ihre Hand genommen hatte. Wenn sie nun daran dachte, fühlte sie sich hilflos und verlassen. Verwirrt.
Sie legte die Schürze über den Sessel am Fenster und wollte sich gerade hinsetzen, als sie Schritte hörte. Stimmen und Geräusche aller Art hallten in den Praxisräumen laut wider, allerdings musste sie in diesem Fall die Ohren spitzen, um die gedämpften Worte zu verstehen.
Mr Lowell und Dr. Lawrence.
»Sie meinte, sie hätte ihn in einem Kreis aus Kreide und Salz gefunden«, berichtete Mr Lowell. »Sollen wir den Magistrat informieren?«
Kreide und Salz? Sofort verflogen sämtliche Gedanken an zärtliche Berührungen und Blut. Jane schob sich näher an die Tür heran, um besser lauschen zu können. Kreide und Salz waren doch sicherlich keine zwingenden Hinweise auf ein Verbrechen, warum also sollte man die örtliche Justiz informieren?
Doch Dr. Lawrence antwortete nicht gleich, was Jane in ihrer Überzeugung wanken ließ. Umso mehr, als er schließlich kaum hörbar raunte: »Aberglaube ruft keine körperlichen Fehlbildungen hervor, Mr Lowell. Hin und wieder aber führt er zu Wahnsinn. Und sicher auch zu ungewollten Vergiftungen.«
»Und was ist mit Verstümmelung?«, drängte Mr Lowell weiter. »Könnte es sich um eine Art … Ritus handeln?«
Irritiert runzelte Jane die Stirn. In Großbreltain hatte man sich schon vor über zehn Jahren von der Kirche abgewandt, doch natürlich hatten nicht alle ihren Glauben abgelegt. Einige Mandanten von Mr Cunningham hielten sogar an Praktiken fest, die weit älter waren als jede Religion: kleine Opfergaben für eine bessere Ernte, Liebestränke und solcherlei Dinge. Aber rituelle Verstümmelungen? Von etwas Derartigem hatte sie noch nie gehört.
Nein. Nein, es konnte nur ein Ausbruch von Wahnsinn gewesen sein. Und wenn sich jemand mit der realen Gefahr eines solchen Verhaltens auskannte, dann wohl der Magistrat.
»Er hat sich selbst den Bauch aufgeschnitten, Sir«, insistierte Mr Lowell.
Diesmal antwortete Dr. Lawrence unverzüglich, und seine Stimme wurde mit jedem Satz lauter: »Den Gewebezuwachs im absteigenden Kolon kann er sich unmöglich selbst zugefügt haben. Möglicherweise fehlt mir eine Erklärung für die Ursache, aber eine solche Fehlbildung ist schmerzhaft genug, um jeden Menschen zu fragwürdigen Handlungen zu treiben. Ich weiß, es ist wenig zufriedenstellend, aber Sie müssen mir glauben, Mr Lowell: Er hat einfach nur Pech gehabt.«
Nun war es Mr Lowell, der sich mit seiner Antwort Zeit ließ. Anscheinend hatten ihn Dr. Lawrences Worte ähnlich gefangen genommen wie Jane, deren Beunruhigung durch die absolute Gewissheit seines Tonfalls schlagartig besänftigt worden war. Aberglaube war bekanntlich ein zweischneidiges Schwert: Einerseits brachte er die Menschen dazu, irrational zu handeln, andererseits verleitete er sie dazu, irrationale Zusammenhänge herzustellen, wo es in Wirklichkeit keine gab.
»Aye, Doktor«, sagte Mr Lowell schließlich. »Heiß oder kalt für Mr Renton?«
»Heiß. Schüren Sie das Feuer, bis er schwitzt, und legen Sie dann noch einmal Kohle nach.«
Die Stimmen verklangen, und Jane ließ sich endlich in den Sessel fallen.
Er war ein guter Arzt. Als sie ihm ihren Vorschlag unterbreitet hatte, hatte sie das nicht mit Sicherheit wissen können, und niemals hätte sie gedacht, dass er die Koryphäe sein könnte, als die er sich im Operationssaal erwiesen hatte. Doch es war tröstlich, das zu wissen.
Nein, das stimmte so nicht. Es war nicht tröstlich, sondern hatte in ihr einen Funken entzündet, der sich nun nicht mehr löschen oder kontrollieren ließ.
Hätte Mr Renton in einer anderen Stadt gewohnt oder wäre Dr. Lawrence nie nach Larrenton gekommen, wäre der arme Mann vermutlich gestorben. Doch dank Dr. Lawrences Behandlung hatte er überlebt. Seine schrecklichen Schreie würde sie wohl nie vergessen, aber ebenso wenig würde sie vergessen, wie geschickt Dr. Lawrences Hände gewesen waren, wie er sie mit seinen Anweisungen geerdet hatte, wie sie gemeinsam daran gearbeitet hatten, diesen Körper zu richten. Bislang war ihr nie klar gewesen, welchen Reiz der Beruf des Mediziners haben könnte, nun aber verstand sie es. Sie verfolgten die gleichen Ziele, betrachteten die Welt durch die gleiche Linse. Sie ordnete Zahlen, er ordnete Körpersäfte.
Doch während sie neutrale Zahlen analysierte, kümmerte er sich um die grundlegenden Belange des Menschen. Wahrscheinlich war er in diesem Moment bei Mrs Renton. Jane konnte beinahe vor sich sehen, wie er die Hand der Frau hielt und ihr erklärte, was nun für ihren Mann zu tun war, der so plötzlich bettlägerig geworden war.
Ihren Mann.
Bis jetzt hatte sie in Mr Renton nur einen Körper gesehen, in der Hektik des Operationsgeschehens war es leicht gewesen, ihn als pures Fleisch zu betrachten.
Was für eine schreckliche Frau sie war! Vielleicht hatte sie weniger mit Dr. Lawrence gemein als sie dachte, weniger als nötig wäre, um bleiben zu können. Diese Distanzierung hatte sie während der Operation durchhalten lassen, hatte dabei geholfen, ihn zu retten, trotzdem wurde sie nun von Schuldgefühlen geplagt. Er war nicht nur ein Körper, er war ein Mensch. Er war ein lebendes, atmendes, denkendes, menschliches Wesen.
Wieder hörte sie Schritte, dann wurde quietschend die Bürotür geöffnet. Jane starrte weiter blind auf die Straße hinunter. Erst als sie das leise Klappern von Tasse und Untertasse hörte, drehte sie sich um.
Dr. Lawrence hatte eine Tasse Tee auf dem Beistelltisch neben ihr abgestellt.
»Als ich sagte, es könnte blutig werden, hatte ich nicht damit gerechnet, dass es heute gleich so aufregend wird«, sagte er nach kurzem Schweigen.
»Aber es gehört zum Leben eines Arztes.« Jane zwang sich, nach der Tasse zu greifen. Das Porzellan klapperte leise auf dem Unterteller.
»Manchmal, aber nicht immer. Ist es zu viel?«
Zu viel? Natürlich war es zu viel. Und ihre Verbindung war noch nicht einmal beschlossene Sache. Sie musste also nur sagen: Ja, es war zu viel für mich. Ich habe es mir anders überlegt. Oder vielleicht sollte sie es so formulieren, wie er es am Abend zuvor getan hatte: Es wäre nicht angebracht für mich, den Bund der Ehe mit Ihnen einzugehen.
Doch sie brachte die Worte nicht über die Lippen. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, aber sie wollte auch nicht, dass er aufhörte zu sprechen.
»Ich brauche wohl noch etwas Zeit zum Nachdenken«, stieß sie schließlich mühsam hervor.
Als er sie gestern so voller Angst angesehen und sich dann doch ihren Forderungen gebeugt hatte – was hatte er da empfunden? Immerhin war sie rücksichtslos über seine Argumente und Wünsche hinweggegangen. Es wäre besser gewesen, wenn sie seine Zurückweisung akzeptiert hätte, besser für sie beide.
Doch er sah sie weiter unverwandt an, und als sie aufblickte, waren seine Züge weich geworden. Sie konnte keinerlei Ungeduld darin entdecken, keinerlei Verurteilung ob ihrer Schwäche, keine Erleichterung darüber, dass sie vielleicht nicht in der Lage sein würde, seine Anforderungen zu erfüllen.
»Und worüber genau denken Sie nach?«, fragte er.
Über Sie. Hastig wandte sie sich ab und suchte nach einer passenderen Antwort. Sie war noch nie gut darin gewesen, um den heißen Brei herumzureden. »Den Patienten«, verkündete sie schließlich. Nahe genug an der Wahrheit, also keine wirkliche Lüge. »Worüber sonst?«
»Worüber sonst, oh ja.« Er kam zu ihr herüber und setzte sich auf den Fußschemel. Durch den Kittel war seine Kleidung größtenteils frei von Blut, nur an den Ärmeln trockneten noch ein paar Spritzer. Nichts im Vergleich zu ihrem Anblick.
Jane wollte sich gerade entschuldigen oder ihn zurück zu seinem Patienten schicken, wo er schließlich hingehörte, als er sagte: »Sie waren einfach unglaublich da drin.« Das ließ sie innehalten. Seine Wangen röteten sich, und er rieb sich verlegen den Nacken. »Für jemanden ohne jede Erfahrung oder Ausbildung haben Sie einen erstaunlich kühlen Kopf bewahrt. Sie haben getan, was getan werden musste.«
Was sollte sie dazu sagen? Angestrengt suchte sie nach einer ähnlich schmeichelhaften Erwiderung. »Und Sie haben geradezu virtuos die Nadel geführt.« Noch immer sah sie deutlich vor sich, wie geschickt er die Wunde behandelt hatte. Und da war er wieder: der gedankliche Sprung vom Menschen zum Fleisch. Betroffen zuckte sie zusammen.
»Miss Shoringfield?«
»Ich … also, ich glaube, ich war nur deswegen in der Lage, Ihnen zu helfen, weil ich ihn nicht mehr als Person gesehen habe.«
Sie rechnete damit, blankes Entsetzen in seiner Miene zu sehen. Doch sie konnte nichts dergleichen an ihm entdecken.
»Ist das nicht grauenvoll?«, hakte sie nach.
Nun schenkte er ihr ein sanftes, beinahe gönnerhaftes Lächeln. »Wohl kaum. Während meines ersten Studienjahres ging es mir genauso. Dadurch wurde es leichter, ihre Schmerzen zu ertragen, ihnen Schmerzen zuzufügen, wenn es nötig war, um sie zu retten. Viele Ärzte kommen nie über diesen Punkt hinaus, aber andere wachsen sehr wohl darüber hinaus. Dann wird es von einer Fluchtmöglichkeit zu einem Werkzeug. Sie haben erkannt, was geschehen ist – das ist ein guter erster Schritt.«
Er war zu freundlich zu ihr. Offenbar waren sie wirklich nicht aus demselben Holz geschnitzt. Stirnrunzelnd starrte sie in ihre Tasse.