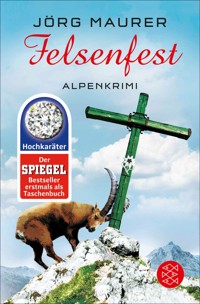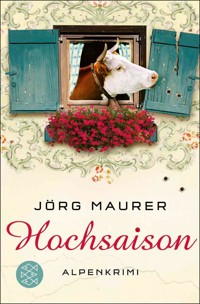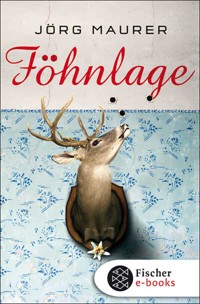8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Tod hat seine Hand im Spiel. Der unheimlichste Fall von Kult-Ermittler Hubertus Jennerwein Der siebte Alpenkrimi von Bestseller-Autor Jörg Maurer Im idyllisch gelegenen Kurort fühlt sich Bertil Carlsson, ehemaliges Mitglied der Nobelpreisjury für Medizin, ganz zu Hause, ist seit Jahren im Trachten- und Heimatverein. Gerade hat er noch im Garten gearbeitet. Kurz danach macht seine Frau einen grausigen Fund – im großen Häcksler. War es ein Unfall? Oder doch Mord? Kommissar Jennerwein und sein bewährtes Team forschen unter hartleibigen Brauchtumswächtern und neidischen Nobelpreiskandidaten. Da meldet die Gerichtsmedizin: im Puzzle der Leichenknochen fehlt eine Hand. Als Jennerwein nach ähnlichen Fällen sucht und ein gruseliges Forschungsprojekt entdeckt, zweifelt er, ob er diesen Fall in den Griff bekommen wird…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jörg Maurer
Der Tod greift nicht daneben
Alpenkrimi
Über dieses Buch
Ein wahrhaft kleinteiliger Fall lehrt Jennerwein das Fürchten
Im idyllisch gelegenen Kurort fühlt sich Bertil Carlsson, ehemaliges Mitglied der Nobelpreisjury für Medizin, ganz zu Hause, ist seit Jahren im Trachten- und Heimatverein. Jetzt wird er in seinem Garten gefunden – im großen Häcksler. Ein grausiger Unfall? Oder doch Mord? Kommissar Jennerwein und sein bewährtes Team forschen unter hartleibigen Brauchtumswächtern und neidischen Nobelpreiskandidaten. Da meldet die Gerichtsmedizin: im Puzzle der Leichenknochen fehlt eine Hand. Als Jennerwein nach ähnlichen Fällen sucht und ein gruseliges Forschungsprojekt entdeckt, zweifelt er, ob er diesen Fall in den Griff bekommen wird …
Weitere Titel von Jörg Maurer:
›Föhnlage‹
›Hochsaison‹
›Niedertracht‹
›Oberwasser‹
›Unterholz‹
›Felsenfest‹
›Der Tod greift nicht daneben‹
Die Webseite des Autors: www.joergmaurer.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: bürosüd°, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403164-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Vorbemerkung]
Zur Entstehungsgeschichte
Vorgriff
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Vorgriff
35. Kapitel
36. Kapitel
Eingriff
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
Angriff
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
Nachgriff
Abschließender Händedruck
Leseprobe: Schwindelfrei ist nur der Tod
1. Kapitel
2. Kapitel
Die folgenden Ereignisse basieren auf einem wahren Fall. Lediglich Eigennamen und Ortsangaben wurden verändert. Die Begebenheiten um die junge Anna Sophia wiederum sind nichts als ein einziger, unfassbarer Schicksalsroman.
Zur Entstehungsgeschichte
Es war an der Zeit, etwas Neues anzufangen. Doch bevor ich mit der Niederschrift dieses Romans begann, dachte ich, dass es nicht schaden könnte, ein paar Tage Urlaub zu machen. Mein Weg führte mich nach Rumänien. Wer mir den Tipp gegeben hat, gerade dorthin zu fahren, ist nicht mehr zu eruieren. Auf der Höhe von Târgovişte bekam ich jedenfalls einen Anflug von Hunger. Ich nahm die Autobahnausfahrt Braşov, lief hinunter zum Marktplatz, zur sehenswürdigen und oft abgelichteten Piaţa Sfatului. Rund um die dichtgedrängten Crenvurşti-Buden duftete es verführerisch nach den echt siebenbürgischen Gepritschelten Krumbien. Doch mir stand der Sinn mehr nach einer in Papier eingewickelten Banater Bratwurst, aus der das Fett nur so tropfte. Ich kaufte mir eine dieser Köstlichkeiten und verschlang sie voll Heißhunger. Auffällig war das Einwickelpapier, das über und über mit einer eleganten, aber zittrigen Handschrift beschrieben war. Das Wort omor stach heraus. Zerstreut warf ich das Papier in einen Abfallkübel und fuhr weiter. Doch das Wort spukte mir im Kopf herum. Omor. Kurz vor Bukarest fuhr ich rechts ran, um einen neugierigen Blick ins Wörterbuch Rumänisch-Deutsch zu werfen. Mord. Omor hieß Mord. Ich drehte den Zündschlüssel, raste zurück, nach Braşov, zum Marktplatz, zu der Crenvurşti-Bude. Verschlossen, zugenagelt. Böse Blicke, keine Auskunft. Mord. Omor. Donnergrollen, schwefelfarbene Blitze zuckten, ein eiskalter Regenguss prasselte auf das schiefe Kopfsteinpflaster. Der Marktplatz von Braşov leerte sich rasch. Die Passanten schlugen den Mantelkragen hoch, als ich auf einen zuging, winkte er unwirsch ab. Und war da nicht noch eine Unterschrift gewesen? So etwas wie Popescu? Emil Popescu? Ich forschte weiter. Und Kommissar Jennerwein hatte plötzlich einen neuen Fall.
Vorgriff
Kommissar Jennerwein wusste, dass er sich mit einer Hand nicht mehr lange an der verrosteten Eisenstange festhalten konnte. Die andere Hand war gebrochen, sie schmerzte pulsierend, regelmäßige Kaskaden von zornigen Peitschenschlägen prasselten auf sie ein. Jennerweins Lage war aussichtslos. Die ersten sauren Krämpfe kündigten sich an. Es konnte nicht mehr lange dauern, dann würde er loslassen müssen und hineinstürzen in das Walzenwerk unter ihm. Die scharfen Schneidemesser blitzten schläfrig im matten Licht. Eine stechende Geruchsmischung aus Schmieröl und heißgekratztem Eisen lag in der Luft. Die beiden Rollen, auf denen die Messer saßen, drehten sich langsam und heiser knirschend gegeneinander. Die seitlichen Einzugswalzen begannen sich schneller und schneller zu drehen. Ihre Funktion war offensichtlich. Sie sollten das Schreddergut erfassen, zerdrücken, um es anschließend zwischen die Häckselwalzen zu schieben. Wenn er zwischen diese Messer geriet, war er verloren. War es möglich, nach einer gezielten Schaukelbewegung auf die seitlichen Gestänge zu springen? Die Schutzplatte war abgenommen worden, die scharfen Kanten der Randverkleidung boten wahrscheinlich keinen ausreichenden Halt. Die Schmerzen in der verletzten Hand wuchsen ins Grauenhafte. Die Griffhand gehorchte ihm nicht mehr, die ersten Finger lösten sich. Doch dann durchzuckte Jennerwein ein Gedanke. Die Messer! Die Zerkleinerungsmesser waren die gefährlichsten, aber gleichzeitig auch die empfindlichsten Teile der Maschine. Die Polizeikantine. Vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren. Das Förderband, auf das die Beamten die Tabletts mit den leeren Tellern stellten. Das Band lief auf den alten Küchenabfallzerkleinerer zu, der die Hühnerknochen und das Plastikgeschirr zerdrückte und pulverisierte. Neben der Einwurföffnung ein kleines handgeschriebenes Schildchen: Bitte kein Metallbesteck in die Maschine werfen! Nicht alle Kollegen hielten sich an diese Bitte. In solch einem Fall knirschte es gewaltig, und das Ungetüm kam zum Stehen. Fieberhaft fingerte Kommissar Jennerwein nach seiner Dienstmarke aus Messing. Es war eine verschwindend geringe Chance. Aber er musste sie nutzen.
1
Braşov/Rumänien, Januar 1987
Versuchsanordnung.
Eine Hand liegt in einem dunklen, kühlen Raum. Es ist ein Tresor. Sie ruht vollkommen entspannt, mit dem Handrücken nach oben, auf weichem Samt. Ein leises Fiepen ertönt. Die Hand zuckt, sie beginnt sich zu wölben, ihre Fingerkuppen betasten den Boden. Was für ein Augenblick! Sie lebt!
Mit pumpenden Bewegungen schiebt sie sich Zentimeter für Zentimeter nach vorn. Der Zeigefinger hebt sich, er berührt die Innensperre des Schlosses an der Wand. Langsam dreht der Finger ein metallenes Rädchen, bis es mit einem hellen, schmatzenden Klickediklack einrastet. Die Tür springt auf. Vorsichtig tippt der Finger an die Innenseite der Tür, er stößt sie an, sie schwingt lautlos auf, Licht fällt von draußen in die kleine Kammer.
Seit Beginn des Versuchs habe ich auf die Tür dieses Tresors gestarrt. Als sie endlich ganz offen steht, halte ich den Atem an. Es überläuft mich kalt. Kein Arm. Kein Körper. Nur die Hand. Sie lebt. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Aber es hat funktioniert. Die Finger zucken zurück, sie bilden zusammen eine abwehrbereite Kralle. Es hat den Anschein, als ob die Hand geblendet wäre vom gleißenden Schein des künstlichen Lichts.
Mein Gesicht schiebt sich vor die helle Lampe. Ich nehme meine Brille ab und stecke sie in die Brusttasche meines weißen Laborkittels. Ich zittere vor Erregung. Sie bewegt sich wirklich. Eine einzelne Hand. Ganz allein. Einige meiner Mitarbeiter flüstern sich in meinem Rücken bewundernde Worte zu. Mit einer kurzen Geste mahne ich sie zur Ruhe. Vorsichtig greife ich in den Tresor und nehme die Hand heraus.
»Ein historischer Augenblick!«, flüstert Dr. Draganovic. »Sie haben es geschafft! Mit Ihren zweiundzwanzig Jahren!«
Lang anhaltender Applaus brandet auf. Die Hand schmiegt sich an meine Brust. Sucht sie Wärme?
2
Ganzjährig geöffnet! Kein Ruhetag! Reisegruppen willkommen! Deftige Brotzeiten! Pfannkuchen von ungeheuren Ausmaßen! Geschichtsträchtiges Gelände! Sensationelles Panorama!
Die knapp zwölfhundert Meter hoch gelegene Ederkanzel ist ein beliebtes Ausflugsziel oberhalb der Leutasch-Klamm. Sie ist selbstverständlich bewirtschaftet. Während des Megapfannkuchenmampfens blickt man auf drei Täler und in zwei Länder, auf fünf Flüsse und zig Wälder, Felsabrisse, Wasserfälle und andere Postkartensensationen. Seit Menschengedenken ist in diesem Gebiet kein Verbrechen mehr geschehen, die bombastische Rundumkulisse (man muss unweigerlich an den Garten Eden denken) ließe so etwas irgendwie auch nicht zu. Als Beispiel dafür wird eine Geschichte aus den zwanziger Jahren erzählt, vom hochverschuldeten Griesgierchl Blasi, der dem Wucherer Schorsch Reindlmayr auf dem Weg zur Ederkanzel in eindeutig mörderischer und dauerhaft schuldentilgender Absicht aufgelauert hat. Der Blasi hatte den Hals vom Reindlmayr schon fest im Würgegriff, gottserbärmlich gespotzt und geprustet hat der Wuchererschorsch, doch angesichts des himmlischen Panoramas rundherum ist der Griesgierchl zur Besinnung gekommen, hat von der ruchlosen Untat abgelassen, sich bekreuzigt und der Kirche später sogar zwanzig Wachskerzen gespendet.
Und in genau dieser Wachskerzenspendenstimmung sitzt man an den Terrassentischen, bestaunt die Naturgewalten und denkt an Vergebung, Milde, Nachsicht und tätige Reue. Es kommt einem so vor, als ob im Ferchenbachtal Milch und Honig flössen, als ob man von den Grünkopfwänden das vieltausendstimmige Hosianna der Berggeister hörte. Und wenn man den Blick nach Nordwesten wendet, zur Kramerspitze hinüber, dann kommt einem ein tief empfundener Halleluja-Seufzer aus. Die Alm selbst ist seit knapp siebzig Jahren bewirtschaftet, und die in vielen Reiseführern beschriebene kuriose Besonderheit ist die, dass der Gastraum und die Toiletten in Deutschland liegen, die Terrasse hingegen in Österreich. Der hochoffizielle Grenzstein befindet sich neben der Terrassentür an der Außenwand des Gebäudes. Die draußen ausgeschenkten Speisen und Getränke werden, als Folge einer Absprache zwischen den bayrischen und österreichischen Finanzämtern, nach deutschem Fiskalrecht vermehrwertsteuert. So stur, wie man sagt, sind sie demzufolge auch wieder nicht, die Finanzerer.
Der europäische Gedanke west also auf dieser Terrasse, vielleicht sogar der globale. Man sitzt eng aufeinander, man prostet sich zu, man scherzt, es mischen sich fremdeste Laute fernster Landstriche zu einer babylonischen Vielstimmigkeit. Ein Rothaariger mit Sonnenbrand beugt sich gerade eben zu seinem Tischnachbarn.
»Weeste was? Jetzt erst versteh ick die Menschen hier.«
»Wieso ’n ditte?«
»Wenn de hier aufwächst, inmitten der Berje, der Naturjewalten und all dem Kokolores, dann wirste eben so.«
»Wie wirste denn?«
»Bayrisch eben.«
Hier irrt der Berliner. Hier irrt er aber gewaltig. Dass die Landschaft den innewohnenden Menschenschlag prägt, ist grundfalsch. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Jede Volksgruppe bildet und formt die Umgebung, in der sie sich niederlässt, in ihrem Sinn. Der offensichtliche Beweis dafür sind die Bewohner des Voralpenlandes. Verspielt, barock, leicht erhitzbar, deshalb dem Theater (und überhaupt allem Theatralen) zugeneigt, haben sie im Lauf der Jahrtausende ihr Innerstes nach außen gestülpt – und entstanden ist die Alpenkulisse, als unverrückbares Symbol ihrer zerklüfteten Gesinnung. Genauso wie der Friese durch jahrhundertelanges, philosophisches Grübeln die weite See sich erschaffen hat, um auf diese Weise ewig und wortkarg weiterzuträumen von günstigen Schiffsrouten und exotischen Auswegen aus dem ständigen Nieselwetter, so hat sich der Alpenländer seine wuchtigen Kulissen zusammengezimmert und übereinandergestapelt in der Mitte Europas. Überbordend, manieristisch, bunt verziert mit einem Fleckerlteppich aus dicht aneinandergefügten und sich überbietenden Sehenswürdigkeiten, für die er Eintritt verlangt. Und jeden Tag hebt sich der Vorhang aufs Neue, und das irrlichternde Freilufttheater beginnt.
3
Es war ein verdammt herrlicher Maimorgen auf den weit ausladenden Hängen des Kramerplateaus. Auf der Galerie, hoch oben auf der Ederkanzel, starrten die Gäste gebannt und erwartungsvoll hinüber auf die sattgrüne Bühne. Man bestellte Kaffee, man war geplättet von der Kulisse, und bis in die letzten Reihen roch man die duftenden Blüten im Tal. Im Hintergrund des Kramerplateaus erhoben sich die schroffen Felsen der Kramerspitze, sie waren in satt strahlendes, stratosphärisch anmutendes Licht getaucht. Am Fuß des Kolosses duckten sich ein paar Berghütten und Schupfen, plattgedrückt vom Föhn und von den gewaltigen Gewittern, die hier in regelmäßigen Abständen und ohne Vorwarnung vom Himmel niederfuhren – furchtbar sich fortsetzend in den Köpfen der Bewohner, als krude Gedanken und irrwitzige Projekte. Die Felsen knackten, die Flüsse und Seen brodelten dumpf und bedeutungsvoll, aus den Wäldern brachen Heerscharen von Statisten: vielstimmig kreischende Frühlingsschwalben, schnatternde Kampfdohlen und anderes geschwätziges Geflügel. Die Sonne, die divenhafteste aller Rampensäue, schlüpfte elegant aus ihrem wattierten Wolkenmantel, der sich sofort auflöste und in alle Himmelsrichtungen zerstob. Nackt und grell, wie sie war, schob sie sich rasch in den Mittelpunkt der Bühne. Nach einer effektvollen Kunstpause, einem gigantischen Räuspern aus Helium und Wasserstoff, begann sie mit ihrer bewährten Lightshow.
Doch der eigentliche Held des heutigen Stückes war ein grün geschürzter Hüne, der eine urtümliche, imposante Holzhacke über der Schulter trug und gerade schwer atmend in den Garten eines Grundstücks an den Kramerhängen stapfte. Er rammte das Beil in den Boden und blinzelte in die Sonne. An den Kramerhängen, zwischen Friedhof und Sportplatz, waren die Weißdorn- und Berberitzenhecken akkurat zurechtgestutzt wie nirgends sonst im Kurort. Es war die Gegend der Zweitwohnungen. Gepflegt, blitzblank, repräsentativ. Die schmiedeeisernen Tore schimmerten im Morgenlicht, und pro Grundstück hechelte mindestens ein scharf abgerichteter Edelpluto. Es war kurz vor zehn, deshalb endsstill, denn die Gärtner und Hausmeister waren noch bei der genetisch festverankerten Brotzeit. Deshalb also schwiegen die Motorwerkzeuge. Manche verzichteten auf die Pause und reparierten grummelnd Swimmingpoolleitungen oder schnitten Buchsbaumhecken mit der Nagelschere zu grünlichen Monster-Enten um. In einer besonders idyllischen, etwas höher gelegenen Grünanlage gartelte der blonde Hüne. Ihm tropfte der ehrlichste Schweiß der Welt, der Morgenschweiß, von der Stirn. Er war ein Baum von Mannsbild, ein Gartenfreund im Basketballermaß, hemdsärmelig und tatendurstig hob er jetzt einen Ast hoch und betrachtete ihn stirnrunzelnd.
»Herrgottsakra!«, fluchte er aus fast zwei Meter Höhe herab. »Schon wieder die Sauviecher!«
Mit den Sauviechern meinte er die schädlichen Schildläuse und Borkenkäfer, die Fransenflügler, giftigen Fruchtschalenwickler und gemeinen Kiefernspanner. Schon die Nennung der Namen konnte einem Juckreiz bescheren.
»Jedes Jahr dasselbe. So ein Geziefer, so ein g’scheats.«
Er hätte eine Rasur vertragen, der grün geschürzte Held, und zum Naturburschen trug noch bei, dass er einen langen Wacholderzweig zwischen die Lippen gesteckt hatte und auf den Nadeln herumkaute wie ein mittelalterlicher Scholastiker auf einem riskanten Gottesbeweis. Die bergseeblauen Augen strahlten, der struppige, semmelblonde Schopf zitterte leicht im Wind. Ein scharf geschnittenes Gesicht hatte er, eine stolze Nase, ein energisches, tatendurstiges Kinn, eine flächige Denkerstirn. Ein Bühnengesicht eben. Er ging in die Knie und suchte das Gras nach weiterem Ungeziefer ab. Doch dann wurde seine Stimmung milder. Keinerlei Schädlinge hatten sich dort breitgemacht. Er zupfte eine Forsythienblüte ab, floristisch prüfend rieb er sie sachkundig zwischen den Fingern.
»Sauguat«, murmelte er. »Das wird ein gaaches Jahr.«
Wenn er Selbstgespräche im Garten führte, redete er immer besonders g’scheat. Wenn er sich unbeobachtet fühlte, holte er uralte Werdenfelser Ausdrücke aus dem hintersten Hirnkastel und sprach sie genüsslich, extra langsam und extra altertümlich aus. Hier zwischen Edelweiß und Almenrausch war er Bayer mit Leib und Seele.
»Bartl!«, erschallte es laut aus dem ersten Stock des Hauses. »Baaaaaartl!«
Er wandte sich um. Auf dem Balkon erschien seine Frau, ähnlich blond wie er, wenn auch mit einem Schuss ins Flachsig-Gelbe. Sie hatte eine gesunde, sonnengebräunte Hautfarbe, sie trug eine regionaltypische laubfarbene Sommerbluse, eine ländliche Vesperjacke, einen Werdenfelser Strickrock, nur die türkisgrüne Brille stach aus dem sorgsam abgestimmten Trachtenensemble heraus.
»Hast du auch deine Herztabletten nicht vergessen?«
Der Bartl nickte. Natürlich hatte er die nicht vergessen. Aber es war schön, dass Gretl daran gedacht hatte. Seine Frau verschwand wieder im Haus, er zog das im Rasen steckende Beil aus dem Boden. Langsam strich er mit der Hand über das Holz des Stiels. Er arbeitete gern mit alten und garantiert unmotorisierten Werkzeugen. Das war seine Leidenschaft. Er liebte die pure Handarbeit. Nur wenn sie ihm gar zu mühsam wurde, ließ er die Dieselchen und Benzinis werkeln. Seufzend stapfte er zu den zwei riesigen Birken, denen er vor Tagen schon einen roten Punkt verpasst hatte. Jammerschade um die Bäume. Über fünfzig Jahre hatten sie wohl auf dem Buckel. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er die stattlichen Birken nicht gefällt. Aber Gretl war der Meinung gewesen, dass sie bei Sturm schon bedenklich zum Haus hinschwankten und gegen die Fenster peitschten. Außerdem – und vielleicht war das ja der wahre Grund – verstellten sie Gretls Blick von ihrem Zimmer auf die geliebte Alpspitze. So oder so, das Birkenpärchen musste heute dran glauben. Die beiden zitterten leicht im Morgenwind, ihr zweistimmiges Säuseln glich einer leisen Doppelklage. Sie schienen zu wissen, was ihnen blühte. Der Bartl sah auf die Uhr. Gleich zehn, Ende der Brotzeit. Er lehnte sich an den Zaun und betrachtete stolz den Balkon des schönen alten Gemäuers, eines giebeldachumgebenen Bauernhauses aus dem vorvergangenen Jahrhundert, er ließ den Blick hochsteigen bis zum schindelgedeckten Walmdach, aus dem ein prächtiger Kamin schoss, dahinter erhoben sich die Kramerhänge. Er verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und ließ den Blick entlangwandern an der kleinen Schneise, die von den Forstarbeitern geschlagen worden war. Es war ein Weg, der nirgendwo anders hinführte als ins Glück.
Der Bartl war nicht mehr der Jüngste. Sein Alter war schwer zu schätzen, vielleicht hatte er die sechzig schon längst hinter sich gelassen, vielleicht auch noch lange nicht erreicht. Ein Golden Ager eben. Ein Best Ager. Die beiden Waxensteine ragten auf wie zwei Kegel aus grobem Schmirgelpapier, seitlich dahinter glitzerte die Zugspitzseilbahn in der Vormittagssonne. Er fixierte eine der beiden festen Stützen, der sich gerade eine vollbesetzte Gondel näherte. Dahinter lag schon die österreichische Grenze. Er überlegte, wohin die Birken genau fallen sollten, da tauchte auf der Straße der Gumpendobler Werner mit seinem undefinierbaren Dackelverschnitt auf. Er blieb am Zaun stehen und blinzelte in die Sonne.
»Servus, Bartl.«
»Servus, Werner.«
Es folgte eine lange Pause. Ein gemeinsames, tiefes Schweigen. Oft ist auch nichts weiter nötig im Alpenland.
»Schöner Tag heut.«
»Grad richtig zum Garteln.«
Wieder eine lange Pause. Beide nickten fast unmerklich. Eine besonders edle Form der Übereinstimmung.
»Am Abend zieht es wieder zu, moan i.«
»Kunnt schon sein.«
Lange Pause. Der Bartl bückte sich, pflückte einen kleinen Wacholderzweig ab und steckte ihn in den Mund.
»Einen schönen Garten hast«, fuhr der Gumpendobler Werner fort. »Das muss ich schon sagen.«
»Da kunnst recht ham.«
Der Gumpendobler Werner wies auf die Birken.
»Müssen weg, ha?«
»Schon.«
»Schad.«
»Ja dann.«
»Genau.«
Der Gumpendobler Werner zog wieder ab, blieb aber ein paar Meter weiter mit seinem sogenannten Hund stehen, der etwas erschnuppert zu haben schien.
Der Hünenbartl atmete tief durch. Den Garten hatte er selbst angelegt. Das Alpinum mit den seltenen Gebirgspflanzen. Den bauernblumenumstellten Teich mit den Goldfischen. Die leibhaftige Blauregen- und Knöterich-Explosion, die sich am Haus hochrankte. Der Knöterich hatte schon die ganze Inschrift verdeckt: Beim Suderer. Suderer war der Hausname, aber die Einheimischen wussten es eh. Der Suderer Bartl sah nochmals auf die Uhr. Ab zehn konnte er wieder loslegen, da war alles erlaubt. Bohren und Fräsen, Spreißeln, Schrauben, Laubblasen, Presshämmern …
Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Das war die Koloratur des Rasenmähers, den der Gärtner ein paar Grundstücke weiter angeworfen hatte. Auf der anderen Seite jaulte eine Bohrmaschine auf, eher dumpf und verbissen röhrte der zylinderköpfige Löcherer, und schon fraß er sich hungrig ins Betonierte. Auch der Bartl fasste sein Beil, liebevoll, wie ein Cellist sein Instrument. Er holte Schwung und trieb mit sicherer Hand zwei tiefe Keile ins Holz der beiden Birken. Ssssonk, ssssonk – und die Fallkerben zeigten in genau die Richtung, in die die Gezeichneten stürzen sollten. Damit der edle Rasen keinen Schaden durch Druckstellen nähme, hatte er vor, die Stämme und Äste sofort im Häcksler zu entsorgen. Das war der Plan für heute Vormittag. Die geschredderten Birken würden herrlichen Birkenholzmulch abgeben.
Rackackackackackackacka! So klang der Schlaghammer bei den Keudells. Bei ihnen wurde ein neuer Terrassenboden verlegt. Wuiiisssssssssss… Das war der Steinschneider des Gärtners bei der Familie Martinsrieder gegenüber. Dort wurde ein neuer Gartenweg angelegt. Langsam gewann man den Eindruck, dass sämtliche Geräte in der Nachbarschaft angeschaltet worden waren, denn jetzt hob sich im Kramerhangviertel ein gärtnerisches Geräuschspektakel von Richard Wagner’scher Dezibilität.
Der Hünenbartl holte mit seiner Hacke aus und schlug tief in den ersten gezeichneten Birkenbaum, mit einem kräftigen, beherzten Knacken drang er ins Holz, er wiederholte den Schlag zwei Dutzend Mal, und schon rutschte und stolperte der Baum auf die Fallkerbe, leise rauschten noch einmal seine Blätter, dann fiel der tapfere Koloss auf den Rasen des Grundstücks, seufzend und matt schlug er auf. Jetzt war er mausetot.
Vorhang. Ende des ersten Aktes. Rauschender Applaus auf der Ederkanzel.
4
Die junge, zierliche Frau, deren nobles Profil sich in den lodernden Flammen des Kamins abzeichnete, straffte entschlossen die Schultern. Ein Ruck ging durch ihren Körper. In ihren meergrünen Augen blitzte ein unerschrockenes, verwegenes Funkeln auf. Sie musste jetzt stark sein. Sie durfte sich nicht niederdrücken lassen von der misslichen Lage, in der sie sich momentan befand. Sie warf ein paar Scheite in den Kamin, und das knisternde Feuer fraß sich sofort ins Holz – wie um ihr zu bedeuten, dass jedes, aber auch jedes Problem gelöst werden konnte. Das Feuer schmatzte zischend, ab und zu spuckte es feine Garben von Glut in die Höhe. Langsam breitete sich wohlige Wärme in der kleinen Hütte aus. Sie war ausgesprochen einfach eingerichtet: ein Tisch, zwei Stühle, eine Kommode, ein Bett. Hinter der Tür hing ein kleines Waschbecken, das allerdings nicht funktionierte. Neben dem Kamin war ein kleiner Stoß Feuerholz aufgeschichtet, vermutlich würde er bald aufgebraucht sein.
Anna Sophia warf ihre rotgold glänzenden Haare zurück, schritt zum Fenster und lehnte ihre Wange an die kalte Scheibe. Sie fühlte sich unendlich einsam und alleingelassen. Draußen schneite es noch immer, ununterbrochen sanken die zerbrechlichen Himmelsgrüße herunter auf das harte, karge Land. Das ging jetzt schon seit vierundzwanzig Stunden so. Mit diesen Unbilden der Witterung hatte sie um diese Jahreszeit nicht gerechnet. Doch trotz aller Beschwerlichkeiten spürte sie, dass ihr junges Leben auf einen Wendepunkt zulief. Sie hatte sich in diese Hütte zurückgezogen, um in aller Abgeschiedenheit die Kräfte zu mobilisieren, die tief in ihrem Inneren schlummerten. Sie wollte den Riesen in sich wecken. Sie hatte vorgehabt, ein paar kreative Tage einzulegen, fernab von allen alltäglichen Widernissen und Kleinkrämereien. Sie hatte sich das so schön ausgemalt. Doch jetzt? Jetzt saß sie fest in einer total abgelegenen, eingeschneiten Jägerhütte, und Martin ließ nichts von sich hören. Er hätte schon längst hier sein sollen. Das sah dem sonst so aufmerksamen Martin gar nicht ähnlich. Gerade jetzt, wo sie ihn so furchtbar dringend gebraucht hätte. Aber was sollte sie tun? Sie hatte keine Netzverbindung, und ein Telefon gab es hier ohnehin nicht. Ihr Auto war ein paar hundert Meter entfernt stecken geblieben – keine Chance, es alleine aus der Schneewechte herauszubekommen. Gott sei Dank hatte sie Essensvorräte für mehrere Tage dabei. Aber das Brennholz ging bald zur Neige. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und hob trotzig das Kinn. Gab es hier Werkzeug, um draußen Holz zu schlagen? Würde sie das überhaupt schaffen? Wie oft hatte sie sich schwach gefühlt. Wie oft hatte sie die Entscheidung anderen überlassen. Damit musste jetzt Schluss sein. Sie straffte die Schultern, und ein stolzer Zug erschien auf ihrem Gesicht. Sie würde draußen Holz schlagen, wenn es nötig war. Jetzt aber war es vielleicht besser, den Anorak anzuziehen und sich damit ins Bett zu legen, sicher ließ sich auf diese Weise Feuerholz sparen. Vielleicht war es auch sinnvoller, hinauszugehen und einen Weg zu suchen, der ins Tal führte. Aber all das konnte sie ja immer noch tun. Wenn die Vorräte aufgebraucht waren.
Und.
Das.
War.
Bald.
»Warum?«, flüsterte sie leise. »Warum hast du dich nur darauf eingelassen?«
Anna Sophia führte oft und gern Selbstgespräche. Niemand hemmte den freien Lauf ihrer Gedanken. Niemand brachte kleinliche Bedenken vor. Niemand widersprach. Doch ein Selbstgespräch hier in dieser verlassenen Hütte?
»Warum nur?«, wiederholte sie noch einmal, und hohl hallten ihre Worte von den Wänden zurück. Sie legte sich aufs Bett. Dann schloss sie die Augen und dachte an die letzten Tage, die angefüllt waren mit Unannehmlichkeiten und lästigen Alltagspflichten. Damit musste jetzt Schluss sein. Draußen bellte in der Ferne ein Hund. (Oder heulte gar ein Wolf? Ein Schakal? Eine Hyäne?) Sie riss die Augen auf. Ein ahnungsvoller Schauer überlief sie, an Schlaf war nicht mehr zu denken. Um die emporkriechende Angst zu bekämpfen, sprang sie wieder aus dem Bett und sah sich um. Es gab keine Bücher hier, keine Zeitschriften, und sie hatte auch nichts zum Lesen oder Schreiben mitgenommen. Der Akku des Notebooks war ebenfalls leer. Sie seufzte: eine abgelegene, verschneite Hütte, irgendwo tief und einsam in den Karpaten. Sie wusste nicht einmal mehr, wo genau sie war. Zwischen Parva und Nặsặud? Oder eher auf der Anhöhe von Romuli? Hinter Tibặu? Vor Muncelu? Julian fiel ihr ein. Warum fiel ihr jetzt um Himmels willen Julian ein?
Julian.
Julian.
Julian.
Sie durfte nicht an ihn denken.
»Ich stehe das durch«, flüsterte Anna Sophia leise, aber beherzt.
Wie konnte Martin nur auf so etwas Abgelegenes wie diese Hütte kommen? Es war sein Einfall gewesen, und sie hatte am Anfang auch begeistert zugestimmt. Da war noch nicht abzusehen gewesen, dass dieses Tief über Nordosteuropa Anfang Mai solch gewaltige Schneefälle bringen würde. Sie war tatendurstig und voller Überschwang vorausgefahren, Martin hätte nachkommen sollen. Sie brauchte ihn. Das Kreative war ihr immer leichtgefallen. Schon von klein auf. Bereits als Mädchen hatte sie ihre Umgebung mit außergewöhnlichen Einfällen überrascht. Um das Geschäftliche, um das Organisatorische, um das alles sollte sich Martin kümmern. Aber wo war er?
»Du bist jetzt allein, Anna Sophia«, flüsterte sie und legte ein Scheit Holz nach.
Die Minuten der Stille zwischen den blechernen Schreien der Raben waren beängstigend. Um die düsteren Gedanken zu verscheuchen, öffnete sie ihre Handtasche und kramte darin herum. Wenn sie wenigstens einen Notizblock eingesteckt hätte! Dann könnte sie jetzt ein paar Ideen aufschreiben, für ihren Laden, den sie in naher Zukunft eröffnen wollte. Der Laden ihrer Träume. Es musste ein lebendiger Ort sein, an dem sie mit Menschen in Berührung kam. Sie hatte sich noch nicht entschieden, was genau in ihrem Laden verkauft werden sollte. Anna Sophia seufzte. Am Anfang hatte sie zwischen einem Perlenladen und einem Weingummi- und Bonbonladen im Boutiquestil geschwankt. Dann fand sie es viel näher am Leben, fraulicher und kommunikativer, einen Näh- und Kurzwarenladen aufzumachen, mit edlen Posamenten, personalisierten Stricklieseln und Kissenschneiderei mit gestickten Sternzeichensymbolen auf Bestellung.
»Wie wäre es denn mit selbstgemachten Pralinen, Hochzeitstorten, Naschwerk und Erotikgebäck?«, hatte Julian gerufen. Schon wieder Julian. Anna Sophia schüttelte ärgerlich ihre rotgoldenen Haare. Sie musste Julian aus ihren Gedanken verbannen. So schnell als möglich. Sie zwang sich zur Konzentration. Über einen Gewürzladen mit individuellen Gewürzmischungen hatte sie auch nachgedacht. Dich kann ich riechen! musste eine der Mischungen unbedingt heißen. Und das Potpourri würde hinausduften bis auf die Straße. Es sollte im ganzen Stadtviertel zu riechen sein und überall seinen Zauber verbreiten. Gewürzläden gab es aber schon so viele. Es musste etwas Besonderes sein. Etwas, das nur mit ihr zu tun hatte.
Ein Einrichtungslädchen.
Ein veganes Kochstudio.
Ein Yogazentrum.
Eine Teestube mit indischer Musik.
Anna Sophia lächelte, während diese Ideenfluten auf sie einstürzten. Aber dann stieg ein Seufzer in ihr auf. Wie sollte sie das alles festhalten? Dafür brauchte sie ein aufgeschlagenes leeres Word-Dokument. Oder wenigstens einen Zettel. Sie warf ein weiteres Scheit Holz ins Feuer. Wenn Martin kam, wollte sie eine Liste mit den möglichen Projekten parat haben, damit er dann einen Businessplan erstellen konnte. Er sollte sehen, dass sie nicht nur vor sich hin träumte. Sie wollte es schaffen. Und dann das Ladenschild:
Anna Sophias Brezelbäckerei.
Anna Sophias Sushi-Bude.
Anna Sophias Schatzkästchen –
Anna Sophia war vielleicht doch nicht so gut als Name. Er klang zu konstruiert. Er war auch nicht zierlich genug. Besser wäre –
Und plötzlich: ein dumpfer Schlag an der Tür. Und da: noch einer. Dann wieder Stille in der kleinen Hütte.
»Martin?«, flüsterte sie verzagt. Und, mit leiserer Stimme: »Julian?«
5
Um zehn wurde die Terrasse der Ederkanzel geöffnet, sie füllte sich immer schnell. Mit vierzig Leuten war sie pickepackevoll, die meisten der Wanderer mussten in aller Herrgottsfrühe schon heraufgestiegen sein, vom Schloss Elmau oder von Mittenwald. Sie waren vollauf damit beschäftigt, das Rundum-Spektakel zu begaffen, zu filmen und zu fotografieren.
»Das ist der Franzosensteig. Der führt nach Leutasch.«
Die Bedienung, die Reisinger Rosi aus Mittenwald, erklärte es geduldig, zum wiederholten Mal, zum millionsten Mal fuhr sie mit den Fingern den Franzosensteig ab. Ein G’röstel nach Art des Hauses, eine Apfelschorle und eine kleine geopolitische Erläuterung – zwölf zwanzig bitte.
»Leutasch?«, berlinerte es schon wieder. »Das ist wohl schon Wienerisch?«
»Österreichisch«, korrigierte die Reisinger Rosi mit leicht hochgezogenen Augenbrauen. »Wienerisch – das hört der Tiroler nicht so gern.«
»Sind denn Tiroler hier anwesend?«, fasste der Berliner frech nach und sah sich herausfordernd um.
Ein Tisch in der Ecke ließ sich mit einigen Innsbrucker Knack- und Explosionslauten hören.
»Woll, woll.«
Es klang wie das Knurren von gereizten Wölfen. Doch der Berliner ließ immer noch nicht locker:
»Tirol, da denk ich immer an Bolzano, Bressanone und Spaghetti – ist das nicht schon halb Italien?«
Unten im Tal hätte es vielleicht wegen so einer unverschämten Bemerkung eine Rauferei gegeben. Ganz sicher sogar. Doch die Tiroler hier auf der Terrasse bewiesen Humor und lachten. Sie bestellten Speis und Trank, dann ließen auch sie den jungen Tag und die Kulisse auf sich wirken.
Am Nebentisch drängte sich alles um die legendären Riesenpfannkuchen der Ederkanzel. Neben dem Servieren erklärte die Reisinger Rosi den nächsten unwissenden Gästen mit einer Eselsgeduld, was es mit dem Franzosensteig auf sich hatte. Im Jahre 1805 sei Bayern unter Maximilian Joseph mit dem napoleonischen Frankreich verbündet gewesen. Also quasi La Grande Nation Seite an Seite mit Mia san mia. Und da wäre es gemeinsam gegen die Tiroler gegangen. Woll, woll. Der Berliner schmiss eine Terrassenrunde. Erst nach und nach wandten sich alle wieder der Bühne unten im Tal zu.
Dort hatte das Geknatter der Gartenmaschinen einen wilden Höhepunkt erreicht. Mit vereinten Kräften fräste und hämmerte das Elektroensemble der Kramerhänge die letzten Langschläfer aus den Daunen. Auch der Bartl hatte von der gefällten Birke schon ein paar armdicke Äste abgeholzt, in seinem Fall allerdings altmodisch-händisch. Er schleppte das Geäst um das Haus herum, wo sich schon ein ansehnlicher Stapel von Zweigen und Ästen gebildet hatte. Hier in diesem abgelegenen, leicht ansteigenden Teil des Gartens, den man von der Straße aus nicht einsehen konnte, stand auch der Schuppen, in dem er seine Gartengeräte aufbewahrte. Am Bartl sei Schupf’n – das hatte ihm die Gretl, Spaß muss sein, zum runden Geburtstag über den Eingang gemalt. Und ihm gleich eine denkmalgeschützte Hacke dazu geschenkt. Im Inneren waren die zahlreichen Gartengeräte gelagert. Baumscheren in allen Größen, Vertikutierer, Rasenmäher, Sensen, Sicheln – das meiste davon uralt und auf Flohmärkten erstanden. Der Suderer Bartl wollte die Gartenarbeit genießen, er wollte sich Zeit lassen. Garteln wie vor hundert Jahren. Eine Ausnahme bildete lediglich die dieselbetriebene Häckselmaschine. Sie war zu groß, um im Schuppen untergebracht zu werden. So stand sie frei auf einem besonders dafür vorgesehenen Rasenstück, im Winter und bei Regen abgedeckt mit einer bundeswehrgrünen Plane. Mit diesem Ungetüm hatte der Suderer vor, das Geäst weiterzuverarbeiten.
»Des wird a Hitz heit!«, stöhnte er und ließ ein paar uralte Werdenfelser Flüche vom Stapel. »A söttane Hitz, a söttane.«
Er musste selbst lächeln über seine bayrischen Urlaute. Den Gumpendobler Werner hatte er jedenfalls damit überzeugen können. Der Gumpendobler Werner hatte ihm den Urbayern abgekauft.
Doch der Bartl, wie er im Ort von fast allen genannt wurde, war alles andere als ein Einheimischer. Er war einer jener Zugezogenen und Zugereisten, Hineingeschmeckten und Hierhängengebliebenen, die sich stärker assimiliert hatten und trachtlerischer verhielten als die einheimischsten Einheimischen.
Der Bartl hieß eigentlich Bertil, nämlich Bertil Carlsson, er war Schwede und stammte aus Nacka nahe Stockholm. Er war ein hünenhafter blonder Nordländer, doch das fiel weiter nicht auf im Kurort. Wer sich da nicht alles hineingemendelt hatte! Da gab es einige verdächtig dunkelhäutige Bauern, deren Vorfahren wohl noch aus der Zeit stammten, als Hannibal hier die Alpen überquert hatte. Da konnte man nicht wenige südländische (vielleicht etruskische?) Gesichtsschnitte sehen, die von der ehemaligen Existenz der uralten Römersiedlung Partanum zeugten. Und dann eben auch Schweden. Bertil Carlsson hatte sich zusammen mit seiner Frau Grit vor fünf Jahren im Kurort zur Ruhe gesetzt. Und er war nicht nur Schwede, er war auch kein Gärtner. Das wunderbare, aber heruntergekommene Suderer-Anwesen am Kramerhang hatten sie sich vor ein paar Jahren gekauft, sie hatten es schön und authentisch renovieren lassen, sie hatten Lüftlmalereien anbringen lassen, die das Herz jedes Passanten höher schlagen ließen: ländliche Ernteszenen, geselliges Beieinandersitzen in den rosigsten Farben. Drinnen ging es weiter mit der Heimatpflege. Alt-Werdenfelser Bauernschränke. Ein Tisch mit eingelassenen Vertiefungen als Teller. Knarzende Bodendielen, Spinnräder, Schindelschnitzmaschinen. Der hundertjährige, hölzerne Bauernkalender an der Wand und ein wuchtiger Steinofen aus dem 19. Jahrhundert. Alles hatten sie mauern, zimmern und schmieden lassen, lediglich die Gartenarbeiten, die ließ sich ein Bertil Carlsson nicht nehmen. Das war sein Spleen, davon hatte er sein ganzes Berufsleben lang geträumt.
Er war mit seiner Frau schon früher im Urlaub hier gewesen, mehrmals, zur Erholung im heilklimatischen Kurort, und die beiden hatten in Erfahrung gebracht, dass die alte Sudererin, die als Einzige noch im Haus wohnte, es nicht mehr lange machen würde. Sie kauften ihr das Haus ab und wurden damit, so war es der Brauch, schnell die neuen Suderers. Die schwedischen Eheleute verwandelten sich im Handumdrehen in Bartl und Gretl. Kaum jemand wusste, dass der Bartl die Medizin und die Gretl die klassische Musik weit hinter sich gelassen hatten.
»Herrgottsakrament«, fluchte Carlsson, als ein Birkenstück im Häcksler stecken geblieben war. »Saugrattler, verreckter, gehst nei!«
Professor Dr. Bertil Carlsson war Arzt gewesen, ein international anerkannter Internist, Autor unzähliger einschlägiger Artikel und Fachbücher, zudem – und das wusste nun wirklich kaum jemand im Kurort – ehemaliges Mitglied der Jury für den Medizinnobelpreis. Der Gumpendobler Werner zum Beispiel hatte sicherlich keine Ahnung davon, dass Carlsson zwischen 1987 und 2008 Leute wie James Whyte Black (»Wegweisende Entdeckungen wichtiger biochemischer Prinzipien der Arzneimitteltherapie«) oder die beiden Deutschen Erwin Neher und Bert Sakmann (»Entwicklung einer Methode zum direkten Nachweis von Ionenkanälen in Zellmembranen zur Erforschung der Signalübertragung innerhalb der Zelle und zwischen den Zellen«) in die hippokratische Weltelite aufgenommen hatte. Dass er im berühmten Restaurant ›Goldener Frieden‹ gesessen und mit seinen Jurykollegen über die neue Shortlist diskutiert hatte. Ein Russe diesmal? Jemand aus der Genetik? Bei den Sitzungen im ›Goldenen Frieden‹ war wie immer Nils Backlund hereingekommen. Das war Carlssons Friseur in Stockholm.
»Hallo, Bertil«, hatte der Friseur jedes Mal gerufen. »Warum gebt ihr nicht dem braven Doktor Fogelström den Preis?«
»Wem?«, fragten die Teilnehmer der Runde, die den Scherz noch nicht kannten.
»Doktor Kjell Fogelström, Allgemeinarzt aus Stockholm-Södermalm«, fuhr der Friseur fort. »Er hat seine Praxis gleich hier ein paar Straßen weiter. Das ist einer, der noch mit dem Köfferchen von Haus zu Haus geht.«
»Und was hat der entdeckt?«, fragte einer aus der Runde.
Beim Gedanken an diese Geschichte musste Carlsson schmunzeln.
»Ja, was hat der entdeckt? Dass in der Medizin eigentlich nichts besser hilft als regelmäßig verzehrte Äpfel.«
»Aha, der konsequente Umsetzer des Spruches An apple a day keeps the doctor away[1] soll in den medizinischen Olymp gehoben werden?«
»So ähnlich«, hatte Carlsson gesagt. »Wir sollten ihn mal auf die Longlist setzen.«
Bertil Carlsson betrachtete lächelnd seine schmutzigen Hände. Er ging noch einmal zurück zum Zaun des Vorgartens. Drei Vormittagsschlenderer lüfteten den Hut und grüßten. Auch sie kannten ihn. Als Bartl.
Die Carlssons hatten sich im Lauf der fünf Werdenfelser Jahre gut in die Gemeinde eingefügt. Zuallererst hatten sie das Oberbayrische gelernt, sich in den schleppenden, etwas rauen Dialekt des Oberlandes fallen lassen. Natürlich wusste man immer noch, dass sie Zugereiste waren, aber sie wurden akzeptiert. Einige Ausdrücke der Altvorderen wie hai, wax, nochat, nacht (glatt, stupfig, nah, gestern), zudem richtig ausgesprochen und an geeigneter Stelle eingesetzt, machten sie schon zu halben Eingesessenen. Sie taten jedoch etwas noch weitaus Wichtigeres. Sie nahmen an Bräuchen und Vereinsaktivitäten teil. Im Volkstrachtenverein waren sie die eifrigsten Mitglieder, Carlsson war ein begeisterter Schuhplattler, er war wohl der erste Schwede aus Nacka, der beim historischen Alten Tanz mittat. Natürlich hatte er seine Kluft nicht bei einem der vielen Gewalttrachtlerläden gekauft, er hatte sich seine Lederhose beim Säckler anmessen lassen. Bertil war zudem Mitglied der Feuerwehr, des Alpenvereins, beider Skiclubs; Grit war in der Blaskapelle, im Bauerntheater, im Kripperlfigurenverein und in der Damenabteilung des Steinheberclubs. Sie war zudem eine enthusiastische Kletterin. Gar mancher Bergfex vom Alpenverein lobte sie wegen ihrer starken, draufgängerischen Grifftechnik. Wenn Grit Carlsson und Prof. Dr. Bertil Carlsson in vollem überbayrischen Ornat aufmarschierten, hätte man sich vielleicht bloß gewundert, dass es so blonde, nordische Bayern auch gab – aber ansonsten wirkten sie echter als mancher echte Einheimische. Da blieb es nicht aus, dass Grit und Bertil ›die Gretl‹ und ›der Bartl‹ genannt wurden, sie ließen es sich gefallen, nannten sich schließlich selbst so, zuerst im Spaß, dann ganz selbstverständlich im Hausgebrauch.
Wuchtend und schwitzend schleppte der Schwede aus Nacka weitere armdicke Äste vom Vordergarten in den hinteren Teil des Anwesens. Bald würde nur noch ein frischer Strunk von der ersten Birke zeugen. Carlsson winkte dem Gumpendobler Werner noch einmal zu, der die Straße wieder zurückgekommen war, sich heruntergebeugt hatte, um auf seinen sogenannten Hund einzureden. Carlsson hob den Kopf und blickte in die gleißende Sonne. Er warf den letzten Ast auf den Haufen. Dann ging er nochmals zurück zum Zaun. Die Arbeit würde bald geschafft sein. Er hatte vor, die kleinen Blätter und Zweige, die Reste der einst so stolzen Birke zusammenzurechen, dann wollte er die Zweige häckseln. Der Gumpendobler Werner war inzwischen verschwunden, doch zwei andere, allzu bekannte Gestalten schlenderten die Straße herauf. Es war das ehemalige Bestattungsunternehmer-Ehepaar Ignaz und Ursel Grasegger, beide im bequemen Trachtenlook, nicht so geschleckt und übertrieben penibel wie bei den Carlssons, eher leicht und locker, das Trachtlerische gewissermaßen ironisch umspielend, wenn nicht sogar parodierend.
»Grüß Gott, Herr Professor«, sagte Ursel. Die Graseggers zählten zu den wenigen, die von dem Geheimnis um die Staatsbürgerschaft der Suderers und der hochrangigen Vergangenheit des Professors wussten. Viele ehemalige Macher und Entscheider wohnten hier im Kramerhangviertel, ehemals Wichtige, die sich zurückgezogen hatten aus dem öffentlichen Leben. Langsamer gewordene Skiasse, geschasste Wirtschaftstycoons, in die Jahre gekommene Größen des Showgeschäfts, ausrangierte Politiker – und eben Pensionisten wie die Carlssons. Das Kramerhangviertel lag zwischen dem Friedhof und dem einstigen Haus der Graseggers, das vor Jahren abgebrannt war. Die ehemaligen Bestatter, denen die Berufserlaubnis wegen krimineller Machenschaften entzogen worden war, gingen hier täglich spazieren. Sie holten sich auf dem Friedhof Inspirationen, manchmal trafen sie sich dort auch mit Schatten der Vergangenheit.
»Wir wollten bloß noch einmal Servus sagen«, fügte Ignaz hinzu.
»Verreisen Sie?«, fragte Carlsson höflich.
»Ja, endlich dürfen wir ins Ausland. Wir haben sozusagen grenzüberschreitenden Freigang.«
»Aber geht denn das so einfach?«
»Wir müssen uns an jedem neuen Ort bei einer lokalen Polizeidienststelle melden.«
»Und wo soll es hingehen?«
»Zuerst einmal nach Wien. Wir erfüllen uns einen langgehegten Traum, wir besuchen berühmte Friedhöfe, mit den europäischen fangen wir an.«
»Ja, genau«, sagte Ignaz begeistert. »Und auf jeden Fall fahren wir auch nach Prag, da, wo der Franz Kafka liegt. Wir wollen uns selbst davon überzeugen, dass dort Briefe aufs Grab geworfen werden. Die er über Nacht höchstpersönlich beantwortet.«
»Davon habe ich auch schon gehört«, sagte Carlsson lächelnd. »Sogar die Prager Schulkinder gehen an Kafkas Grab und legen ihre angefangenen Aufsätze über Nacht darauf. Am nächsten Tag sind sie in sauberer Sütterlin-Schrift zu Ende geschrieben.«
»Ist natürlich ein Schwindel«, kicherte Ursel. »Ein vom Prager Fremdenverkehrsamt bezahlter Lohnschreiber macht das.«
»Und welche Friedhöfe wollen Sie außerdem besuchen?«
»Den Highgate Cemetery in London. Den Montjuïc in Barcelona. Solche Kaliber.«
»Sie dürfen auf keinen Fall den Skogskyrkogården in Stockholm vergessen«, sagte Carlsson.
»Den was?«, fragte Ursel.
»Den Stockholmer Waldfriedhof. Weltkulturerbe.«
»Und welche Berühmtheiten sind dort beerdigt?«
Ursel entging das kleine Lächeln von Carlsson nicht. Aber sie konnte es nicht deuten. Sie merkte sich das Lächeln.
»Greta Garbo zum Beispiel«, entgegnete Carlsson.
Carlsson bückte sich, um einen kleinen Zweig aufzulesen, der am Boden gelegen hatte. Es war ein Birkenzweig mit einem Blatt, auf dem eine Raupe kroch. Sorgsam schnippte Carlsson die Raupe vom Blatt, auf dass sie keinen Schaden nähme.
»Sie kennen sich gut aus mit Gräbern, Grabpflege und allem Drum und Dran«, fuhr Carlsson fort. »Da liegt solch eine Reise nahe.«
»Wenn wir uns da nicht auskennen, dann weiß ich auch nicht«, sagte Ignaz. »Jedes Grab erzählt eine Geschichte, zu jedem gibt es eine Anekdote.«
»Drum ist der Spruch Schweigen wie ein Grab eigentlich ein Schmarrn«, warf Ursel ein. »Denn gerade ein Grab schweigt überhaupt nicht. Die Bepflanzung, der Grabstein, die Inschriften, der Allgemeinzustand – das alles redet eher wie ein Wasserfall.«
»Wobei Reden wie ein Wasserfall umgekehrt auch ein Schmarrn ist«, entgegnete Ignaz. »Denn gerade ein Wasserfall redet überhaupt nicht. Er verwischt alle Spuren. Mehr schweigen als ein Wasserfall geht gar nicht.«
Carlsson schwieg. Wie ein Wasserfall.
»Na, dann gute Reise«, sagte er schließlich zerstreut. »Schreiben Sie mir Ansichtskarten von den Friedhöfen? Mich als Arzt interessieren Friedhöfe natürlich ebenfalls. Und grüßen Sie die Greta Garbo von mir.«
Ignaz und Ursel spazierten weiter.
»Hast du gesehen, wie der komisch geschaut hat?«
»Wer?«
»Der Carlsson.«
»Bei was?«
»Als er von dem Friedhof in Stockholm erzählt hat.«
Alles war gut an diesem Morgen. Carlsson kaute auf einem Wacholderzweig herum, er pfiff ein bayrisches Lied, er schleppte den letzten Birkenast nach hinten zum Häcksler.
Fußnoten
[1]
Sinngemäße Übersetzung: Pro Abend ein Bier, und dein Arzt stirbt vor dir.
6
Braşov/Rumänien, Februar 1987
Ein einfaches, aber beeindruckendes Experiment, das ich gerade gestern wieder vor einer Gruppe von Patienten durchgeführt habe.
Alles, was man dazu braucht, ist eine Taschenlampenbatterie, ein paar Elektrodrähte und Heftpflasterstreifen. Ich will zeigen, dass Muskeln auf einfache Weise elektrisch stimuliert werden können. Ich klebe die Enden der Drähte auf meine Handfläche unterhalb des Zeigefingers. Etwa so:
Auf diese Weise sende ich Signale an den ›musculus adductor pollicis‹, den sogenannten ›Daumenheranzieher‹. Ich öffne und schließe den 12-Volt-Stromkreis in unregelmäßigen Abständen. Meine Hand liegt ruhig und locker auf dem Tisch. Ich spüre nur ein leichtes Kribbeln. Dann aber bewegt sich der Daumen von selbst.
»Ha!«, ruft Dr. Draganovic verächtlich. »Ein billiger Trick!«
Ich wiederhole den Versuch mit der Hand eines Patienten. Und es funktioniert! Es ist alles andere als ein billiger Trick. Der Daumen zuckt und berührt schließlich den Zeigefinger. Die Stromstöße haben die Hand wirklich bewegt. Dr. Draganovic schweigt. Er muss endlich einsehen, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde.
7
Bertil Carlsson stand knöcheltief im Schmutz. Der schluffige Batz quoll quatschend und seufzend an seinen Knöcheln hoch, doch Carlsson, der Hüne aus Nacka, stand mit seinen schwarzen Gummistiefeln sicher im aufgeweichten Boden. Er startete den Dieselmotor des Häckslers, dessen Einzugswalzen sich sofort hungrig und schmatzend drehten. Diese Maschine hatte er aus Schweden importiert, und es war fast das Einzige, was er von dort mitgebracht hatte – sah man von den medizinischen Fachbüchern (und natürlich von Grit) ab. Er hatte ihn bei der Firma Hasselnöt & Efterfragåd gebraucht erstanden, es war ein großer Industriehäcksler, der Holzdurchmesser bis fast zu einem halben Meter schaffte. Hydraulischer Einzug mit zwei großen Einzugswalzen und zwei bauchigen Wannen, die das Häckselgut aufnahmen. Schwedische Qualitätsarbeit. Carlsson liebte es, Dünger und Mulch für den Garten selbst zu produzieren, und so häckselte er die Zweige einmal zu schützendem Mulch, das andere Mal zu Düngerspreu.
Carlsson schnitt eine zufriedene, stolze Grimasse, als er einen großen Ast in die leise ratternde und hustende Maschine steckte. Als die Walzen das Holz erfassten und mit einem schaurig-schönen Geräusch zerquetschten, schob sich ein ganz ferner, lange nicht mehr gedachter Gedanke in seinen momentan reichlich gärtnerisch ausgerichteten Kopf. In diesen Tagen musste die erste Sitzung für die Nobelpreisverleihung stattfinden. Wer würde wohl dieses Jahr das Rennen bei den Medizinern machen? Er wusste, dass die Juroren jetzt im Restaurant ›Goldener Frieden‹ über die Longlist quatschten, und er dachte daran, wie es damals gewesen war, als er selbst dort gesessen hatte. Mit Granqvist, Sundström und Pettersson, den drei Ultrakonservativen. Piet Pettersson war der Schlimmste gewesen. Ein richtiger Reaktionär. Hätte Pettersson im Mittelalter gelebt, hätte er dem Papst den Nobelpreis gegeben und nicht Galilei. Vielleicht kam in diesem Moment Nils Backlund, sein früherer Friseur, herein und schlug wieder einmal Doktor Kjell Fogelström, den Allgemeinarzt mit dem täglichen Apfel, für den Nobelpreis vor. Inzwischen fand Carlsson das gar keine so schlechte Idee. Täglich einen Apfel genießen, und die Pharmas können schließen …
Carlsson schob eine armdicke Birkenstange in den Häcksler, nicht ohne zuvor erneut einer grünen Raupe das Leben gerettet zu haben. Hoppla! Fast wäre er gestrauchelt. Man musste hier verdammt aufpassen, um nicht auszurutschen. Er blickte hoch, weil er ein Geräusch im ersten Stock des Hauses gehört hatte. Grit war gerade dabei, das Badfenster zu öffnen. Sie lächelte ihm zu und hielt ein Zahnputzglas in die Höhe. Sie drehte es, betrachtete es prüfend, stellte es behutsam ab. Sie hob die freie linke Hand leicht an, der Handteller zeigte nach oben, sie strich mit der Handfläche der anderen Hand schnell darüber. Die Bewegung war eindeutig: Sauber. Rein. Clean. Carlsson lächelte zurück. Grit nickte und schloss das Fenster wieder. Heute hatte Bartl eigentlich einen Termin mit Leonhard Wörndle, dem Ersten Vorsitzenden des örtlichen Volkstrachtenvereins, vereinbart. Mit dem hätte er über die Gestaltung der jährlich stattfindenden Heimatwochen sprechen wollen. Er hatte Wörndle abgesagt, die Gartenarbeit ging heute vor.
Bei dem großen, krummen Prügel, den Carlsson jetzt in der Hand hielt, war es besser, ihn von oben in den Häcksler zu stecken. Carlsson bestieg einen umgedrehten Gartenkübel und kletterte auf die Maschine. Er hatte die Abdeckplatte, die das Innere des Geräts schützte, schon vor langer Zeit abgeschraubt. Es war einfach praktischer so. Er stand nun breitbeinig auf dem Paradehäcksler der Firma Hasselnöt & Efterfragåd und zog den Ast nach oben. Fast wäre er dabei abgerutscht mit seinen batzigen Stiefeln. Er konnte sich gerade noch fangen. Er war eben auch nicht mehr der Jüngste. Er wischte sich den Schweiß ab. Unter ihm summte, pfiff und schnatterte das Räderwerk der Maschine. Wieder kam er leicht aus dem Gleichgewicht. Er riss den Birkenast noch ein wenig nach oben. Das Trumm war schwerer als gedacht. Sollte er nochmals nach unten klettern und ihn zerhacken? Nein, es musste auch so funktionieren. Carlsson zerrte an dem störrischen Ast. Als er kurz hochblickte, schrak er zusammen.
Am Zaun, der das Grundstück zum Wald hin begrenzte, stand jemand. Ein weißes Gesicht löste sich aus dem Tannengrün. Es war ein Gesicht, das Carlsson nur allzu gut kannte. Bertil Carlsson atmete schwer. Seine Brust zog sich zusammen. Unwillkürlich ließ er den Ast los. Auch nach all den Jahren war kein Zweifel möglich: Er war es. Ein unguter, ahnungsvoller Schauer durchlief Carlsson. Jetzt war also eingetreten, was er so lange befürchtet hatte. Er stand immer noch breitbeinig auf der Häckselmaschine. Er schwankte nicht. Der Ast steckte zwischen den Fräsewalzen und wurde langsam hineingezogen. Der Mann am Zaun öffnete die kleine Tür, trat in den Garten und kam über den gepflasterten Weg auf ihn zu. Er hielt ein kleines Kästchen unter dem Arm geklemmt. In Carlsson stieg eine schaurige Ahnung auf, was sich in diesem Kästchen befinden könnte. Er schüttelte sich und atmete tief durch. Er griff sich an die Brust und massierte die Herzgegend. Der Mann war schon in der Mitte des Gartens angelangt. Er begann seine Schritte zu beschleunigen. Er kam immer näher. Carlsson wusste, dass jetzt, mitten an diesem schönen Maivormittag im herrlichen Werdenfelser Land, etwas ganz Furchtbares geschehen würde.
8
Am anderen Ende des Kurorts, in keiner ganz so guten Gegend, saß einer in seinem miefigen Zimmer, der von alledem nichts wusste. Es war ein schlaksiger junger Mann Mitte zwanzig, mit starker Brille und fettigen Fingern. Der Tisch war bedeckt mit angebissenen Hamburgern, leeren Pizzaschachteln und umgeworfenen Coladosen. Er starrte abwechselnd auf drei flimmernde Bildschirme. Einer der Computer war ein wasserunempfindlicher GetacX500-Rechner mit militärischer E/A-Schnittstelle. Ein Schnäppchen. Er hatte ihn für seine Zwecke ein wenig umgebaut. Jetzt lehnte sich der schmalbrüstige Junge mit der Bekenner-T-Shirt-Aufschrift Hacker Bräu in seinem Sessel zurück.
Motte war ein Computer-Nerd. Ein Cracker. Sogar in seinen Träumen erschien oben rechts ein HD-Symbol. Trotzdem war Motte ein Faultier. Er arbeitete nicht viel mehr als eine Stunde am Tag, die Einkünfte daraus reichten allerdings locker für den Lebensunterhalt. Und die Arbeit war denkbar einfach. Er drang vom Schreibtisch aus in fremde, schlecht geschützte Computersysteme ein, und dafür, dass er wieder rausging, ohne größeren Schaden zu hinterlassen, kassierte er ein wenig Kohle ab. War eh nicht viel, und das meiste spendete er. Brandschatzen hätte man das früher genannt. Das Androhen von Niederbrennen – und das Verzichten auf das Niederbrennen gegen eine kleine Gebühr. Die Mafia arbeitete so, und der Staat tat im Grunde auch nichts anderes. Motte stieß bei seinen Aktionen selten auf Widerstand. Die meisten kleinen Banken und Sparkassen zahlten sofort. Versicherungen und Fastfoodketten warfen einem das Geld schier nach. Motte hätte wesentlich mehr verdienen können, aber er war ein faules Stück. Er war der Oblomow unter den Crackern.
Trotzdem hatte Motte Viskacz ein paar Probleme. Seine größte Sorge war immer noch sein bescheuerter alter Herr. Der war Künstler. In seinem Alter! Und neuerdings … Motte schüttelte den Kopf. Wenn man normale Eltern hatte, dann fragten die Finanzschnüffler nicht, wovon man lebte. Die nahmen an, dass einen die Eltern unterstützten. Aber so? Motte malte sich aus, wie so ein fiskalischer Clown bei ihm an der Tür klingelte.
»Von was leben Sie, Herr Viskacz?«
»Gelegenheitsjobs.«
»Welcher Art, wenn ich fragen darf?«
»Online-Handel.«
»Sie versteuern das natürlich?«
»Natürlich.«
»Können wir mal Unterlagen davon sehen?«
»Klar. Jederzeit. Ich mail sie Ihnen zu.«
Er musste sich endlich einen richtigen Tarnjob besorgen. Er verdiente gut Geld, spendete viel, doch niemand konnte ihm das glauben, wenn er nicht ein paar legal verdiente Kröten vorzeigen konnte.
Er hätte EDV-Kurse geben können, in der VHS. Aber er wollte keine öden EDV-Kurse geben. Man hatte so was im Blut oder eben nicht. Er hatte eine bessere Idee gehabt. Er hatte sich für eine Kfz-Mechaniker-Lehre beworben. Genauer gesagt, eine Kfz-Mechatroniker-Lehre. Das war die Zukunft. Autos wurden immer mehr zu fahrbaren Rechnern. In einem stinknormalen Mittelklasse-Pkw waren siebzig Steuergeräte eingebaut, die die unterschiedlichsten Daten sammelten, speicherten, preisgaben, verarbeiteten, weiterleiteten. Persönliche Daten, denn die ahnungslosen Fahrer hinterließen Informationen ohne Ende. Die ganze Autoelektronik-Technologie war erst am Anfang, also empfindlich gegen Angriffe und manchmal auch noch reichlich rechtsfrei. Eine ganz normale Kfz-Werkstatt. Und Zugriff auf Autos von wichtigen Personen. Davon gab es im Kurort eine ganze Menge. Jede Schrottlaube eine Datenkrake. Und in der Nähe vom Autohaus Schnabelböck gab es eine Fastfood-Bude. Übermorgen würde er dort anfangen.
9
»Baaaartl!«
Grit Carlsson war völlig außer Puste vom Schreien. Sie setzte sich auf einen original Melkschemel aus dem 18. Jahrhundert. Sie verschnaufte. Sie hielt sich die Seite. Ihr war es wesentlich schwerer als ihrem Mann gefallen, Schweden zu verlassen. Auch sie war dafür gewesen, den Ruhestand im Kurort zu verbringen, doch sie hatte sich die Assimilation leichter vorgestellt. Erst nach und nach legte sie schwedische Gewohnheiten und Marotten ab. Sie sprach inzwischen gutes Werdenfelserisch, doch manchmal rutschte die nordische Linguistik durch.
»Seiße«, rief sie gerade halblaut. »Son so spät.«
Die alte Standuhr im Flur schlug drei. Auch die ferne Kirchturmuhr in der Ortsmitte böllerte ihr nachmittägliches, melodisches Lied. Kaffee- und Kuchenzeit. Die Gartengeräte schwiegen. Kein Rasenmäher mehr, kein tenoraler Bohrschlaghammer. Selbst die kreischende Flex lag mucksmäuschenstill in der Ecke.
»Baaaaaaaartl!«
Keine Antwort. Grit war in den Sechzigern groß geworden, da war es noch Sitte gewesen, auch allein im Hause immer chic und adrett auszusehen. Nix Schuhe in die Ecke gekickt, Schlapfen, Bier und RTL II, sondern: Stil, Haltung und gekämmte Haare, es könnte ja jederzeit Besuch vor der Tür stehen. Grit zupfte an der selbstgestrickten Bauernjacke und schnippte ein Fusselchen weg. Einer der handgedrechselten Hirschhornknöpfe mit den eingeschnitzten Jagdmotiven hing lose am Faden. Sie holte Nähzeug und machte ihn mit ein paar Stichen wieder fest. Sie war eine, die nichts aufschob oder liegen ließ. Sie erledigte alles sofort. Sie fingerte nach einer losen Haarsträhne und steckte sie sorgsam zurück. Sie trug einen strengen Knoten, wie ihn die älteren Damen im Ort zu tragen pflegten. Sie betrachtete sich im Spiegel, strich ihren Rock glatt und machte zum wiederholten Mal einen Kontrollgang durch die verwinkelten Zimmer des alten Bauernhauses. Sie warf einen Blick ins Bad, in den Speicher, in den Keller. Sie blieb an der geschlossenen Tür von Bertils Arbeitszimmer stehen. Sie zögerte. Dann trat sie vorsichtig ein. Der Raum war fast vollständig ausgefüllt von einem riesigen Eichentisch, auf dem sich Bücher, Zeitschriften und beschriebene Papiere in einer nur für Carlsson selbst nachvollziehbaren Ordnung türmten. Das hölzerne Ungetüm mit den auffällig massiven Fußleisten war einst der Esstisch der Bauernfamilie Suderer gewesen, das konnte man an den eingelassenen, tellergroßen Essmulden noch erkennen. An die Wand waren Zettel mit schematischen medizinischen Zeichnungen gepinnt. Ein handsigniertes Foto von Alexander Fleming, dem Nobelpreisträger von 1945 (»Für die Entdeckung des Penizillins«). Auch dieser Raum war verwinkelt, in einer nicht gleich auf den ersten Blick sichtbaren Ecke stand ein hölzerner Großvater-Schaukelstuhl, daneben ein kleines, windschiefes Beistelltischchen. Grit trat einen Schritt näher. Ein fast ausgetrunkenes Glas Tee, ein paar angebissene Kekse, eine angebrochene Packung mit herzstabilisierenden pflanzlichen Tabletten. Grit nahm das Teeglas und den Keksteller und trug beides in die Küche. Danach trat sie auf den Balkon hinaus und ließ ihren Blick über den Vorgarten schweifen. Eine Birke fehlte. Die andere hatte einen Keilschnitt, der bis zu einem Drittel in den Stamm reichte. Die Birke schien zu schreien mit ihrem weißen, zahnlosen Mund. Es war ganz und gar untypisch für den Perfektionisten Bertil Carlsson, eine angefangene Arbeit nicht zu beenden.
Auf der Straße spazierten ein paar Leute vorbei und grüßten. Sie grüßte zurück. Sie rief nochmals weithin vernehmlich nach ihrem Mann. Wieder keine Antwort. Dann fragte sie die Mails ab. Es war keine besondere Nachricht dabei, nicht einmal Nils Backlund, der Friseur aus Stockholm, hatte geschrieben. Der schickte oft eine Mail, um wieder einmal darauf hinzuweisen, dass der wackere Allgemeinarzt Doktor Kjell Fogelström doch der geeignetste Kandidat … Nette Geschichte. Sie ging um das Haus herum und warf einen Blick auf den leicht ansteigenden Hintergarten. Auch hier ließ sie ihre Stimme mehrmals erschallen. Keine Spur von ihrem Mann. Der Schuppen mit der Inschrift Am Bartl sei Schupf’n