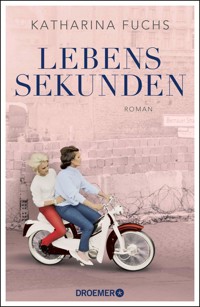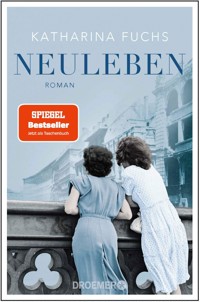9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Moderne Aschenputtel-Geschichte in der glitzernden Pariser Modewelt der wilden 90er Jahre: Bestseller-Autorin Katharina Fuchs erzählt in »Der Traum vom Leben« einfühlsam, authentisch und hochspannend ein faszinierendes Frauen-Schicksal in der Ära der Topmodels, basierend auf einer wahren Geschichte. Zu groß, zu dünn und zu blass ist die junge Luise für die Jungs in der norddeutschen Provinz – da verliebt sie sich in Nils, den Sohn des Großbauern mit den strahlenden Augen. Doch die Tochter des ärmsten Bauern weit und breit ist für seine Eltern nicht standesgemäß. Ein Star-Friseur öffnet ihr die Türen, sie ergreift die Chance – und findet sich als Model auf den glamourösen Pariser Laufstegen wieder. Denn die 90er sind das Zeitalter der Supermodels. In der ganzen Stadt schießen aufstrebende Modelabels wie Pilze aus dem Boden, die Nachtclubs feiern legendäre Partys. Zwischen Modeglamour und dem schillernden Pariser Nachtleben tut sich für Luise eine eindrucksvolle Welt auf ... Das verrückte Paris der Neunzigerjahre will aus dem schüchternen friesischen Mädchen einen Star auf dem Catwalk machen. Doch wie hoch ist der Preis? Luise muss eine Entscheidung treffen … Katharina Fuchs hat selbst in Paris gelebt und den Beginn des verrückten und aufregenden Jahrzehnts, das mit seiner Mode alles in Frage stellte, hautnah miterlebt. Entdecken Sie auch die berührenden historischen Romane von Katharina Fuchs, die auf der Familiengeschichte der Bestseller-Autorin beruhen: - Zwei Handvoll Leben (1914–1953) - Neuleben (50er- und 60er-Jahre) - Unser kostbares Leben (70er- und 80er-Jahre)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Katharina Fuchs
Der Traum vom Leben
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein faszinierender Roman über den Traum von Liebe und Glamour in der schillernden Welt der Pariser Mode.
Zu groß, zu dünn und zu arm ist die junge Luise für die Jungs in der norddeutschen Provinz der 90er Jahre. Da bekommt sie bei einem Friseurwettbewerb die Chance ihres Lebens: Ein Starfriseur nimmt sie mit nach Paris. Für die Prêt-à-Porter-Shows der Modedesigner stylt sie die Supermodels. Zwischen Modeglamour und dem schillernden Pariser Nachtleben tut sich für Luise eine eindrucksvolle Welt auf, und das Unglaubliche geschieht: Ausgerechnet vor der Chanel-Schau fällt eines der Models aus… Luise steht vor einer Entscheidung: Soll sie wirklich ALLES dafür tun, um in der Pariser Modewelt ganz nach oben zu kommen?
Inhaltsübersicht
Es gibt Tage, da [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Danksagung
Es gibt Tage, da kann ich die salzige Butter des Briocheteigs auf der Zunge schmecken, den Geräuschpegel des Boulevards St. Germain hören, den Duft des Pariser Berufsverkehrs riechen. Wie duftet eine Stadt? Sicher ist jedenfalls: Wenn die Nacht sich vor dem Tag verneigt, steigt die Intensität der Gerüche und Paris zeigt ein anderes Gesicht. So viel Magie liegt an keinem Ort in der Luft wie in Paris.
Es kommt mir dann vor, als säße ich wieder auf einem der Bugholzstühle im Café de Flore, vor mir auf der Marmorplatte des kleinen runden Tischchens einen Café Crème double und eine der unvergleichlich luftigen und zugleich saftigen Brioches, die Aydin jede Nacht um vier Uhr anfängt zu backen.
Ich nehme das Gebäck in die Hand, sehe Männer in maßgeschneiderten Anzügen – dafür habe ich inzwischen einen Blick – auf ihrem Weg zur Métrostation vorübergehen. Übernächtigte Paradiesvögel in Paillettenkleidern, die aus einem Nachtclub oder einem Hotelbett zurück in ihr Arrondissement kommen. Mütter und Kindermädchen, die dunkelblau gekleidete Kinder zur Schule oder in den Kindergarten bringen. Kleinwagen der Marken Renault und Peugeot tuckern vor schwarzen Stretchlimousinen her. Und ich mag sogar den Pariser Berufsverkehr, denn er bildet einen der größten Gegensätze zu der Situation in meinem Heimatort. Die Mystik und Faszination der Stadt liegt in dieser besonderen Mischung.
»Avec ardeur«, pflegt Aydin zu sagen – mit Hingabe. Damit meint er seine innere Haltung, wenn er die herrlichen Backwaren für das Café herstellt. Ich schließe jedes Mal die Augen, wenn ich hineinbeiße, und weiß, dass er mir dabei zusieht. Wie gespannt er auf mein genießerisches »Hmmm« wartet. Aydin wurde in Marokko geboren und ist in Casablanca aufgewachsen, er hat in Lyon gelebt – und ist dennoch unter meinen Freunden der typische Pariser schlechthin.
Manchmal ärgere ich ihn ein wenig und spanne ihn auf die Folter, lasse ihn zappeln und sage sekundenlang gar nichts. Erst wenn ich ihn dann ansehe und ihm versichere, mich wie im Himmel auf Erden zu fühlen, lächelt er zufrieden.
Ich setze meine schwarze Sonnenbrille ab, ziehe meinen federleichten Kamelhaarmantel enger um die Schultern, werfe ein Alka-Seltzer in das Glas Wasser und frage ihn, was er nach Feierabend vorhat – bei ihm beginnt er schon um elf. »Dormir!«, lautet seine Antwort. Er legt beide Handflächen zusammen und bettet die Wange darauf. »Das würde dir auch guttun!« Dabei nickt er in Richtung der dunklen Ringe unter meinen Augen, die vorher verdeckt waren. Und wie immer schließt er die Frage an, ob ich ihm dabei Gesellschaft leisten wolle. Zwischen uns ist das okay, diese Art Geplänkel gab es von Anfang an, keiner von uns nimmt es allzu ernst. Später werden wir uns sowieso alle wieder in einem der angesagten Bistros treffen. Die ganze verrückte Truppe, zu der er aus irgendeinem Grund von Anfang an gehört hat, mit seiner wohltuenden Normalität. Vielleicht haben wir uns deshalb immer so seelenverwandt gefühlt – weil wir beiden Landeier da eigentlich gar nicht wirklich reinpassten. Und weil ich nur zu gut weiß, wie es sich anfühlt, jeden Morgen vor Sonnenaufgang mit der Arbeit zu beginnen. Aydin wird sich um vier Uhr nachts in seine Backstube verabschieden, während wir noch weiter ins Le Palace, Natasha, Les Bains Douches oder in eine andere der angesagten Pariser Discos und Nachtclubs weiterziehen. Außer an den Tagen, an denen ich gebucht bin. Außer während der Prêt-à-porter- und Haute-Couture-Schauen, außer während der Pariser Modewoche. Dann übe ich mich in eiserner Disziplin und gehe ohne Abendessen, ohne den kleinsten Schluck Alkohol um halb zehn ins Bett.
Das könnt ihr glauben oder nicht!
»Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, belle Lou!«, sagt Aydin mit seinem charmanten Akzent. »Un jour magnifique, ma belle de nuit … belle de minuit!«, verbessert er sich und verschwindet danach in seiner Küche.
»Mitternachtsschönheit.«
In Paris nennen mich alle »Lou«. Obwohl ich Luise heiße.
Luise Jensen.
Ich mag die französische Version meines Vornamens, denn sie ist ein Zeichen meiner Verwandlung. Von dem viel zu lang geratenen, schüchternen Mädchen aus der norddeutschen Provinz mit der Narbe am Bein in eine echte Pariserin.
Ich denke gerne zurück an diese Zeit. Es war eine wahnwitzige, irre Epoche in Paris, als die Modemacher wie Pilze aus dem Boden schossen. Als an jeder Ecke plötzlich eine neue Boutique, eine neue Marke entstand, innerhalb einer einzigen Woche aus einer unscheinbaren Landpomeranze ein Star auf den Laufstegen der Modewoche werden konnte. Was man irgendwann im Gedächtnis behält, sind gar nicht die wichtigen Ereignisse, es sind nur noch die Momente. Es ist eine Farbe, eine Stimmung, ein Klang, eine Melodie oder nur ein Duft, der bleibt. Irgendwann werde ich mich zwar noch daran erinnern, dass ich mit zwei bildschönen Jungen auf der Dachterrasse der Galeries Lafayette stehe, kurz vor Sonnenuntergang, und eine helle Wolke hebt sich über Montmartre ab. Ich werde den Namen des zweiten Jungen vergessen haben, aber mich noch genau an die Umrisse der leuchtenden weißen Wolke erinnern, die hinter der Silhouette von Sacré-Cœur am Himmel hing, und an ihre Lichtreflexe auf den Dächern der Stadt, fein wie Perlmutt. Ich werde mich an ein opulentes Abendessen in einem Penthouse mit Blick auf die Seine erinnern, an den Geschmack von Cœur de filet de bœuf au poivre noir avec sauce béarnaise, daran, ein fließendes Seidenkleid von Gaultier direkt auf der Haut zu tragen, an das wunderbare Gefühl, gut gegessen zu haben und satt zu sein. Aber ich werde mich weder an den Mann, der mich einlud, noch daran erinnern, ob ich seine Erwartungen an diesen Abend erfüllt habe. Was mein Gedächtnis von jenen ersten Pariser Monaten am deutlichsten festhielt, das war die liebevolle Wärme, die Aydin aus seiner Backstube mitbrachte. Die Hingabe, mit der er mir seine selbst gebackene Brioche servierte. Die stolze Begeisterung von Jean-Luc, des Parisers, der mir seine geheimen Lieblingsplätze zeigte. Das fein gewobene Band ihrer unverbrüchlichen Freundschaft, die sie mir nie ganz entzogen, ganz gleich, was ich tat und zu was ich mich überreden ließ. Das ist es, was ich für immer behalten werde.
Im Nachhinein kommt mir dieser Abschnitt meines Lebens vor wie ein Zauber – und das, was folgte, wie ein Traum.
Ich glaube, bevor alles in Vergessenheit gerät, ist es an der Zeit, dass jemand euch meine Geschichte erzählt – am besten von Anfang an. Die Chronistin hat versprochen, dabei objektiv zu bleiben, so kann sich jeder sein eigenes Bild machen.
1
Ostfriesland, April 1992
Luise erwachte noch vor der Dämmerung und schlug sofort die Decke zurück. Bliebe sie noch länger liegen, käme sie auf dumme Gedanken, und gerade das Denken vor der Morgendämmerung wollte sie vermeiden. Denn sobald sie über ihr Leben nachdachte, verlor sie sich leicht in Wünschen und Sehnsüchten, die ihre Mutter nur als Flausen bezeichnet hätte.
Sie hielten keine Hühner mehr, und ihr kleiner Hof war so abgelegen, dass nicht einmal die Hahnenschreie von anderen Bauernhöfen zu ihnen herüberhallten, die sie dazu brachten, aufzustehen.
Dann lag man da, lauschte auf die Stille, wo man doch wusste, dass es hier draußen nie ganz still war. Man glaubte es nur. Aber es gab Geräusche. Meistens prasselte Regen aufs Dach, knisterte der Wind im Gras, schlug ein Ast an einen Stamm, raschelten Zweige, wenn kleine nachtaktive Tiere hindurchschlüpften. Alles lebte, alles war in Bewegung, auf der Suche nach Futter oder Material für den Nestbau, dem Selbsterhaltungstrieb folgend. An diesem Morgen pfiff der Wind durch die Ritzen. Luise begann zu frieren.
Genau aus dem Grund hatte sie gleich die Decke zurückgeschlagen. Sie schwang die Beine aus dem Bett, tastete mit den nackten Füßen nach ihren Pantoffeln.
Wie jeden Tag hatte sie ihr innerer Wecker um fünf Uhr aus dem Schlaf geholt. Und jetzt begann ihr Arbeitstag.
Sie stand auf, zog die gerippte Unterwäsche an, schlüpfte in den sackartigen blauen Overall, band sich den Gürtel fest um die Taille und warf einen Blick in den Spiegel. Das blasse Gesicht mit den blonden, kaum sichtbaren Augenbrauen und Wimpern war so was von nichtssagend! Sie sah aus wie eine Bäuerin, nicht mehr und nicht weniger! Nur dass sie selbst dafür viel zu groß geraten war. Mit den Handflächen strich sie über das feste Köpergewebe des neuen Blaumanns. Männerkleidung – alles andere war ihr an Armen und Beinen zu kurz. Sie würde ihn sich enger nähen müssen, wie alle Kleidungsstücke. Abnäher sahen ordentlicher aus, als wenn sie Stoffborten an den Hosenbeinen annähte – und auf Ordnung legte ihre Mutter besonderen Wert. »Örnung und Süverheid«, wurde sie niemals müde, ihnen zu predigen, »sind dat A und O.« Luise musste sich jedes Mal zusammenreißen, damit sie nicht laut mitsprach. Sie wollte ihre Mutter auf keinen Fall verhöhnen, das hatte sie nicht verdient! Die liebe Moder, die immer nur schuftete. Aber ihre Sprichwörter, Redensarten und Bauernregeln, die sie und Grootmoder Lina zu jeder Gelegenheit herunterbeteten, brachten jeden auf dem Hof hin und wieder auf die Palme.
Als sie den Kopf einzog und die enge Treppe hinunterstieg, hörte sie schon ein Klappern und das Pfeifen des Kessels auf dem Herd. Ihre ganze Kindheit lang war die Küche von frischem, selbst angesetztem Sauerteigbrot aus dem Ofen und starkem Ostfriesentee erwärmt worden. Der Duft der Brotkruste war früher durch das ganze Haus gezogen. Inzwischen fehlte ihrer Mutter die Zeit zum Backen, und es gab meistens Schnittbrot aus der Metro. Immerhin ein schnelles Frühstück, bevor es in den Stall zum Melken ging.
»Moin moin, Moder.«
»Moin moin, Luise.«
Die alte Katze saß auf dem Fensterbrett und starrte hinaus in die Dämmerung. Sie hatte die Schulterblätter hochgezogen und die Ohren angelegt. Ihre ganze Haltung drückte eine Art Unbehagen aus. Der Wind rüttelte so stark am Fensterrahmen, dass das Glas fast aus dem brüchigen Kitt sprang.
»Gleich gibt’s frische, warme Milch, Missi!«, flüsterte Luise ihr mit weicher Stimme zu. Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr hatte sie nichts außer Plattdeutsch gelernt – und keine einzige Autobahn gesehen. Erst in der Grundschule wurde ihr Hochdeutsch beigebracht. Inzwischen sprachen sie zu Hause fast alle eine Mischung aus beidem, bis auf Grootmoder Lina, die am »Plattdüütschen« festhielt, in tief verwurzeltem Misstrauen gegen alles Neue.
Zärtlich strich Luise über das stumpfe Fell der Katze.
»Missi macht mir Sörgen!«, sagte sie, an ihre Mutter gewandt. »Man sieht jede einzelne Rippe hervorstechen, und ihr Fell geht aus.« Zum Beweis hielt sie ein kleines graues Haarbüschel aus ihrem Rücken hoch.
»Se is mager as ’n Stück Holt!«
Ihre Mutter drehte sich zu ihr um und schüttelte den Kopf. »Du und dien Deren! Wir hebben über dreißig Katzen auf dem Hof, und du machst dir Sorgen um das einunddreißigste Exemplar. Missi is old, se quält sich nur noch. Wir sollten ihr eine Spritze geben lassen, wenn der Tierarzt dat anner Mal up de Hof kommt.«
»Eine Vitaminspritze?«, fragte Luise mit unschuldiger Miene, obwohl sie genau wusste, was ihre Mutter meinte.
Auch Dörte Jensen war, wie die meisten Frauen hier, hochgewachsen, einen Meter siebzig groß, breite Schultern von der harten Arbeit. Die blonden Haare, Wimpern und Augenbrauen hatte sie mit Luise gemein. Als Luise mit dreizehn schon alle Kinder ihrer Klasse um einen Kopf überragte, hatten ihre Eltern begonnen, in ihren Ahnenreihen zu forschen, und eine entfernte Tante ausfindig gemacht, die stattliche einen Meter sechsundsiebzig groß gewesen war – vor vierzig Jahren eine Seltenheit. Doch Luise hörte auch nach eins sechsundsiebzig und ihrem vierzehnten Geburtstag nicht auf zu wachsen. Die Striche am Türrahmen, die wie bei so vielen Familien das Gedeihen der Kinder dokumentierten, hatte ihr Vater irgendwann aufgehört zu ziehen. Inzwischen war sie siebzehn, einen Meter sechsundachtzig groß und hatte trotz der »goden Utsicht von daar boven«, wie ihr Vater sie allzu häufig aufzog – der guten Aussicht von da oben –, nichts von der Welt gesehen außer den Torfwiesen, den kunstgedüngten Feldern um ihren Hof herum und dem nächstgelegenen 400-Seelen-Dorf.
»Missi ist die Ururgroßmutter von mindestens fünfzig Kätzchen und Katern. Du wolltest doch auch nicht, dass deine Ururenkel dich irgendwann einmal vor die Tür setzen, nur weil sie en Bült Minsken in de Hüttspott … weil sie das Haus voll haben.«
»Dat kann man doch nich verglieken!«
Die Katze Missi stand auf, machte einen Satz zu Luise auf die Eckbank und stieß sie sanft mit dem Kopf an.
»Und ob man dat vergleichen kann!«
Luise schnitt sich eine Scheibe Brot ab, schmierte sich die billige Nussnougatcreme aus dem Großmarkt darauf. Sie warf zwei Stücke weißen Kandis in ihre Tasse, die beim Einschenken des heißen Tees immer so herrlich knisterten und dem Tee die leckere Süße gaben. Dann goss sie einige Tropfen dickflüssige Sahne dazu. Sie nahm die Tasse in beide Hände, trank einen Schluck, schloss die Augen und war sich in diesem Moment bewusst, dass sie niemals etwas anderes zum Frühstück trinken wollte: Am Anfang kam die cremige und etwas kühlere Sahneschicht, gefolgt vom herben Geschmack des Ostfriesentees, gekrönt von der Süße am Schluss.
Sie öffnete wieder die Augen und biss in ihr Brot. Auf dem Tisch lagen ein ausgefüllter Lottoschein, Vaders halb leere Zigarettenpackung, ein gelbes Feuerzeug, das Kreisblatt, auf dessen erster Seite über das Feuerwehrfest berichtet wurde.
»Es ist nichts anderes, als wenn wir zu de Oma sagen würden: Wir brauchen nu die Einliegerwohnung, Grootmoder, die könnten wir gut verhüren. Du büst unnütt, und wir laten di nu einschläfern.«
»Luise!« Die Stimme ihrer Mutter klang ungewohnt schrill. Sie knallte den Kessel auf den Topfuntersetzer. »Dat geiht to wied!«
»Ist doch wahr!«
Luise klappte das Brot zusammen und sprang auf. »Ich fange besser mal mit dem Melken an. Is Vader schon im Stall?«
»Klaar, und Jakob auch.«
Jakob war Luises älterer Bruder.
Zum Abschied streichelte sie der alten Katze über den Rücken, und diese schmiegte sich an ihre Hand. »Bleib schön nah an der Heizung, Missi«, flüsterte sie leise.
Die schweren Arbeitsschuhe in Größe 43 an den Füßen, lief sie über den durchgeweichten Hof, machte sich nichts aus den Pfützen und sah dabei in die Ferne zu den Pappeln. Wie tintenschwarze Zähne ragten sie in den Himmel, der eine fast unwirkliche Färbung annahm. Endlich waren die Tage wieder länger, und sie begannen die Arbeit nicht mehr in tiefster Nacht. Sie liebte die Blaue Stunde, wenn sich der Schein der ersten Dämmerung mit dem Licht des untergehenden Mondes vermischte. Luise legte den Kopf in den Nacken, atmete tief die kühle Luft ein. Sie schmeckte frisch und prickelte in ihren Lungen. Der Wind fuhr ihr ins Gesicht, fegte das letzte bisschen Schläfrigkeit fort – und ihr Stallkopftuch.
Endlich hatte der Dauerregen aufgehört! Die Wege zu den Feldern hatten an vielen Stellen einem Flussbett geglichen. Es war gar nicht daran zu denken, die Saat für das Sommergetreide auszubringen. Frühlingshochwasser gehörte, seit sie denken konnte, zu ihrem Leben wie Hitzeperioden im Hochsommer und Gewitter mit Platzregen während der Erntezeit. Eiseskälte mit Frostbeulen im Winter. Der Jensenhof stand auf Endmoränenland, und das konnte mehr Eis und Wasser ab, als sie in ihrem Leben jemals sehen würden. Und doch war das Wetter ein nie enden wollendes Thema.
»Die Klaag is des Buur Grööt!«, hieß es dazu am Dorfstammtisch von den wenigen, die nicht von der Landwirtschaft lebten. Die Klage ist des Bauern Gruß. Allein das dauernde Trommeln auf den Dachschindeln, die mit Steinen beschwert waren, damit der Wind sie nicht davonriss, hatte in den letzten Wochen auf die Gemüter aller Familienmitglieder gedrückt.
Seit heute Nacht peitschte der Westwind die dunklen Wolkenberge vor sich her und pfiff sogar durch die Holzlatten des Stalls, in dem es sonst immer warm war. Als sie die Tür öffnete, riss ihr eine Böe den Eisenschieber aus der Hand und knallte die Bretter gegen die Wand, dass diese bebte. Mit aller Kraft stemmte sich Luise gegen den Sturmausläufer, um die Tür – nun so schwer wie ein Mühlstein – langsam wieder von innen zuzuziehen und zu verriegeln. Dann wischte sie sich die Haarsträhnen aus dem Gesicht. Verschwunden war das Kopftuch, das ihr draußen der Wind vom Kopf gezerrt hatte. Vollkommen sinnlos, danach zu suchen. Längst hatte es die Böe Hunderte Meter weit fortgetragen. Sie zog das Gummi aus dem zerzausten Zopf, strich sich die Haare straff nach hinten und zurrte sie zu einem festen Knoten.
Dann ging sie weiter in den Stall und sah nach den Kühen. Seit sie die neue Melkmaschine angeschafft hatten, sparten sie Zeit. Doch die Anschaffungskosten hatten sich bei ihren fünfundzwanzig Kühen noch lange nicht rentiert, der Kredit war kaum abbezahlt. Mehr als fünfundzwanzig Kühe wiederum gab der Stall nicht her. Die zu niedrigen Milchpreise stellten das Dauerthema bei ihren Mahlzeiten dar, das bei allen stets für eine herrlich schlechte Laune sorgte.
»Na, Frida, bist du schon fertig?«, fragte Luise die Schwarzbunte, die ihren Kopf durch die Eisenstangen im Melkstand steckte und geduldig wartete. Zur Antwort leckte ihr Frida über beide Hände. Frida war ihr Liebling, geduldig und gutmütig. Außerdem ein besonders reinliches Tier, wie Luise fand. Sie achtete immer darauf, sich nicht in die eigenen Fladen zu legen. Nur als Luise einmal auf ihr reiten wollte, hatte sie sich geweigert. Für einige Zeit war die Freundschaft damit ausgesetzt, und Luise hatte begonnen, für ein Ponyfohlen zu sparen, wozu ihr bisschen Geld niemals reichen konnte. Nur für ein zu schwaches, kränkliches vielleicht, und das erlaubte ihr Vater nicht.
»Heute Abend bössel ich dich noch fein, freust du dich?« Luises Stimme nahm die weiche Tonlage an, in der sie immer mit den Tieren sprach. Manchmal striegelte sie die Kühe mit einer Nylonbürste. Einige hatten das gern und hielten dabei ganz still. Auch die Katzen wurden seit jeher von ihr gebürstet. Es war einer der Gründe, weshalb ihre Mutter darauf verfallen war, eine Friseurlehre könnte für ihre jüngere Tochter das Richtige sein. Die Katzen genossen ihre Behandlung besonders, weil sie Flöhe hatten, auf die Luise sie ausgiebig mit einem Staubkamm untersuchte. Zum Glück waren es keine Flöhe, die auf Menschenblut aus waren. Gelbliche große Tiere, die wie Käfer aussahen und eher krabbelten als sprangen. Die Kühe hatten kein Ungeziefer.
Luise stieg über die Metallstangen und bückte sich zu Fridas Euter, um die Sauger von den Zitzen zu nehmen. Wenn ihr Vater morgens um fünf in den Stall kam, führte er Frida immer als Erste in den Melkstand. Danach begann er mit den Stallarbeiten, und Luises Aufgabe bestand darin, den anderen Kühen nach und nach die Melkmaschine anzulegen. Das neue System pumpte die Milch über eine fest installierte Leitung in den Kühltank, ohne dass sie erst umständlich aus den Eimern umgefüllt werden musste. Damit sparten sie sich Arbeitsgänge, und die neuen Hygienevorschriften wurden auf das Genaueste eingehalten.
Jetzt fuhr ihr Vater auf seinem kleinen Schaufelbagger an Luise vorbei und rief: »Moin moin! Na, betüttelst du schon wieder deine Frida? Kieck mal, die anderen werden ungedürig!«
»Moin moin, Vader!«
Ihr Vater war ein stattlicher Mann mit dem typischen Ostfriesengesicht – gerötet, vage freundlich und mit jugendlich fülligem, aber grauem, gescheiteltem Haar, das er häufig zur Seite strich. Bei der Arbeit trug er immer eine blaue Kapitänsmütze auf dem Kopf.
Er hatte recht! Hinter Frida wartete bereits die nächste Kuh, und sie wirkte wirklich unruhig, muhte, scharrte mit dem Huf. Frida hingegen hatte es nicht im Geringsten eilig. Luise rieb ihre Zitzen vorsichtig mit Melkfett ein. Nachdem sie losgebunden war, schlenderte Frida ganz gemächlich und fast aufreizend langsam von allein zurück in den Laufstall. Die mächtige Schwarzbunte dahinter schlug den Vorderhuf auf den Zement, dass es knallte und die Funken sprühten. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr.
»Du hast es aber heute ielig, Mathilde!« Luise gab ihrer Stimme einen beruhigenden Klang und breitete ganz langsam die Arme aus. »Was ist denn bloß los mit dir, bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden, oder ist es de Störm, der dich so aufregt?« Das riesige Tier muhte wieder laut, setzte seinen massigen Körper in Bewegung, und Luise sprang rasch zur Seite, als es unerwartet wild auf sie zustürmte. Auch während sie ihr die Melkmaschine anlegte, war Mathilde unruhig und stampfte immer wieder mit dem Vorderlauf auf. Luise wollte ihn anheben, um nachzusehen, ob sie sich etwas eingetreten hatte, doch die Kuh gab ihr den Fuß nicht.
Luise sah auf ihre Armbanduhr. Um Punkt sieben musste sie im Friseursalon sein, bis dahin hatte sie alle Kühe fertig zu melken, sich selbst zu waschen, zu kämmen und umzuziehen.
»Vader?«, rief sie und sah sich um. Doch er war schon wieder ans andere Ende des Stalls gefahren und rangierte dort mit seinem kleinen Bagger, sodass er sie nicht hören konnte. Es war nicht ganz einfach, Mathilde wieder aus dem Melkstand zu bugsieren, und so wie sich die Kuh heute anstellte, war Luise dankbar für ihre Stahlkappen auf den Schuhspitzen. Ihr hatte schon mit fünf ein Rind auf dem Fuß gestanden, die Erfahrung reichte fürs ganze Leben. Als alle Kühe fertig waren, füllte sie rasch eine Kanne frischer Milch aus dem Tank ab, um sie ihrer Mutter zu bringen. Dann suchte sie ihren Vater, fand aber nur Jakob, dem sie im Gehen zurief: »Mathildes rechter Vorderlauf scheint nicht in Ordnung zu sein. Sagst du es Vader?«
»Hm«, brummte er, ohne aufzusehen. »Wie viele Dauerwellen hast du heute?« Sie drehte sich noch einmal zu ihrem Bruder um. Sein Gesicht war hell, die Konturen vom niedersächsischen Wind geschliffen, und ähnelte denen auf Porträts alter flämischer Meister. Ein Michelgesicht, hatte ihre Mutter es immer genannt, in Anspielung auf Michel aus Lönneberga und dessen Streiche, denen Jakobs täglicher Unfug in nichts nachstand.
»Heute gibt es hoffentlich keine Dauerwellen, wir üben heute nämlich für die Show. Und zwar Farbe und Kurzhaarfrisuren.«
Jakob stützte sich auf den Griff der Mistgabel und sah sie an. Seine weit auseinanderstehenden blauen Augen hatten den typischen fragenden Ausdruck. Seit sie denken konnte, stellte ihr Bruder Fragen, immer nur Fragen.
»Was für eine Show?«
»Die Frisurenshow mit Wettbewerb in Bremerhaven. Stell dir vor, der oder die Gewinnerin von allen achtzig Salons wird sogar nach Hamburg ins Hotel Atlantic eingeladen.«
»Hamburg bei Schleswig-Holstein?«
»Na, wo denn sonst, du Törfkopp? Kennst du ein anderes Hamburg?«
»Hm.«
Luise verdrehte die Augen und winkte ab. »Aber es gibt zu viele Bewerber, da haben wir sowieso keine Chance.« Dann, als sie schon losrennen wollte, fiel ihr noch etwas ein, und sie setzte ein schmachtendes Lächeln auf. »Meinst du, du könntest Imke fragen, ob sie sich als Modell zur Verfügung stellt? Sie bekommt auch einen tollen Haarschnitt – ganz umsonst!«
Imke war Jakobs erste feste Freundin, eine hübsche Sechzehnjährige mit überschulterlangen glatten Haaren, und allein bei der Vorstellung tippte er sich an die Stirn. »Imke mit kurzen Haaren? Bei dir piept’s wohl?«
»Man kann ja mal fragen!« Luise lief los und rief noch einmal über die Schulter: »Vergiss nicht Mathildes rechten Vorderlauf!«
Eine halbe Stunde später stand sie in Gittes Friseursalon und schüttete Peroxid in eine kleine Schüssel. Sie verrührte es mit der Farbe, schob den Holzperlenvorhang beiseite und stellte sich hinter den Frisierstuhl, auf dem ihre erste Probandin saß, ohne von diesem besonderen Status etwas zu ahnen. Ilse Detlefsen trug die Haare noch immer hochgesteckt, genau wie früher – und wie fast alle Leversdorfer Frauen, die sich bisher standhaft gegen Gittes Gestaltungswut zur Wehr gesetzt hatten. In dem runden Spiegel, der mit einer Girlande aus Plastik-Margeriten dekoriert war, trafen sich Luises und Ilse Detlefsens Blicke. Heute würden die zwei Trockenhauben des Salons ausnahmsweise unbenutzt bleiben. Luise setzte die Sohle ihrer Klappsandalen auf den Fußhebel und sah zu, wie die kleinwüchsige Frau höher und höher wanderte. Luises Körpergröße machte es erforderlich, nahezu neunundneunzig Prozent aller Leversdorfer hochzuliften. Ilse Detlefsen hatte zusätzlich noch eine Kindersitzerhöhung unter dem Po. Ihr rundlicher Körper war in einen der neuen Wickel-Kimonos gehüllt, in trendigem Schwarz.
»Und, Froo Detlefsen? Klaar für dat neje Farv?«, fragte Luise betont munter, um der Wirtin des Moorbachhofs auch noch den letzten Zweifel zu nehmen. »Se worden sehn, Chocolate Cherry maakt Se zu einem ganz nejen Minsk. Es is genau de recht Klöör to hör Teint un deckt dat gries Haar ab.« Luise war tatsächlich sicher, dass der neue Farbton genau der richtige für den Teint der Kundin war und deren hellgraues Haar abdeckte.
Sie wusste, dass sie bei Ilse Detlefsen keinen Fehler machen durfte. Sie war die Erste, die sich traute – neue Farbe, neuer Schnitt. Eine halbe Stunde hatten sie gemeinsam die Farbkarte der Rottöne studiert, die sich die brünette Gastwirtin partout wünschte, und das schrille Kupferrot hatte sie ihr nur mit Mühe ausreden können. Den warmen Braunton mit einem schwachen rötlichen Hauch, den sie stattdessen gewählt hatten, bekäme heute Abend sogleich der Mittwochs-Stammtisch zu Gesicht. Wenn er nicht gefiel, würde sich die Nachricht über ihre Missetat wie ein Lauffeuer im gesamten Dorf und auf den umliegenden Höfen verbreiten. Ginge es nach ihrer Mutter, wäre dies eine Todsünde. »Hang de Lüü nix in de Hals!«, lautete eines ihrer liebsten Sprichwörter. – Gib anderen keinen Anlass zu Klatsch und Tratsch!
Während Luise routiniert mit dem Stielkamm Scheitel für Scheitel durch die brünetten Haare zog, die Farbe gleichmäßig aufpinselte, begann sie mit »dat Prootje«. Der Kunst des kurzweiligen Gesprächs, dem »Snack«, den sie inzwischen ziemlich gut beherrschte und von dem so manche Kundin wusste, dass sie nahezu die gleiche Mühe darauf verwendet hatte, ihn zu erlernen, wie auf das Friseurhandwerk. Denn als Kind hatte Luise nur mit ihrer Familie und ihren Tieren gesprochen. Gegenüber Fremden war sie steif wie Holz gewesen. Inzwischen war ihr spät entdecktes Kommunikationstalent ein Segen für ihren Beruf.
Stießen eine Wirtin und eine Friseurin aufeinander, begegneten sich zwei Meistervirtuosen desselben Fachs.
»Wat maken de Kinner?«, fragte Luise genau im gleichen Moment, wie Ilse Detlefsen den Satz sagte: »Wat maken de Ollen?«
Sie sahen sich kurz in die Augen, dann setzten beide neu an: »All good toweeg?« Synchron verließen die Worte ihre Münder. Luise tippte Ilse Detlefsen leicht an die Schläfe, damit sie den Kopf zur Seite neigte, holte Luft und führte die Unterhaltung auf reinstem Plattdeutsch fort: »Hat mit de Beerlevern diesmal all geklappt?« Ob mit der Bierlieferung alles geklappt habe. Im gleichen Moment fragte Ilse Detlefsen: »Gibt de Brita weer Melk?« Ob Brita wieder Milch gebe.
Es war, als würden sie beide eine Liste abarbeiten. Ilse Detlefsen verhielt sich so, als stünde sie hinterm Tresen, spüle Gläser oder zapfe Bier und frage die Gäste nach den Kindern, Kühen, Schweinen, Hühnern – wobei sie bei jedem Bauer genau wusste, welches Viehzeug er hielt, und die meisten sogar mit Namen kannte. Nach de Rapssaad, Rapssaat, Kartuffeln, Rööv, Rüben, ganz wichtig: de Gröönkohl, de dartig, den dreißig Katzen und Oma Lina. Sie gab Kommentare ab wie: »Slimm mit de Pladderregen, hatten wir dat lest Maal de Februar 1987 – und dabei kien Spur von Fröst.« Solche Kommentare kamen an bei den Bauern! Die meisten von ihnen fühlten sich bei ihr gut aufgehoben, wenn sie vor ihrem Tresen saßen. Denn ihr Gedächtnis für das Wetter jedes einzelnen Monats in den letzten zwanzig Jahre zeigte, wie sehr man Ilse Detlefsen vertrauen konnte und dass sie eine von ihnen war.
Luise fragte die Wirtin nach dem »platten Reifen am Sprinter«, »de Water in de Klunten, hörs Swegermoder«, dem Wasser in den Beinen der Schwiegermutter, »de vorzeitige Wehen hörs Swegerin«, welche bis dato Vorsitzende des Landfrauenvereins war, »dat Befinnen de Bellmer van Hund«, des Hofhunds. Sie fanden ihren Rhythmus zwischen Fragen und Gegenfragen wie bei einem einstudierten Tanz, und schließlich kam Luise zum Höhepunkt jeden Schnack-Repertoires einer Friseurin – den Urlaubsplänen: »Woll Pläne? Oder woll al gebokt?« Alles gebucht?
Die Gastwirte waren privilegiert, deshalb unterhielt sie sich besonders gerne mit Ilse Detlefsen über dieses Thema: Sie besaßen keinen Hof, konnten die Gastwirtschaft zuschließen und verreisen.
»Dit Jahr Teneriffa.« Die Wirtin öffnete mit der unbewegten Miene einer Königin den Reißverschluss ihrer großen Handtasche und holte einen Prospekt heraus, als sei sie auf die Frage vorbereitet gewesen. Luise beugte sich über ihre Schulter und besah sich die Fotos der Hotelanlage mit Poollandschaft, weißen Plastikliegen, Palmen und gelbem Sandstrand. Verwundert stellte sie fest, wie wenig Fernweh der Anblick in ihr auslöste, wartete einen Moment und legte eine Hand auf die Brust. Aber da war nichts, kein Pochen, kein Sehnen nicht das kleinste Gefühl. Hätte Ilse Detlefsen den Eiffelturm oder die London Bridge auseinandergefaltet, wäre sie aus dem Schwärmen nicht mehr herausgekommen. Das war es, was sie wollte, wovon sie träumte: die Großstädte Europas besuchen. Einmal hätte es fast schon geklappt, bei einem Schüleraustausch mit einer englischen Schule nahe London. Aber dann hatte sie absagen müssen, weil die Fahrt in die Erntezeit gefallen war und sie auf dem Hof gebraucht wurde.
Sie stellte die Uhr, legte Ilse Detlefsen einen Stapel Hefte des Lesezirkels auf die Ablage unter dem Spiegel, fragte: »Koffje as immer, Froo Detlefsen?«, und ging die Schüssel mit den Farbresten spülen.
»Und? Hast du noch ein paar Modelle auftreiben können?«, raunte Gitte mit gedämpfter Stimme in dem kleinen Raum hinter dem Perlenvorhang. Luises Chefin war um die vierzig und steuerte den kleinen Friseursalon seit zehn Jahren durch alle Höhen und Tiefen der deutschen Konjunktur. Sie legte die aktuelle Brigitte mit den neuesten Vorher-nachher-Bildern vor sie auf die Arbeitsfläche. Luise trocknete sich die Hände ab und besah sich die Fotostrecke, die die Verwandlung eines Mädchens mit langen dünnen Haaren zu einem androgynen Geschöpf dokumentierte.
»Das wollen Sie genau so umsetzen, Chefin?« Mit der Chefin sprach sie Hochdeutsch, denn diese kam aus Bielefeld, und es hatte sie nur aufs niedersächsische platte Land verschlagen, weil sie auf eine Heiratsannonce des Leversdorfer Dachdeckermeisters geantwortet hatte. »Gitte, meine ich.« Sie verbesserte sich, denn sie wusste, dass ihrer Chefin der Vorname als Anrede lieber war. Die Grammatik, die Vokabeln, auch die hochdeutsche Betonung hatte Luise erst in der Grundschule gelernt, aber sie saßen.
»Ich glaube nicht, dass ich eine finde, die bereit ist, sich den Nacken ausrasieren zu lassen.«
Sie tippte auf den langen zur Seite gekämmten Fransenpony des Models im Heft, der ein Auge des Fotomodells halb verdeckte. »Und das ist doch viel zu unpraktisch, damit kann man ja gar nichts mehr arbeiten, ohne immer ein bis zwei Haarklemmen zu benutzen.«
»Jetzt geht es nicht um ›praktisch‹, jetzt geht es um ›Glamour‹!« Das Wort »Glamour« sprach Gitte auf deutsch aus. Sie legte den Kopf schief und zwinkerte theatralisch mit ihren schwarz getuschten Wimpern. »Aber wir könnten das Deckhaar auch etwas länger lassen.« In ihrem runden Gesicht zeigten sich die Grübchen, die Luise jedes Mal verdeutlichten, wie sehr sich ihre Chefin ihrer eigenen Übertreibung bewusst war. Wie immer war ihr Teint leicht überschminkt, mit zwei Nuancen zu dunkler Foundation, pflaumenfarbenen Rouge-Dreiecken unterhalb der Wangenknochen, die diese schmaler wirken lassen sollten, und die »Smokey Eyes« fehlten nie. In ihrem fransigen Pony prangte eine pinkfarbene Strähne. Sie war der festen Überzeugung, dieses Styling ihren Kunden und Kundinnen schuldig zu sein. Kein Trend, keine Mode, und war sie auch noch so flüchtig, dürfe ungenutzt an ihr vorbeiziehen. Ob diese Einstellung für die Besitzerin eines Dorfsalons ungewöhnlich war, wusste Luise nicht zu beurteilen, denn sie hatte noch keinen anderen Friseurladen von innen gesehen. Aber sie ahnte es, da bisher kaum eine der Kundinnen einen von Gittes Trends übernommen hatte. Ihr Alltag bestand aus Dauerwellen, Waschen, Legen.
»Und das da nennen Sie Glamour?«, fragte Luise, sprach das Wort englisch aus und konnte mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten. »Für mich sieht das eher nach einer Mangafigur aus.«
»Das ist der neueste Schrei aus Paris, Luise!«
Gitte wusste ziemlich genau, womit sie Luise ködern konnte.
»Paris!« Allein der Name der Modehauptstadt vermochte jeden Zweifel im Keim zu ersticken. »Sieh mal hier. Die Modelle sehen genauso aus.«
Sie drehte sich nach einem dicken Hochglanzkatalog um, der in einem überfüllten Regal zwischen Farbcremes und Karten mit Haarmustern lag. Wie von selbst blätterte er auf einer bestimmten Seite auf, wie es der Fall ist, wenn sie zuvor schon häufig aufgeklappt wurde. Die Mädchen auf den großformatigen Farbfotos steckten in Lederjacken und Hosen, die mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden. Und tatsächlich trugen sie fast alle den gleichen asymmetrischen Haarschnitt. Das Deckhaar auf der einen Seite etwas mehr als kinnlang, auf der anderen Seite kürzer und hinter das Ohr gekämmt, das voller Piercings war.
»Das ist voll im Trend. Damit schießen wir in Bremerhaven den Vogel ab, Luise!«
Luise seufzte. »Trotzdem wird das hier niemand freiwillig mit sich machen lassen, Gitte.«
Sie merkte, wie ihre Chefin sie anstarrte, drehte sich um, nahm die Kanne mit dem Filterkaffee von der Wärmeplatte und füllte eine Tasse. Während sie ein Plastikdöschen Kaffeesahne auf die Untertasse legte und alles auf ein kleines, rundes Tablett stellte, ruhte Gittes Blick noch immer auf ihrem langen blonden Pferdeschwanz. »Es gibt einen Ausweg, er ist direkt vor meiner Nase.«
Luise schüttelte ganz langsam den Kopf, ohne Gitte anzusehen. »Denken Sie nicht mal dran, Chefin!« Sie drehte sich um, schob den Perlenvorhang zur Seite und brachte Ilse Detlefsen ihren Kaffee.
Um acht Uhr fünfunddreißig fragte sie die Wirtin: »Und, Froo Detlefsen? Seen se, wie die neje Farv Ihre blauen Augen schienen lett?« Wieder begegneten sich ihre Blicke im Spiegel. Ilse Detlefsen hatte früher den Ruf innegehabt, die schmuckste Frau von Leversdorf zu sein, das wusste Luise von ihrer Mutter. Damals war die Tochter des Wirts vom Moorbachhof zwar nicht größer, aber viel schlanker gewesen. Jetzt, mit achtundvierzig Jahren, konnte man die frühere Schönheit nur noch erahnen. Der altbackene Schnitt, die grauen Haare hatten sie nicht eben attraktiver werden lassen, fand Luise. Aber mit den frisch gefärbten sah sie schon interessanter aus.
»Klaar für dat neje Schnitt?«
»Ik weet, dat ik up di an kann!«, sagte die Wirtin und nickte ihr zu. Es ging um Vertrauen, das wusste Luise. Sie hob die Schere und atmete tief ein: Schnipp – war die erste lange Strähne ab.
Neun Kunden und Kundinnen später, um sechzehn Uhr fünfundvierzig, saß Luise selbst auf dem ganz nach unten gefahrenen Friseurstuhl und sah zu, wie die Strähnen ihrer eigenen Haare auf den braunen Kachelboden fielen. Hell und dicht wie Gänsedaunen.
»Klar für den neuen Schnitt?«, hatte Gitte gefragt, und eh sie antworten konnte, war die erste lange Strähne ab gewesen. Luise begann, auf den Lippen zu kauen, während sich ihr Blick auf das bleiche Gesicht im Spiegel richtete. Im Gegensatz zu ihrer Chefin Gitte hatte sie hohe, hervorstehende Wangenknochen, und darunter wirkte die konkave Wölbung, als würde sie sich andauernd in die Backen beißen. Die Nase schmal und gerade, die Stirn hoch, die Lippen nicht übervoll, die Mundwinkel leicht nach unten gezogen, und dann die Augen: »To vööl Water!« Zu viel Wasser!, sollte ihre Großmutter als Erstes gerufen haben, als sie auf die Welt kam. Ihre Iris war von einem so hellen Blau, dass es wirklich an einen frisch gefüllten Priel im Wattenmeer denken ließ. Ein Blick, der ihre Gefühle niemals abbildete, ihr Innerstes vor der Außenwelt verbarg, aber dessen war sie sich gar nicht bewusst.
Wenn sie es recht bedachte, war ihr langes blondes Haar immer das gewesen, was sie am meisten an sich gemocht hatte. Und nun?
Gitte zog die Schublade des Rollcontainers auf. Als sie merkte, wie Luise ihren Bewegungen mit den Augen folgte, stellte sie sich so hin, dass ihr Rücken das Tun ihrer Hände verdeckte.
»Jetzt musst du tapfer sein, Luise. Möchtest du vielleicht, dass ich den Stuhl umdrehe, dann kannst du aus dem Fenster gucken, während ich …«
»Kommt nicht infrage!« Luise schob den Unterkiefer trotzig nach vorne. »Ich will alles sehen!«
Ihre Chefin seufzte: »Ganz wie du willst!«
Dann holte Gitte die neue Point-Cut-Schere hervor, und die Vorstellung, dass die gekürzten Haare nun auch noch »ausgesoftet« wurden, wie der Fachausdruck dafür lautete, ließ Luise ein klein wenig zusammenzucken. Als Gitte die Klinge ansetzte, hielt sie still und beobachtete, wie ihre Chefin mithilfe des breiten Zahnungsabstands Lücken in die einzelnen Haarsträhnen schnitt, um den unregelmäßigen Franseneffekt zu vervollkommnen.
Niemand wird mich jetzt beim Tanz in den Mai noch auffordern, schoss es ihr durch den Kopf. Bisher war es nur ihre Größe, die bei Dorffesten fast alle abgeschreckt hatte. Verlegen hatte sie herumgestanden, an ihrer Cola genippt, erleichtert, wenn die Musik vorbei war und die Mädchen sich verschwitzt wieder zu ihr stellten.
»Und? Was sagst du?« Gitte hielt ihr den Handspiegel hinter den Kopf und bewegte ihn hin und her. Luise strich sich über die lange, fransige Strähne, die ihr linkes Auge halb verdeckte. Sie wusste, dass der Schnitt perfekt gelungen war. Gitte verstand ihr Handwerk. Aber das Mädchen, das ihr aus dem Spiegel entgegensah, hatte nichts mehr mit der Luise zu tun, die sie kannte.
Als Gitte Luises unglücklichen Blick bemerkte, sagte sie: »Nun schau mal nicht so bedröppelt. An so eine Veränderung muss man sich erst gewöhnen.«
Luise kannte den Satz, in letzter Zeit hatte sie ihn des Öfteren selbst verwendet, wenn sie Bekannte und Freundinnen zu einem neuen Haarschnitt überredet hatte. Eigentlich geschah es ihr recht, nun selbst einmal in dieser Situation zu sein. Gitte legte den Spiegel zurück, zog die Schublade auf, die als Ladenkasse diente, und holte eine gelb-schwarz bedruckte Karte heraus.
»Hier! Das ist ein Gutschein für das Solarium, das die Tochter vom Hilgersen vor zwei Wochen eröffnet hat. Da gehst du heute noch hin, wärmst dich mal richtig auf und holst dir eine schöne Urlaubsbräune.« Luise drehte das dünne glänzende Papier mit den aufgedruckten Palmen in ihrer Hand und sah dann hoch zur Wanduhr. Warum nicht?, dachte sie. Um sechs musste sie beim Melken sein, also wenn die Chefin sie jetzt entließe, würde noch genug Zeit bleiben. »Kann ich dann vielleicht früher gehen?«
Auf Gittes rundem Gesicht zeigte sich ein mitfühlendes Lächeln, das mit den sympathischen Grübchen. Ihre Antwort, sie dürfe sogar jetzt schon gehen, verriet ihr schlechtes Gewissen. So schlimm ist es also, dachte Luise.
»Und wirst sehen: Mit brauner Haut ist dein Haarschnitt der absolute Hit.«
Luise presste die Lippen zusammen, murmelte ein »Danke, Chefin«, zog ihren gelben Regenmantel an, öffnete die schwere Glastür und ging durch den Windfang nach draußen.
Als sie auf den Gehsteig der Durchgangsstraße trat, musste sie blinzeln, weil gerade die Sonne durch die Wolken blitzte. Für die diesjährigen Verhältnisse war es ein recht guter Apriltag. Es lag eine erwartungsvolle Spannung über dem Dorf, so als würden jeden Moment die ersten Frühlingsboten auftauchen und keiner wolle sie verpassen: Knospen an den Kastanienbäumen vor dem Moorbachhof hätten ganz plötzlich von einem auf den anderen Tag aufblühen können. Aus den grünen Stielen der Osterglocken neben den Baumstämmen mochten unverhofft goldgelbe Blütenstände sprießen. Es war jedes Jahr ein Wunder, wie sich die unscheinbaren Spitzen der Stängel durch die verdichtete und platt getretene Erde kämpften. »Peng«, eines Morgens war es passiert, ohne dass es vorher irgendein Anzeichen gegeben hätte.
Als Luise mit langen Schritten an den zum Lüften weit geöffneten Fenstern des Gasthofs vorbeiging, späte sie hinein, suchte den leeren Gastraum nach Ilse Detlefsens Kopf ab, nach der neuen Frisur: Die Haarfarbe war ihr perfekt gelungen und der weiche Bob, den sie ihr geschnitten hatte, so hübsch geworden, dass sie die Wirtin zum ersten Mal, seit sie ihre Kundin war, sprachlos erlebt hatte. Luises Hand griff unwillkürlich in ihren eigenen Nacken und zuckte zurück, als sie die glatt rasierte Haut spürte.
Wie gerne hätte sie jetzt ihre asymmetrische Fransenfrisur gegen den Bob der Wirtin in Chocolate Cherry getauscht!
In den Rinnsteinen lagen noch die Reste des grauen Streusplitts, und die Backsteinfassaden wirkten nun trotz des Frühlingshauchs so trist wie immer während der langen Wintermonate. In der Mitte verlief der Kanal und trennte die beiden Straßenseiten. Leversdorf lag mitten in der Friesländer Fehnlandschaft. Hier war das Landschaftsbild vom Netz der Wasserwege geprägt. Lange Kanäle mit parallel zueinander verlaufenden Straßen, Hebebrücken, Backsteinhäuser mit tief gezogenen Dächern. In den letzten Jahren hatte sich das Dorfbild nach und nach verändert. Im Schreibwarenladen hatte Luise früher Tintenpatronen und Schulhefte gekauft. Inzwischen war das Schild überklebt worden. »Playhouse-Spielothek« stand dort jetzt in Neon-Buchstaben. Die Folie am Schaufenster war gerade so hoch, dass Luise darüber hinweg ins Innere sehen konnte. Zwei Burschen, die mit ihr in die Grundschule gegangen waren, saßen stoisch auf Barhockern vor den einarmigen Banditen und rauchten. Ein Kleinwagen näherte sich von vorne. Bildete sie sich das nur ein, oder fuhren die Autos langsamer, wenn sie an ihr vorbeikamen? Bis zu Melanies neuem Sonnenstudio waren es nur gut hundert Meter. Als sich das unverkennbare Tuckern des Dieselmotors eines Traktors näherte, wagte sie nicht, zur Seite zu schauen.
»Moin, Luise, wat is mit dien Haar passeert?«, rief der strohblonde Junge ihr vom Beifahrersitz aus zu. Sein Onkel am Steuer grinste breit, er hatte kaum noch einen Zahn im Mund.
Noch heute wird es im Dorf rum sein!, dachte Luise und zog sich die Kapuze über den Kopf.
»Hest al hört von Luise Jensen?« Sie konnte sich jeden Witz und jeden ihrer Sprüche ausmalen.
Als das mit Metallic-Folie beklebte Schaufenster neben ihr auftauchte, auf dem der Slogan stand: Bleib frisch und gesund mit SUNSTAR, schlüpfte sie rasch durch die Tür des Windfangs.
»Moin, Melli!«
Melanie Hilgersen saß mit gekreuzten Beinen vor dem Tresen auf einem Hocker und hob nur kurz den Kopf, denn sie war mit dem Dekorieren ihrer Fingernägel beschäftigt. Doch dann riss sie die Augen auf.
»Moin, Luise! Wat is mit dien Haar passeert?«
»Neuer Schnitt für die Show in Bremerhaven.«
»Top!«
Melanie grinste und wickelte ihren Kaugummi in ein Stück Stanniol. Luise stand es immer klarer vor Augen: Sie würde sich ein dickes Fell zulegen müssen. Als sie der jungen Frau den Gutschein auf den laminierten Tresen legte, zuckte diese mit keiner ihrer verlängerten Wimpern.
»Ah, Nummer 29! Dreißig Gutscheine haben wir ausgegeben, und du bist erst die Fünfte, die damit kommt.« Ihrer Stimmlage ließ sich nicht anhören, ob sie diese Tatsache positiv oder negativ fand.
»Warst du schon mal in einem Solarium?«
Luise schüttelte den Kopf.
»Pass auf, ich erklär’s dir.«
Erst als sie auf der Sonnenbank lag, den Kopfhörer eines Discmans über den Ohren, der in jeder Kabine auslag, fiel das beklemmende Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben, langsam von ihr ab. Sie summte die Melodie der Musik mit, zum Refrain bewegten sich ihre Lippen:
»If you’re blue and you don’t know where to go to
Why don’t you go where fashion sits?
Puttin’ on the ritz.«
Ihre Hände trommelten den Takt auf die Glasfläche des Solariums. Als ein durchdringender Ton von der Digitaluhr auf dem Klapptisch erklang, hörte sie ihn trotz der lauten Musik. Sie öffnete den Deckel der Sonnenbank und drehte sich auf den Bauch, so wie Melanie es ihr empfohlen hatte. Aus Erfahrung wisse sie, dass man auf diese Weise gleichmäßiger bräune, auch wenn es rein technisch keinen Sinn ergab. Sowohl in der Haube als auch unter der Liegefläche befänden sich je zehn hundert Watt starke Röhren.
Nach weiteren acht Minuten schaltete sich die Besonnung automatisch aus. Luise öffnete die Haube, stand auf und griff nach ihrer Kleidung, die sie über den Stuhl gelegt hatte. In dem kleinen Spiegel an der Wand konnte sie sehen, dass ihre Haut im Gesicht und am Dekolleté stark gerötet war, aber das würde nach einer Stunde vergehen, hatte Melanie gesagt. Auch der spezielle Geruch nach dem Sonnenbad wäre ganz normal, weil gewisse Bestandteile der Haut wie Fettsäuren und Hauttalg durch die UV-Strahlen gespalten wurden.
Sie schlüpfte in ihre Jeans und spürte, wie ihre Haut brannte, zog das grüne Sweatshirt über den Kopf. Dann kämmte sie sich ohne viel Erfolg ihren glatten blonden Pony, der so stark elektrisch aufgeladen war, dass er in alle Richtungen abstand. Luise sprühte sich etwas von dem Glasreiniger, der eigentlich für die Reinigung der Solariumfläche gedacht war, in die Handflächen und fuhr sich damit vorsichtig über die Haare. Als Luise am Tresen vorbeiging, beklebte sich Melanie gerade jeden ihrer in Pink lackierten Fingernägel sorgfältig mit schwarzen Herzchen.
»Und, wie war’s? Tut gut, oder?«
»Ja, tut gut! Tschüss, Melli!«
Luise schlüpfte in den Regenmantel, trat in den Windfang, von dem Windfang auf die Straße und zog die Kapuze über den Kopf.
Freibier für alle!, hatte jemand in roter Schrift auf den Glascontainer gesprüht. Gleich daneben stand das F-Wort, mit einem gemalten unmissverständlichen Mittelfinger. Es musste tagsüber angebracht worden sein, denn am heutigen Morgen war ihr der Schriftzug noch nicht aufgefallen. Und es gab nur eine einzige Person, die dafür infrage kam, in Leversdorf am helllichten Tag Graffiti und Politparolen an öffentliches Gut oder Einrichtungen zu sprühen. Jeder kannte seinen Namen und sprach ihn doch nicht aus, wenn einer der beiden Polizeibeamten im Moorbachhof nach ihm fragte. Hier stand man good binanner.
Luise schritt weit aus, denn es war längst Zeit fürs Melken. Mit gesenktem Kopf, die Hände in den Manteltaschen, die Schultern hochgezogen, jedes Auto missachtend, das an ihr vorbeifuhr, lief sie am Rand der Landstraße entlang. Sie ging nach vorn gebeugt, stemmte sich dem Wind entgegen, in der typischen Haltung der Norddeutschen, und nahm sich vor, endlich den Achter in ihrem Fahrrad zu reparieren. Der Wind riss ihr die Kapuze vom Kopf.
Zu Hause angekommen, stürmte sie hoch in ihr Zimmer, zog eilig den Blaumann an, die Arbeitsschuhe, steckte sich den Pony mit zwei Haarklemmen fest und rannte über den dunklen Hof hinüber zum Stall.
Jakob stand vor ihr, kaum dass sie die Stalltür öffnete, eine Schaufel in der Hand. Sofort prustete er los und zeigte mit dem Finger auf sie. »Wat is mit dien Haar passeert? Warst du dien eigenes Modell?« Luise spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg, aus Scham und aus Wut. »Und so wolltest du Imke die Haare schneiden? Meiner Imke?«
»Das war die Chefin«, murmelte sie. »Ich hätt’s anders gemacht.«
»Und was ist mit dien Gesicht? Rood wie ’n gekochter Flusskrebs … nee, noch besser, wie ’n Leuchtturm siehst du aus!« Ihr Bruder krümmte sich vor Lachen und deutete auf ihren Kopf. »Hast du dich nicht im Spiegel gesehen?«
Sie wollte brüllen, Jakob zur Seite stoßen, stattdessen zuckte sie mit den Achseln und sah ihn nicht an. Sie ging mit langen, tiefen Schritten an ihm vorbei, als würde sie eine Sackkarre schieben. Zum Melkstand, wo Frida bereits fertig gemolken, aber ganz geduldig auf sie wartete. Dahinter stand Mathilde und stampfte wütend mit dem Huf auf. Die Kühe kannten ihre Reihenfolge und wussten normalerweise, wann sie dran waren. Aber Mathilde wirkte jetzt noch weitaus unruhiger als heute Morgen. Die dunklen Augen glänzten fiebrig. Luise näherte sich ihr langsam, sprach beruhigend auf sie ein und streichelte ihr dabei über das nass geschwitzte Fell. Das laute unruhige Muhen klang nicht gut.
»Was hat der Tierarzt gesagt?«, fragte Luise und drehte sich halb zu ihrem Bruder um. Jakob stand noch immer am Tor und lachte, schlug sich theatralisch auf die Schenkel. Nach einem letzten Wiehern richtete er sich langsam auf.
»Welcher Tierarzt?«
Während Luise ihr langes Bein weit nach oben hob, um über die oberste Stange zu klettern, und sich zu Fridas Euter hinunterbeugte, fauchte sie: »Petersen sollte sich doch Mathildes rechten Vorderlauf ansehen. Ich hab’s dir heute Morgen zweimal gesagt. Da ist was nicht in Ordnung!«
»Du hast recht, ich Dussel hab’s vergessen.« Jakob wirkte sofort ehrlich zerknirscht. »Wir hatten viel zu tun, waren den ganzen Tag auf dem Feld und haben gedrillt.«
»Und Vader hat auch nicht bemerkt, dass sien Rind seek is? Das ist sonst gar nicht seine Art.«
Sie nahm Frida die Sauger von den Zitzen, rieb sie mit Melkfett ein und führte sie aus dem Ständer. Kaum war sie draußen, stürmte Mathilde schon auf sie zu.
Luise hatte nie Angst vor einem Rind gehabt, das auf sie zukam, auch wenn manche von ihnen vierzehn Zentner wogen. Sie waren gutmütige Tiere, die sie von klein auf kannte, auch wenn es hieß, ein unberechenbares Rind gebe es in jedem Kuhstall.
Im Sommer molken sie sogar mitten auf der Koppel, und die Tiere waren dabei völlig frei. Doch Mathilde senkte jetzt den Kopf, und vor den Hörnern hatte Luise Respekt. Zumal es hier zu eng zum Ausweichen war.
»Komm schon, Mathilde, bleib ganz ruhig!« Vor Aufregung war sie heiser, versuchte aber, trotzdem Ruhe auszustrahlen. Langsam breitete sie die Arme aus und wich zurück, bis ihr Gesäß das hintere Gatter berührte. Der Melkstand war an drei Seiten von Metallstangen umgeben. Wo sollte sie so schnell hin? Mathilde scharrte mit dem Huf und schnaubte.
»Luise, raus da!« Jakob stand jetzt genau hinter ihr. »Raus, unten durch die Stangen, mach schnell!«
Im gleichen Augenblick tat Mathilde einen Satz nach vorn, und in letzter Sekunde rettete sich Luise durch einen Hechtsprung zwischen den Stangen hindurch. Sie landete auf dem harten Zementboden neben dem Melkstand. Doch mit einem Horn hatte die Kuh sie an der Wade erwischt.
Jakob war sofort bei ihr. »Ist dir was passiert?«, fragte er besorgt. Auch ihr Vater kam aus der anderen Ecke des Stalls angerannt. Jakob deutete auf die Blutlache unter Luises rechtem Bein. Geistesgegenwärtig öffnete ihr Vater seine Jacke und riss sich ein Stück von seinem Oberhemd ab, drehte das Bein auf die Seite, band einen langen Fetzen um ihren Unterschenkel, knotete ihn fest zu. »Lauf ins Haus und wähl den Notruf!«, befahl er Jakob.
»Ich hab’s immer gesagt«, schimpfte er, während er mit beherzten Griffen einen Druckverband an der aufgeschlitzten Wade anlegte, aus der Luises Herz im Sekundentakt eine Blutfontäne pumpte. »Da können diese Demeter-Quacksalber und Bio-Spinner erzählen, was sie wollen. Die Hörner gehören eben doch ab.«
Um achtzehn Uhr zweiundreißig wurde Luise mit der Trage in den Rettungswagen geschoben. Sie zitterte. Das Letzte, was sie sah, war das Gesicht ihrer Mutter, das blass und besorgt zwischen den geöffneten Türen ins Innere blickte.
»Kommst du nicht mit?«, wollte Luise fragen, sagte aber nichts. Denn sie wusste, dass die Kühe fertig gemolken werden mussten und auf dem Hof jede Hand gebraucht wurde.
Während der Woche, die Luise im Krankenhaus von Bremerhaven verbrachte, bekamen alle Rinder auf dem Jensenhof ihre Hörner abgesägt. Obwohl sich rasch herausstellte, dass Mathilde ein eitriger Abszess im Huf gequält hatte und sie deshalb durchgedreht war, ließ sich Kai Jensen nicht mehr von seinem Plan abbringen: Er bestand darauf, von diesem Tag an bei jedem neuen Kalb bereits im Alter von drei Wochen die Hornansätze auszubrennen, wie es seit jeher in der Bullenmast und vielfach auch in der neueren Laufstallhaltung der Rinder üblich war. Das hatte einen praktischen Vorteil: Die Kühe hatten weniger Respekt voreinander, hielten geringeren Abstand und brauchten dadurch auch weniger Platz.
2
Siehst du das?«, fragte Magnus, der Rettungssanitäter, der sie vom Krankenhaus nach Hause fuhr.
Vierundzwanzig Kilometer noch bis Leversdorf.
Auf dem Weg kamen sie an verwaisten Haltestellen mit Plexiglaswindfang vorbei, an denen schon lange kein Bus mehr hielt. Mit seinem kurzen Zeigefinger deutete Magnus auf ein nacktes Feld voller Solaranlagen und fünf Windräder am Horizont. Luise, mit ausgestrecktem Bein auf dem Armaturenbrett, halb liegend auf dem Beifahrersitz des Rotkreuzwagens, Gummibärchentüte und Wundsalbe auf dem Schoß, reckte den Kopf, um nachzuschauen, was er meinte – dabei kannte sie die Landschaft doch. Sie liebte die schnurgeraden Alleen mit den windschiefen Kastanien links und rechts, wo die Lastwagenfahrer achtgeben mussten, damit sie mit der Ladung nicht an die Kronen stießen. Sie mochte das satte Grün der Wiesen, seinen Kontrast zum blau-weißen Himmel.
Seit der Boom der erneuerbaren Energien vor zwei Jahren begonnen hatte, formierten sich die Ostfriesen zu Bürgerinitiativen gegen die Windanlagen, die ihnen den Horizont verstellten und an Sonnentagen lange Schatten warfen. Nachts blinkten ihre roten Warnlichter am Himmel hundert Meter hoch.
Magnus sprach weiter, in ernsthaftem Ton: »Das da ist die Zukunft! In ein paar Jahren baut hier keiner mehr Getreide an, und Milchwirtschaft wird es auch nicht mehr geben.«
»Und was essen wir dann?«, fragte Luise leichthin, aber sein Satz ging ihr während der gesamten Fahrt nicht mehr aus dem Kopf. Was, wenn die Landwirtschaft wirklich bald am Ende war? Sie betrachtete Magnus von der Seite, seine platte Nase und die struppigen Haare. In dem Augenblick drehte er den Kopf zu ihr, und seine abstehenden Ohren erinnerten sie sofort wieder an die Henkel einer Suppentasse.
»Sopptass« lautete daher auch sein Spitzname, von klein auf.
»Übrigens: Ich hab einen Studienplatz bekommen!«
»Wirklich? Wo? Das ist genial!«
Alle wussten, dass er schon seit zwei Jahren auf den Medizinstudienplatz wartete.
»Hab Glück im Losverfahren gehabt: Zum Wintersemester fang ich an der Uni Bremen an.«
»Kommst du dann als Landarzt zurück nach Leversdorf?«
Magnus zuckte mit den Achseln. »Wer weiß? Wär sicher nicht verkehrt, der alte Soderberg hat keinen Nachfolger, soweit ich weiß.«
Magnus war einer von den netteren gleichaltrigen Burschen, die sie beim gemeinsamen Heuen auf den Feldern und beim anschließenden Planschen im Moorbach traf. Auf einmal konnte Luise nicht anders, als sich auszumalen, wie ihre gemeinsamen Kinder aussehen würden: wie die Nachkommen einer dürren Riesin und eines Hobbits. Mit wässrigen Augen, Sommersprossen, unsichtbaren hellen Brauen und Wimpern, zu langen Gliedmaßen, zu kurzem Rumpf – das Gespött jedes Kindergartens und jeder Grundschulklasse. Insgeheim begrub sie die Idee, Arztgattin zu werden, bevor sie geboren war.
Zur Feier von Luises Rückkehr gab es sonntags Grünkohl mit Pinkel. Der Esszimmertisch war mit dem weißen Damasttuch aus Dörte Jensens Aussteuer gedeckt. Das Monogramm DJ passte auch nach ihrer Heirat noch, obwohl es für Jonasson stand, ihren Mädchennamen. Auf dem Tuch war das gute Geschirr mit dem blauen Zwiebelmuster gedeckt, das nur zu Feiertagen herausgeholt wurde. Dörte Jensen war stolz auf ihre zehn verschiedenen Grünkohlsorten. Wenn Luise ehrlich war, hatte sie noch nie einen Unterschied zwischen diesen herausgeschmeckt, denn der Grünkohl wurde vier Stunden in Schweineschmalz geschmort und musste einen Tag ziehen. Aber weil sie ihrer Mutter eine Freude machen wollte, fragte sie heute ganz genau nach, welcher verwendet worden war.
»Winterbor.«
Dörte Jensens Stimme bekam einen schwärmerischen Klang, und sie betonte die Silben, als sei die Grünkohlsorte mit den dunkelgrünen, krausen Blättern eine exotische Kostbarkeit. »Und dieses Jahr hat er ordentlich Frost abgekriegt, genau so, wie es sein muss.« Ein geschmeicheltes Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, während sie sich die Schürze auszog. Luise wurde sich in diesem Moment bewusst, wie sehr sie ihre Mutter liebte, die sich geradezu kindlich über ihre Grünkohlzucht freuen konnte.
Nach dem in der Familie Jensen überlieferten Rezept gab man vier Esslöffel Hafergrütze und eine Messerspitze Piment dazu. Diese »Verfeinerung« des Grünkohls variierte von Hof zu Hof. Zu einem echten Grünkohlessen gehörten neben Pinkel – das war Grützwurst, gefüllt mit Speck, Schinken, Zwiebeln und Hafergrütze – auch traditionell Mettenden und Kassler. Aber alle drei Sorten Schweinefleisch gab es bei den Jensens nur zu Weihnachten, seit sie keine Schweine mehr hielten.
Luise hätte sich geehrt fühlen können, dieses Festessen zu ihrer Rückkehr im gemütlichen Bauernzimmer vorgesetzt zu bekommen, in dem die Familie nicht einmal an gewöhnlichen Sonntagen aß. Normalerweise wurde nur der Ofen in der Küche angeheizt. Sie durfte zwei Stühle besetzen und lagerte das mit achtzehn Fäden zusammengeflickte Bein seitlich auf einem Kissen. Dabei machte sie gute Miene zu dem Scherz ihres Vaters über die besondere Größe der Wunde, die natürlich auch ihrem überdurchschnittlich langen Unterschenkel geschuldet sei.
»Das wird eine Narbe geben!«, sagte ihre Mutter und rollte bedeutungsvoll mit den Augen.
»Eh se sük traut, ist’s weer gut«, sagte Oma Lina.
»Die un sük traun?«, rutschte es Jakob heraus. »Nooit – niemals!« Der tadelnde Blick seiner Mutter brachte ihn zum Schweigen. Oma Lina hatte den Rücken an den warmen Kachelofen gelehnt, ein graues Wolltuch um die Schultern, und schien mit jedem Jahr eine Kachel weiter nach unten zu rutschen. Die Furchen auf ihrer Stirn setzten sich in den Faltenbündeln der äußeren Augenwinkel und um den Mund herum fort. Ihre gichtigen Hände ragten aus den Ärmeln wie Stecken aus dem Sackkleid einer Vogelscheuche. Da Lina in letzter Zeit kaum noch redete, fiel es besonders auf, wenn sie sich zu Wort meldete, und sei es auch nur mit dem Spruch, der Luise schon von klein auf begleitete.
Eh se sük traut, ist’s weer gut!
Klemmte sie sich den Finger in einer rostigen Türangel, hieß es: Eh sie heirate, werde es wieder gut, und der Vater gab ihr Waffenöl darauf. Verklebte sie sich einen ihrer blonden Zöpfe, weil er tief in den Teertopf baumelte, wurde das Abschneiden mit den gleichen tröstenden sieben Worten begleitet. Verlor sie an einem Fuß alle Zehennägel, weil sich eines der Rinder beim Melken versehentlich daraufstellte, hörte sie zur Aufmunterung die gleiche fromme Lüge, die auf bessere Tage vertröstete: Das wird schon wieder – und vieles wurde auch, fast wie von selbst, tatsächlich wieder gut.
Jakob sprach fast ebenso selten, wie Oma Lina Sätze von Belang von sich gab, fand Luise. Aber das bemerkte man kaum, denn stattdessen stellte er Fragen oder stritt sich mit ihrem Vater. Luises Bruder war achtzehn, hatte seine Landwirtschaftslehre abgeschlossen, und alle gingen stillschweigend davon aus, er werde den Hof einmal übernehmen. Dass ihr Vater es allerdings jemals vermochte loszulassen, konnte sich niemand vorstellen.
»Wie war die Aussicht von deinem Krankenzimmer? Hast du den Hafen sehen können?«, fragte Jakob voller Interesse, um seine freche Bemerkung über Luises Heiratsaussichten wieder wettzumachen.
Luise schüttelte den Kopf und streichelte Missi, die zu ihr auf die Bank gesprungen war, tastete besorgt den mageren Körper der alten Katze ab, der nun nur noch aus Haut und Knochen bestand. »Nein, nicht den Hafen, nur den anderen Flügel vom Krankenhaus, die Polyklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, hat die Patientin im Bett neben mir erklärt.«
»Morgen wird das Stalldach repariert«, sagte ihr Vater und wechselte einfach abrupt das Thema. »Sobald das Vieh versorgt ist, fangen wir an.«
Jakob fragte sofort: »Hast du den Zimmermann bestellt?«
»Der ist ein Taugenichts, hat die Nägel alle krumm geschlagen.«
»Sprichst du von Fiete Jacobsen?«, fragte Luise und wusste schon, wie seine Antwort lauten würde. Der Ehemann ihrer Chefin Gitte genoss keinen besonders guten Ruf in Leversdorf. Es hieß, er sei einmal vom Dach gerutscht und auf den Kopf gefallen. Seitdem habe er sie nicht mehr alle beisammen.
»Jawoll, den meine ich! Diesmal machen wir es selbst. Vor dem nächsten Regen, und die Feldarbeit wartet auch nicht. Ist reichlich spät dieses Jahr, aber was konnte man schon machen, bei der vermaledeiten Sintflut, die uns dieses Jahr geschickt wurde.«
Einer saß immer mit am Tisch – und das war der Hof. Er war das wichtigste Familienmitglied.
Sie waren einmal fünf Kinder gewesen, und die Familie hatte immer in großer Armut gelebt. Luise war das jüngste, ihre knapp drei Jahre ältere Schwester Maike war seit fünf Jahren aus dem Haus, mit einem Landwirt verheiratet und hatte schon zwei Kinder. Dann kamen ihr Bruder Jakob und sie selbst, gefolgt von Zwillingsmädchen, von denen das eine aber bei der Geburt und das andere am plötzlichen Kindstod starb. Danach war ihre Mutter fortschrittlich genug, um zu verhüten – und nahm die Pille. Luise hatte inzwischen gelernt, dass es schwer war, wurde man in Armut hineingeboren, aber noch schlimmer wäre es gewesen, keine Familie und keinen Hof zu haben.