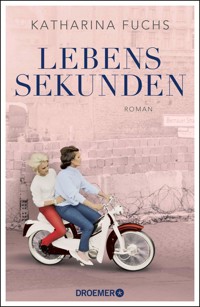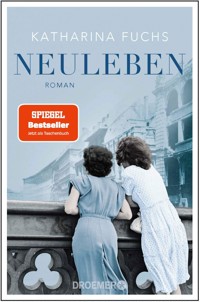16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue große Generationenroman der Bestsellerautorin, von der Weimarer Republik bis heute Lena eckt an, seit sie denken kann: in der Schule, im Studium, in Beziehungen und in ihrem politischen Engagement. Als sie mit ihrer Mutter Anja die Wohnung der Großmutter ausräumt, entdeckt sie das Vermächtnis von Anjas Großtante Clara, über deren Leben stets der Schatten von etwas Unausgesprochenem lag. Im Berlin der 1920er-Jahre interessiert sich die junge Clara kaum für Politik. Selbst als 1933 alle Zeichen auf Sturm stehen, gestattet sie dem idealistischen Revolutionär Aleksei, im Hinterzimmer ihres Hundesalons geheime Treffen abzuhalten – ohne zu ahnen, in welche Gefahr sie sich und ihre Familie dadurch bringt. Endlich erkennt Lena, dass sie nicht die Erste in der Familie ist, die ein konfliktträchtiges Leben führt und dass es um mehr geht als nur um eine verheimlichte Liebe. Schließlich treffen Mutter und Tochter eine Entscheidung, die niemand in ihrer Familie nachvollziehen kann … Ein großer Generationenroman über drei bewegende Frauenschicksale, verbunden durch das generationsübergreifende Band einer Familie Einfühlsam und authentisch erzählt Katharina Fuchs von einer außergewöhnlichen Frau in dunklen Zeiten – und von einer jungen Frau, die die Vergangenheit erkennen muss, um ihre eigene Zukunft zu gestalten. Denn Scham, Schuld und die Tragik des Zweiten Weltkriegs werden oft innerhalb einer Familie vererbt. Die Romane von Katharina Fuchs beruhen teilweise auf ihrer eigenen Familiengeschichte: - Zwei Handvoll Leben (1914–1953) - Neuleben (50er und 60er Jahre) - Lebenssekunden (BRD und DDR, 50er und 60er Jahre) - Unser kostbares Leben (70er und 80er Jahre[KS1] )[KS2] - Der Traum vom Leben (Pariser Mode-Welt der 90er Jahre) - Das Flüstern des Lebens (wahre Liebesgeschichte in Tansania)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katharina Fuchs
Vor hundert Sommern
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Lena mit ihrer Mutter Anja die Wohnung der Großmutter ausräumt, entdeckt sie den Nachlass von Anjas Großtante Clara: Über derem Leben über deren Leben stets der Schatten von etwas Unausgesprochenem lag. Im Berlin der 1920er-Jahre interessiert sich die junge Clara kaum für Politik. Selbst als 1933 alle Zeichen auf Sturm stehen, gestattet sie dem idealistischen Revolutionär Aleksei, im Hinterzimmer ihres Hundesalons geheime Treffen abzuhalten – ohne zu ahnen, in welche Gefahr sie sich und ihre Familie dadurch bringt. Endlich erkennt Lena, dass sie nicht die Erste in der Familie ist, die ein Leben voller Konflikte führt. Schließlich treffen Mutter und Tochter eine Entscheidung, die niemand in ihrer Familie nachvollziehen kann …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Anja
Lena
Anja
Anja
Clara
Lena
Lena
Anja
Clara
Anja
Elisabeth
Clara
Anja
Lena
Clara
Anja
Lena
Clara
Anja
Clara
Lena
Anja
Lena
Clara
Lena
Anja
Clara
Lena
Clara
Anja
Lena
Clara
Anja
Clara
Lena
Anja
Clara
Lena
Clara
Anja
Lena
Clara
Lena
Clara
Anja
Lena
Clara
Lena
Clara
Anja
Lena
Clara
Anja
Clara
Anja
Clara
Anja
Lena
Epilog
Nachwort
Wahrheit ist ein hohes Gut,
kommst du auf die Spur ihr,
bleib und folge ihrem Pfad,
denn er führt dich zu dir.
Friedrich Rückert (1788–1866)
All denen gewidmet, denen das Gefühl, nicht dazuzugehören, ein ständiger Begleiter ist
Berlin-Charlottenburg, Anfang Januar 2024
Anja
Anja lenkte ihren Wagen durch die Mommsenstraße. Ihr Blick glitt über die kahlen Äste der Bäume, die wie filigrane Skulpturen gegen den grauen Himmel standen. Die kühle Eleganz der Nachbarschaft, gepaart mit der Stille eines ruhigen Vormittags, verlieh dem Ort eine fast unwirkliche Atmosphäre. Sie hatte kaum damit gerechnet, direkt vor dem Haus ihrer Mutter einen Parkplatz zu finden, doch wie durch ein kleines Wunder fuhr, gerade als sie ankam, ein Golf auf der gegenüberliegenden Straßenseite weg. Geschickt manövrierte sie ihren Kombi in die freie Parklücke und stieg aus. Ein kalter Windstoß begrüßte sie, ließ sie kurz frösteln und erinnerte sie daran, dass der Winter ihr in Berlin immer schon besonders kalt vorgekommen war, kälter als in allen anderen Städten, in denen sie bisher gewohnt hatte.
Anja überquerte die Straße, die gefalteten Umzugskartons fest unter den Arm geklemmt. Die Blockabsätze ihrer Stiefel verursachten ein klackendes Geräusch auf dem Kopfsteinpflaster, während sie die Fassade betrachtete, die von Jahrzehnten Geschichte gezeichnet war. Dieses Haus hatte zwei Weltkriege fast unversehrt überstanden, bis auf die Fensterscheiben. In einer Nacht im Jahr 1944 war eine englische Trichterbombe in die Mitte der Straße eingeschlagen und alle Scheiben waren zerborsten. Ihre Mutter hatte ihr diese Geschichte erzählt, obwohl sie sonst selten über die Vergangenheit sprach. Doch der Gedanke an die überstandenen Bombennächte verlieh dem Gebäude in Anjas Augen eine seltsame, melancholische Aura.
Aus dem Briefkasten holte sie alle möglichen Wurfsendungen heraus und Briefe, die trotz des Nachsendeauftrags nicht zur neuen Adresse umgeleitet worden waren. Anja wollte schon die Steinstufen hinaufsteigen, setzte dann aber doch kurz die Kartons ab. Sie konnte nicht anders, als ihre Handfläche über das kunstvoll geschmiedete Geländer gleiten zu lassen, in das die Initialen A.H. eingearbeitet waren – die Zeichen des Erbauers aus dem Jahr 1904. Noch nie hatte sie das Haus betreten, ohne über das Geländer zu streichen. Sie nahm die Kartons wieder auf, ging weiter die Treppen hoch und der vertraute Geruch, eine Mischung des Dufts von jahrhundertealtem Holz in der Wandverkleidung und dem Poliermittel für das Messinggeländer, stieg ihr in die Nase.
Es war ihr bewusst, dass sie dieses Haus, das so sehr mit der Geschichte ihrer Familie verwoben war, bald für immer verlassen würde. Aber der Gedanke an den bevorstehenden Abschied schmerzte weniger, als sie erwartet hatte. Vielleicht, weil es nun tatsächlich an der Zeit war, loszulassen. Ihre Mutter, Elisabeth, war vor knapp vier Monaten in ein Pflegeheim in Anjas Nähe gezogen und am vergangenen Heiligabend – inmitten der warmen, festlichen Atmosphäre von Anjas Hamburger Doppelhaushälfte – hatte sie verkündet, ihre Berliner Wohnung nun endgültig aufgeben zu wollen. Anja hatte diesen Entschluss mit Erleichterung aufgenommen, denn bisher war es allen klar gewesen, dass ihre Mutter nicht mehr allein würde leben können, den Ärzten, den Pflegerinnen, der Familie – nur Elisabeth nicht. Elisabeth hatte sich die ganze Zeit an die Vorstellung geklammert, bloß vorübergehend in dem Seniorenheim zu leben, bis es ihr gesundheitlich wieder besser gehen würde. Niemand aus der Familie hatte ihr in aller Deutlichkeit sagen wollen, dass diese Vorstellung mit vierundneunzig Jahren und einer unheilbaren Herzkrankheit nicht realistisch war. Keiner hatte ihr die Illusion nehmen wollen, und das war auch gut so, denn Elisabeth hatte die Entscheidung schließlich selbstständig getroffen. Nur die praktische Umsetzung lastete jetzt auf Anjas Schultern.
Schon während sie den Schlüssel im Schloss drehte und die Wohnungstür öffnete, wusste sie, dass die drei Tage, die sie sich Urlaub genommen hatte, nicht ausreichen würden, um das Aussortieren und Ausräumen zu bewältigen. So viele Emotionen – Abschied und Neuanfang – mischten sich in diesem Moment, dass Anja kurz innehielt und tief durchatmete, bevor sie die Tür aufschob.
Sofort spürte sie die ungewohnte, tiefe Stille. Ihre Mutter hatte in den letzten Jahren fast den ganzen Tag Fernseher in allen Zimmern laufen lassen, überall unterschiedliche Programme – ihr Mittel gegen die Einsamkeit. Anja bemerkte auch den unverkennbaren, leicht muffigen Geruch einer Wohnung, die leer stand. Hier musste dringend gelüftet werden.
Das sanfte Knarren der Dielen unter ihren Füßen fügte sich nahtlos in das leise Summen der Stadt draußen ein. Sie stellte die Kartons ab, platzierte den Poststapel behutsam in der großen Zinnschale, die auf der Biedermeierkommode im Flur ruhte. Als sie aufsah, begegnete sie ihrem eigenen Blick und es war, als würde die Zeit für den kurzen Augenblick stillstehen, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart im Spiegel des Flurs begegneten. Fast meinte sie, die Züge ihrer Mutter in ihrem Gesicht zu erkennen – die gleichen ausgeprägten Wangenknochen, die eine starke Familienähnlichkeit verrieten. Rasch fasste sie ihre Haare zu einem Zopf zusammen und zog den Haargummi darüber, den sie seit heute früh um ihr Handgelenk trug – für die Ausräumarbeiten war diese Frisur praktischer –, und öffnete die Fenster.
Obwohl die fahle Wintersonne nur ein paar blasse Strahlen in das Wohnzimmer warf, sah Anja den Staub darin tanzen. Der große Sessel, in dem ihre Mutter so gern gesessen hatte, immer eine Wolldecke auf den Knien, weil sie meistens fror, war leer. Trotzdem fühlte Anja die mütterliche Präsenz in diesem Raum so sehr, als würde Elisabeth dort sitzen. Sie ließ sich in den bequemen Sessel sinken und betrachtete das Zimmer zum allerersten Mal aus dieser Perspektive, die beigefarbene Stofftapete, die den Stil der Neunzigerjahre repräsentierte, als die Wohnung das letzte Mal renoviert worden war, die Glastische mit Messingfüßen und das gemusterte Sofa in Creme- und Hellblautönen. Die Kissen darauf lagen wie immer perfekt arrangiert in einer Reihe. Sie sah ihre Mutter vor sich, wie sie sie sorgfältig aufschüttelte, den Stoff straff zog und dann mit geübter Hand links und rechts einkerbte. Schließlich drückte sie mit einem sanften Klaps die Mitte des Kissens nach unten, sodass es eine gemütliche Form bekam. Jetzt sahen sie aus, als würden sie auf etwas warten. Da war der große Fernseher, auf dem Beistelltisch lag die Hörzu, ein fertig ausgefülltes Kreuzworträtsel mit Kugelschreiber darauf und ein dicker Roman, Die Waffen des Lichts. Das Lesezeichen schaute zwischen den Seiten im ersten Drittel heraus und Anja musste unwillkürlich lächeln. Je dicker die Bücher waren, desto mehr zog es ihre Mutter zu ihnen hin. Ken Follett und Charlotte Link gehörten zu ihren Lieblingsautoren, ihre Werke füllten noch immer die Regale im Wohnzimmer. Doch in den letzten Jahren hatten ihre Augen nachgelassen – ein schleichender, unaufhaltsamer Prozess. Das Vergnügen, in die dichten Welten dieser Bücher einzutauchen, wurde für sie immer mühsamer.
Es war nach Elisabeths Schlaganfall, der Diagnose Vorhofflimmern, dem Aufenthalt im Krankenhaus und in der Reha-Klinik ein sehr überhasteter Aufbruch gewesen und das Appartement im Seniorenheim war nur 36 Quadratmeter groß. Jetzt lag es an Anja, zu entscheiden, was sie ihrer Mutter noch dorthin mitbringen sollte.
Beige war die Lieblingsfarbe ihrer Mutter – und Blau. Den blauen Ohrensessel wünschte sich Elisabeth für ihr kleines Appartement. Es war ihr einziger Wunsch. Anja lehnte den Kopf an seine hohe, bequeme Rückenlehne und dachte, vielleicht würde sie irgendwann genau wie ihre Mutter werden, wenn sie nur lange genug hier sitzen bliebe.
Aus der Ferne drang das Glockengeläut der Gedächtniskirche an ihre Ohren. Anja erinnerte sich daran, was sie einmal in einem Schulaufsatz geschrieben hatte, nachdem sie mit der Klasse bei einem Ausflug den Glockenturm besichtigt hatten: In der Glockenstube hängen sechs Bronzeglocken, die größte Glocke wiegt 5600 kg und wenn man sie aus der Nähe läuten hört, wird man fast taub.
Die Wohnung war seit dem Ende der Siebziger, seit der Scheidung ihrer Eltern, das Zuhause ihrer Mutter und auch das ihre gewesen, bis sie zum Studium nach Hamburg gegangen war. Es würde ihr unendlich schwerfallen, sie in den Verkauf zu geben. Anja atmete tief ein. Ein Jammer! Die schönen, hellen Räume, die perfekte Lage. Doch die Pflegekosten in dem teuren Seniorenheim waren so hoch, dass die Rente ihrer Mutter allein dafür nicht ausreichte, und auch sie verdiente als Angestellte der Hochschulbibliothek Bremen, wo sie als Systemadministratorin arbeitete, nicht genug, um sie dauerhaft zu unterstützen.
Anja wurde bewusst, wie wenig sie es sich erlauben konnte, hier herumzusitzen und noch länger über den Lauf der Zeit nachzudenken. Sie stand auf. Alle Wasserhähne mussten aufgedreht, die Rohre gespült werden, das Wasser sollte laufen, damit sich keine Bakterien bildeten. Das hatte ihr eine Freundin geraten, die in einer ähnlichen Situation gewesen war. Außerdem musste Anja endlich mit dem Aussortieren und Ausräumen beginnen. Sie nahm den Follett vom Tisch – er kam auf jeden Fall mit in das Seniorenheim. Ein einmal angefangenes Buch wurde auch zu Ende gelesen.
Berlin-Prenzlauer Berg, am selben Tag
Lena
Ihr Atem bildete kleine Nebelschwaden in der frostigen Luft. Sie trat in die Pedale, die eisige Kälte biss in ihre Wangen, während Lena sich ihren Weg durch die Straßen Berlins Richtung Charlottenburg suchte. Nachdem sich die kilometerlangen Staus des Vormittags aufgelöst hatten, lag die Stadt nun unter einer Decke aus frostiger Stille, durchbrochen nur vom gelegentlichen Rauschen einzelner Autos, die sie überholten. Der strenge Ostwind trieb die Menschen auf kürzestem Weg in ihre Wohnungen und beheizten Büros. Oder in die Praxen der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte.
Während Lenas Fahrrad über den rauen Asphalt glitt, fühlten sich ihre Gedanken an wie die herumwirbelnden Blätter, die nie von jemandem aufgekehrt wurden. Sie hatte ihrer Mutter versprochen, ihr beim Ausräumen der Wohnung von Oma zu helfen, und war erleichtert, dass sie so um den Besuch der Mensa herumgekommen war. Nicht, weil das Essen dort nicht gut gewesen wäre – im Gegenteil. Die Kantine der Kunsthochschule bot eine Vielzahl schmackhafter veganer Gerichte. Doch der Moment, in dem sie mit einem Tablett in der Hand nach einem freien Platz suchte und sich überwinden musste, Kommilitonen anzusprechen, versetzte sie in die altbekannte Panik.
Ihre Therapeutin hatte behauptet, es sei unmöglich, sich ständig ausgegrenzt zu fühlen. Doch Lena war sich ziemlich sicher, dass sich ihre Therapeutin irrte. Tatsächlich schien das Gefühl des Ausgegrenztseins ihr ständiger Begleiter zu sein. Es war sozusagen ihr Standardmodus. Ab und zu gab es ganz kurze Augenblicke der Erleichterung, in denen sie sich zwar immer noch außen vor, aber weniger einsam fühlte. Momente wie dieser, wenn sie dem sozialen Druck entkam, sich unter Menschen zu mischen und Gesellschaft zu suchen.
Als sie den menschenleeren Tiergarten erreichte, verlangsamte sie ihren Tritt. Die kahlen Bäume ragten wie stumme Zeugen in den grauen Himmel, ihre Zweige in der Winterluft wie erstarrt. Hier, in der relativen Stille des Parks, schien die Zeit langsamer zu fließen. Eingefangen in der winterlichen Ruhe, konnte sie sich auf sich selbst konzentrieren, ohne das Gefühl zu haben, beobachtet oder bewertet zu werden.
Plötzlich, fast wie eine Erscheinung, erblickte Lena im Augenwinkel einen großen, räudigen Hund. Sie bremste und sah genauer hin. Er war mit einem kurzen Strick an einen Laternenmast gebunden und zitterte. Statt eines Halsbands lag ein speckiges Seil um seinen Hals, dem sie ansah, dass er es schon lange trug. Sein Fell wirkte struppig und sie konnte mit bloßem Auge seine Rippen zählen. Lena stieg ab und ging langsam, Schritt für Schritt auf ihn zu. Sie hatte Respekt vor fremden Hunden und dieser reichte ihr bis zur Hüfte. Sie wusste nicht, was er erlebt hatte, wie er erzogen worden war, ob er womöglich aus Angst oder einem Reflex zuschnappen könnte. Doch der Hund sah einfach nur müde aus, seine Augen waren rot geädert und voller Traurigkeit.
Lena blickte sich um, halb in der Hoffnung, den Besitzer zu entdecken, halb wünschte sie sich, ihn nicht zu finden. Was konnte das schon für ein Mensch sein, der einen Hund hier in der Kälte anband? Weit und breit war niemand zu sehen.
Sie ging in die Hocke. »Du Armer, wer hat dich denn hier angebunden, wo ist denn dein Herrchen oder Frauchen?«, sagte sie leise. Sie zog die Handschuhe aus und ließ ihn an ihrer Hand schnuppern, dann strich sie ihm sachte über die Flanke, kraulte ihn vorsichtig hinter einem Ohr. Sofort schmiegte er seinen Kopf in ihre Hand. Vorsichtig tastete sie das Seil um seinen Hals nach einer Hundemarke ab, aber vergeblich. Nach kurzem Zögern wagte sie es, ihn mit beiden Händen zu streicheln. Sein Fell fühlte sich stumpf und ungepflegt an, aber er hatte bereits ihr Herz erobert. »Sie waren wohl nicht besonders nett zu dir?« Er legte den Kopf schief, als versuchte er, sie besser zu verstehen. Lena hatte einmal gelesen, dass Hunde das einerseits taten, um Empathie zu zeigen, andererseits auch, um trotz ihrer langen Schnauze das sehen zu können, was direkt vor ihnen lag.
Ohne länger zu zögern, versuchte Lena jetzt das Seil zu lösen, das den Hund gefangen hielt. Es war gar nicht so einfach, derart festgezurrte Doppelknoten zu öffnen. Insgesamt waren es drei, einer am Mast, zwei am Strick um den Hals. Es wirkte, als habe jemand viel Mühe darauf verwendet, jeglichen Selbstbefreiungsversuch des Hundes zu verhindern. Seine dunklen Augen folgten ihren Bewegungen, als würde er ihre Absichten verstehen. »Autsch«, entfuhr es ihr, als sie sich einen Fingernagel einriss, aber schließlich bekam sie den Knoten am Laternenmast auf. Sie ließ das Ende des Seils auf den Boden fallen. »Na los, lauf nach Hause«, sagte sie zu ihm, aber der Hund rührte sich nicht von der Stelle. Er sah sie nur an, die Augen voller Unsicherheit.
»Los, geh schon«, ermutigte sie ihn mit festerer Stimme, streckte den Arm aus und zeigte die Allee hinunter, doch der Hund blieb reglos stehen. »Geh nach Hause!« Er schien verloren, nicht wissend, wohin er gehen sollte. Vielleicht war er auch einfach zu ängstlich, um sich zu bewegen, oder er wollte den einen Menschen, der freundlich zu ihm gewesen war, nicht verlassen. Lena begriff, dass er nicht allein loslaufen würde, und in diesem Moment entschied sie, dass sie den Hund nicht seinem Schicksal überlassen würde.
Sie streichelte ihm nochmals sanft über den Kopf und sprach beruhigend auf ihn ein. »Okay, du kommst mit mir«, sagte sie entschlossen.
»Du kommst mit mir«, flüsterte sie nochmals, mehr zu sich selbst als zu dem Hund, als wollte sie sich davon überzeugen, dass es die richtige Entscheidung war. Sie würde schon eine Lösung finden, jetzt mussten sie erst einmal ins Warme. Echte Erfahrungen mit Hunden hatte sie nicht. Doch ihr Instinkt sagte, er würde sich sicherer fühlen, wenn sie das Ende des Stricks in die Hand nahm und ihn führte. Und er kam auch sofort willig mit ihr mit, lief auf gleicher Höhe neben ihr her.
Sie ließ ihn die Fahrradreifen beschnuppern, dann schob sie das Rad und er ging neben ihr. Nach einer Weile traute sie sich aufzusteigen. Kurz schaute er sie fragend an, schien aber zu verstehen, dass es jetzt schneller voranging, und begann locker zu traben. Mit dem Hund in gebührendem Abstand neben sich fuhr Lena weiter Richtung Charlottenburg. Der Hund musste spüren, dass er in sicheren Händen war, es wirkte fast, als würde er sein Bestes geben. Doch sobald sie den geschützten Tiergarten verließen und sich auf belebteren Straßen wiederfanden, änderte sich die Lage. Auf der Budapester Straße rauschte plötzlich ein Bus so dicht an ihnen vorbei, dass der Hund erschrak und zur Seite sprang, direkt auf ihr Vorderrad zu. Lena bremste geistesgegenwärtig und sprang ab. »Das war knapp!«, sagte sie leise. Sie sog tief die kalte Luft ein und beschloss, den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen.
Nach einer Dreiviertelstunde erreichten sie die Mommsenstraße. Lena lehnte ihr Fahrrad an die Hauswand, schloss es ab und blieb kurz vor dem schweren, altvertrauten Portal stehen. Mit einem letzten, nachdenklichen Blick auf den Hund öffnete sie die Tür und trat ein. Sie hatte keine Ahnung, wie ihre Mutter auf den unerwarteten vierbeinigen Gast reagieren würde.
Die Ornamentfliesen, mit denen der Eingang schon vor über hundert Jahren ausgelegt worden war, wirkten fast wie ein Jugendstilbild aus einem Museum und Lena wurde sich bewusst, wie vertraut ihr dieser ungewöhnliche Boden war. Als Kind hatte sie häufig die Ferien bei ihrer Oma in der Charlottenburger Wohnung verbracht. Seit sie in Berlin studierte, war sie mindestens einmal pro Woche hierhergekommen. Jetzt schloss sie die Augen und saugte alles ein. Sie kannte den eigentümlichen Geruch nach altem Holz und Bohnerwachs und sie mochte das Haus, so wie einen alten, lieb gewonnenen Freund. Aber sie wusste von ihrer Mutter, dass der Verkauf der Wohnung unumgänglich war.
Vor der Wohnungstür angekommen, hielt Lena kurz inne. Links und rechts waren bereits einige fertig gepackte Umzugskisten gestapelt. Der Hund blickte sie erwartungsvoll an, als spüre er ihr Zögern. Mit einem tiefen Atemzug entschied Lena, dass es keine Umkehr mehr gab. Die Tür war nur angelehnt, Lena schob sie auf und betrat die Wohnung ihrer Oma.
»Mama?«, rief sie. Aus der Küche drang Geschirrklappern. »Ich muss dir etwas zeigen«, fügte sie leiser hinzu, während sie den Hund in die Diele führte. »Mach Sitz!«, sagte sie zu ihm und er setzte sich. Anja kam herbei, in der Hand hielt sie einen Teller. Als sie den Hund sah, hielt sie sich verblüfft die freie Hand vor den Mund.
»Wo kommt der denn her? Der ist ja riesig.«
»Ich habe ihn im Tiergarten gefunden. Er war ganz allein und an einen Laternenmast angebunden«, erklärte Lena. »Ich konnte ihn doch nicht einfach dort lassen, Mama.«
Anja stellte den Teller ab und kam näher, um den Hund genauer zu betrachten. Mit seiner großen rosafarbenen Nase schnupperte er vorsichtig an ihrer ausgestreckten Hand. Lena erkannte die Sorge im Blick ihrer Mutter, die eingehend die herausstehenden Rippen musterte, das ungepflegte, struppige Fell, dessen Farbe ziemlich undefinierbar war. Grau-schwarz-beige meliert, gemischt mit Schmutz und Talg. Da begann der Hund, sich ausgiebig mit der Pfote hinter dem Ohr zu kratzen, und Anja machte einen Schritt zurück.
»Und du hast keinen Besitzer gesehen?«
Lena schüttelte den Kopf. »Da war niemand.«
»Merkwürdig. Fast als wäre er ausgesetzt worden. Ich wusste nicht, dass es das in Deutschland noch gibt.«
»Doch, es hat wieder zugenommen.« Lena zog ihre Jacke aus und hängte sie an den Garderobenhaken. »Während Corona haben sich viele Leute aus Langeweile einen Hund angeschafft, auch weil sie im Homeoffice arbeiten konnten. Und nach und nach merken sie, dass er doch nicht in ihr normales Leben passt … die Tierheime sind überfüllt.«
Anja nickte. »Wir können ihn vorerst hierbehalten, sollten aber trotzdem versuchen herauszufinden, ob er einen Besitzer hat. Vielleicht ist er gechipt«, sagte sie und trat wieder näher an den Hund heran, um seinen Hals abzutasten. »Ehrlich gesagt, glaube ich aber nicht wirklich daran, wenn ich seinen Zustand so sehe«, murmelte sie. »Wir brauchen ein vernünftiges Halsband für ihn, Futter«, im selben Moment kratzte sich der Hund schon wieder, »… und wohl auch ein Mittel gegen Flöhe.«
Lena fragte sich, warum sie so ein seltsames Kribbeln in ihrem Bauch spürte. Eine leise vibrierende Freude. Sie hatte Widerstand erwartet, doch ihre Mutter zeigte ein großes Herz.
»Schau mal!«, sagte sie und machte eine Kopfbewegung in seine Richtung. Der Hund hatte sich auf die Seite gelegt und streckte wohlig die Beine von sich, als wüsste er, dass er in sicheren Händen war. »Er scheint sich hier zu Hause zu fühlen.«
Anja schwieg und dann meinte sie in einem Ton, den Lena sehr an ihr mochte: »Schön ist er nicht, aber selten … würde Oma sagen.« Sie rieb sich die Hände. »Während er hier ein Mittagsschläfchen macht, könnten wir uns doch an die Arbeit machen.« Anja zeigte auf die halb vollen Kartons, die im Flur standen. »Ich habe schon einiges ausgeräumt, vielleicht siehst du die Sachen, die ich aus den Schränken geholt habe, noch einmal durch und überlegst, was du davon haben möchtest.«
Nachdem Lena dem Hund eine Schüssel Wasser aus der Küche geholt hatte, öffnete sie die Tür zum Wohnzimmer und ließ ihre Hand über die Rücken der Bücher gleiten, die fein säuberlich in dem beige lackierten Regal aufgereiht waren. Dazwischen silberne Rahmen mit Familienfotos, feine Porzellanfiguren und Vasen. Gut gehütete Schätze. Sie zog eines der Bücher heraus und es fiel ein gepresstes Kleeblatt heraus – vierblättrig. Sie wandte sich an ihre Mutter: »Weißt du noch? Oma braucht nur durch eine Wiese zu gehen und schon findet sie ein vierblättriges Kleeblatt. Ich weiß nicht, wie sie das macht.«
»Ja, sie hat einen Blick dafür.«
Seite an Seite gingen sie durch die Wohnung, nahmen verschiedene Gegenstände aus den Schränken – alte Kleidungsstücke, Porzellan, Kristall, Silber, Andenken. Spuren eines gelebten Lebens. Jedes Mal, wenn eine von ihnen ein Stück hochhielt, entstand eine kleine Pause, ein Moment des Innehaltens.
»Schau mal, die Mokkatasse mit dem Stiefmütterchen-Muster!«, sagte Lena und hielt das zierliche Tässchen hoch. »Das war immer ihre Lieblingstasse.«
»Ja, ich weiß.« Anjas Stimme klang leicht belegt, als sie näher kam und den Goldrand berührte. »Sie ist es vermutlich immer noch. Mama wollte ihren Espresso immer nur daraus trinken. Die Tasse muss ich ihr unbedingt mit nach Hamburg bringen.«
Sie tauschten Erinnerungen aus, erzählten sich bei jedem zweiten Stück, woher es kam, und beratschlagten sich. »Ich wünschte, Oma wäre jetzt hier und könnte selbst entscheiden«, wiederholte Lena immer wieder. Anja erwiderte: »Vermutlich wüsste sie es selbst nicht und wäre komplett überfordert.« Jedes Kleidungsstück, jeder Teller, jedes kleine Souvenir war Teil des Mosaiks des Lebens ihrer Großmutter, überlegte Lena. Es war unendlich schwierig zu entscheiden, was damit geschehen sollte.
»Erinnerst du dich an diesen Schal?«, fragte Lena, während sie eine sorgfältig gefaltete taubenblaue Stola aus weicher Wolle hochhielt.
Anja lächelte. »O ja, den hat Mama oft getragen. An kühlen Frühlingsabenden saß sie damit ganz häufig auf dem Balkon. Ich verstehe gar nicht, warum ich den Schal nicht für sie eingepackt hatte, aber es musste ja alles so schnell gehen, als sie den Pflegeplatz bekommen hat.«
Auf diese Weise vergingen Stunden und beiden wurde immer bewusster, was für eine Mammutaufgabe noch vor ihnen lag. Es war ein zäher Prozess des Abschiednehmens von Erinnerungsstücken, aber auch der Wertschätzung für das, was in einem vierundneunzig Jahre währenden Leben angeschafft worden war.
Der Hund steckte zwischendurch immer wieder die Schnauze durch halb geöffnete Türen, hob abwechselnd eine Augenbraue, als würde er überlegen, was die Zweibeiner dort wohl gerade taten. Dann legte er sich wieder in den Flur, ruhig und geduldig, als wollte er ihnen den nötigen Raum für ihre Erinnerungen geben.
»Wir tun ja fast so, als wäre Oma schon gestorben!«, bemerkte Lena plötzlich, während sie ein Kaffeeservice sorgfältig in alte Servietten und Zeitungspapier einpackte. »Irgendwie kommt es mir komisch vor, das alles ohne sie auszuräumen. Müssten wir sie denn nicht doch lieber mit einbeziehen?«
Anja, die auf der anderen Seite des Zimmers vor den geöffneten Türen einer Anrichte hockte, richtete sich auf und fasste sich mit der Hand ins Kreuz. »Sie hat ausdrücklich gesagt, dass wir entscheiden sollen. Ich glaube, es ist Oma alles zu viel und sie hätte noch viel größere Probleme als wir, über jedes einzelne Stück zu entscheiden.«
»Okay, wenn sie es wirklich so will …«, erwiderte Lena leise und setzte das Einpacken fort.
»Vielleicht ist es besser, wenn wir uns zuerst einen Überblick verschaffen. Womöglich wird es doch zu viel für uns und wir müssen einen Entrümpler beauftragen. Der Keller ist ja auch noch da.«
»Der Keller? Du meinst, da steht auch noch alles voll?«
Anja nickte. »Ich war sehr lange nicht mehr da unten, aber ich fürchte, dass sich dort Stücke aus vielen Jahrzehnten angesammelt haben.«
Gemeinsam machten sie sich auf den Weg nach unten. Als sie die schwere Kellertür erreichten, griff Anja nach dem alten Schlüssel. Mit einem kraftvollen Dreh öffnete sie die Tür, die mit einem leisen Quietschen nachgab. Die Treppe zum Gemeinschaftskeller war lang und schlecht beleuchtet, jede Lampe warf nur ein schwaches, flackerndes Licht auf den verblassten Boden. Ihre Schritte hallten leise wider, während sie sich vorsichtig vorwärtsbewegten.
»Im Zweiten Weltkrieg war das hier mal der Luftschutzkeller«, murmelte Anja. Ihre Worte waren kaum zu hören, verschwanden, als würden sie von der stickigen, sauerstoffarmen Luft geschluckt. Lena erinnerte sich nicht mehr, ob sie jemals hier unten gewesen war, und das leichte Zögern in den Bewegungen ihrer Mutter verriet auch ihre Unsicherheit. Hinter jedem der Holzverschläge lag ein Raum, der zu einer einzelnen Wohnung gehörte und womöglich, neben Gerümpel, die vergessenen Schätze und Geheimnisse ganzer Generationen von Berlinern barg.
Die Tür war nur mit einem einfachen Vorhängeschloss gesichert und Anja suchte an dem Schlüsselbund, der in der Diele gehangen hatte, nach dem passenden, probierte einige aus. Endlich ließ sich das kleine rote Schloss öffnen und sie tastete nach dem Lichtschalter.
»Das darf nicht wahr sein!«, entfuhr es Lena, als das gelbe Licht der vergitterten Deckenleuchte den Raum etwas erhellte.
Ihre Blicke fielen auf die Regale und Schränke, prall gefüllt mit Erinnerungsstücken, Kisten und staubigen Büchern, Einweckgläsern, Werkzeug, alten Lampen. Ein Sammelsurium aus der Vergangenheit breitete sich vor ihnen aus.
»Wow«, entwich es ihr, während ihre Mutter nur stumm nickte. Die Größe der Aufgabe, die vor ihnen lag, war überwältigend. Hinzu kam der Geruch, die schwere, muffige Luft hier unten, die typisch für lange Zeit unbelüftete Räume war. Es war ein dichter, erdiger Duft, der an Staub, feuchte Erde und moderndes Holz erinnerte.
Lena begann, einige Pappkisten zu öffnen, in denen sie Holzengel, Weihnachtskugeln und Kerzenhalter fand. Eine ganze Kiste voller Geschenkpapier und altem Spielzeug. Sie nahm Bücher aus den Regalen, pustete den Staub weg und schließlich zog sie einen alten Koffer aus einer Ecke hervor. Er war aus abgenutztem, dunkelbraunem Leder. Die Metallbeschläge waren angelaufen und der Griff wirkte, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Mit einem neugierigen Blick öffnete sie ihn.
Im Inneren fand sie eine Sammlung von Kämmen und Bürsten, alle mit Spuren langjähriger Nutzung. Neben diesen alltäglichen Gegenständen lag ein elektrisches Gerät, das auf den ersten Blick wie eine Bartschneidemaschine aussah.
»Was könnte das sein?«, fragte Lena, während sie in die Hocke ging und das Gerät vorsichtig hochhob. Sie betrachtete es eingehend, drehte und wendete es, versuchte, seine Funktion zu ergründen. Es hatte eine seltsame Form, nicht ganz passend für menschliches Haar, fand sie.
Anja lugte ihr über die Schulter. Nach ein paar Momenten des Rätselratens kam ihr ein Gedanke. »Könnte es vielleicht etwas für das Frisieren von Hunden sein?«
»Aber Oma hatte doch gar keinen Hund.«
»Doch, doch, sie hatte mal einen.«
»Das wusste ich nicht.« Lena betrachtete das Gerät nun mit neuen Augen. »Das sieht alles ziemlich professionell aus, aber auch sehr alt.«
»Ich erinnere mich daran, dass ihre Tante Clara früher mal einen Hundesalon hatte, ich glaube sogar, hier in Charlottenburg. Das könnte das Werkzeug daraus sein.«
Lena sah sie einen Moment lang erstaunt an und nahm die Geräte in die Hand. »Das wäre eine Erklärung. Aber warum hat Oma diese Sachen alle aufbewahrt?«
Anja zuckte leicht mit den Schultern. »Vielleicht aus sentimentalen Gründen. Manchmal behalten wir Dinge, die an Menschen erinnern, die uns wichtig waren. Oder sie hat es einfach hier unten vergessen.« Sie nickte. »Ja, ich glaube, Letzteres ist der Fall.«
Lena wiegte das alte Frisiergerät in ihrer Hand, betrachtete es nachdenklich. »Tante Clara … kanntest du sie?«
»Nein, leider nicht«, antwortete ihre Mutter, während sie einen alten Kamm aufhob. »Aber ich erinnere mich, dass Oma sie einmal erwähnt hat, eben vor allem mit dem Hinweis, dass sie einen Hundesalon besaß. Gab es ja vermutlich nicht allzu viele damals.«
»Wenn sie Omas Tante war, dann war sie meine Urgroßtante, richtig?«
»Ja, und meine Großtante.« Die beiden Frauen verharrten einen Moment. Jeder Gegenstand in ihren Händen war ein Überbleibsel einer vergangenen Ära, von der sie kaum etwas wussten.
»Es ist seltsam, wie diese Dinge uns mit Menschen verbinden, die schon lange nicht mehr leben, aber doch auch ein Teil von uns sind«, sinnierte Lena. Sie legte den Hundekamm und die Maschine wieder in den Koffer und schaute sich im Keller um, als würde sie nach weiteren verborgenen Schätzen suchen, dabei sah es eher nach schrecklich viel unnützem Gerümpel aus.
Anja stand auf und klopfte sich den Staub von der Hose. »Ich glaube, wir brauchen doch einen Profi, der das hier alles ausräumt«, murmelte sie, während sie eine uralte Hutschachtel in einem Regal hochhob, sie öffnete und einen mit Rosen verzierten, breitkrempigen Sommerhut herausholte.
»Der ist ja cool!«, sagte Lena und setzte ihn sich auf den Kopf. »Von Tante Clara?« Sie fuhr mit dem Finger an der staubigen Strohkrempe entlang.
Anja zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht.«
»Vielleicht finden wir hier noch mehr über Tante Clara und ihren Salon heraus oder über andere Verwandte, von denen ich bisher nichts wusste«, meinte Lena und begann, weitere Kisten zu öffnen, gespannt darauf, welche Geschichten sich noch im Keller ihrer Großmutter verbargen.
»Na ja, ich finde es ja schön, dass du dich so für die alten Zeiten interessierst«, sagte Anja. »Aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Hauptsorge. Ich denke eher daran, wie wir das hier alles nach oben und abtransportiert bekommen …«
»Schau mal, hier sind auch noch alte Fotos von ihrem Salon und den Hunden«, unterbrach Lena ihre Mutter. Anja kam näher, und gemeinsam blätterten sie durch die alten, verblichenen Bilder, die ein weiteres Kapitel in der Geschichte ihrer Familie zu erzählen schienen. Als Lena die Fotos genauer betrachtete, entfaltete sich vor ihren Augen ein fast lebendiges Bild der Vergangenheit. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigten einen kleinen, jedoch elegant wirkenden Hundesalon, auf der Rückseite, mit Tinte geschrieben, stand das Jahr: 1925. Die Fotos hatten diesen typischen, leicht verblassten Charme alter Fotografien, den Lena so liebte.
»Ich glaube nicht, dass es 1925 schon elektrische Schermaschinen gab«, sagte Anja und bückte sich nach dem merkwürdigen Gerät, das aussah wie ein überdimensionierter Rasierapparat. »Das hat sie dann vermutlich erst später angeschafft.«
»Ja, vermutlich«, sagte Lena. »Keine Ahnung, ab wann es die ersten elektrischen Rasierer gab, und hier unten habe ich kein Netz, sonst hätte ich es gegoogelt.«
Sie blätterte weiter durch die alten Fotos. Auf einem der Bilder stand Tante Clara stolz und mit einem breiten Lächeln in der Tür ihres Salons. Es war von 1933, wie mit verblasster Tinte auf der Rückseite vermerkt war. Das Schild über der Tür trug die Aufschrift Claras Hundesalon in geschwungenen Buchstaben.
Die Fassade des Geschäfts war stilvoll gestaltet, mit großen Fenstern. Auf einem anderen, undatierten Foto sah man den Innenraum des Salons. Es war ein Raum mit schwarz-weißem Schachbrettmuster auf dem Boden und einer eleganten Theke, in der Bürsten und andere Accessoires für die Fellpflege ausgestellt waren. An den Wänden hingen gerahmte Bilder von verschiedenen Hunderassen.
Ein besonders beeindruckendes Foto zeigte Tante Clara bei der Arbeit. Sie stand an einem Frisiertisch für Hunde, umgeben von einer Vielzahl von Bürsten und Scheren, während sie konzentriert am Fell eines prächtigen Königspudels arbeitete. Ihre Haltung wirkte selbstsicher und der Hund blickte schicksalsergeben in die Kamera. In weiteren Aufnahmen waren Kunden des Salons zu sehen – elegante Damen und Herren mit ihren Hunden, die von Dackeln bis zu Deutschen Schäferhunden reichten.
Lena ließ den Bilderstapel sinken. »Hat man denn damals schon so viel fotografiert?«, fragte sie.
Anja schüttelte den Kopf. »Das wundert mich auch. Aber es sieht fast so aus, als hätte sie einen Fotografen bestellt, um Werbefotos zu machen. Es sind ja keine Schnappschüsse, sondern alles wirkt genauestens vorbereitet und gestellt.« Sie deutete auf ein Foto von einer Frau im Pelzmantel, die einen Zwergpinscher auf dem Arm hielt wie ein Accessoire. »Sieh mal, wie streng die Dame in die Kamera schaut.«
Lena ließ sich das Foto von ihr geben. »Ja, man hat damals anders posiert als heute. Es wirkt so, als wäre Fotografieren eine sehr ernste Angelegenheit gewesen.«
Mit einem Mal wurden sie von einem leisen Geräusch unterbrochen. Es war das vertraute Hecheln ihres Findelhundes, der den Kellergang entlangkam.
»Oje, ich hab wohl die Wohnungstür offen gelassen!«, sagte Lena.
»Sieht aus, als hätte dein Spürhund uns sogar hier unten gefunden«, bemerkte Anja und kraulte ihn am Kopf.
Lena musste lachen. »Er könnte tatsächlich mal etwas Hundeshampoo und eine Frisur gebrauchen. Vielleicht ist es Schicksal, dass wir gerade die alten Frisiergeräte gefunden haben.«
Der Hund schnüffelte jetzt in jeder Ecke des Kellers. Anja hob das Schergerät hoch und betrachtete es nachdenklich. »Stell dir vor, wir benutzen das jetzt für ihn«, sagte sie mit einem Schmunzeln. »Ein Hauch von Tante Claras Salon-Flair des letzten Jahrhunderts im Jahr 2024.«
Berlin, am selben Abend
Anja
Es war längst dunkel, als Anja das vollgepackte Auto vor Lenas Wohnung im Prenzlauer Berg abstellte. Unterwegs hatten sie noch Hundefutter, Halsband, Hundeleine und ein Mittel gegen Flöhe besorgt. Sie trugen jede einen Umzugskarton die Treppen hinauf, begleitet von dem Hund, der ihnen bereitwillig folgte, als hätte er niemals einen anderen Besitzer gehabt. Lenas erste Handlung, als sie in der Wohnung angelangt waren, galt denn auch ihm. Sie holte den Beutel mit Trockenfutter aus ihrem Rucksack und füllte eine Schüssel voll. Dann lehnte sie sich an den Tisch und beobachtete, wie er gierig fraß. Sein Durst schien genauso groß zu sein, denn er leerte seine Wasserschüssel fast ebenso rasch und versah das umliegende Parkett mit kleinen Pfützen, die von seinen Barthaaren tropften. Lena holte ein Handtuch.
»Er hat ja einen Mordshunger!«, sagte Anja und stellte ihre Kiste neben dem Küchentisch ab.
»Ja, wir hätten ihm vermutlich schon viel früher etwas zu fressen besorgen sollen.« Lena füllte den Wassernapf auf und legte diesmal das Handtuch unter. Anja beobachtete ihre jüngste Tochter. Obwohl sie erst neunzehn war und seit nur drei Monaten in Berlin wohnte, bewegte sie sich mit einer Selbstverständlichkeit in ihrer neuen und ersten eigenen Küche, die ihr gefiel. Wobei »neu« für die zusammengestückelten Möbel und Elektrogeräte nicht unbedingt der passende Ausdruck war. Sie hatte Küchenschränke, Kühlschrank, Spüle und Herd von der Vormieterin übernommen, die Holz-Arbeitsplatte im Baumarkt zuschneiden lassen und selbst montiert.
»Schön hast du’s hier!«, meinte Anja und setzte sich auf einen der alten Thonetstühle.
Lena hatte das Glück gehabt, sowohl einen Platz für Produktdesign an der Kunsthochschule Berlin bekommen als auch eine bezahlbare Einzimmerwohnung im Prenzlauer Berg gefunden zu haben. Die Wohnung war zwar unrenoviert, aber mit altem Fischgrätparkett und den in Studentenkreisen immer noch begehrten stuckverzierten Decken, an denen vor hundert Jahren vermutlich Art-déco-Lüster gehangen hatten, ausgestattet. Sie hatte sie nur durch Zufall bekommen – die Freundin einer Freundin ihrer Schwester Anabel war ausgezogen.
Lena, die bemerkte, wie genau ihre Mutter sich umsah, sagte: »Ja, die Wohnung ist toll, aber im Grunde war es auch ein Riesenpech, dass Oma, schon kurz nachdem wir den Mietvertrag unterschrieben haben, den Schlaganfall hatte und nun nicht mehr in die Mommsenstraße zurückgeht. Im Grunde hätte ich ja dann auch dort einziehen können.« Als Anja sie unverwandt ansah, wurde ihr bewusst, wie sich ihr Satz gerade angehört hatte, und sie hielt sich beschämt die Hand vor den Mund. »O Gott, ich wollte damit nicht sagen, dass sie den Schlaganfall schon früher hätte kriegen sollen.« In ihrem Gesicht zeichnete sich ihr tiefes Bedauern und Mitgefühl für ihre Großmutter ab.
»Das weiß ich doch, Lena!« Anja stand auf und schlang die Arme um ihre Tochter. »Du musst dich nicht dauernd für alles entschuldigen. Ich verstehe dich besser, als du denkst.«
Vielleicht trug jeder erwachsene Mensch die Empfindsamkeit seiner Jugendjahre für immer wie eine geheime Flamme in seinem Innern, dachte Anja. Sie versuchte, sich an die Zeit zu erinnern, als sie selbst mit neunzehn häufig zu unsicher gewesen war, um die eigene Wirkung zu beurteilen. Anja wusste, wie sehr sich Lena noch immer bemühte, die »richtigen« Entscheidungen zu treffen, nichts falsch zu machen, nirgends anzuecken. Sie hatte bisher nie den Grund dafür erfahren, weshalb Lena sich schon als Kind so häufig ausgeschlossen fühlte. Ihre jüngste Tochter trug dieses tiefe Gefühl der Zurückweisung, der Ablehnung, des Nichtdazugehörens in sich, seit sie auf der Welt war. Von der Psychologin wusste sie, dass dieser Zustand genauso schmerzen konnte wie körperliche Verletzungen.
Lena wand sich aus ihrer Umarmung. »Wir sollten ihm vielleicht einen Namen geben«, überlegte sie laut. »Wie wollen wir ihn nennen?« Sie strich dem Hund liebevoll über sein stumpfes Fell. »Er sieht aus wie ein Riese … Goliath vielleicht?«
Anja sah den Hund nachdenklich an. »Vielleicht sollten wir als Allererstes versuchen, seinen Besitzer zu finden, bevor wir uns zu sehr an ihn binden«, schlug sie vor. »Es ist möglich, dass ihn jemand vermisst.«
»Der Jemand, der ihn an der Laterne im Park angebunden hat und dann verschwunden ist?«, versetzte Lena. »Ich glaube kaum, dass der oder die ihn allzu gernhat.« Ihre Blicke folgten den geruhsamen Bewegungen des Hundes, der sich jetzt gemütlich auf dem Boden ausstreckte. »Und umgekehrt kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen.«
»Ich gebe dir recht, dass es nicht gerade fürsorglich gewirkt hat«, erwiderte Anja, »aber es könnte auch eine andere Geschichte dahinterstecken. Vielleicht war sein Besitzer in einer Notlage oder konnte sich nicht mehr um ihn kümmern.«
»Dann hätte er oder sie ihn wenigstens zum Tierheim bringen können.« Lena seufzte und sah den Hund an, dessen Augen halb geschlossen waren, sichtlich zufrieden nach seiner Mahlzeit. »Es ist nur … er scheint sich hier so wohlzufühlen«, sagte sie leise. »Und ich glaube, ich werde ihn Finn nennen, das ist mir gerade eingefallen. Es bedeutet Vagabund.«
Anja legte eine Hand auf Lenas Schulter. »Ich verstehe nur zu gut, dass du jetzt schon an ihm hängst. Ich finde ihn auch besonders liebenswert. Aber wir sollten zumindest versuchen herauszufinden, ob es da draußen jemanden gibt, der ihn vermisst. Wenn nicht, dann können wir immer noch entscheiden, was das Beste für ihn ist.«
Lena nickte widerstrebend, drehte sich um und begann, Gemüse aus dem Kühlschrank zu holen. »Ich hatte übrigens gedacht, dass wir heute Abend zusammen kochen«, sagte sie. »Ich wollte Falafel, Süßkartoffeln und gebackenen Kürbis machen.«
»Das klingt gut«, antwortete Anja und half Lena, die Zutaten auf dem Küchentisch auszubreiten. Lena entkorkte die Flasche Wein, die Anja mitgebracht hatte, sie stießen die Gläser mit leisem Klirren aneinander und genossen die Mutter-Tochter-Zeit. Lena hatte Anja, wenn sie ehrlich mit sich war, unendlich gefehlt, seit sie, die jüngere ihrer beiden Töchter, ausgezogen war.
Sie arbeiteten Seite an Seite, in einem stillen und vertrauten Rhythmus. Aus dem Augenwinkel beobachtete Anja, wie ihre Tochter die Zutaten in einer Schüssel mischte und den Falafel-Teig zu kleinen, runden Bällchen formte. Ihre Finger bewegten sich geübt, Anja konnte sehen, dass sie mit dem Gericht schon Erfahrung hatte. Sie war so unendlich dankbar dafür, dass ihre Jüngste sich offenbar wieder stabilisiert hatte. Nach alldem, was passiert war!
»Was sind das für Stoffbeutel und Glasbehälter?«, fragte Anja und deutete mit dem Messer, mit dem sie Süßkartoffeln schälte, auf ein Küchenregal.
»Ich versuche, Zero-Waste-Prinzipien zu folgen, wo immer es geht«, erklärte Lena. »Kein Einwegplastik, deshalb bringe ich meine eigenen Behälter zum Einkaufen mit.«
Anja hörte interessiert zu. »Das ist wirklich beeindruckend. Was ist mit Kleidung?«
»Oh, ich kaufe hauptsächlich Secondhand«, antwortete Lena und strich über ihren kurzen Grobstrickpullover. »Vielleicht finde ich ja auch noch einige gebrauchte Kleidungsstücke bei Oma, die sie nicht mehr möchte!«
Anja konnte sich ihre Tochter nicht unbedingt in der beigefarbenen Garderobe ihrer Mutter vorstellen, aber sie nickte trotzdem, weil sie Lenas Enthusiasmus nicht bremsen wollte. Ihr Outfit war ihr bereits am Nachmittag aufgefallen. Sie trug heute eine hellgrüne Paperbag-Hose und trotz der Kälte draußen einen Pullover, der über dem Hosenbund endete. Sie musste lächeln. Es gab eine Zeit, da hatte sich Lena in knielange Sweatshirt und Jacken gehüllt, um ihren Körper wie in einem Kokon zu verstecken. Jetzt traute sie sich sogar, Bauch und nackte Haut zu zeigen. Ihre hellbraunen Haare waren locker im Nacken zusammengebunden.
Die orangefarbenen Süßkartoffeln leuchteten Anja frisch und saftig entgegen und sie legte die geschälten Stücke auf das Blech zu den Kürbisschnitzen, bereit, gleich in den Ofen geschoben zu werden.
»Könntest du auch ein paar Möbel gebrauchen?« Sie legte die nächsten Kartoffelschreiben auf das Blech und blickte Lena dann wieder direkt an. »Zum Beispiel den hübschen Biedermeierschrank oder die Tischgruppe aus Kirschbaum?«
Lena legte eine Kugel Falafel in die Keramikschüssel und als sie dem Blick ihrer Mutter begegnete, bekräftigte sie: »Ich höre zu.« Sie zeigte auf die vollgestellten Wände der Küche. »Aber so viel Platz ist hier natürlich auch nicht mehr, mein Schlafzimmer hast du ja gesehen, da passt bei bestem Willen nichts mehr rein, und ein Wohnzimmer habe ich nicht.«
Eine halbe Stunde später erfüllte der Duft von gebackenem Kürbis und Süßkartoffeln die Luft. Lena saß am Küchentisch und ihre Augen leuchteten, als sie von der Uni erzählte.
»Und dann hat Avi Steinberg uns spontan in Gruppen eingeteilt«, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Sie drehte das Glas Wein in ihrer Hand. »Er hat uns Alltagsgegenstände gegeben und gesagt: ›So, jetzt designt das Ganze neu, aber für eine völlig andere Zielgruppe.‹«
Anja wischte sich die Hände an einem Geschirrtuch ab und warf einen Blick auf den Ofen, aus dem der warme, süßliche Duft drang, während ihre Tochter von der Aufgabe, eine Wasserflasche für Kinder zu gestalten, berichtete.
»Das Beste war«, fuhr Lena fort, »dass Avi nicht einfach nur zusah. Er ging herum und stellte uns Fragen wie: ›Was, wenn ein Kind die Flasche falsch herum hält?‹, oder: ›Wie erkennt ein Kind, dass es das Produkt benutzen soll?‹ Er hat uns richtig gefordert.«
Anja lächelte und stellte das Backblech auf den Tisch. »Das klingt, als ob er euch wirklich zum Nachdenken bringt.«
Lena nickte begeistert, während sie aufstand und begann, den Tisch zu decken. »Ja, total! Es ging nicht nur um das Aussehen, sondern wirklich um die Funktion und die Geschichte, die das Design erzählt. Keiner wollte, dass die Vorlesung zu Ende geht.«
Anja nahm die gebratenen Falafel vom Herd und gab ihnen jeweils eine Portion auf. »Wirkt, als hättest du genau den richtigen Dozenten.« Sie hatte den Eindruck, dass Lena in dieser neuen Phase ihres Lebens Wurzeln schlug und zu wachsen begann. Es war, als ob eine schwere Last von ihren Schultern genommen wurde. Sie hatte sich so viele Sorgen um Lena gemacht, als diese sich entschied, nach Berlin zu ziehen und an der Universität zu studieren. Das Loslassen hatte sie bei Lena besonders viel Überwindung gekostet, nicht nur, weil sie ihr jüngstes Kind war. Lenas Erfahrungen während der Schulzeit, geprägt von ihren seelischen Belastungen, hatten in ihr einen tief verwurzelten Beschützerinstinkt entfacht, der sich nicht so leicht abstreifen ließ. Ein langes Gespräch mit Lenas Therapeutin hatte ihr offenbart, dass gerade in Lenas Fall ein behutsames Loslassen unerlässlich war. Dies sei der Schlüssel, um Lena den Raum zu geben, den sie benötigte, um sich in Richtung eines selbstbestimmten und unabhängigen Lebens zu bewegen. Und doch hatte die Unsicherheit darüber, wie Lena sich in dieser neuen Umgebung zurechtfinden würde, Anja in den Wochen nach ihrem Auszug manchmal fast überwältigt.
»Morgen früh werde ich noch mal in Omas Wohnung fahren, mal sehen, was ich noch zusammenpacken kann, und dann wollte ich eigentlich direkt zurück nach Hamburg«, sagte sie zwischen zwei Bissen. »Es macht dir doch nichts aus, wenn ich nicht mehr hier vorbeikomme?« Sie versuchte, Lena in die Augen zu sehen, aber diese war sehr eifrig damit beschäftigt, ihr Gemüse zu verspeisen. »Ich lass dir einen Zweitschlüssel für die Charlottenburger Wohnung da, dann kannst du noch mal hinfahren und entscheiden, was du noch gebrauchen kannst.«
»Ja, okay, das werde ich machen. Aber sag mal …« Lena hielt inne, ihre Augen flackerten kurz, als würde sie mit sich ringen. Anja, die das Zögern längst bemerkt hatte, wartete geduldig. Sie spürte, dass Lena etwas auf dem Herzen lag, etwas, das sie nicht leicht aussprechen konnte.
»Gibt es wirklich keine Möglichkeit, die Wohnung zu behalten?« Lenas Stimme war leise, fast flehend. Sie hatte den Blick auf den Küchentisch gerichtet, ihre Finger spielten nervös mit einer Haarsträhne, die sich aus ihrem Knoten gelöst hatte. »Es hängen so viele Erinnerungen daran. Vielleicht könnte ich dort eine WG gründen, dann hätte Oma auch Mieteinnahmen.«
Anja blinzelte überrascht. »Du in einer WG?« Die Worte entglitten ihr, bevor sie sie zurückhalten konnte, und sofort biss sie sich auf die Lippen. Wie konnte sie nur so unbedacht sein? Nach allem, was Lena durchgemacht hatte, wollte sie nichts sagen, was den Eindruck erweckte, sie zweifle an ihr.
Lenas Augen verengten sich leicht und Anja konnte die Verletzung darin sehen.
»Entschuldige«, sagte sie schnell, »ich habe nicht …« Wieder viel zu viele Entschuldigungen, dachte sie. Würde es mit Lena irgendwann einmal leicht und unbelastet sein?
Diese zuckte mit den Schultern, als würde sie es locker nehmen. »Ich weiß, Mama, du hast vermutlich recht.«
»Es tut mir leid, Lena«, sagte Anja sanft. »Es war nicht so gemeint.« Sie beugte sich vor und berührte vorsichtig ihre Hand, sie wollte ihr zeigen, dass sie bei ihr war, dass sie verstand. »Ich werde noch einmal darüber nachdenken, ob es eine Lösung gibt, bei der wir die Charlottenburger Wohnung nicht verkaufen müssen. Aber letztlich wird es Omas Entscheidung sein.«
Langsam zog Anja ihre Hand zurück, als würde sie zögern, die Verbindung zu lösen. Sie erhob sich schließlich vom Tisch und auch Lena stand auf.
Dann, ebenfalls zögerlich, umarmte sie ihre Tochter. Eine Umarmung, die länger dauerte, als es nötig gewesen wäre, aber auch ihre eigene Unsicherheit und Sorge offenlegte. Lena drückte sie fest, ließ sie als Erste los, als wollte sie der intensiven Nähe entfliehen, bevor die Emotionen übermächtig wurden. Sie ging zum Schrank, öffnete die Tür und holte eine kleine Dose heraus. »Hier, die habe ich gebacken«, sagte sie und reichte sie ihrer Mutter.
Als Anja den Deckel öffnete, strömte der Duft frisch gebackener Kekse heraus. Unter Lenas neugierigem Blick probierte sie einen der goldgelben Taler. »Und? Rein vegan.«
Anja spürte dem fruchtigen Geschmack nach. »Die sind köstlich. Mit Karotten?«
Lena nickte. »Sie sind für dich, Mama«, fügte sie hinzu. »Für die Fahrt.«
»Danke dir!«
Anja griff nach dem Schlüsselbund in ihrer Tasche und löste den zweiten Schlüssel zur Charlottenburger Wohnung aus dem Ring. Sie legte ihn bedächtig auf den Küchentisch, direkt vor Lena. Er sah unscheinbar aus und doch schien er mehr zu wiegen als sonst. Der Schlüssel war aus einfachem Stahl, die Oberfläche vom ständigen Gebrauch zerkratzt. Das schlichte Metall schimmerte matt im Licht des Zimmers und lag dort, als könnte es die Vergangenheit aufschließen – all die Momente, die zwischen den Wänden der Charlottenburger Wohnung weiterlebten, all die unbeantworteten Fragen, die noch in der Luft hingen.
Weder Mutter noch Tochter wussten, wie tief diese flüsternden Ungewissheiten schon lange in ihrem Inneren verwurzelt waren.
Hamburg, zwei Tage später
Anja
Seit fünf Jahren war es Anjas Glück, die Morgenstunden allein zu begrüßen. In dieser Zeit hatte sie eine besondere Gewohnheit entwickelt, die nur ihr gehörte. Während Stefan noch schlief, stand sie sehr früh auf, zog sich leise an und verließ das Haus.
Bevor sie an diesem Morgen vorsichtig die Schlafzimmertür hinter sich schloss, hatte sie nur ganz sachte die Hand auf seinen Rücken gelegt, um ihn atmen zu spüren. Sie wusste, dass sie dringend mehr Zweisamkeit brauchten, dass sie nur noch funktionierten. Die letzten Wochen und Monate waren von den gesundheitlichen Problemen ihrer Mutter bestimmt gewesen, der überhasteten Suche nach einem Pflegeplatz, ihrem Umzug nach Hamburg, dem von Lena nach Berlin und nun dem Ausräumen der Charlottenburger Wohnung. Wenigstens war bei Anabel alles in Ordnung, ihre ältere Tochter hatte ihr Leben im Griff.
Nun stand Anja in der Morgendämmerung vor ihrem Haus in Hamburg-Othmarschen, eine Thermoskanne mit heißem Tee in der Hand, eingehüllt in die Stille einer Welt, die noch in tiefem Schlummer lag. Es machte den Kopf frei, frühmorgens rauszugehen, und da traf sie die Erkenntnis: Sie brauchte eine längere Auszeit. Sie brauchte Zeit mit Stefan. Vielleicht sollten sie am nächsten Wochenende an die Küste fahren!
Heute Vormittag musste sie zu ihrer Mutter ins Pflegeheim. Am Abend und den ganzen morgigen Tag würde sie im Homeoffice damit beschäftigt sein, die Umstellung auf die neue Bibliothekssoftware vorzubereiten. Dafür war eine Teams-Besprechung mit einem IT-Spezialisten von SAP angesetzt, um die wichtigsten Aspekte der Transformation zu klären. Ende des Monats würde sie dann eine Präsentation für die Mitarbeiter der Hochschulbibliothek halten, die auch vorbereitet sein wollte. Sich in all dem Stress einmal ein gemütliches Wochenende zu zweit zu gönnen, wäre eine willkommene Option. Der Gedanke an die Nordsee, an lange Strandspaziergänge, gefiel ihr immer mehr.
Der Frost der Nacht hatte sich auf den Scheiben ihres Autos niedergeschlagen, bedeckte das Glas mit einer dünnen weißen Schicht. Sie nahm den Eiskratzer in die Hand, ein unverzichtbares Werkzeug in diesen kalten Monaten, da ihre Garage mit Fahrrädern und Gartengeräten vollstand. Mit gleichmäßigen Bewegungen begann sie, den festgefrorenen Raureif von der Windschutzscheibe zu kratzen. Der harte Kunststoff glitt über das Glas, brach die eisigen Partikel und ließ sie in kleinen Schneeflocken zu Boden fallen. Anja sah ihren kondensierten Atem in der kalten Luft, während sie ihre Arbeit fortsetzte.
Aus dem Augenwinkel bemerkte sie das Flackern eines Fahrradlichts in der Ferne und sah auf ihre Armbanduhr: fünf nach halb sechs. Eigentlich eine ungewöhnliche Zeit für Begegnungen, doch das Licht näherte sich wie ein kleiner wackeliger Stern. Als die Gestalt näher kam, erkannte sie das Gesicht unter einem dicken Schal – es war Hilde Jansen, eine Nachbarin aus der Parallelstraße.
»Moin, Frau Jansen! Schon so früh unterwegs?«, fragte sie freundlich.
»Moin!« Frau Jansen hielt an, richtete ihren Schal und erwiderte das Lächeln. »Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, oder in meinem Fall die Bücher.« Anja wusste, dass Frau Jansen seit Jahrzehnten eine Buchhandlung in Winterhude führte.
»Ich bekomme heute eine große Lieferung und wollte vorher noch meinen Frühsport machen. Es sind übrigens einige ganz besondere Bücher dabei.«
Anja nickte. »Ich habe schon gehört, dass Sie seit Jahren eine richtige Institution in Winterhude sind. Ich war nur noch nie da.«
»Ach, das höre ich hier öfter. Aber in Winterhude kennt mich jeder, vielleicht verirren Sie sich auch einmal zu mir, bevor ich in den Ruhestand gehe. Ich habe eine sehr gemütliche Leseecke und auch immer einen heißen Tee auf dem Stövchen.«
Anja lächelte verlegen. »Das klingt tatsächlich sehr einladend, vielleicht wird es wirklich mal Zeit.«
Die Buchhändlerin deutete auf Anjas Auto. »Und Sie sind schon auf dem Sprung zur Arbeit?«
Anja schloss die Tür auf. »Nein, ich muss nachher zu meiner Mutter ins Seniorenheim und will vorher noch im See schwimmen, ist drei Tage ausgefallen, weil ich in Berlin war.«
Frau Jansen schüttelte den Kopf. »Alle Achtung! Ich könnte das nicht, würde schon auf dem Weg ins Wasser erfrieren.«
»Sagt die, die bei Wind und Wetter ohne Handschuhe Fahrrad fährt.«
Frau Jansen hauchte ihre Hände an. »Alles eine Frage der Übung.«
»Das Eisschwimmen auch. Bis bald, Frau Jansen, ich komme demnächst vorbei.« Sie winkte der Buchhändlerin zu, bevor sie sich ins Auto setzte.
Anja unterhielt sich gern mit Nachbarn oder Leuten wie dem Zeitungsboten, dem Briefträger, den Frauen an der Supermarktkasse, in der Reinigung und mit Handwerkern. Etwas, das Stefan auch nach dreiundzwanzig Jahren Ehe noch immer den Kopf schütteln ließ. Solche kleinen Schwätzchen waren überhaupt nicht seine Sache.
Wobei gerade er nur zu gern davon profitierte, dass beispielsweise der Paketbote immer wieder versuchte, ihre Pakete persönlich zuzustellen, statt einfach eine Benachrichtigung zu hinterlassen. Schließlich war es Stefan, der ständig im Internet bestellte. Seien es Druckerpatronen, Kabel, Mikrofone, Leuchten, Kameras oder sonstiges technisches Zubehör, fast täglich kamen Lieferungen. Sein Homeoffice im ehemaligen Gästezimmer war seit den Corona-Jahren perfekt ausgestattet – weitaus besser als ihres. Während er an seinem höhenverstellbaren Schreibtisch mit zwei Bildschirmen saß, fand sie sich oft in einem der verlassenen Kinderzimmer wieder, wo sie ihren Laptop auf dem Schreibtisch aufklappte und versuchte, konzentriert zu arbeiten. Es war kein Vergleich, aber sie hatte sich damit arrangiert.
Sie schüttelte diese Gedanken ab und startete den Motor. Wenn eine Ehe sich nur noch um den Alltag drehte, war es leicht, sich in den kleinen Unzulänglichkeiten des anderen zu verlieren. Sie atmete tief durch. Die Straßen Hamburgs lagen noch ruhig und still da, während sie durch Othmarschen fuhr. Die gepflegten Reihenhäuser standen in ordentlichen Reihen, mit Vorgärten, in denen die kahlen Äste der Bäume von weißen Froststernen bedeckt waren. Zwischen den traditionellen Villen mit ihren roten Ziegeldächern tauchten bald moderne Wohnanlagen auf, die ein wenig wie Fremdkörper in der altehrwürdigen Umgebung wirkten. Der frische Morgen schien so friedlich, als die ersten Sonnenstrahlen den Raureif und die Schneereste auf den Dächern glitzern ließen, doch in Anjas Innerem herrschte eine leise Unruhe, die sich nicht so leicht abschütteln ließ.
Sie waren froh gewesen, als sie sich hier eine Doppelhaushälfte für die Familie hatten leisten können. Die gute Anbindung an die Innenstadt und die idyllische Umgebung machten Othmarschen besonders reizvoll für Familien und Berufstätige. Aber auch hier wurde das Leben immer teurer, Inflation, ausufernde Energiepreise und ausgerechnet als die Hypothekenzinsen im Sommer 2023 ihren neuen Höhepunkt erreichten, mussten sie das Darlehen für ihre Doppelhaushälfte refinanzieren.
Anja fuhr vorbei an den geschlossenen Geschäften und Cafés, die noch in der morgendlichen Dämmerung schlummerten. Nur vereinzelt waren andere Frühaufsteher unterwegs. Sie überquerte die Elbbrücken, die beeindruckende Ausblicke auf den Fluss und die vorbeiziehenden Schiffe boten.
Dann änderte sich die Landschaft. Die dicht bebauten Straßenzüge wichen offenerem Gelände und bald fuhr Anja auf einer Landstraße, die sie in die Boberger Niederung führte, einem Naturschutzgebiet. Sie hatte die Gegend erst letztes Jahr entdeckt.
Schließlich erreichte Anja den See, dessen nördliches Ufer von schilfbewehrten Böschungen gesäumt war. Die gefrorene Wasseroberfläche schimmerte in einem matten Silbergrau. Nur das Eisloch, das sie bei einem der letzten Male hineingeschlagen hatte, war tiefschwarz, aber da der Frost im Moment nicht tief war, würde sie die neue, dünne Eisschicht mit bloßen Hände zerplatzen lassen.
Sie parkte das Auto, stieg aus und spürte den Atem des Winters. Ein Kribbeln der Vorfreude erfüllte sie, als sie wusste, dass es Zeit war. Ohne zu zögern, begann sie, sich aus ihrer warmen Winterkleidung zu schälen. Die eisige Luft umhüllte ihren Körper, sie konnte die Eiskristalle förmlich auf ihrer Haut fühlen, als sie ihre Kleidung auf den Fahrersitz legte. Schließlich stand sie nackt am Ufer des Sees und fühlte sich lebendiger denn je.
Anja wusste, dass das Wasser nah am Gefrierpunkt sein musste. Doch das hinderte sie nicht, sie dachte einfach nicht darüber nach und machte einen entschlossenen Schritt in die Eiseskälte. Es fühlte sich an, als würden tausend Nadelstiche auf ihre Haut prasseln. Mit einem tiefen Atemzug tauchte sie ein. Ihre Zehen krümmten sich, als sie den Grund unter ihren Füßen verlor. Das Wasser umhüllte sie und ein Schauer durchfuhr ihren Körper. Ihre Haut prickelte vor Kälte und sie kämpfte kurz gegen den Instinkt des Auftauchens an. Schlingpflanzen und Blätter streichelten sie wie die zärtlichen Hände einer längst vergessenen Liebe.
Sie kam aus dem Wasser und ihr ganzer Körper zitterte, krebsrot und mit Gänsehaut übersät. Anja rubbelte sich hastig mit dem Handtuch ab, zog sich Schicht für Schicht an und umklammerte dann die heiße Teetasse, als wäre sie ihr letzter Halt. Die Sonne, am Horizont hinter dem dichten Grau verborgen, war nur zu erahnen, ihre Strahlen erreichten Anja nicht. Krähen saßen regungslos in den Fichten, ihre dunklen Silhouetten zeichneten sich scharf gegen den graurosa Himmel ab. Etwas an ihrem stillen, stoischen Dasein rührte Anja. Diese fremden und doch so vertrauten Lebewesen – rotes Blut unter schwarzem Gefieder – waren Sinnbilder einer unerschütterlichen Geduld. Einer Geduld, die nichts mehr erhoffte, die einfach nur ausharrte, bereit, das Licht ebenso wie den Schatten hinzunehmen.
Kurz darauf fuhr sie wieder durch die Straßen Hamburgs, während die Stadt langsam erwachte und in ihrem gewohnten Tagesrhythmus zu pulsieren begann. Sie stellte die Sitzheizung auf die höchste Stufe und ließ sich die Hände aus der Lüftung warm blasen. Im Moment fühlten sich ihre Fingerspitzen und Zehen noch taub an.
Anja steuerte zielsicher auf das Pflegeheim zu, das am Ende der Allee lag – das Seniorenheim Alsterblick in Winterhude, einem Stadtteil, der für seine Ruhe und den Wohlstand seiner Bewohner bekannt war. In der warmen Jahreszeit säumten üppige, gepflegte Grünanlagen den Weg und alte Bäume warfen lange Schatten auf die breiten Gehwege. Es war nicht einfach gewesen, kurzfristig einen Platz für ihre Mutter in einem Pflegeheim zu finden. Nach der Reha war schnell klar gewesen, dass sie nicht mehr allein in ihrer Wohnung bleiben konnte. Und da sie nirgends eine Anwartschaft aufgebaut hatte, war es fast zwangsläufig, dass nur in den teuren Heimen noch Zimmer verfügbar waren. Die gesamte Rente ihrer Mutter floss nun in die hohen Kosten für Pflege und Unterbringung.
Anja betrat die Eingangshalle. Das Gebäude selbst war modern, ein Zweckbau, mit großen Fenstern, die viel Licht in die Räume ließen. Die Wände leuchteten in warmen Farben und überall standen gemütliche Sitzgelegenheiten und Pflanzen, die dem Ort eine heimelige Ausstrahlung verleihen sollten. Nur der Geruch nach Desinfektionsmittel verriet, dass es sich nicht um ein Viersternehotel handelte, sondern um ein Seniorenheim mit Pflegeabteilung.
Mit einem mulmigen Gefühl machte sich Anja auf den Weg in den zweiten Stock. Die Heimleiterin hatte sie vor Kurzem telefonisch darüber informiert, dass ihre Mutter sehr schwach sei und zumindest vorübergehend einen Rollstuhl benutzen müsse. Anja atmete tief durch, versuchte, sich innerlich darauf vorzubereiten, ihre Mutter in dieser neuen Situation zu sehen. Sie erinnerte sich daran, wie schwer es gewesen war, Elisabeth überhaupt dazu zu überreden, in das Heim zu ziehen. Es schien fast, als würde ihre Mutter sie für ihren Zustand verantwortlich machen. Seitdem war ihr Verhältnis abgekühlt. Nun sollte Elisabeth also auch noch im Rollstuhl sitzen. Ein weiterer Tiefpunkt.
Als sie das Einzimmerappartement betrat, erwartete sie, ihre Mutter in gedämpfter Stimmung vorzufinden. Doch der Rollstuhl stand leer in einer Ecke. Elisabeth saß in einem Sessel, eine karierte Decke über den Knien, und schaute interessiert in den Fernseher. Neben sich hatte sie eine Packung mit den harten Butterkeksen liegen, die sie in großen Mengen verzehrte und die ihr Anja regelmäßig besorgen musste. Elisabeth konnte ihre Tochter weder sehen noch hören, denn sie saß mit dem Rücken zur Tür und trug Kopfhörer.
Anja trat näher, legte ihr die neue gelbe Kekspackung und den angefangenen Roman von Ken Follett auf den Tisch. »Guten Morgen, Mama, wie geht es dir heute?«
Da bemerkte Elisabeth die Bewegung neben sich und drehte sich um. »Ach, du bist es! Dieser Film hier ist ganz amüsant. Tierärztin Dr. Mertens sehe ich immer gerne, vor allem seit ich ganz allein in diesem kleinen Zimmer hier sitzen muss.« Anstelle der Beantwortung der Frage nach ihrem Befinden oder einer Begrüßung äußerte sich Elisabeth fast immer über die aktuelle Sendung. Anja wusste aus Erfahrung, dass ihre Stimmung mit dem gebotenen Fernsehprogramm stieg und fiel.
Sie biss sich auf die Zunge, um nicht zu erwidern, dass ihre Mutter auch schon in der großen Berliner Wohnung sehr viel Fernsehen geschaut hatte und vermutlich noch häufiger allein gewesen war. Sie setzte sich neben sie, nahm die Fernbedienung und fragte höflich, ob sie trotzdem ausstellen dürfe.
»Ja, natürlich, jetzt bist du ja endlich da!«, lautete die Antwort.
Anja überging den unterschwelligen Vorwurf und fragte behutsam nach, was es mit dem Rollstuhl auf sich habe.
Ihre Mutter machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ach, den brauche ich nicht. Die haben hier doch einen Vogel, mich in so ein Ding zu setzen. Das können sie machen, wenn ich alt bin.«