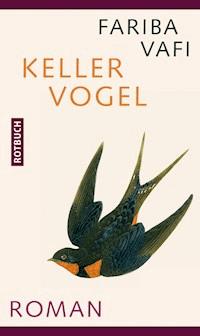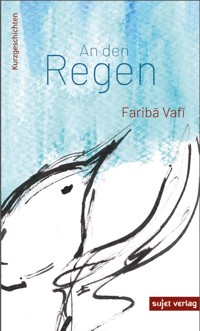Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sujet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon in "Kellervogel" und "Tarlan", Fariba Vafis ersten beiden in deutscher Übersetzung vorliegenden Romanen, kam zum Ausdruck, dass Beziehungen zwischen Menschen kompliziert sind. Diesmal führt Scholeh uns das vor Augen. Ihr Gefühlsleben ist gehörig durcheinander geraten, gern würde sie ihrer älteren Schwester Schiwa ihr Herz ausschütten. Weil die aber mit der Bewältigung des ganz normalen Alltags beschäftigt ist, bleibt Scholeh nur die Zwiesprache mit sich selbst. Während sie über ihre eigene Lage nachdenkt, nimmt sie auch schonungslos ihre Umgebung unter die Lupe. Sie schaut hinter viele Fassaden, offenbart die vielen kleinen Gefechte, die großen Kämpfe, die es im Zwiespalt zwischen den eigenen Träumen und den Erwartungen anderer fast täglich auszufechten heißt. Und inmitten aller Wünsche und Widersprüche stellt sich mehr als einmal die Frage, was man um des eigenen Glückes willen bereit ist, aufs Spiel zu setzen. "Der Traum von Tibet" ist weit mehr als eine Bestandsaufnahme von Liebeskummer. Fariba Vafi schickt ihre Leute auf immer neue Feldzüge. Fast beiläufig, leise, beharrlich werden Freiräume erst ausgelotet, dann erobert. Die Autorin versteht ihr Handwerk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman
Der Traum von Tibet
Fariba Vafi
Aus dem Persischen
von Jutta Himmelreich
Originalausgabe:
Roya-ye Tabat
Nashr-e-Markaz Publishing, Teheran
1. Auflage 2005
Die Übersetzung aus dem Persischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt durch
Litprom - Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V.
CIP - Titelaufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek
Vafi, Fariba
Der Traum von Tibet
Aus dem Persischen von Jutta Himmelreich
ISBN 9783962026103
© der deutschen Ausgabe 2018 by Sujet Verlag
Umschlaggestaltung: Ina Dautier
Satz und Layout: Joëlle Stüben
Lektorat: Jutta Himmelreich
Druckvorstufe: Sujet Verlag, Bremen
Printed in Europe
1. Auflage 2018
www.sujet-verlag.de
1
Schiwa! Steh auf. Du hast’s verbockt. Sonst bin immer ich diejenige, die Mist baut. Diesmal warst du’s. Wer hätte je auch nur im Traum geglaubt, dass die brave, vernünftige Schiwa zu sowas imstande ist? Das grelle Blitzlicht der Kamera hatte uns alle für einen Augenblick versteinert. Seitdem weiß ich, dass Verblüffung sich bei jedem Menschen anders zeigt. Djawid, mit scheinbar vor Schmerz verzerrtem Gesicht, hat ausgesehen, als würde er jeden Moment die Beherrschung verlieren. Mama, die ihren Augen nicht zu trauen glaubte, hat forschende Blicke zwischen dir und mir hin- und hergeschickt. Ich stand in meiner langen traditionellen Tracht stocksteif da, wie die Kleiderpuppen in Schaukästen von Heimatmuseen, meine Arme weit offen, der Blick starr. Wie die anderen aussahen, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war’s ein lebendiger Haufen, lebhaft und laut. Die Stille, die von einer Sekunde auf die andere eintrat, blieb mir noch lange im Ohr. Völlige Stille, als alle reihum ihre Münder geschlossen haben, weil sie genau sehen wollten, was sich da vor ihren Augen tat.
Ich frage mich allerdings, wie du, die seit jeher stärker unter Beobachtung gestanden hat als alle anderen, über die vielen neugierigen Blicke hinwegsehen konntest. Du hast sie glatt alle missachtet und wurdest dafür wohl mit einem Schlag blind. Man hat dir deine unbändige Freude angesehen, stille, ungetrübte Verzückung. Gestrahlt hast du, übers ganze glänzende Gesicht, und schienst von weit entfernt spielender Musik bezaubert. Wie gut ich diesen Zustand kenne. Dieses Hochgefühl der Liebenden, die ihr Bett mit ihrem Auserwählten teilt. Die leichte körperliche Anspannung, die sanfte Benommenheit. Ich dachte damals, dieser Zustand sei allen Frauen vertraut, von Geburt an, selbst wenn sie ihn über Jahre hin verbergen müssen oder überhaupt nie die Gelegenheit bekommen, ihn offen zu zeigen. Manche haben dieses Glück wirklich nie, dir blieb es sechzehn Jahre lang verwehrt. Du und Djawid, ihr habt euch in euer Schlafgemach zurückgezogen wie zwei Mönche, einer uralten Tradition getreu. Vielleicht auch nur, um eine Kerze anzuzünden. Ohne Yalda und Nima wäre diese Lesart die wahrscheinlichere. Wer euch im Laufe eines Tages beobachtete, der sah nie zärtliche Gesten, keine Anzeichen für eine liebevolle Beziehung, die verraten hätten, dass zwischen euch Dinge passieren, die euch Freude machen. Djawid war nicht der Typ Mann, der seiner Frau in die Küche folgt, hinter ihr stehenbleibt und sich an sie schmiegt. Und du warst nicht die Sorte Frau, die sich bückt, vorgeblich, um irgendwas vom Boden aufzuheben, tatsächlich aber, damit man ihr in den Ausschnitt schauen kann. Forough wandte diesen Kniff gern an, wobei ihr völlig egal war, dass ihr Dekolleté an die in so mancher Schusterwerkstatt hängenden Lederlappen erinnerte.
Mama hat erzählt: „An dem Tag, als Schiwa mit Djawid das Haus verlassen hat, konnten wir kaum fassen, dass sie in die Flitterwochen fährt. Wir dachten, sie geht zu einem ihrer Volleyballturniere, wie immer.“
Deine Mitgift bestand aus einer einzigen, nun schon seit Ewigkeiten vertrockneten Blume, und du hast Djawid immer gern mit dem Spruch aufgezogen: „Mich gib frei, die Mitgift sei dein.“ Er konterte regelmäßig: „Pflück dir im Hof ein Blümchen und geh.“ Einer eurer Dauerbrenner, über den eure Freunde euch zuliebe jahrelang gelacht haben.
Djawid hat mit einem Gedicht von Arash Kamangir um deine Hand angehalten. Sein Vortrag kam dir damals ziemlich langatmig vor, hast du gesagt. Und dass Djawids Wortgewalt dich von Anfang an beeindruckt hat. Wenn ich Djawids markanten Unterkiefer sah, dachte ich jedes Mal: Menschliche Fantasie übertrifft Schönheitschirurgie.
„Er hat pure Entschlusskraft ausgestrahlt, vom Scheitel bis zur Sohle“, hast du gesagt. Hast von Überzeugungen gesprochen und beteuert, ein Mann ohne Überzeugungen sei wie ein Fisch ohne Gräten. Ohne Rückgrat. Dabei hatte Djawid jede Menge Knochen, so schlaksig hoch aufgeschossen und knochig wie er war, auch wenn Sadegh, einst als „Das Gerippe“ berühmt, ihm damals den Rang ablief.
Djawid sagte damals immer: „Er ist zwar nur Haut und Knochen, aber beinhart.“
„Sadegh besteht doch aus nichts als Fleisch und Fett“, meinte ich, kam, ihn imitierend, als beleibter General in Zivil ins Zimmer und ließ meine massige Gestalt in einen Sessel fallen.
„In solchen Momenten seid ihr beiden Schwestern euch total ähnlich“, hat Mama lachend gesagt.Und ich hab gefragt: „Wie sind wir denn?“
Woraufhin Djawid den Kopf über den Halbkreis seiner Zeitung hinweg gehoben und geantwortet hat: „Außen strenger Richter, innen wirrer Clown.“
Er hat sich in die Brust geworfen, stolz wie immer, wenn er fand, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hatte.
Du hast mal gesagt: „Sadegh war früher schlank, schlanker sogar als Djawid.“
Und Djawid hat bekräftigt: „Beim Bergwandern war er ausdauernder als wir alle zusammen.“
Mich hat das noch nicht überzeugt. „Nenn mir Eigenschaften, die ein Kamel nicht hat.“
Mama hat genickt. „Er ist ganz zahm.“
Ich hab geseufzt und hatte ein Pferd vor Augen.
Djawid hat die Zeitung beiseite gelegt. „Die Jugend von heute hat nur Äußerlichkeiten im Kopf.“
„Ich bitte dich. Was sollen wir denn sonst im Kopf haben?“, hab ich gemurmelt.
Djawid hat meine Frage überhört, und ich hab sie neu formuliert: „Was übersehen wir denn?“
Um mir das zu erklären, brauchte er eine ganze Stunde.
Du hast es in ein Wort gefasst: „Geist.“
Dieses Wort, aus deinem Mund, kam dem Fund eines Fläschchens Parfüm unter hundert Fläschchen Arznei gleich. Ich hab gestaunt. Genau wie damals, als ich das Buch über Traumdeutung unter deinem Kopfkissen entdeckt hatte.
„Wir Glückspilze“, hab ich gesagt. „Endlich halten Geister auch bei uns Einzug.“
„Stimmt das wirklich, Tante Scholeh?“, hat Nima gefragt und von seiner Modelleisenbahn aufgeschaut.
Bei mir und Mama waren sie seit jeher zuhause. Frei und ungebunden gingen sie ein und aus, gehörten ganz selbstverständlich zur Familie. Sie tauchten in unseren Träumen auf, waren kein bisschen bedrohlich. Papas Geist erschien Mama hin und wieder im Traum, und ständig beschwor sie den Geist dieses oder jenes Mitmenschen. Sie fand, auch der Geist eines Menschen trage menschliche Züge und habe Persönlichkeit, und auch ihm gebühre Respekt. Weil sie daran glaubte, galt Mama als abergläubisch, ich als versponnen, als gespaltene Persönlichkeit.
„Ich meine nicht diese Art von Geist.“
Dann bist du in die Küche gegangen.
„Welche denn?“
Djawid ist uns gefolgt, wohl um die Entdeckung des Geistes historisch herzuleiten. Den begeisterten Hobbyhistoriker gewann mühelos für sich, wer ihm ein, zwei Fragen zum Thema stellte.
Du hast den Pfannenwender gehoben und mit der Autorität des Küchenmeisters in der Klapse verkündet: „Essen ist fertig!“
Du hast jegliche Art von Diskussion lange gemieden und die Angewohnheit, deine Gesprächspartner überzeugen zu wollen, irgendwann abgelegt wie eine ungesunde Sucht. Mit Yalda und Nima hast du dir nie lange Wortgefechte geliefert. Du warst der Meinung, eine kurze, vernünftige Erklärung müsse genügen. Djawid hat gerufen: „In diesem Haus werden keine Lektionen mehr erteilt!“
Für euch war sogar die Liebe ein Ritual, kein persönliches Erlebnis. Deshalb wart ihr an dem Abend, als ich zu euch kam, auch aus dem Konzept gebracht. Djawid hat den Kopf zur Schlafzimmertür rausgestreckt und konstatiert: „Unsere Wohnung ist wie die Schweizer Botschaft. Wer Probleme hat, sucht bei uns Zuflucht.“
Er hat in Richtung Obergeschoss gedeutet und „Leise!“ gesagt.
Ich hab laut geweint, gefleht: „Tut doch was!“ und wusste im Grunde, dass nichts zu machen war. Mehrdad hatte mich verlassen, für immer. Es war dunkel im Treppenhaus, ich hab Djawid in seinen Hausschlappen, flipp-flapp, nach draußen kommen hören, hab mich auf den Treppenabschnitt vor der Wohnung des Hauseigentümers im Stockwerk über euch gesetzt und gedacht: „Hier geht’s schlimmer zu als in der ugandischen Botschaft.“ Von irgendwoher wehte der üble Geruch nach verfaulten Gurken.
„Leiser“, hat Djawid gesagt, „ich bitte dich!“
Und ich dachte: Der Botschafter eines Landes aus der vierten Welt.
Die Wohnungstür über uns ist aufgegangen. Du hast mich am Arm gefasst und durchs Treppenhaus in eure Wohnung geleitet. „Irgendwas musst du tun!“, hab ich dich angefleht und auf deine Reaktion gewartet. Stattdessen fühlte Djawid sich berufen, mir eine Predigt zu halten. Über Klassenunterschiede, über die Unmöglichkeit des Zusammenlebens zweier Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Ich hab dich angeschaut, hab mich gefragt, wie du diesen Mann lieben konntest, nicht nur eine Stunde lang, nein, jede Stunde jedes Tages, beim Frühstück, beim Mittag- und beim Abendessen. Nicht nur an ein, zwei Tagen, nein, tagein, tagaus, seit sechzehn Jahren schon. Einen Mann, der selbst dann redete, wenn man ihn nicht aufmunternd ansah, und der seinen Redefluss wohl auch nicht unterbrechen würde, wenn man in Ohnmacht fiele.
Ich hab noch mehr Tränen vergossen. Diesmal nicht nur Mehrdads-, nein, auch deinetwegen.
Du hast mir derweil die Papiertaschentücher gereicht und das festklemmende erste Tuch energisch aus der Schachtel gezerrt. Sekundenlang hatte ich das unbestimmte Gefühl, keine zutiefst vernichtende Niederlage erlitten zu haben, sondern erleichtert zu sein, erlöst. Noch war nichts verloren, und es kam gar nicht so sehr darauf an, ob Mehrdad nun ging oder blieb.
Ich hab ihn vor mir gesehen, in der weiten Pyjamahose, die Djawid von der schmalen Taille rutscht, und hab sein „Psst, psst!“ gehört. Trotz meiner Tränen hab ich kurz andere Töne wahrgenommen, die mir die Kraft gaben, mich für immer von Mehrdad loszusagen. Doch so rasch wie er gekommen war, war dieser Moment der Stärke auch wieder verflogen.
2
Heute Abend aber ist von Vernunft und Logik keine Spur mehr. Heute Abend bist du verrückt geworden und Djawid ist so aus der Fassung geraten, dass er dich nicht „Verrücktes Huhn“ nennen konnte. In dem Ton, in dem er’s neulich abends in eurer verwinkelten Mietwohnung zu mir gesagt hat. „Verrücktes Huhn“, hat er gesagt, wenn auch nicht so, wie ein Kumpel es sagen und dabei lachen würde. Es hat sich nicht angehört wie die freundschaftliche Bemerkung, die dir signalisieren soll: Bleib wie du bist.
Du hast gesagt: „Wenn er echtes Interesse an dir hat, kommt er zurück.“
Ich hab gesagt: „Er hat echtes Interesse an mir, aber er kann nicht.“
Ich und Mehrdad gingen spazieren und redeten.
Seine Mutter hatte ihm zur Verlobung ein, wie er es ausdrückte, „grundsolides Kind aus gutem Hause“ ausgesucht und erwartete ihn nun. Es war alles bereit. Er musste nur noch nach Hause gehen. Er könne, so sagte er, seiner Familie gegenüber nicht länger Widerstand leisten.
Auf diesem Wort beharrte er, und ich dachte jedes Mal an Sadegh, den entweder du oder Djawid, genau weiß ich das nicht mehr, als die Verkörperung des Widerstands bezeichnet hat.
Ich fand, wir müssten Mehrdad vor vollendete Tatsachen stellen, es irgendwie so einrichten, dass er ohne Widerstand auskommen konnte. Und wieder kam mir Sadegh in den Sinn.
Yalda schlug vor: „Wir nehmen ihn einfach fest und halten ihn solange gefangen, bis die Hochzeit platzt.“
Erst jetzt wurde Djawid auf seine Tochter aufmerksam, die unter ihrer Decke hervorgelugt hat wie eine Schildkröte unter ihrem Panzer.
„Du, schlaf jetzt bitte.“
Er ist aufgestanden und hat die Schiebetür zugezogen.
„Wenn wir zusammen erwischt werden, müssen wir zwangsläufig heiraten.“
Über dieser Option hatte ich seit längerem gebrütet. Jetzt sprach ich sie zum ersten Mal offen aus und erntete ein heftiges Schnauben und ein „Verrücktes Huhn!“ von Djawid.
Dann hat er dich angeschaut.
„Sie faselt im Fieber.“
Du hast gesagt: „Wenn alles schon so weit gediehen ist, heißt das doch, Mehrdad ist einverstanden, er will mit ihr zusammenleben.“
Djawid hat gesagt: „Liebesbeziehungen unterliegen bestimmten Gesetzen, wie alles andere auch. Deshalb erkennst du ja, dass diese nicht echt ist.“
Es war kaum Licht im Zimmer. Djawid musste auf einem Stuhl Platz nehmen. Wer Gewichtiges sagen möchte, kann nicht einfach irgendwo hocken, sondern muss aufrecht sitzen und Rückhalt haben.
„Woran denn?“, wollte ich wissen und erinnerte mich an den schummrigen Laden in einem Film, in dem ein Antiquitätenhändler, mit Messlupe vorm Auge, über alte Stücke gebeugt saß, und echte Originale von Fälschungen unterschied.
Djawid hat seine ausgestreckten Beine angezogen und sie unter seinen Stuhl manövriert.
„Am Ende. Du siehst ja, dass alles rausgekommen ist.“
Ich musste lachen. Ich hatte mich zu Djawid nach Hause begeben, um mir von ihm, dem Detektiv, berichten zu lassen, dass die Affäre aufgeflogen war.
Er hat die Arme verschränkt. „Wenn du aufmerksam bist, merkst du’s auch gleich zu Beginn.“
Ich wusste nicht, was ich merken sollte. Ich war müde, ließ den Kopf hängen. „Aber er liebt mich.“
Djawid hat sich von seinem Stuhl aus zu mir gebeugt. „Gefühl ist nicht alles. Zweckdenken spielt die größere Rolle. Wenn jemand von Liebe redet und ,von ganzem Herzen‘ sagt, glaub ihm kein Wort. Das ist die größte Lüge.“
Umso mehr fragte ich mich jetzt, wie sich euer Liebesspiel wohl gestaltete. Früher hab ich mir Djawid immer als den Typ Mann vorgestellt, der seine Frau umarmt und dabei an einen irgendwo einzuschlagenden Nagel oder an den Scheck denkt, den er am nächsten Tag einlösen muss.
Djawid ist aufgestanden, hat mich im Vorbeigehen angestubst, hat „Sei vernünftig, Mädchen!“ gesagt und ist schlafen gegangen.
Ich wünschte die Vernunft indes zum Leichenwäscher. Was bringt mir eure Pseudovernunft. Was bringt sie euch? Sie hat euch bloß geschützt. Und das auch nur äußerlich. Sie hat euch, wie das Gesetz zum Schutz der Umwelt, einen Schonraum verschafft. Ihr habt einander an den Händen gefasst und einfach beschlossen, gemeinsam unter einem Dach zu leben. Mir wird von solch vertraglich geregelter Harmonie kotzübel. Eure Beziehung ist während der letzten sechzehn Jahre zum Werbespot geworden: Stets vernünftig und zufrieden.
Heute Abend aber waren alle Schutzmechanismen außer Kraft. Und für mich ist die Sache jetzt sonnenklar. Auch wenn ich mich von eurer Fassade ja nie hatte täuschen lassen. Ihr wart einander treu, wart rechtschaffen, ehrbar und tausend andere Dinge mehr, aber glücklich wart ihr nicht.
3
Ich höre draußen ein Geräusch. Schaue durchs Fenster in den Hof. Die Nacht ist hell, im Mondlicht ist alles deutlich zu sehen. Der große Samowar auf dem großen Tisch, die Wasserpfeife, halb volle Gläser Tee. Teller mit Obstresten. Forough geht zwischen den Stühlen hin und her, rührt nichts an. Sie setzt sich auf die Treppe, kehrt mir den Rücken zu. Sie wirft sich ein Ende ihres Tschadors über die Schulter, stellt die Kanne Wasser neben sich. Entweder vermutet sie, dass jemand auf der Toilette ist, oder sie will einfach im Hof frische Luft schnappen.
Nachdem alle gegangen sind, deckt Mama den Tisch ab, trägt jeweils zwei Teller gleichzeitig in die Küche. Djawid geht zu ihr nach draußen, sagt, er räumt die Teller ab, und bittet Mama, Yalda und Nima mitzunehmen.
Mama hält Djawids Hilfsangebot für übertriebene Höflichkeit, nicht ernst gemeint. Djawid pflanzt sich vor ihr auf, in voller Größe, beugt sich zu ihr nach unten und schaut ihr ins Gesicht.
„Ich bitte euch, geht“, fleht er. Sein Rausch war verflogen.
Mama deutet auf mich. „Dann bleib du hier“, sagt sie und geht ihre Handtasche suchen.
Und Djawid ist trotzdem nicht glücklich. Wenn er gekonnt hätte, hätte er seine Mutter gleich mit vor die Tür gesetzt. Seit er, mit Frau und Kindern, zu Forough gezogen ist, hat er keine ruhige Minute mehr. Foroughs Anwesenheit hat dem schützenden Kokon um seine Familie einen Knacks versetzt.
„Wallah, meine Güte, ständig hat man Angst, was Falsches zu sagen. Was machen die beiden bloß?“, hat Mama wissen wollen.
„Inzwischen machen sie nichts mehr“, hab ich sie beruhigt, „aber sie kommen aus ihren Parteikreisen und aus ihrem Geheimniskrämerladen einfach nicht raus.“
Während ich und Mama gelacht haben, hast du uns argwöhnisch beäugt. Ihr wart manchmal schlimmer als die Agenten vom KGB. Wenn ihr aus dem Haus gingt, wusste man nie genau, wohin ihr unterwegs wart. Über Leute aus eurem Freundeskreis habt ihr nur geredet, ohne sie namentlich zu nennen. Eure Freunde hatten entweder gar keine oder gleich mehrere Namen. Eure Bücher waren noch immer in Zeitungspapier eingeschlagen. Einer ermahnte den anderen, am Telefon nichts Unüberlegtes zu sagen. Ihr wurdet allem und jedem gegenüber schnell misstrauisch, kamt zu jeder Verabredung pünktlich, wart auf jede Kleinigkeit peinlich genau bedacht, Disziplin und Selbstoptimierung war eure Devise.
Eines Abends, eine Woche nach eurem Einzug bei Forough, kam Djawid unerwartet früh aus der Werkstatt nach Hause. Er ist durch die Diele gegangen, vorbei an Forough, die dort schlief, hat kurz in die Küche geschaut, dich schließlich im Kinderzimmer aufgespürt und gefragt:
„Glaubt sie, sie ist hier im Urwald oder was? Liegt im Flur und streckt wie ein Bär alle Viere von sich.“
Yalda hat noch eins draufgesetzt: „Wir haben von hier aus gesehen, wie Mama Forough mitten im Wohnzimmer lag, Augen zu, und hat sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen, von allen Seiten.“
Und dein Kommentar war: „Ein Bär, der genüsslich an Honig denkt, ist nichts dagegen.“
An dem Abend hat Djawid einen noch passenderen Spitznamen für Forough gefunden. Sie war „Oblomow“. Das weibliche Gegenstück zum berühmten faulen Russen. Mit Lockenpracht und Armreifen, die bei jeder Bewegung, kling-klang, klimperten. Forough verwendete Handcreme und band kleine und große Muttermale an ihrem verschwitzten Hals mit kräftigem Zwirn ab. Im Hof machte sie sich’s gern an einem sonnigen Fleckchen auf einer Decke gemütlich. Bevor ihr hier eingezogen seid, hatte sie einen Studenten als Untermieter, und mit den Nachbarn kam sie gut aus. Ohne deren Hilfsbereitschaft, sagt sie, hätte sie nach dem Tod von Djawids Vater einen der alten Knacker heiraten müssen, die sich um sie bemühten, und von denen nicht einer gesunde Zähne, geschweige denn ein ordentliches Gebiss hatte. Mürrische Miesepeter die einen, lüsterne Spanner die anderen. Einer war ihr allerdings sympathisch, sagt sie.
„Ein feiner Herr, wortgewandt, charmant. Und immerhin war nur die Hälfte seiner Zähne künstlich. Aber seine zittrigen Hände! Allein die Vorstellung, er könnte mich mit seinen Tattergreispatschern begrapschen, einfach widerlich.“
Ein paar Wochen nach eurem Einzug hat die Tochter der Nachbarn dich um Bücher gebeten. Forough hatte ihr offenbar erzählt, dass du eine Leseratte bist, und nun wollte sie Lebensgeschichten lesen. Ein anderer Nachbar hat Tage später Djawids Weg gekreuzt und ihn hinter vorgehaltener Hand gefragt, was es denn Neues gebe von der anderen Seite. Ernst und mit wohlgesetzten Worten, wie es Djawids Art ist, hat er dem Nachbarn erklärt, dass er seine Frage nicht versteht, woraufhin der Nachbar meinte, es sei doch allseits bekannt, dass Djawid sich mit Politik auskenne und wisse, was im Ausland los sei.
Djawid meinte, mit Foroughs losem Mundwerk könne er sich wohl irgendwie abfinden, aber ihr schlechtes Beispiel sei nur schwer hinnehmbar. Yalda durfte sich die Lippen anmalen und Foroughs Kajal ausprobieren. Und von Forough bekam sie ausführliche Antworten auf all die Fragen, die ihr beiden gern aufgeschoben habt.
Als Djawid Yalda eines Morgens beim Frühstück gefragt hat, wie’s mit der Schule vorangeht, hat sie über Physik und Chemie berichtet und dann, mit vollem Mund, über Schwangerschaft und die Wechseljahre. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass er große Augen gemacht hat. So wie vor Jahren, an dem Tag, als Mama Yalda erklärt hat, Erdbeben passieren, weil eine Riesenkuh die Erdkugel auf ihre Hörner nimmt und den Kopf schüttelt. Djawid hat damals seine behaarte, knochige Hand gehoben. „Moment, Schwiegermama.“ Sein spitzer Adamsapfel war reglos verharrt, sein Unterkiefer leicht nach vorn geschoben. „Niemand darf meinen Kindern Bären aufbinden.“