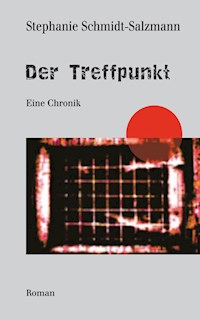
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Da ist ein Paar, wie es ungleicher nicht sein könnte: Er, Dr. Kaspar Fischer, ein sehr von sich selbst überzeugter Genussmensch, so dominant wie borniert und sie, Sabina Karsten, nach ihrer traumatisierenden Kindheit zur Abweichlerin und Außenseiterin geworden, schwierig und unangepasst. Kein Wunder, dass die Beziehung in die Brüche ging. Trotzdem sind die Beiden weiter ineinander verstrickt, und als Sabina plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist wächst in Kaspar die Unruhe. Ganz gegen seine sonstige Gewohnheit macht er sich auf Spurensuche. Eines Tages erhält er einen Brief von Sabina aus Südamerika. Sie bittet ihn, zu ihr zu kommen, um ihn ein letztes Mal zu sehen, bevor sie sich in ein neues Leben aufmacht. Kaspar folgt ihrer Aufforderung und fliegt nach Chile, eine fatale Entscheidung . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephanie Schmidt-Salzmann
Der TreffpunktEine Chronik
Roman
Da ist ein Paar, wie es ungleicher nicht sein könnte: Er, Dr. Kaspar Fischer, ein sehr von sich selbst überzeugter Genussmensch, so dominant wie borniert und sie, Sabina Karsten, nach ihrer traumatisierenden Kindheit zur Abweichlerin und Außenseiterin geworden, schwierig und unangepasst. Kein Wunder, dass die Beziehung in die Brüche ging. Trotzdem sind die Beiden weiter ineinander verstrickt, und als Sabina plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist wächst in Kaspar die Unruhe. Ganz gegen seine sonstige Gewohnheit macht er sich auf Spurensuche. Eines Tages erhält er einen Brief von Sabina aus Südamerika. Sie bittet ihn, zu ihr zu kommen, um ihn ein letztes Mal zu sehen, bevor sie sich in ein neues Leben aufmacht. Kaspar folgt ihrer Aufforderung und fliegt nach Chile, eine fatale Entscheidung . . .
Ein phantastisches Buch. Die Autorin hat das Zeug dazu, unser Leiden an der Welt ertragbar zu machen.
Die Woche, RegensburgEin Rezensent, der Krimi-Schlüsse in die Welt hinausposaunt, gehört gehängt!
Mittelbayerische Zeitung, Regensburgebook Ausgabe 2017
Copyright:© Stephanie Schmidt-Salzmann
Chodowieckistraße 24, 10405 Berlin
www.schmidt-salzmann.de Druck:epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin 2017
Cover:
ISBN:
Printausgabe: Der Treffpunkt, 1. Auflage 1991Karin Fischer Verlag, Aachen 1990ISBN 3-927854-29-8
Ausgerechnet in meiner Küche, wo ich mich am sichersten fühle, ging der ganze Wahnsinn los.
Es war mir ein Anliegen, die Geschichte des hinter mir liegenden Jahres in einer Art Chronik zusammenzustellen.
Jetzt werde ich in den Keller gehen und sie mit allem, was Erinnerungen daran in mir wachrufen könnte, in eine Kiste packen. Vielleicht werden meine Enkelkinder, sollte ich je welche haben, es wieder ausgraben.
27.09.1987, Kaspar Fischer
September
Immer, wenn ich Geschirr spüle oder sonst welchen nichtssagenden Tätigkeiten nachgehe, fällt mir plötzlich Sabina ein. Seit einiger Zeit schaffe ich es einfach nicht, mich bei Hausarbeiten zu entspannen. Im Gegenteil, ich fange an, mich in Grübeleien zu versteigen. Die stummen Selbstgespräche, die ich während meiner Hantierungen führe, münden jedes Mal unweigerlich ins Thema »Sabina«. Zum Beispiel so: »Wie gut, dass ich mich leicht ins Unvermeidliche fügen kann (dreckiges Geschirr, politische Weltlage). Ich bin eben ein bürgerlicher Mensch mit solider bayrischer barock-katholischer Prägung. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr zum Pedanten entwickle.« – Jetzt sehe ich wieder die wütende Sabina vor mir, die mir ihren Vater vormacht, spähend durchs Zimmer schleicht und, wenn sie auf dem Teppich ein Haar oder einen Krümel entdeckt, sich umständlich bückt, um den Fund zum nächstbesten Aschenbecher zu tragen, wo sie ihn so sorgfältig deponiert, als hätte sie ihn aus der Tiefsee geborgen.
Ich muss schon wieder lachen, beim bloßen Gedanken daran! Ich habe es gleich übernommen, bin in meiner Stube herumgegangen und habe Sabinas Vater beim Aufhebespiel gespielt.
Eigentlich habe ich viel Humor. Meine eigenen Schwächen amüsieren mich köstlich. Neulich, ich hatte opulent aufgekocht, sagte doch ein Gast beim Gehen, es wäre sehr nett gewesen bei mir, nur ich hätte ein bissl gestört. Mein Zwerchfell wäre fast zerborsten.
Was habe ich mir nicht alles von Sabina bieten lassen! Gleich nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat sie mich als dicklichen, phlegmatischen Biedermann bezeichnet, nur, weil ich mit ihr in der Küche meiner Mutter Plätzchen backen wollte! Eigentlich unglaublich. Aber meine Verliebtheit in sie und mein Sinn fürs Originelle haben mich darüber hinweggerettet. Allerdings hab ich’s ihr dann genauso gezeigt. Ich kann nämlich auch ganz anders.
Wenn sie mich nicht immer so schikaniert hätte! Ich konnte mich kaum vor einem Stadtpanorama ergehen oder bei der Betrachtung eines Denkmals in Begeisterung geraten, da wurde ich schon ein Schmierenschauspieler aus der Provinz genannt, der einen euphorischen Studienrat darzustellen versucht!
Manchmal kann ich selbst kaum glauben, dass ein Mensch so gutmütig sein kann wie ich.
Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, dann werde ich rabiat. Dann sag’ ich mir: Man darf den Frauen nicht zu viel durchgehen lassen! Agnes ist ja gottlob brav. Jedenfalls meistens. Und immer für mich da. – Diese Sabina! Die blöde Geiß – wo steckt sie nur? So lange hat sie sich noch nie davongemacht, ohne sich bei mir abzumelden. Schon kurios. Ich war bisher einer der wenigen, die sie über ihre Vorhaben informiert hat.
Alles will ich natürlich auch nicht wissen. Überhaupt, wenn es was Unangenehmes ist, weil ich mich dann verpflichtet fühlen müsste, mir Sorgen zu machen.
Ich sorge mich gar nicht gern um jemanden. Bringt ja auch nichts. Jeder soll sich selber helfen, das ist meine Devise. –
Warum hat sie sich in diese Ecke zurückgezogen? Warum hat sie so wenig erzählt? Früher war das anders. Und nie was Vernünftiges zu tun. Wollte nicht. Ist ja ihre Sache, aber ich könnte das unmöglich. Ich muss immer etwas zu tun haben ...
Wenn ich an Sabinas Scheu vor der Hausarbeit denke! Sie hat mir mal gesagt, das Ameisengewimmel in den Geschäften ginge ihr so auf die Nerven, dass sie keine Erdnuss im Kühlschrank hätte. Wie sie sich wohl ernährt hat?
So laufen meine Gedanken im Kreis herum, wenn ich allein bin und mich auf nichts Wichtigeres konzentrieren muss.
Agnes stört das schön langsam auch. Immer öfter paradiere ich zu vorgerückter Stunde, das Weinglas in der Hand, kurz bevor wir ins Bett gehen auf und ab, während sie auf dem Sofa sitzt und mich argwöhnisch beobachtet. Ich versuche auf diese Weise Ordnung in das Sammelsurium von aufkeimenden Ahnungen in meinen Kopf zu bringen. Irgendwann bemerkte Agnes lapidar, ich solle der Sache doch lieber nach-, statt ständig auf- und abzugehen. Sie ist im übrigen die Frau, mit der ich alt werden will, weil sie es geschafft hat, mit mir in einem Grad von Harmonie zu leben wie keine andere zuvor. Schon gar nicht Sabina. Mit der kann man auch in keiner Harmonie leben, sondern nur in Reibung. Wenn ich sie doch endlich beiseite lassen könnte!
Agnes. Agnes hat alles, was meinem Ideal vom Urweiblichen entspricht. Das leicht Spröde an ihr unterstreicht wirkungsvoll ihre Mädchenhaftigkeit. Nicht wie bei Sabina, die durch und durch spröde ist, sondern mit darunterliegender Hingabefreude, ja, mit genau dem richtigen Maß anschmiegsamer Sinnlichkeit und dem dazugehörigen Willen zur Anpassung. Einfach ideal! Sie gibt mir das Gefühl, mich zu brauchen, und das wiederum brauche ich. Ich habe Agnes von Anfang an als reizvolle, artige Pensionatsschülerin gesehen, aber nicht zu artig, damit ich mir vorstellen kann, was ich mit ihr mache, wenn sie ungezogen ist (und dann mache ich es auch). Die Utensilien, die ich dafür benötige, liegen oben auf dem Schrank. – Trotz ihrer Kratzbürstigkeit war Sabina für mich ein rührendes, aus dem Nest gefallenes Vögelchen. Ob das der Grund ist für diesen Zustand, dessen Neuartigkeit mich selbst erstaunt, nämlich eine plötzliche Besorgnis um sie, die doch schon vor Jahren die Frechheit besessen hat, sich mir nichts, dir nichts von mir zu trennen? Ich werde es wohl nie begreifen.
Vor kurzem hab’ ich dann den Entschluss gefasst, ihre Mutter anzurufen, um unter einem Vorwand unauffällig Nachforschungen über ihren Verbleib anzustellen. Ich tat möglichst harmlos, denn Mütter bringen oft genug fürchterliche Lawinen ins Rollen, wenn man sie aufschreckt. Außerdem hatte ich keineswegs vor, tiefer in was hineingezogen zu werden, das mir vielleicht Unannehmlichkeiten bereiten könnte. Herausbekommen habe ich dabei nur, dass Sabinas nächste Angehörige offenbar wenig Interesse für mein verstecktes Anliegen aufbringt. Sie redete recht munter auf mich ein. »Ja, Herr Kaspar, so eine Überraschung!« Dass ich mal anrufe! Wie es mir denn geht? Ob ich immer noch die tolle Stellung habe, bei der ich so viel herumreise? Nein? Ach, eine besserbezahlte Stelle – Forschungsauftrag der Stadt? Gratuliere, ich bin eben ein Glückspilz!
Ihre Tochter? Nein, tut ihr leid, von der hört sie selten. Im Mai war sie nochmal zu Besuch. Nicht sehr erfreulich, der Besuch, aber zu erzählen gibt es nicht viel darüber. Wenn sie sich aufregt, steigt ihr Blutdruck, und sie kriegt Ohrensausen, also keinerlei Aufregung.
So, ein Päckchen habe ich für Sabina? Na ja, das kann ich schon schicken! An Weihnachten wird sie schon wieder auftauchen, es ist immerhin bald Oktober.
Wenn sie halt mal was Gescheites machen würde, aber bei ihr klappt ja nichts. Dabei waren so große Hoffnungen in sie gesetzt worden. »Sie ist eben nicht so glücklich veranlagt wie Sie. Gell, Herr Kaspar, das kennen Sie auch!«
Wenn sie nichts von ihrer Tochter hört, dann wundert’s sie nicht, aber bei mir ... na ja, ist vielleicht ganz gut so, denn Sabina ist oft dermaßen negativ. Bloß kein Ohrensausen!»
Im Alter braucht der Mensch ein Hobby, dann ist er nie allein, gell?« Einen schönen Gruß soll ich meiner Mutter ausrichten. »Die ist ja so vital, bewundernswert!«
Sabina hat auch immer gesagt, sie soll sich nicht in alles hineinsteigern. Also, sie regt sich jetzt überhaupt nicht auf. Mit Sabina war es ja immer schwierig, aber das braucht sie mir wohl nicht extra sagen. »Sie kennen sie ja, Herr Kaspar!«
Sie spielt erst Mal toter Käfer. »Ist meistens das Beste, gell?« Aber wenn ich was höre, soll ich ruhig wieder anrufen. »Auf Wiedersehen, Herr Kaspar!«
Danach ließ ich die Sache eine Weile auf sich beruhen. Wenn ihre Mutter es so sah, konnte es mir schließlich auch wurscht sein. Ich konnte mich in aller Ruhe meiner Arbeit an einem Artikel über die monarchistische Nachkriegsbewegung in Bayern widmen. Gäbe es sie heute noch, ich wäre ihr beigetreten und hätte mich um den Privatsekretärsposten bei Prinz Rupprecht beworben. Das wäre genau der richtige Posten für mich.
Schon in meiner Kindheit haben mir die romantischen Effekte der Geschichte gefallen – die Machtkämpfe zwischen Klerus und profanen Fürsten, das Intrigenspiel am Hof von Versailles, eingefädelt von dunklen Hintermännern und grauen Eminenzen, die in letzter Minute abgesandten Depeschen, Kuriere, die auf schweißnassen Pferden die Allee der Tuilerien hinabsprengen ... Welch ein faszinierendes Szenario meiner privaten historischen Dramen! Wörter wie »Koadjutor«, »Fürstbischof« oder »Kurienkardinal« bereiten mir ein sinnliches Vergnügen.
Ich bedaure immer wieder, in eine so prosaische Zeit hineingeboren zu sein. Wenigstens ist es mir durch meine Arbeit vergönnt, die Faszikelberge der Vergangenheit genussvoll zu durchforsten.
Tagsüber sitze ich über meinen aus dem Staatsarchiv geliehenen Büchern, die Abende verbringe ich mit Agnes. Manchmal überfällt mich, wenn wir nach dem Essen bei Wein, Kerzenschein und Barockmusik zusammensitzen, eine dankbare Rührung über unseren Gleichklang. Agnes ist das einzige weibliche Wesen, dem ich in der Küche eine Könnerschaft zugestehe, die an meine heranreicht, ohne es deshalb als Konkurrenz zu empfinden. Und ich will bei meiner Selbstbetrachtung nichts ausklammern, nein, ich möchte sogar ganz besonders meine sinnliche Seite hervorheben, weil ich auf Agnes nach nunmehr fünf Jahren und dreiundzwanzig Tagen, seitdem ich mich im Restaurant einfach neben sie gesetzt habe, noch genauso scharf bin wie in der ersten Nacht!
Diese erste Nacht war, trotz meiner Trunkenheit, die Initialzündung, ohne die Agnes wohl dasselbe Schicksal beschieden gewesen wäre wie vielen Frauen seit Sabina.
Doch diese Phase meines Lebens ist abgeschlossen. Bin ich nicht inzwischen in einem Alter, in dem ich aufgehört habe, mir ständig beweisen zu müssen, ein für Frauen attraktiver Mann zu sein? Trotz meiner zunehmenden Körperfülle und kleinen, altersspezifischen Gebrechen kann ich der Zukunft beruhigt entgegensehen.
In Zeiten, in denen ich wie jetzt ganz meinem selbstgewählten Gusto lebe, könnte es mir gefallen, unsterblich zu sein.
Wie sich aber herausgestellt hat, ist meine Ruhe nicht so recht stabil. Eigentlich ist gar nichts Besonderes passiert. Am Wochenende habe ich mit Agnes und einem befreundeten Paar einen längeren Spaziergang durch die Ausläufer des Bayrischen Waldes gemacht. Wir sind abends zurückgekommen, gingen zum Essen und danach, auf eine Flasche Wein, ins »Bon Fin«. Als ich mich später zu Hause ins Bett legte, war ich angenehm müde und sehr zufrieden.
Ich schlief sofort ein und mir träumte, ich ginge wieder mit Agnes durch den Wald. Unser Weg führte einen schmalen Pfad entlang, der eine mit felsigem Gestein gefüllte Schlucht säumte. Ich kannte den Weg und wusste, dass unten in der Schlucht ein kleiner Bach war, den man in der Tiefe plätschern hören konnte. Aber ich hörte nichts. Es war so still um mich herum, dass es mir den Atem nahm. Auf einmal war Agnes fort. Immer noch folgte ich dem Pfad, obwohl ich kaum noch vorwärtskam, weil meine Beine sich unter großen Mühen nur unendlich langsam hoben und senkten. Mein Körper dagegen war merkwürdig schwerelos geworden und schwebte, wie ein Luftballon an der Schnur eines Kindes, über den kaum noch beweglichen Beinen. Ich war in zwei Teile zerfallen, deren oberer willenlos am unteren hing. Wo war Agnes?? Den Kopf zu wenden, um mich nach ihr umzusehen, war unmöglich, es zog mich immer tiefer in die lautlose Wildnis hinein. Der Ruf, den ich nach ihr ausstoßen wollte, erzeugte keine Schallwellen, sondern blieb ein unhörbarer Gedanke. Ich hatte nichts mehr unter Kontrolle, selbst meine Augen gehorchten mir nicht mehr. Sie waren starr geöffnet und geradeaus gerichtet. So musste ich vor mir eine Art Lichtung entdecken, auf der eine schemenhafte Gestalt stand und mir zuwinkte. Wer war das? Was wollte sie von mir? Ich lief und lief, aber ich kam nicht von der Stelle. Die Lichtung rückte nicht näher, sie blieb, wo sie war. Mein Herz schlug zum Zerspringen, die Anstrengung wurde zur Angst, ich rang nach Atem, versuchte, um mich zu schlagen ...
Morgens ging mir der Traum noch immer im Kopf herum, so dass ich ihn beim Frühstück Agnes erzählte. Sie knabberte eine Weile nachdenklich an ihrer Semmel herum. Dann fragte sie mich auf halb ironische, halb ernsthafte Weise: »Vielleicht hat das was mit Sabina zu tun?«
»Wie kommst du denn darauf?«
Agnes legte die Semmel weg und zündete sich eine Zigarette an. »Ich weiß nicht, ich hab’ eben so ein Gefühl. Sie beschäftigt dich anscheinend sogar im Traum.«
Das klang leicht gekränkt. Bei Agnes geht so was schnell.
»Wenn der Traum bedeuten soll, du bist auf der Suche nach ihr, dann such sie halt!«
»Das hat mir gerade noch gefehlt! Ich hab’ schließlich noch was anderes zu tun!«
»Jeder hat immer was anderes zu tun. Aber manchmal sollte man vielleicht doch das eine und nicht das andere tun.«
Ich sah schon, Agnes wurde wieder sphinxisch, meinte aber durchaus, was sie mir durch Rauchwolken hindurch sagte.
Wenn man mich direkt oder indirekt zu etwas bewegen will, das mir unbequem ist, und sei es noch so wichtig, dann vergeht mir erst recht die Lust. Ich sagte ihr, dass ich jetzt wirklich keine Zeit hätte, Sherlock Holmes zu spielen, setzte mich an meinen Schreibtisch und fing an zu arbeiten.
Agnes, geschickt wie immer, wartete ab, ohne das Thema nochmals anzuschneiden. Sie sah mich nur hin und wieder an, als sei ich krank. Das war ich auch, in gewisser Hinsicht, wenn »im eigenen Saft zu kochen« eine Krankheit ist.
Am Mittwoch hatte ich nichts weiter zu tun und da hielt ich es nicht mehr aus. Bei meiner Mutter, deren Vertrauensposition ihr die Aufgabe eingebracht hatte, haushüterische Dienste während der Abwesenheit der Besitzerin zu verrichten, nahm ich Sabinas Wohnungsschlüssel an mich. Damit fuhr ich los, entschlossen, mit den Recherchen zu beginnen.
Mir war etwas unbehaglich zumute, als ich das unscheinbare Haus betrat, in dem sie wohnt. Meine Mutter war offensichtlich pflichtvergessen gewesen, denn Sabinas Briefkasten quoll fast über von Rechnungen, Zeitschriften und Reklamebroschüren. Glücklicherweise begegnete mir niemand auf der Treppe, der mir hätte ansehen können, dass mich bei dem, was ich vorhatte, tatsächlich so was wie ein schlechtes Gewissen plagte. Es war zwar nichts Anstößiges dabei, aber Kleinbürgerhäuser lassen mich auf ärgerliche Weise zu einem schuldbewussten Knaben schrumpfen, und ich versuchte, diesem Effekt mit einer betont harmlosen Miene zu begegnen. Die Wohnungstür war doppelt versperrt. Nur mit einiger Mühe brachte ich das alte Schloss auf. Im Flur roch es muffig. Hier war seit Wochen nicht mehr gelüftet worden. Ich durchquerte die Küche und öffnete ein Fenster. Die Zimmerpflanzen, die davor wie verhutzelte alte Weiber in ihren Töpfen hingen, boten einen trostlosen Anblick. Meine saumselige Mutter hatte auch das Gießen grob vernachlässigt.
Auf dem Küchentisch lag ein Haufen ähnlich nutzloser Post wie der, den ich in den Händen hielt. Daneben, in einem Körbchen, bogen sich zwei vergessene Schwarzbrotscheiben vor Trockenheit. Ich schüttelte den Kopf und fragte mich, warum Mutter die nicht weggeworfen hatte. Die locken doch Ratten und Mäuse an! Aber sie nimmt eben nur das mit, was sie noch brauchen kann, genau wie ich. Der Kühlschrank, den ich, meiner Gewohnheit entsprechend, daraufhin inspizierte, war leer bis auf eine Essigflasche und auf ein paar austreibende Kartoffeln. »Typisch Sabina«, dachte ich und warf alles in den Mülleimer.
Ich wanderte durch die Wohnung und stieß auf ihr wie üblich ungemachtes Bodenlager, das sie hartnäckig statt eines Bettes beibehalten hat, und fand, dass es aussah, als hause hier ein Schulmädchen.
Sabina hat immer zur Ärmlichkeit geneigt, ungeachtet ihrer familiären Verhältnisse. Sie hat nie Standesbewusstsein gezeigt. Wenn ich daran denke, in was für Löchern sie gehaust hat, als sie noch studierte! Zum Beispiel der Verhau, in den ich ihr gleich am ersten Abend unseres Kennenlernens gefolgt bin. Damals wohnte sie mit einem anderen Mädchen zusammen, das wenig dazu neigte, nach seinem Einzug noch einen Finger zur Aufrechterhaltung der Ordnung zu krümmen, und Sabina war aus Trotz ihrem Beispiel gefolgt. Alles war zu einem unbeschreiblichen Zustand verkommen, nur ihr Zimmer stellte einen rührenden Hort improvisierter Gemütlichkeit inmitten des Chaos dar. Viele ihrer Möbelchen sind noch da, großzügig in ihrem Domizil verteilt und noch abgenutzter als früher. Wie glücklich war ich damals über meine schnelle Landung in ihrem Nest gewesen!
Ich musste mich gewaltsam aus meinen sentimentalen Betrachtungen losreißen, weil schon ganz schön Zeit vergangen war. Ich beschloss, auch die Topfpflanzen wegzuwerfen. Die waren eh nicht mehr zu retten. Dann sichtete ich die Post auf dem Küchentisch. Es waren kaum persönliche Schreiben dabei. Zwei oder drei geschlossene Briefe von einem U. Philipp aus Hamburg und eine Postkarte von ihrer Mutter, auf der nur die Zeile stand: »Wenn du zurück bist, melde dich doch mal! Gruß, Mama.«
Sie scheint nicht mehr mit vielen Leuten in Korrespondenz zu stehen. Aber so ist das heute. Man telefoniert. Früher haben wir uns wenigstens noch unterhaltsame Briefe geschrieben, hauptsächlich, um den Ärger abzureagieren, den wir uns gegenseitig gemacht haben.
Ich hatte keine Schwierigkeiten mit meiner detektivischen Arbeit, weil ich Sabinas Aufbewahrungsorte für Persönliches kenne. Das Gesuchte befand sich, wie erwartet, in der untersten Schublade ihrer Kommode.
Aufzeichnungen, Briefe (auch meine), Berge von Fotos. Es war mehr als erwartet.
Ich nahm einen dicken Stapel loser, von ihr beschriebener Blätter und steckte ihn in die Plastiktüte, die ich vorsorglich mitgebracht hatte. Aus der Post zog ich die Briefe von U. Philipp als die einzigen persönlichen Zeugnisse jüngeren Datums. Bevor ich die Wohnung wieder verließ, schrieb ich einen Zettel und legte ihn auf den Küchentisch: »Liebe Sabina! Bin aus Sorge bei dir „eingebrochen“. Habe deine Notizen mitgenommen. Man weiß ja nie ... Sollte es unnötig gewesen sein, entschuldige bitte. Die Sachen sind bei mir an einem sicheren Ort. Lass von dir hören, sobald du wieder da bist, du Streunerin! Herzlichst, K.«
Wieder daheim machte ich mir einen großen Milchkaffee. Den Hafen in der Hand, das Kinn in die Hand gestützt, begab ich mich an die Lektüre von Sabinas Blätterwald. Die ersten Seiten trugen die Überschrift »Das Kind«. Warum schreibt sie nicht »Meine Kindheit«? Ich nahm verschiedene Seiten aus dem Stapel heraus und sah mit wachsender Verwunderung, dass sie nur in der dritten Person von sich spricht. Hat sie sich so wenig mit sich selbst befreunden können? Das gibt mir sehr zu denken, und ihr wirres Gekrakel trägt ein Übriges zu meiner Beklommenheit bei. Mag sein, dass ich eben darum eine Art Pflichtgefühl verspüre, es gründlich zu lesen.
Das Kind
Als es noch eines war, lebte das Kind in einem großen, alten Haus, umgeben von einem zauberhaft verwilderten Garten am Rande der Stadt.
Der Wechsel der Jahreszeiten fand im klassischen Sinn des deutschen Volksliedes statt (heute, wo es nicht mehr so ist, kann sie das beurteilen), und mit ihnen änderte sich das Mienenspiel des Gartens, denn er hatte ein Gesicht. Im Frühling spross ihm erstes zartes Grün, und es zeigten sich frische, unschuldige Farben von Schneeglöckchen, Krokus und Ahornblüten in Weiß, Gelb und Blasslila. Voller Kraft, satt und leuchtend stand er im Sommer und strotzte. Doch dann kam der Herbst, um ihn seiner naiven Schönheit zu berauben, zauste seine Blätter, färbte sie von Rot zum Erdigen, riss an ihnen, bis sie fielen. Die Last überreifer Früchte hing ihm schwer an den Zweigen, wenige von ihnen wurden gepflückt, die anderen zerplatzten halbverfault am Boden. Auf den Einzug des Winters mit seinem Leichentuch wartete der Garten als ein mürrisch-grauer, kahler, stachliger Greis. Die umliegenden Gärten ähnelten dem des Kindes, aber er schien ihm der schönste, trug eine schwere, weiße Haube, darin das Kind mit den Eltern, Ullrich, Onkel und Tante und Helene lebte. Man hatte sie ihm vor der Jahrhundertwende aufgesetzt, als er noch gar kein Garten war, sondern von Laub- und Obstbäumen bewachsene Anhöhe, an deren Seiten entlang sich sanft Weingärten hinunterschwangen, bis immer neue Zuzöglinge kamen, denen sie weichen mussten. Inmitten von abgrenzenden Hecken und Stauden wurden phantastische, ihren Besitzern angemessene Wohngebilde in die Höhe gerichtet.
Der Garten hatte einen Lattenzaun, vor dem die Blutbuche ihre Röcke ausbreitete. Dahinter lugte das wunderlich verspielte Häuschen der Nachbarn des Kindes hervor. Sie hießen Märzwieser. Das waren seine besten Freunde, besonders Julius, weil er genauso alt war wie das Kind, gemeinsam mit ihm im Wägelchen gelegen hatte, bevor zusammen die ersten, unsicheren Schrittchen probiert wurden. Märzwiesers waren ein Glücksfall. Ihre Fähigkeit, in allen Dingen Geduld und Ruhe walten zu lassen, bewährte sich besonders in Erziehungsfragen und war um so ungewöhnlicher, als in den Bücherschränken ordentlicher Elternpaare das Werk »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« zurückgeblieben war. Dieses unverbrüchliche Kulturgut war bei Märzwiesers nicht zu finden, dafür bunteste Unordnung von Requisiten für wunderbare Spiele, durch die ein Zoo von frei herumlaufenden Haustieren krabbelte.
Eine alte Truhe barg die Jugendgarderobe der uralten Großmutter Märzwieser, aber auch Caplumba hockte gepanzert darin vor einem von Julius hineingestreuten Haufen Salatblätter. Die schwimmenden Artgenossen der Schildkröte paddelten in der Badewanne durcheinander. Julius fand, dort sei es ihnen nicht so langweilig wie in ihrem engen Aquarium. Er hatte auch fürsorglich den Wäscheschrank geöffnet, damit das Hamsterpärchen bei seinem Versuch einer Senkrechtbesteigung in den Bügelfalten Tritt finden konnte, während sich der Hase Mümmel mit beiden Nagezähnen dem Lampenkabel widmete. Das Telefonkabel hatte er schon mehrfach erfolgreich bezwungen, was von den Eltern Märzwieser ergeben hingenommen worden war. Die chinesischen Tanzmäuse hingegen hatten es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie in ihr Glasgehäuse verbannt blieben, nachdem sie einmal einen Ausflug zu Frau Harms in die Küche und von dort aus weiter in die Speisekammer gemacht hatten, mit schrecklichen Verheerungen als Folge.
Im Badezimmer, wo er sein Bett stehen hatte, saß Julius an einem strategisch günstigen Punkt auf dem Boden und überschaute sein Reich. Auch im angrenzenden Schlafzimmer der Großmutter durfte er nach Belieben schalten und walten, solange die Eltern arbeiteten, denn sie wurde derweil von Frau Harms beaufsichtigt oder in den Wintergarten gesetzt. Die um ihn herum verstreuten Spielsachen interessierten ihn nur mäßig, obwohl er unübersehbare Mengen von Bauteilen seiner elektrischen Eisenbahn das ganze Jahr über zu architektonischer Verfügung hatte.
Er war von unbezähmbarer Art, ausgestattet mit dem Bewegungsdrang, der Geschicklichkeit und den Instinkten eines nervösen Raubtiers, und so blieb es die vergebliche Hoffnung der Erwachsenen, ihn einer stillen Beschäftigung im Hause zuzuführen. Bei schlechtem Wetter hütete er nur widerwillig das Zimmer. Bald tobte er auf Handflächen und Fußsohlen hinter dem Hasen her, stieß dabei unartikulierte Laute aus und äußerte auf Befragen, er sei ein Affe, der ein fremdes Tier aus seinem Revier verjagen müsse.
Die Eltern, in solchen Fällen aus dem unteren Stockwerk herbeigeeilt, wo sie ihrem Arztberuf nachgingen, mahnten ihren Sohn mit gezügeltem Ernst zu etwas mehr Ruhe. Der Hase, so erklärten sie, auf den in einer Ecke zusammengekauerten Mümmel deutend, werde noch am Herzschlag sterben. Ernste Anzeichen dafür seien schon vorhanden: angelegte Löffel, schreckensstarre Knopfaugen und Nasenflügelhüpfen. Julius zeigte sich einsichtig. Sobald die Eltern wieder unten waren, ging er das Kind und Ullrich holen, damit sie die Rolle des Hasen übernähmen.
Jedermann war daher erleichtert, wenn die drei ihre Energien im Freien loswerden konnten. In der Latschenkiefer sah man sie von Ast zu Ast springen, in der Bemühung, ein Eichhörnchen zu fangen. Sie hingen an einer Kniekehle in der Krone der Kastanie, bewarfen von der hohen Gartenmauer aus ihre Straßengefährten mit unreifen Birnen oder benutzten die Trambahn dazu, ihre Todesverachtung zur Schau zu stellen, indem sie sich auf die Schienen legten und das sich unter wütendem Gebimmel nähernde Ungetüm zum Anhalten zwangen. Derlei machte sie im Umkreis von einem Quadratkilometer berühmt.
Die Mutproben, die Julius von ihm verlangte, erfüllte das Kind immer getreulich. Eines Tages entdeckten es seine Eltern in schwindelnder Höhe, wo es auf der handbreiten Dachrinne der dreigeschossigen Villa hinter dem Nachbarsjungen herbalancierte. Ullrich, noch zu klein für diese Unternehmen, stand heulend auf dem Küchenbalkon. Die Hausumrundung fand ein jähes Ende durch lange Arme, die sich aus einem geöffneten Fenster streckten und die beiden Akrobaten hereinzogen.
Julius entfloh dem hinter ihm her gellenden Schimpfen in sausender Fahrt auf dem Treppengeländer, wobei ihm Kläfflaute entfuhren, deren imitatorische Qualität die Tirade noch steigerte und dem Kind eine Tracht Prügel bescherte.
Dennoch konnte Märzwiesers und ihren beiden schon fast erwachsenen Kindern die redliche Bemühung nicht abgesprochen werden, Julius und seinen zwei Anhängseln auch die Errungenschaft der Kunst- und Geisteswelt nahezubringen. Auf dem alten Klavier, dessen Platz in der Diele war, erlernte das Kind unter der Anleitung verschiedener Familienangehöriger den Flohwalzer, abgelöst von Julius. Dem war der Flohwalzer indessen herzlich egal. Er zog vor, im Stil der neuesten musikalischen Entwicklung mit beiden Händen auf die Tastatur einzuschlagen.
Ullrich tat es ihm nach, war doch Julius sein großes Vorbild, anders als das Kind, an dem er wenig Nachahmenswertes fand.
Der große Bruder zeigte den drei Ahnungslosen ungeheuer gelehrte Bücher. Die brauchte er für eine furchtbar schwere Prüfung. Für so etwas würden sie immer zu dumm bleiben, auch für Englisch oder Französisch. Julius machte das nichts aus, er hatte sowieso das andere Buch viel lieber, das von Frau Harms. Er konnte gar nicht genug davon bekommen. Immer, wenn sie mit dem Vorlesen zu Ende war, drehte er es ihr in den Händen um, und sie musste wieder von vorne anfangen mit der »Geschichte vom kleinen Prinzen«.
Abends waren die Eltern mit der Arbeit fertig, was hieß, dass Julius die Inbetriebnahme des Schallplattenapparates verlangte. Er hatte eine eigene Platte mit Namen Peter und der Wolf. Jedes Mal verging er in derselben Angst, wenn Peter dem Wolf begegnete, denn eines Tages würde der Wolf ihn bestimmt fressen. Es schien, als ob Julius diesen Tag nicht versäumen wollte, damit das bange Warten ein Ende hätte.
Zur Beruhigung spielte Herr Märzwieser anschließend noch zwei Lieder. Das erste sang der Sänger langsam und traurig, weil er wollte, dass seine Liebste ans Fenster käme, aber sie ließ sich nicht rühren, obwohl der Mann sogar vom Tod bedroht war deswegen. Im zweiten sang er plötzlich sehr schnell und freute sich wie toll, auch diesmal wegen eines Mädchens, wohl eines anderen, das in einem Garten und auf einem Fest erscheinen sollte. Nach diesem Lied musste das Kind mit Ullrich zum Abendessen nach Hause gehen.
So gesehen war sie voller Abenteuer und wiederkehrender Freuden, die Kinderzeit. Pünktlich im Jahr kamen die Maikäfer. Sie purzelten von den Bäumen und krochen zuversichtlich in die von Julius aufgestellten laubgefüllten Kartons. Über ihnen schlossen sich die Deckel, um erst auf der Sonnenterrasse vor dem Wohnzimmer des dritten Stockwerks der Villa geöffnet zu werden. Ein dünnes Terzett setzte ein und sang: »Maikäfer, flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt ...« Und die Maikäfer pumpten mit aller Kraft Luft in ihre schweren Panzerkleider, bevor sie in den blauen transparenten Äther abhoben und gewichtig losbrausten. Die Kinder sahen dem Geschwader hinterher, wie es sich auf eine Art Sinkflug begab, als wollte es unten in der Stadt auf einem geheimen Maikäferflugplatz landen, den die Kinder dort vermuteten, wo es noch immer halbverfallene Häuser auf leerem Strauchgelände gab.
Ein paar Jahre später ereignete sich etwas, das die Erwachsenen »Wirtschaftswunder« nannten. Die Stadt kaufte die Grundstücke, und alle Anwohner verließen ihre Häuser. Märzwiesers waren schon geraume Zeit weggezogen. Auch die alte Villa musste geräumt werden. Jeder packte sein Hab und Gut, um abzuwandern. Onkel und Tante zogen in die entgegengesetzte Richtung wie das Kind mit Eltern und Bruder. Wenige Wochen später hatte die Anhöhe mit allem, was darauf war, aufgehört zu existieren. Trassen für eine vierspurige Schnellstraße wurden gelegt. Sie sollte von der Autobahn direkt ins Zentrum der Stadt fuhren. An ihren Rändern entstanden »Wohneinheiten« aus einem Gemisch von Grobkies und Beton, die sich hochtürmten wie schmutzgraues Gerümpel. Davor und dazwischen blieben bettlakengroße Grünflächen, das Gras darauf sprießt noch heute, dürftig und militärisch kurz geschoren. Der Kindheit war ein Ende gesetzt, diesem Bilderbuch voll froher Geschichten, – jetzt drängt es, noch einmal genauer hinzusehen...
Abends, das Kind lag schon im Bett und wartete auf die lange Nacht, die nun beginnen sollte, beobachtete, wie der Lichtschein, der aus dem erleuchteten Flur durch den Spalt der angelehnten Tür in sein Zimmer fiel, sich immer deutlicher am Boden abzeichnete, das Kind also, dessen einziger Trost diese Vergünstigung war, weil es sich im Dunkeln allein so sehr fürchtete, hatte es sich seit einiger Zeit angewöhnt, vor dem Einschlafen Beschwerdebriefe an den lieben Gott zu schreiben.
Wie so oft hatte der Tag hingereicht, um den Stoff für den ausführlichen Vorwürfekatalog, den das Kind selbst über sich hatte ergehen lassen müssen, weiterzureichen zu dem alten Mann da oben, von dem man ihm immer erzählte. Die Briefe schrieb es nur in Gedanken, denn es konnte noch nicht wirklich schreiben oder lesen und ursprünglich war ihm eingeschärft worden, es solle vor dem Schlafengehen beten, damit der liebe Gott sich seiner erinnere und ihm helfe. Das Kind wusste aber nicht, wie das geht, beten, und den lieben Gott dachte es sich als gebrechlichen Zausel in einem langen weißen Nachthemd mit wallendem Bart, über den er, wenn er in den Wolken wandelte, hin und wieder stolperte.
Viel Vertrauen hatte es ohnehin nicht zu ihm, denn er war so vergesslich und tat nie, um was es ihn für den nächsten Tag am Abend zuvor gebeten hatte, vielleicht hörte er noch nicht einmal richtig zu, sondern machte es wie die Mutter, die auch immer aus dem Zimmer ging, wenn es sie etwas fragte, oder anfing, mit Helene, dem Kindermädchen, zu reden. Helene war die einzige, die ihm Antworten gab, und von ihr stammte der gute Rat, es doch einmal mit dem lieben Gott zu versuchen, der sowieso für alles Schwierige zuständig wäre. Aber irgend etwas machte es dabei falsch, und es fand sich niemand in der ganzen Familie, der wusste, wie es richtig geht. Vielleicht wäre das Vernünftigste gewesen, gleich zum Großvater zu beten, der fast so alt wie der da oben im Himmel und für alle, die ihn kannten, viel wichtiger war als der liebe Gott. Der Großvater wusste und konnte alles, aber den Mut, ihm als dem Tüchtigeren die Allmacht anzuvertrauen, hatte das Kind doch nicht, weil es sich nicht sicher war, ob der andere, der schweigsame Heimlichtuer, es dafür bestrafen würde, aus Wut darüber, dass es aufgehört hatte, zu glauben, er werde ihm doch einmal helfen, wenn es erst gelernt hätte, richtig zu beten. Es versuchte deswegen immer wieder und immer missmutiger sein Glück, ihn zu einer Reaktion zu bewegen:
Lieber Gott!
Entschuldige, dass ich nicht richtig beten kann, aber kannst du mir nicht trotzdem helfen und machen, dass mir niemand mehr weh tut? Heute hat mich meine Mama so an den Haaren gerissen, dass mein Kopf ganz schief in der Luft stand. Ich habe mich an dem Griff am Fenster festgehalten, damit ich nicht umfalle. Sie hat nicht aufgehört und immer weiter gerissen, weil sie wollte, dass ich ihr sage, was wir auf dem Geburtstagsfest von Martina gemacht haben, dabei haben wir gar nichts Böses gemacht. Ich hab ’ ihr gesagt, wir haben was gemacht, aber ich kann ihr nicht sagen, was, weil ich mich geniert habe, ihr zu sagen, dass wir uns als Prinzessinnen verkleidet haben und uns die Lippen rot angemalt haben, weil man sowas erst macht, wenn man groß ist. Eigentlich wollte ich es ja erzählen, aber dann hab’ ich mich auf einmal doch nicht getraut, weil sie gleich so geschrien hat, ich soll es ihr sofort sagen, und da hab’ ich Angst gekriegt. Und da hat sie angefangen, mich an den Haaren zu reißen, damit ich es sage, aber da wollte ich es erst recht nicht mehr sagen. Lieber Gott, mein Kopf tut so weh, aber ich hab’ es ihr trotzdem nicht gesagt: Bitte, mach dass mein Kopf nicht mehr weh tut! Mach’, dass sie mich nichts mehr fragt, weil ich ihr jetzt nichts mehr, gar nichts mehr sage!
Lieber Gott!
Bitte mach’, dass ich nicht wieder ins Kinderheim muss. Es ist so schlimm im Kinderheim, immer muss man im Bett bleiben und schlafen und darf nicht aufs Klo. Die Kinder machen ins Bett, und dann nehmen sie mir meinen Schlafanzug weg, weil sie ihren nassgemacht haben. Ich muss mich immer mit den Händen unten zuhalten, damit ich nicht auch ins Bett mache, weil ich auch immer so dringend muss, aber vor jedem Zimmer sitzt eine Tante und passt auf, dass wir nicht aufstehen und nicht reden. Manche Kinder machen ganz leise ins Zimmer, weil sie es nicht mehr aushalten, und manche machen ins Bett, und dann müssen sie im Nassen liegenbleiben, bis der Mittagsschlaf vorbei ist. Wenn die Tanten es merken, schimpfen sie einen, und man darf am Nachmittag nicht hinaus ins Freie. Abends muss man Haferschleim essen, der schmeckt ganz scheußlich! Der Onkel und die Tante, denen das Heim gehört, sind nicht nett, und alle Kinder wollen nach Hause, aber sie dürfen nicht. Man muss Onkel und Tante zu ihnen sagen und so tun, ab wären sie lieb, aber sie sind gar nicht lieb! Wenn die Kinder nicht selber schreiben können, schreiben immer der Onkel und die Tante und sagen, dass es einem da gut gefällt, dabei stimmt es gar nicht! Wenn die Kinder selber schreiben können, müssen sie auch schreiben, »es gefällt mir hier sehr gut«, weil sonst die Tante den Brief zerreißt. Lieber Gott, ich war doch schon zweimal im Kinderheim, bitte mach’, dass ich nicht mehr hin muss! Meine Mama sagt, ich muss ins Kinderheim, weil ich ihr nicht folge. Sie will mich nur loshaben.
Lieber Gott!
Ich hab’ solche Angst, dass meine Mama mit mir in die Kirche geht, damit ich umfalle. Du weißt doch, dass ich nicht nach oben schauen kann, weil mir dann immer so schwindelig wird. Sie sagt immer, wenn ich nicht brav bin, geht sie mit mir in die Kirche. Einmal bin ich schon umgefallen, die ganze Treppe runter, wie mich Märzwiesers am Sonntag mit in die Kirche nehmen wollten. Ich hab’ nach oben geschaut, und dann hat sich alles gedreht, und weil ich gleich rückwärts umgefallen bin, wollte ich nicht mehr in die Kirche rein. Märzwiesers wollten mir in der Kirche bestimmt zeigen, wie man richtig betet, und jetzt kann ich ’s immer noch nicht, weil ich nicht in Kirchen rein kann. Meine Eltern haben gesagt, dass du da drinnen wohnst und jetzt bestimmt böse bist. Entschuldige, lieber Gott, aber ich verstehe nicht, wie du in so was wohnen kannst. Muss man dahin, um dich zu besuchen? Hörst du mir nicht zu, weil ich dich nicht besuche?
Aber sie wollen ja gar nicht, dass ich dich besuche, sie wollen nur, dass ich umfalle, wenn ich nicht folge.
Lieber Gott!
Warum muss ich bei meinen Eltern wohnen, warum kann ich nicht zu Märzwiesers oder zu Tante Nina und Onkel Kurt? Hier hauen mich alle und keiner mag mich. Märzwiesers haben mich lieb und sind nett.
Mein Papa ist die ganze Woche nicht da. Wenn er heimkommt, ist er müde. Immer will er seine Ruhe haben, und wir müssen leise sein und dürfen nichts sagen.
Manchmal, wenn wir meine Mama geärgert haben – meistens ich, findet sie jedenfalls, aber sie kann mich ja auch nicht leiden –, sagt sie zu meinem Papa, er soll uns verhauen, wenn er zur Tür reinkommt. Er sagt uns dann nicht Grüßgott, weil er uns ja verhauen muss.
Sag mal, lieber Gott, warum macht er das? Meine Mama muss es ihm nur sagen, aber manchmal muss sie auch ganz schön lange ein Gesicht ziehen, dann geht er mit uns, meistens mir, ins Esszimmer. Da holt er den Rohrstock vom Schrank runter, und wir müssen uns bücken, meistens ich. Dann haut er uns auf den Po. Es tut so weh! Immer muss ich laut schreien. Wenn Ullrich gehauen wird, aber er wird nicht so oft gehauen wie ich, schreit er noch viel lauter, und dann tut er meiner Mama leid. Ich nicht.
In der Familie des Kindes herrschen, rein äußerlich betrachtet, erfreuliche Verhältnisse. Seit Generationen, egal, von welchem Zweig der Sippe aus betrachtet, war solider Besitzstand vorhanden. Wie es als normal galt, bestand die Familie aus vier Mitgliedern, mehr wären nicht standesgemäß gewesen: dem Vater, der Mutter, Ullrich und dem Kind. Den Spielregeln des Wohlstandes gemäß wurde eine Hausgehilfin gehalten, die für Kinder und Küche zuständig war. In den Augen des Kindes und wohl noch mehr von Ullrichs Warte aus, fiel aber auch die Gestaltung des Familienlebens, sofern etwas Ähnliches stattfand, in ihr Ressort. Natürlich wurde die gute Helene keineswegs dazugezählt und aß in der Küche.
Das Kind und Ullrich hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten Fahrräder und Skier, Roll- und Schlittschuhe, Flossen und Taucherbrillen, Puppen mit blondem und schwarzem Haar, Steifftiere in allen Größen und ein Schaukelpferd, um das sie sich stritten. Helene kochte Spaghetti mit Tomatensauce, wenn Ullrich danach verlangte. Während ihrer Sonntagsnachmittagsbesuche bei der Großmutter drückte diese den Kindern Geld für Mohrenköpfe in die Hand.
Waren sie aber miteinander allein, dann dauerte es nicht lange, bis sie ihre Spielsachen langweilten und sie sich in die Haare gerieten. Die handgreifliche Auseinandersetzung war, genaugenommen, ihre einzige Umgangsform miteinander. Das Kind hatte sich deswegen schon früh andere Kameraden gesucht, die ihm nicht andauernd wegnehmen wollten, was es für sich beanspruchte, und Ullrich als der Kleinere musste sich anschließen, wollte er nicht allein Zurückbleiben mit all den Dingen, auf die er keinen Wert mehr legte, sobald das Kind fortging.
So wurden sie beide zu Nestflüchtern, denen Helene kummervoll, die Mutter ärgerlich aus dem Fenster gebeugt, hinterhersahen.
Mit der Zeit verloren sie sogar den Dialekt, den ihre Eltern sprachen, und tauschten ihn ein gegen eine undefinierbare Sprechweise, weil es ihnen nicht gelang, auf das akzentfreie Hochdeutsch der Märzwiesers umzusteigen.
Mutter und Vater gewöhnten sich daran, die Kinder nur noch bei den Mahlzeiten zu sehen, und diese an das oft ausgiebige Warten vor der geschlossenen Haustür ihrer Ersatzfamilie oder an die lange Suche von Julius in der Nachbarschaft.
Es gab Ereignisse, durch die die Kinder kontrastreich erfuhren, wie gegensätzlich die Spielregeln ihrer beiden Familien waren. Eines geschah am Palmsonntag.
Bei Märzwiesers war es der Brauch, an diesem Tag den Palmesel aus dem Bett zu peitschen. Dazu wurde ein Sprüchlein aufgesagt, das in etwa lautete: »Pitsche-patsche, Domine, Palmesel, spring in die Höh!« Der Palmesel, zur Strafe, weil er so lange geschlafen hatte, wurde kräftig mit der Haselgerte bearbeitet.
Naturgemäß waren es die Eltern und später sie und die größeren Geschwister, die den Palmesel abgaben, weil die Kleinen schon im Morgengrauen hellwach waren, erwartungsvoll auf ihre Haselruten schielten, und, wenn sie es nicht mehr aushielten, jubelnd das elterliche Schlafzimmer stürmten. So war es seit je, und so wurde es weiter gehalten, und wer als letzter auf die Beine kam, musste den ganzen Tag Palmesel sein. Julius hatte den Geschwistern begeistert davon erzählt. Sie bettelten so lange, bis er ihnen mit dem Einverständnis seiner Eltern versprach, sie dürften das nächste Mal mitmachen.
Welch eine Aufregung! Am Tag zuvor brachen sie sich im Garten Haselzweige vom Strauch, in der Nacht konnten sie aus lauter Vorfreude kaum schlafen. Hoffentlich würde Julius sie nicht im Stich lassen!
Das Kind schlief ein, sehr spät, ohne es zu wissen. Und es kam zu sich, ohne es zu wissen, genau dann, als Julius’ Steine gegen das Fenster klickten. Einen Moment überlegte es, ob es Ullrich wecken sollte, die Gelegenheit wäre günstig gewesen, ihm manches heimzuzahlen, aber im Schlaf konnte er so unschuldig aussehen, dass selbst seine jüngsten Untaten nicht mehr ins Gewicht fielen. Der kleine Bruder wurde unsanft geweckt, und zuerst schien es, als wolle er anfangen, wütend zu greinen. Das Kind rüttelte ihn und raunte ihm zu: »Du weißt doch, pitsche-patsche, also komm! Ich geh’ jetzt, Julius hat die Steine geworfen.« Ullrich, mit weinerlichem Gesicht, aber entschlossen, versuchte, sich etwas anzuziehen, was misslang. Das Kind stülpte ihm ungeduldig den Bademantel über. In seltener Eintracht schlichen sie leise über den Flur und die Treppe hinunter. Mit Julius gemeinsam zogen sie zum Nachbarhaus. Dort war alles still. Julius’ Bett stand im Badezimmer, da seine beiden älteren Geschwister eigene Zimmer brauchten. Er war auch ein zu unruhiger Geist, fand Frau Harms, die es wissen musste, weil sie schon seit Jahrzehnten den Haushalt der Märzwiesers führte.
»Soll’n wir gleich anfangen?« fragte Ullrich mit ängstlicher Stimme. Julius nickte. Zuerst würden die Eltern drankommen, dann seine Schwester und zuletzt der große Bruder, der sie immer so bös gekitzelt hat, bis sie brüllten, es gar nicht mehr lustig fanden und ihm aus dem Weg gingen, wo sie konnten. Dafür sollte er Palmesel werden, dann konnte man ihn ungestraft noch den ganzen Tag ärgern und mit der Rute nach ihm hauen. Julius blies zum Angriff. Noch nie hatten die Geschwister so etwas getan, noch nie einen solchen Lärm vollführt, schüchtern anfangs, dann immer selbstsicherer, weil die Gesichter unter den Plumeaus keineswegs böse, sondern gutmütig-erschrocken hervorblinzelten. Noch nie war ihnen ein solcher Sieg über die Großen gelungen! Sie waren vollkommen glücklich, als schließlich alles vorbei war und der verschlafene große Bruder von den übrigen Beteiligten feierlich zum Palmesel erklärt wurde. Im Hochgefühl ihrer neugewonnenen Kräfte rannten sie stolz nach Hause zurück.





























