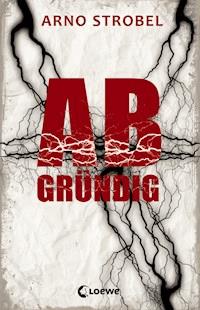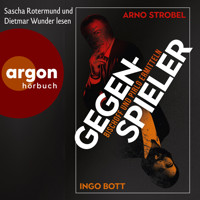9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit zwei Jahren wartest du auf ein Lebenszeichen von deinem Bruder. Sein Wohnmobil-Trip sollte unvergesslich werden. Aber seither keine Spur von ihm. Bis die Morde geschehen … Der neue Psycho-Thriller von Nr.1-Bestseller-Autor Arno Strobel Evelyn Jancke ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, seit ihr Bruder Fabian zwei Jahre zuvor auf einem Wohnmobil-Trip spurlos verschwand. Es gibt kein Lebenszeichen von ihm, die Ermittlungen wurden eingestellt. Allein ihre Arbeit als forensische Psychologin hält Evelyn aufrecht, vor allem, als die Oldenburger Polizei um ihre Mithilfe bei einer Mordserie bittet. Im norddeutschen Raum tötet ein Unbekannter scheinbar wahllos Menschen auf Campingplätzen. Er kommt immer nachts und verschwindet unerkannt wieder. Bis es einen Zeugen gibt. Und daraufhin ein Phantombild. Evelyn traut ihren Augen nicht, als sie es sieht. Und fasst einen verzweifelten Entschluss, der sie alles kosten könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Arno Strobel
Der Trip
Du hast dich frei gefühlt. Bis er dich fand.
Psychothriller
Über dieses Buch
Evelyn Jancke ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, seit ihr Bruder Fabian zwei Jahre zuvor auf einem Wohnmobil-Trip spurlos verschwand. Es gibt kein Lebenszeichen, die Ermittlungen wurden eingestellt. Allein ihre Arbeit als forensische Psychologin hält Evelyn aufrecht, vor allem, als die Oldenburger Polizei um ihre Mithilfe bei einer Mordserie bittet. Im norddeutschen Raum tötet ein Unbekannter scheinbar wahllos Menschen auf Campingplätzen. Er kommt immer nachts und verschwindet unerkannt wieder. Bis es einen Zeugen gibt. Und daraufhin ein Phantombild. Evelyn traut ihren Augen nicht, als sie es sieht. Und fasst einen verzweifelten Entschluss.
»Was Arno Strobels Thriller so unverwechselbar macht: eine Atemlosigkeit der Handlung, die sich unweigerlich auf den Leser überträgt.« Express
»Chapeau! Genau so müssen Thriller geschrieben werden.« Kölner Stadt-Anzeiger
»Arno Strobels digitaler Horror ist präzise durchdacht.« STERN Crime
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arno Strobel liebt Grenzerfahrungen und teilt sie gern mit seinen Leserinnen und Lesern. Deshalb sind seine Thriller wie spannende Entdeckungsreisen zu den dunklen Winkeln der menschlichen Seele und machen auch vor den größten Urängsten nicht Halt.
Seine Themen spürt er dabei meist im Alltag auf und erst, wenn ihn eine Idee nicht mehr loslässt und er den Hintergründen sofort mit Hilfe seines Netzwerks aus Experten auf den Grund gehen will, weiß er, dass der Grundstein für seinen nächsten Roman gelegt ist. Alle seine bisherigen Thriller waren Bestseller, »Offline«, »Die App« und »Fake« standen wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste.
Arno Strobel engagiert sich für den Opferschutz und ist Förderer des Weißen Rings e.V.
Er lebt als freier Autor in der Nähe von Trier.
www.arno-strobel.de
www.facebook.com/arnostrobel.de
@arno.strobel
Außerdem bei FISCHER Taschenbuch erschienen:
»Der Trakt«, »Das Wesen«, »Das Skript«, »Der Sarg«, »Das Rachespiel«,» Das Dorf«, »Die Flut«, »Im Kopf des Mörders – Tiefe Narbe«, »Im Kopf des Mörders – Kalte Angst«, »Im Kopf des Mörders – Toter Schrei«, »Offline«, »Die App«, »Fake«, »Stalker«, »Mörderfinder – Die Spur der Mädchen«, »Mörderfinder – Die Macht des Täters«, »Mörderfinder – Mit den Augen des Opfers«, »Mörderfinder – Stimme der Angst«, »Mörderfinder – Das Muster des Bösen«
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Bei Erfahrungen mit Gewalt oder Missbrauch können manche Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Wenn es Ihnen damit nicht gut geht, finden Sie hier Hilfe: www.hilfetelefon.de oder www.weisser-ring.de.
Redaktion: Ilse Wagner
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: unter Verwendung von Motiven von Shutterstock
ISBN 978-3-10-491661-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Der spannendste Trip ist der Trip zu sich selbst; alles andere sind Ersatzreisen.
Ute Lauterbach, Autorin
Prolog
Er hockt zusammengekauert vor der Bretterwand auf dem feuchten Boden. Die Beine hat er angezogen, die Arme um die Unterschenkel geschlungen, den Kopf gesenkt. Um seine Schultern hat er die stinkende, schwere Decke gelegt, mit der er sich nachts auch zudeckt. Er friert nicht, es ist Sommer, aber der Druck des harten Stoffs auf seinen Schultern gibt ihm zumindest die Ahnung einer Berührung, vor der er nicht weglaufen möchte.
Er wiegt sich leicht hin und her, als bewege er sich zu einer Musik, die nur er hören kann. Seine Augen sind geöffnet, doch er sieht nichts von dem Schmutz um ihn herum und den Essensresten, die hier und da auf der festgetretenen Erde liegen. Sein Blick ist nicht auf Dinge gerichtet, sondern in eine andere Zeit. Als er noch bei seiner Mama und seinem Papa sein durfte. Ohne die immer präsente Furcht. Glücklich.
Er weiß nicht mehr, wie es ist, keine Angst zu haben. Er weiß nicht, wie lange es her ist, dass er zum letzten Mal gelacht hat. Er hat keine Vorstellung davon, wie oft sie seitdem gekommen sind und ihn geholt haben.
Meist kommen sie zu zweit, Karl und Otto, manchmal auch nur einer von ihnen. Karl ist ein großer Kerl mit vielen Falten, der schlimm aus dem Mund stinkt. Otto ist kleiner und dick. Alles an Otto ist eklig weich und teigig. Alles. Er weiß das.
Als sie ihn das erste Mal aus der Grube gezogen und in das Wohnmobil gezerrt haben, da hat er noch gehofft, er darf wieder zurück zu Mama und Papa. Das war, kurz nachdem sie ihn auf dem Nachhauseweg von seinem Freund Kai in ihr Auto gezerrt hatten.
Aber sie haben ihn nicht gehen lassen.
Otto hat ihm ein Messer mit einer langen, blitzenden Klinge gezeigt und zu ihm gesagt: »Wenn du schreist oder nach Hilfe rufst, werde ich dir damit den Bauch aufschneiden. Und dann fahre ich zu euch nach Hause und schlitze deiner Mama und deinem Papa den Bauch auf. Hast du das verstanden?«
Er hatte es verstanden. Er hatte es geglaubt. Und er glaubt es bis heute.
Sie haben in diesem Wohnmobil Dinge mit ihm gemacht und ihn gezwungen, Dinge zu tun. Unaussprechliche Dinge.
Nach einer endlos langen Zeit haben sie ihn zurückgebracht in die Grube und die Falltür geschlossen. Dann hat er dagesessen und versucht, nicht an die pochenden Schmerzen zu denken. Und er hat sich geschämt. So sehr wie noch nie zuvor in seinem kurzen Leben.
In diesem kalten, feuchten Erdloch, das an den Wänden notdürftig mit groben Brettern ausgekleidet ist, hat er schnell das Gefühl für die Zeit verloren. Er hat viel geweint in den ersten Tagen. Lautlos. Nach innen. Trotz der Schmerzen und der Scham und der Angst.
Wann immer er es nicht unterdrücken konnte und ein Schluchzen über seine Lippen kam, hat er sich angstvoll zusammengekrümmt, sich verzweifelt in die zur Faust geballte Hand gebissen und gehofft, dass Karl und Otto es nicht gehört haben. Dass sie nicht kommen und ihm den Bauch aufschneiden würden. Oder, noch schlimmer, zu seiner Mama und seinem Papa nach Hause fuhren und ihnen den Bauch aufschnitten. Er war sicher, dass sie das tun würden.
Irgendwann ist die Falltür aufgegangen, und er hat etwas zu essen bekommen. Irgendwann später haben sie ihn wieder nach oben geholt und in das Wohnmobil gebracht. Und so ist es weitergegangen. Tag für Tag.
Dann ist zum ersten Mal ein Besucher gekommen.
Karl und Otto hatten ihn wie immer zum Eingang des Wohnmobils geführt und dann hineingestoßen, doch dieses Mal waren sie selbst draußen geblieben.
Wie lange ist das her? Wochen? Monate?
Jetzt sitzt er wieder da und wartet. Darauf, dass sie kommen. Vielleicht sind sie allein, vielleicht ist ein Besucher da. Vielleicht mehrere Besucher. Vielleicht sollte er einfach laut schreien. Dann wird Otto kommen und ihm den Bauch aufschneiden. Dann kann er für immer schlafen, und keiner der Besucher kann ihm mehr weh tun. Und Karl und Otto auch nicht. Aber dann denkt er an Mama und Papa. Was Otto auch mit ihnen machen würde. Und er weiß, dass er nicht schreien wird.
Der Teller, auf dem die Brote gelegen haben, die er eben gierig in sich hineingeschlungen hat, steht vor ihm auf dem Boden. Die halb leere Flasche Cola liegt daneben.
Sie geben ihm die Cola zur Belohnung, haben sie gesagt. Weil er so ein braver Junge ist. Er greift danach, öffnet den Verschluss und trinkt einen Schluck.
Gerade als er sie wieder schließt, hört er von oben Geräusche. Erst Schritte, dann die klickenden und kratzenden Laute, mit denen das Schloss geöffnet wird. Sekunden später wird die Falltür aufgezogen, und Karl schaut auf ihn herab.
»Komm«, befiehlt er.
1
Es dauerte nur drei, vier Sekunden, als es passierte, und doch erlebte Fabian Jancke jedes Segment dieser Zeitspanne so glasklar, als würde sie in extremer Zeitlupe ablaufen. Der Aufprall geschah am Samstag, dem vierten Juni, um neunzehn Uhr zweiundfünfzig auf der französischen A31, etwa fünfzehn Kilometer hinter Dijon.
Fabian registrierte den braunen Körper, als er hinter dem Brückenpfeiler auftauchte und auf die Straße sprang. Er sah den Blick aus den schwarzbraunen Augen, glaubte sogar, die Erkenntnis des Tieres darin zu sehen, dass sein Leben in der nächsten Sekunde vorüber sein würde, und die Erstarrung, die dieses Bewusstsein in dem Reh auslöste. Bei dem unausweichlichen dumpfen Knall übernahm Fabians Unterbewusstsein die Kontrolle und dirigierte seinen rechten Fuß auf das Bremspedal, während seine Hände das Lenkrad fest umklammerten, ohne es herumzureißen. Fünfzig Meter weiter kam das Wohnmobil auf dem Standstreifen der Autobahn zum Stehen.
Zwei, drei Sekunden herrschte absolute Ruhe in der Fahrerkabine, dann sah Fabian seine Frau an und sagte: »Scheiße!«
Erst in diesem Moment erwachte sie aus einer Art Schockstarre. »O mein Gott! Wie … wie kommt das Reh auf die Autobahn?«, sprudelte sie aufgeregt heraus. Sie sah blass aus, und eine Strähne ihrer schulterlangen blonden Haare hing ihr wirr ins Gesicht. »Wie konnte das passieren? Ist es tot? Siehst du es?«
»Ich weiß es nicht«, entgegnete Fabian und löste seinen Sicherheitsgurt. Noch unter dem Eindruck des gerade Erlebten, blickte Fabian in den Rückspiegel an der Frontscheibe, der in einem Wohnmobil ein vollkommen unsinniges Utensil war, weil der Blick nach hinten wegen der fensterlosen Rückwand normalerweise nichts zeigte als den Innenraum. Fabian hatte den Spiegel irgendwann so gedreht, dass er sich selbst darin sehen konnte. Er stellte fest, dass er in diesem Moment nicht wie ein Achtundvierzigjähriger aussah, sondern eher wie ein Mann Mitte fünfzig. In einer instinktiven Geste fuhr er sich mit einer Hand erst über das Gesicht und dann über die kurzen braunen Haare, bevor ihm ein Blick in den Außenspiegel zeigte, dass das Reh mit unnatürlich verdrehtem Körper schräg hinter ihnen reglos auf der Überholspur der Autobahn lag. Es war tot, daran bestand nicht der geringste Zweifel.
Als er die Tür öffnete, schlug ihm eine Welle heißer Luft entgegen. Obwohl es schon Abend war, herrschten noch Temperaturen von über dreißig Grad.
Fabian stieg aus und überlegte, dass die Autobahn an diesem Abschnitt und um diese Uhrzeit zum Glück kaum befahren war. In dem Moment, als er die Tür zugeschlagen hatte, näherte sich ein einzelner silberner Peugeot, umfuhr mit verminderter Geschwindigkeit den Tierkadaver und gab dann wieder Gas. Kein Anhalten auf dem Standstreifen vor ihnen, kein Nachfragen, ob jemandem etwas passiert war.
Andererseits hätte Fabian sowieso kaum ein Wort verstanden und noch weniger erklären können. Seine rudimentären Französischkenntnisse beschränkten sich auf die Überbleibsel von ein paar Jahren Französischunterricht in der Schule, und das war rund fünfunddreißig Jahre her.
Fabian ging vor der Front des Wohnmobils in die Hocke, betrachtete den Schaden und wusste im selben Moment, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Neben dem stark verbeulten Kotflügel, dem zersplitterten Glas des linken Scheinwerfers und den abgerissenen Plastikteilen des Kühlergrills war es der Kühler selbst, der dies verhindern würde. Er war eingerissen und hatte schon fast alles Wasser verloren, wie die Lache auf der Straße darunter zeigte. Zudem lief noch eine andere, ölige Flüssigkeit von einer Stelle irgendwo hinter dem Kühler in einem dünnen Rinnsal aus.
»Und?«
Fabian richtete sich wieder auf und sah Isabel an, die mittlerweile ebenfalls ausgestiegen war und ihm einen fragenden Blick zuwarf.
»Das war’s.« Er deutete auf die zerbeulte Front. »Der Kühler ist hin. Damit fahren wir keinen Meter mehr.«
»O nein! Und jetzt?«
»Zuallererst muss ich ein Warndreieck aufstellen«, erklärte Fabian und ging los zur Klappe des hinteren Stauraums, in dem er das Dreieck untergebracht hatte. »Zum Glück ist hier kaum Verkehr.«
Als wollten sie das dementieren, kamen gleich drei Autos nacheinander angefahren, bremsten ein wenig ab und beschleunigten wieder, nachdem sie das tote Tier umfahren hatten.
Kurz darauf entfernte sich Fabian mit dem Warndreieck in der Hand auf der Standspur vom Wohnmobil, hielt auf Höhe des toten Rehs an und betrachtete den Kadaver. Er war sehr tierlieb, und ein Tier zu überfahren – was ihm bis auf ein Kaninchen und ein paar Frösche bisher zum Glück erspart geblieben war – empfand er als sehr schlimm. Als sein Blick nun aber auf dem toten Reh ruhte, stellte er fest, dass sich sein Mitleid mit dem Tier dieses Mal sehr in Grenzen hielt. Zwei Wochen Urlaub in Spanien hatten sie geplant, auf einem wundervollen Campingplatz direkt am Meer. Seit Monaten schon hatten sie sich auf diese Zeit gefreut. Kein Stress, keine Termine, nur die Seele baumeln und sich treiben lassen. Und nun war wahrscheinlich alles vorbei.
Er wandte sich ab und ging weiter. Auf Autobahnen sollte das Warndreieck in zwei- bis dreihundert Metern Entfernung aufgestellt werden, erinnerte er sich.
Etwa zwanzig Meter weiter entdeckte er sein Nummernschild, das auf der rechten Spur der Straße lag. Die Autobahn war leer, also sprintete er auf die Fahrbahn und griff sich das verbeulte Kennzeichen.
Als er Minuten später wieder am Fahrzeug ankam, war sein T-Shirt durchgeschwitzt, und seine Stirn und der Nacken waren schweißnass. Die drückende Hitze, die zusätzlich noch vom Asphalt reflektiert wurde, war kaum zu ertragen. Hier und da fuhren Autos an ihm vorbei, manch neugieriger Blick wurde durch die geschlossenen Autoscheiben auf ihn und das Wohnmobil gerichtet, doch kein einziger Wagen hielt an.
Gemeinsam mit seiner Frau stieg Fabian ein, nahm sein Handy aus der Halterung am Armaturenbrett und setzte sich im Wohnbereich auf die gepolsterte Bank. »Ich versuche mal die Notrufnummer«, erklärte er. »Hoffentlich können die Englisch.«
Das konnte zumindest der Mann, der sich gleich darauf meldete, nicht.
»D’accord«, sagte Fabian enttäuscht und suchte in seinem kaum vorhandenen französischen Vokabular fieberhaft nach Worten. »J’ai un accident avec mon voiture. Sur l’autoroute 31.« Er wusste das Wort für Reh nicht mehr. Aber was Tier hieß, daran erinnerte er sich. »Un animal.«
»Des personnes ont-elles été blessées?«
»Pardon?«
»Blesser. Quelqu’un est-il blessé?«
Blesser … das hieß verletzt, glaubte Fabian, sich zu erinnern. Der Mann wollte wissen, ob jemand verletzt war.
»Non. Mais l’animal est mort. Sur la rue.«
Das schien der Mann zu verstehen, denn aus dem, was er anschließend erklärte, hörte Fabian heraus – auch weil er sich wieder daran erinnerte, dass das in Frankreich so geregelt war –, dass die Polizei nur zu Unfällen mit Personenschäden kam.
Nachdem er mehrfach versuchte, zu fragen und zu verstehen, was er nun tun musste, gab Fabian entnervt auf und beendete das Gespräch.
»Und?«
»Ach, großer Mist! Ich hab kaum was verstanden. Es kann doch nicht wahr sein, dass an einer Notrufnummer in der Urlaubszeit jemand sitzt, der kein Englisch spricht. Verdammt. Jedenfalls kommt die Polizei nicht, wenn niemand verletzt ist.«
»Und was sollen wir jetzt tun?«
Fabian atmete tief durch und wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. »Ich werde beim ADAC anrufen. Die sollen sich darum kümmern. Dafür zahlen wir ja schließlich Beiträge.«
Nachdem er von seiner Mitgliedskarte die Nummer für Auslandsschadensfälle abgetippt hatte, wurde er durch eine aufgezeichnete Ansage begrüßt und darüber informiert, dass zurzeit alle Mitarbeiter im Gespräch waren und er sich bitte gedulden solle, der nächste freie Mitarbeiter sei für ihn da.
»Was denkst du, kann man das so weit reparieren, dass wir trotzdem weiterfahren können?«, wollte Isabel wissen, und ihre Stimme klang dabei so zaghaft, als hätte sie Angst vor der Antwort. »Ich bräuchte diesen Urlaub wirklich dringend.«
Fabian stellte auf Lautsprecher um und legte das Handy vor sich auf den Tisch. »Ich weiß es nicht. Der Kühler ist kaputt. Vielleicht können die einen neuen einsetzen, und wir können die Plastikteile notdürftig mit Klebeband fixieren, aber morgen ist Sonntag, da arbeitet niemand. Das heißt, vor Montagabend oder sogar Dienstag kommen wir hier auf keinen Fall weg.«
»So ein Mist.«
»Kann man so sagen«, bestätigte Fabian, dann starrten beide vor sich hin und hörten der nervtötenden Musik der Warteschleife aus dem Telefon zu.
Es waren etwa fünfzehn Minuten vergangen, in denen sie darüber spekulierten, wie es nun weitergehen würde, während die Musik der Warteschleife des ADAC vor sich hin dudelte, nur alle zwei, drei Minuten unterbrochen von der Ansage, dass sämtliche Mitarbeiter in Gesprächen seien, als es an die Tür des Wohnmobils klopfte.
Fabian wechselte einen Blick mit seiner Frau, dann erhob er sich und öffnete. Vor ihm stand ein Mann mit raspelkurzen schwarzen Haaren und lächelte ihn an. Er trug einen grauen Arbeitsanzug über einem blauen T-Shirt und ausgetretene Sneakers, die wahrscheinlich einmal weiß gewesen waren.
»Puis-je vous aider?«, fragte er und deutete auf das Wohnmobil. »J’appartiens au Service Autoroute, je peux la remorquer.«
Fabian zuckte hilflos die Schultern. Service Autoroute klang zwar grundsätzlich gut, aber vom Rest hatte er kein Wort verstanden. »Pardon? Ehm … je ne parle pas français. Do you speak English? Parlez-vous anglais?«
Der Mann schüttelte den Kopf und deutete Fabian an, er möge sich draußen etwas anschauen. Als Fabian der Aufforderung folgte, war er erleichtert. Hinter dem Wohnmobil stand ein Abschleppwagen auf dem Standstreifen.
Mit einem erlösten Lächeln nickte er dem Mann zu und hob den Daumen. »Oui, merci! Merci bien!«
»Schatz, er hat einen Abschleppwagen«, rief er ins Innere des Wohnmobils, woraufhin Isabel ebenfalls nach draußen kam und sagte: »Na, Gott sei Dank.«
Während der Mann in den Abschleppwagen stieg und ihn vor das Wohnmobil bugsierte, stellte Fabian fest, dass das tote Reh verschwunden war. Zurückgeblieben waren ein dunkler Fleck sowie eine schmale, dunkle Schleifspur quer über die Autobahn bis hin zum Standstreifen. Wahrscheinlich hatte der Mann das Tier von der Straße gezogen und dann hinter der Leitplanke abgelegt.
Das Aufladen des großen Wohnmobils gestaltete sich schwierig, doch nach etwa zwanzig Minuten war es geschafft. Sie stiegen in die Fahrerkabine des Abschleppwagens ein und setzten sich auf die Rückbank. Im Inneren roch es nach Öl, und es herrschte ein heilloses Durcheinander an Werkzeugen, Dosen, Gurten und Ketten, doch das störte sie nicht. Sie kamen endlich von der Autobahn herunter und wurden in eine Werkstatt abgeschleppt. Alles andere würde sich dann zeigen.
Bevor der Fahrer einstieg, führte er draußen noch ein Telefonat, bei dem er mit ernster Miene ein paarmal nickte. Als sie kurz darauf schließlich losfuhren, witzelte Fabian darüber, dass sie ohne Aufpreis eine Abenteuerkomponente zu ihrem Urlaub dazubekommen hatten, woraufhin er und seine Frau erleichtert lachten. Dieser Anflug von Galgenhumor hielt allerdings nicht lange vor.
Sie verließen die Autobahn über die nächste Ausfahrt und fuhren an einer kleinen, schäbig aussehenden Ansiedlung vorbei, dann bog der Fahrer in eine schmale Straße ab, die durch ein Waldstück führte.
»Mein Gott, wo bringt der uns hin?«, sagte Fabian nach etwa zehn Minuten, in denen sie durch unwirtliches Gelände gefahren und dabei an keinem einzigen Haus vorbeigekommen waren. Mittlerweile hatte die Dämmerung eingesetzt, was die Felder und vereinzelten Wäldchen, an denen sie entlangfuhren, noch unfreundlicher erscheinen ließ.
»Keine Ahnung. Jedenfalls ist es hier ganz schön unheimlich.«
Weitere zehn Minuten später beugte Fabian sich nach vorn und versuchte, den Fahrer zu fragen, wohin sie fuhren, doch der schien ihn nicht zu verstehen und redete auf Französisch so schnell auf ihn ein, dass Fabian auch kein einziges Wort verstand.
»Vielleicht rufst du besser mal jemanden zu Hause an und sagst denen, was passiert ist und wo wir sind«, schlug Isabel vor. »Wer weiß …«
Fabian zog sein Handy aus der Tasche und tippte darauf, ließ es aber gleich wieder sinken. »Kein Netz.« Er warf erneut einen Blick nach draußen. »Hätte mich hier aber auch gewundert. Ich versuche es, wenn wir angekommen sind.«
Er sah seine Frau grinsend an. »Du hast aber jetzt nicht wirklich Angst, oder?«
»Nun tu das nicht so ab. Es ist unheimlich hier, oder etwa nicht?«
Fabians Grinsen wurde breiter. »Jetzt hör aber auf. Das ist ein Abschleppwagen, und der Mann bringt uns in eine Werkstatt. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir das mit der Übernachtung machen, aber wenn wir angekommen sind, öffnen wir eine Flasche Wein und trinken ein Glas, dann sieht die Welt schon anders aus. Es kann ja nicht mehr lange dauern.«
Fabian blickte wieder durch die Seitenscheibe nach draußen und musste sich dabei eingestehen, dass diese ganze Fahrt wirklich sehr ungewöhnlich war und er die Bedenken seiner Frau durchaus nachvollziehen konnte.
Tatsächlich bog der Fahrer wenige Minuten später auf einen schmalen Weg ab, der ein paar hundert Meter weiter durch ein geöffnetes Tor führte. Es war in einen etwa zwei Meter hohen Zaun eingelassen, der ein großes Grundstück einfasste.
»Na also«, sagte Fabian erleichtert, auch wenn diese Anlage nicht so aussah, wie er sich das erhofft hatte.
Vor einem Gebäude, das Fabian anhand der verwitterten Schilder mit Logos von bekannten französischen Automarken als Werkstatt identifizierte, standen etliche alte, verbeulte Autos und Lkws herum. Selbst das Skelett eines offenbar ausgebrannten Busses entdeckte er neben dem Zaun.
Der Platz vor der Werkstatt, auf dem der Abschleppwagen schließlich zum Stehen kam, war nicht betoniert, sondern bestand aus Schotter und festgestampfter Erde. Alles in allem machte diese Werkstatt – oder was immer es auch war – keinen sehr vertrauenerweckenden Eindruck.
Der Fahrer sagte etwas, das Fabian nicht verstand, und stieg dann aus. Fabian öffnete die Tür und machte Anstalten, ebenfalls auszusteigen, während Isabel nach vorn durch die Windschutzscheibe blickte und sagte: »Mein Gott, wo sind wir denn hier gelandet?«
Die Dämmerung war mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die Umrisse der Gegenstände in der Umgebung unkenntlich werden würden.
»Das werden wir herausfinden«, versicherte Fabian ihr und schwang sich aus dem Fahrzeug. Nachdem er einen Blick auf sein Handy geworfen und festgestellt hatte, dass es in dieser Gegend kein Netz gab, hielt er nach dem Fahrer Ausschau, entdeckte ihn jedoch nicht wie erwartet an der Ladefläche des Abschleppwagens, sondern am Tor, durch das sie gefahren waren und das er in diesem Moment zuzog. Anschließend legte er eine schwere Kette um die Holme der beiden Torhälften und verband sie mit einem Schloss, das er einrasten ließ.
Fabian fand das mehr als seltsam, schließlich würden sie ja gleich noch zu einem Hotel fahren müssen, wo sie übernachten konnten.
Er ging dem Fahrer entgegen, als der zurückkam, deutete auf das verschlossene Tor und hob dann die Schultern zum Zeichen, dass er nicht verstand, warum er es geschlossen hatte.
Der Mann ignorierte ihn und ging einfach weiter. Der finstere Ausdruck, der plötzlich auf seinem Gesicht lag, sorgte dafür, dass etwas nach Fabians Magen griff und begann, ihn langsam zuzudrücken.
»Hey!«, rief er dem Mann nach und ging ihm hinterher, doch schon nach wenigen Metern blieb er stehen und starrte auf die in das verrostete Tor des Werkstattgebäudes eingelassene Tür, die sich geöffnet hatte und durch die nun mehrere Männer ins Freie traten. Fabian zählte vier, fünf … nach dem sechsten war Schluss. Die Kerle waren etwa zwischen zwanzig und vierzig Jahre alt, einige von ihnen trugen abgewetzte Jeans, andere Arbeitsoveralls. Zwei von ihnen standen mit nacktem Oberkörper da, ihr Schweiß glänzte im Licht, das aus dem Inneren des Gebäudes drang. Sie machten allesamt einen sehr ungepflegten Eindruck, aber was Fabians Puls rasen ließ, war etwas anderes: Sie wirkten gefährlich.
Vor dem Abschleppwagen blieben sie in einem Halbkreis stehen und starrten mit feist grinsenden Gesichtern an dem großen Fahrzeug vorbei auf etwas, das Fabian von seinem Standort aus nicht sehen konnte. Als ihm aber schwante, was es war, schoss eine Angst in ihm hoch, wie er sie noch nie zuvor in seinem Leben empfunden hatte.
Was diese Männer unverhohlen anstarrten, war seine Frau.
2
Evelyn tastete nach dem Wecker und schaltete ihn aus, dann öffnete sie die Augen und betrachtete eine Weile unbeteiligt die schemenhaften Umrisse der Einrichtung ihres Schlafzimmers, während ihre Gedanken sich mit dem Verlauf der letzten Nacht beschäftigten.
Mit dem Teil, den sie erlebt hatte, und dem, den ihr Unterbewusstsein ihr in wirren Bildern vorgaukelte, als sie irgendwann gegen drei Uhr endlich in einen bleiernen Schlaf gefallen war.
Sie war erst eine Weile durch Oldenburgs Kneipen gezogen, hatte hier und da einen Drink bestellt und sich nie länger als eine Viertelstunde aufgehalten, nachdem sie die Umgebung gescannt und festgestellt hatte, dass nichts für sie dabei war.
Es musste gegen elf Uhr gewesen sein, als sie in diesem Irish Pub gelandet war. Der Typ, an dessen Namen sie sich nicht erinnerte, weil er nicht wichtig war, hatte an der Bar gesessen und ihr zugezwinkert, als sie sich zwei Meter von ihm entfernt auf den Hocker geschoben und einen Mojito geordert hatte.
Er war weder gutaussehend noch auf irgendeine andere Art anziehend, sondern einfach nur nicht abstoßend gewesen, was schon genügte, ihn aus der Masse an Typen, die man an einem Wochentag nachts in Bars und Kneipen traf, herausstechen zu lassen. Sie war nicht anspruchsvoll.
Eine halbe Stunde später hatten sie gemeinsam den Pub verlassen und waren zu ihm gegangen. Sie nahm nie einen Kerl mit zu sich nach Hause. Ihre Wohnung war ihr Castle, ihre Festung, in der kein Fremder etwas zu suchen hatte. Es waren immer Fremde, die sie bei ihren abendlichen Streifzügen suchte, und sie sorgte stets dafür, dass sie das auch blieben.
Um kurz vor drei war sie wieder zu Hause angekommen, hatte den Geruch und die Berührungen des Kerls unter der Dusche von ihrer Haut geschrubbt und sich dann ins Bett fallen lassen, wo kurz danach der übliche Horror ihrer Albträume begonnen hatte.
Evelyn schlug die Bettdecke zurück und schob die Beine aus dem Bett. Einige Sekunden blieb sie mit vorgebeugtem Oberkörper und hängendem Kopf sitzen und ergab sich dem hämmernden Pochen in ihrem Kopf, dann erhob sie sich seufzend und schlurfte ins Bad.
Der Blick in den Spiegel und das, was sie dort sah, erschreckten sie schon längst nicht mehr. Eine Zweiundfünfzigjährige mit den dunklen Augenringen und der fahlgrauen Haut einer Frau von siebzig. Zudem war sie mittlerweile für ihr Empfinden zu schlank geworden. Fast schon mager. Lediglich die hellbraun gefärbten Haare ließen sie etwas jünger aussehen.
Zum zweiten Mal innerhalb von vier Stunden stellte sie sich unter die Dusche und drehte nach wenigen Sekunden das Wasser mit einem Schlag auf kalt. Sie stöhnte kurz auf, während sich ihr ganzer Körper unter dem Eisregen zusammenzog, doch schon nach kurzer Zeit spürte sie die Lebensgeister, die der Kreislaufschock in ihre Glieder und vor allem in ihren Kopf zurückkehren ließ.
Nachdem sie sich abgetrocknet und angekleidet hatte, richtete sie ihr Gesicht mit Cremes, Make-up und Puder halbwegs ansehnlich her, trank zwei Tassen schwarzen Kaffee und machte sich dann auf den Weg zur Polizeiinspektion Oldenburg, wo sie sich wie fast jeden Morgen seit geraumer Zeit mit Kriminalhauptkommissar Gerhard Tillmann treffen würde.
Evelyn und Tillmann kannten sich bereits eine ganze Weile und arbeiteten häufig zusammen. Da war auch schon mehr zwischen ihnen gewesen, doch nach einer Weile war ihr bewusst geworden, dass sie Tillmann als Freund mehr brauchte als in der Rolle des Geliebten.
Sie hatte Tillmann angemerkt, wie schwer es ihm gefallen war, ihren Entschluss zu akzeptieren, aber letztendlich hatte er sich damit abgefunden, mit Evelyn nur befreundet zu sein. Das war nach seiner eigenen Aussage immer noch besser, als sie komplett zu verlieren.
Dass sie sich gerade in den letzten beiden Monaten regelmäßig mit ihm traf, war dem aktuellen Fall geschuldet, der Deutschland in Atem hielt. Innerhalb von neun Wochen waren fünf Menschen – quer über Norddeutschland verteilt – getötet worden. Alle Morde geschahen entweder auf Camping- oder auf Wohnmobilstellplätzen und waren mit äußerster Brutalität begangen worden. Bisher war, abgesehen vom Ort der Taten, noch keine Gemeinsamkeit zwischen den Opfern gefunden worden.
Evelyns Aufgabe bei der Zusammenarbeit mit der Polizei bestand darin, die Fahndung nach dem Täter mit ihrem Fachwissen als forensische Psychologin zu unterstützen.
Da im Bereich Oldenburg die ersten beiden Verbrechen begangen worden waren und man von einem Serientäter ausging, war dort die Sonderkommission Camping gebildet worden, der mittlerweile Mordkommissionen aus den verschiedenen norddeutschen Städten angehörten, in denen der Täter ebenfalls gemordet hatte.
Sie alle gemeinsam jagten diesen Mann, der es zumindest bisher hervorragend verstanden hatte, einem Phantom gleich zuzuschlagen und wieder zu verschwinden, ohne gesehen zu werden.
Evelyn nickte dem Portier im Eingangsbereich der Inspektion zu, woraufhin der zurückgrüßte und die erste Glastür der Schleuse öffnete. Als die hinter ihr wieder zugefallen war, entriegelte er die zweite Tür, und Evelyn konnte auf den Flur treten, über den sie zum Aufzug gelangte.
Als die Tür sich mit einem schleifenden Geräusch geschlossen hatte, presste sie die Mittelfinger beider Hände auf ihre Schläfen und massierte sie mit kreisenden Bewegungen. Die rasenden Kopfschmerzen konnten entweder an zu wenig Schlaf oder an den Mojitos liegen, die sie am Vorabend getrunken hatte. Wahrscheinlich aber waren sie ein Resultat von beidem.
Kurz dachte sie an den Kerl, in dessen Bett sie gelandet war, schaffte es jedoch nicht mehr, sich daran zu erinnern, wie er ausgesehen hatte. Es spielte auch keine Rolle.
Schon beim Betreten von Tillmanns Büro sah sie dem Hauptkommissar an, dass wieder etwas geschehen sein musste. Seine moderne Frisur mit kurzgeschnittenen Seiten und längerem, dunkelblondem Deckhaar, war durcheinander. Die ausgeprägten Kieferknochen traten noch etwas deutlicher hervor als sonst. Evelyn kannte diesen Ausdruck zwischen Schmerz und Wut in seinen blaugrauen Augen, so wie sie mittlerweile viele Nuancen von Gerhard Tillmann kannte. Das mochte daran liegen, dass es sonst niemanden mehr gab, mit dem sie sich näher beschäftigte.
»Morgen«, begrüßte Tillmann sie, und bevor sie etwas erwidern konnte, fügte er hinzu: »Er hat wieder zugeschlagen.«
»Verdammt!« Evelyn stellte ihre Tasche auf einem der beiden Stühle vor Tillmanns Schreibtisch ab. »Wo?«
»Nicht sehr weit von hier, in … Moment.« Er sah auf seinen Computermonitor und verengte die Augen zu Schlitzen. »Hier: Campingplatz am Timmeler Meer in Großefehn. Das ist etwa fünfzig Kilometer von hier.« Tillmann richtete den Blick wieder auf Evelyn, die sich mittlerweile auf den freien Stuhl gesetzt hatte. »Ein Mann Mitte dreißig. Der Täter hat ihn übel zugerichtet.« Mit einer Kopfbewegung deutete Tillmann auf seinen Monitor. »Wenn du möchtest … aber ich muss dich warnen. Kein schöner Anblick.«
Evelyn stand auf, ging um den Schreibtisch herum und blieb neben Tillmann stehen, während der mit ein paar Mausklicks ein Foto öffnete und auf die Größe des Monitors aufzog. Überflüssigerweise fiel ihr in diesem Moment, als sie ihn von oben betrachtete, auf, dass er abgenommen hatte. Tillmann war schon immer sportlich gewesen, hatte sich aber in der Zeit, als sie noch zusammen gewesen waren, ein wenig Speck an den Hüften angefuttert. Der schien nun verschwunden zu sein. Sie fragte sich, wie sie in dieser Situation auf solche Gedanken kam, und konzentrierte sich auf den Monitor.
Sie hatte schon viele Leichen gesehen, auf Fotos und real, aber beim Anblick dessen, was Tillmann ihr auf dem Monitor in hoher Auflösung zeigte, musste sie mehrmals schlucken.
Die männliche Leiche lag auf sandigem Untergrund. Der Körper war so sehr mit Blut überzogen, dass selbst das Gesicht und die Haare unter einer verkrusteten, dunklen Schicht lagen. Das Shirt war völlig zerfetzt, Brust, Bauch und offensichtlich auch der Unterleib waren übersät mit teils wulstigen Einstichstellen. Am Unterbauch war dem Mann eine derart breite Wunde zugefügt worden, dass Teile des Darms daraus hervorquollen.
»Mein Gott!«, entfuhr es Evelyn, während sie wie gebannt auf den Monitor starrte.
»Ähnlich wie bei den anderen Opfern, nur dieser breite Schnitt am Bauch ist neu. Der Täter scheint in Rage zu geraten, wenn er auf seine Opfer einsticht, und so, wie es aussieht, wird seine Wut mit jedem Opfer größer.«
»Er liegt auf einem sandigen Untergrund«, sagte Evelyn und schaffte es endlich, den Blick von dem misshandelten Körper abzuwenden und wieder zu ihrem Platz zurückzugehen. »Ist das auch der Tatort?«
»Höchstwahrscheinlich, ja. Der Mann stand seit vorgestern mit seinem Wohnwagen auf dem Platz. Seine Frau und seine kleine Tochter sind dabei. Sie sind gestern Abend am Wohnwagen geblieben, während er vor dem Zubettgehen noch mal mit dem Hund eine Runde drehen wollte. In der Nähe des Platzes am Ufer des Sees hat er dann wohl seinen Mörder getroffen.
Ob der dort auf irgendwen gelauert hat und zufällig auf ihn getroffen ist oder ob er sich speziell diesen Mann ausgesucht hat, ist nicht klar.«
»Und natürlich gibt es wieder niemanden, der ihn gesehen hat.«
»Das weiß ich nicht, die Befragungen durch die Kollegen vor Ort laufen noch. Wenn ich in den nächsten Stunden irgendetwas Neues erfahre, melde ich mich. Du hast heute Vormittag noch einen Termin in der Klinik mit Kleinbauer, nicht wahr?«
»Ja.« Evelyn sah auf die Armbanduhr. »In einer Stunde, um zehn.«
Nils Kleinbauer war dreiundzwanzig Jahre alt und hatte eine Prostituierte getötet, indem er sie während des Geschlechtsverkehrs erwürgte. Anschließend hatte er sich stundenlang an ihrer Leiche vergangen und dabei eindeutige Spuren hinterlassen, so dass er schnell gefasst werden konnte. Er war auf Anordnung des Haftrichters in der Forensischen Psychiatrie der Universitätsmedizin Oldenburg untergebracht worden, und man hatte Evelyn als Psychologin hinzugezogen, um eine Expertise für den Prozess zu erstellen. Dass ausgerechnet sie als Gutachterin in diesem Fall eingesetzt worden war, hatte einen plausiblen Grund: Kleinbauer hatte sie verlangt. Er hatte erklärt, sich ausschließlich mit ihr unterhalten zu wollen, denn sie kannte ihn und seine Geschichte.
Schon als Kind war bei Nils Kleinbauer das Asperger-Syndrom diagnostiziert worden. Als er dann als junger Erwachsener in Evelyns Praxis kam, war sie nach etlichen Therapiestunden zu dem Schluss gelangt, dass Nils Kleinbauer eher Anzeichen einer Schizophrenie aufwies. In seinem Fall waren es sogenannte positive Schizophrenie-Symptome, die darauf hindeuteten, dass er nach und nach den Kontakt zu einigen Bereichen der Realität verlor. Dazu gehörten teils ungewöhnliche, dysfunktionale Denkweisen und eine – noch – leichte Form von Wahnvorstellungen. Evelyn hielt eine Behandlung mit Psychopharmaka für dringend angezeigt und empfahl ihm einen befreundeten Psychiater, der ihn entsprechend medikamentös einstellte. Das war nun ein Jahr her.
An diesem Vormittag hatte sie das erste Gespräch mit Kleinbauer seit dieser Zeit.
Evelyn zuckte zusammen, als sie merkte, dass Tillmann sie mit zur Seite geneigtem Kopf ansah.
»Wie geht es dir?«
»Geht schon«, wiegelte Evelyn die Frage ab.
»Wieder Albträume gehabt?«
Sie nickte.
»Schlimm?«
»Nicht schlimmer als sonst.«
»Möchtest du darüber reden?« Falls Tillmann eine Antwort erwartet hatte, ließ er ihr nicht die Zeit dazu. »Komm!«, sagte er und erhob sich. »In der Kantine ist jetzt nichts los. Ich spendiere dir einen Kaffee und ein Brötchen. Du hast doch sicher noch nichts gegessen, oder?«
»Nein. Aber …«
»Keine Widerrede«, fiel Tillmann ihr ins Wort, während er an ihr vorbeiging und das Büro verließ. Mit einem Seufzer stand Evelyn auf und folgte ihm. Er war ein guter Freund.
Wie Tillmann es vorausgesagt hatte, war die Kantine bis auf zwei uniformierte Polizistinnen und einen Mann in Zivil leer.
»Setz dich«, ordnete Tillmann an. »Ich bringe dir was mit. Käse und Salami, richtig?«
Evelyn nickte und setzte sich an einen Vierertisch.
»Findest du nicht auch, es wäre an der Zeit, endlich eine Therapie zu machen?«, fragte Tillmann kurz darauf, bevor er in sein Brötchen biss.
Evelyn stieß ein humorloses Lachen aus. »Ja, sicher. Ich halte eine Therapiestunde mit Kleinbauer ab, und sobald der den Raum verlassen hat, setze ich mich auf seinen Stuhl und warte auf meinen Therapeuten, oder wie?«
»Evelyn …«
»Mein Gott, Gerhard, was soll das denn bringen? Fabian ist vor über zwei Jahren verschwunden. Man sagt mir, ich solle mich damit abfinden, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit tot ist. Er war mein Bruder, da ist es völlig normal, dass es mir schwerfällt, damit klarzukommen. Du kannst mir glauben, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin vom Fach.«
Tillmann wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab. »Nein, es ist eben nicht normal, dass eine Frau Anfang fünfzig ihr komplettes Leben wegwirft, dass sie sich von allen Freunden zurückzieht und nur noch für ihre Arbeit lebt. Und dass sie …« Er beugte sich nach vorn und senkte die Stimme. »Dass sie nachts durch Kneipen zieht und mit irgendwelchen Pennern, die sie nicht kennt, nach Hause geht.«
Evelyn verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen, dem jeder Anflug von Humor fehlte. »Tja, mein Lieber. Dann solltest du mir dafür danken, dass ich dich vor mir bewahrt habe.«
»Nun lenk nicht ab, Evelyn. Du bist eine hervorragende Psychologin mit einem messerscharfen Verstand, aber ich habe Angst, dass du den irgendwann verlieren wirst, wenn du so konsequent daran weiterarbeitest, dich zugrunde zu richten.«
Sie trank einen Schluck Kaffee und betrachtete das Brötchen, das noch unangetastet vor ihr auf dem Teller lag.
»Ich weiß ja, dass du recht hast. Ich denke noch mal darüber nach, okay? Und vielleicht unterhalte ich mich mal mit Dr. Gersmann, dem Leiter der Klinik.«
»Nicht vielleicht. Versprochen!«
»Ach, komm, nun hör aber …«
»Versprich es mir.«
»Also gut, ich verspreche dir, ich werde mit Dr. Gersmann reden.«
»Danke!«, sagte Tillmann und legte seine freie Hand auf ihre. »Das ist mir wichtig, weil du mir wichtig bist.«
»Ich weiß.«
Evelyn zog ihre Hand unter seiner heraus, stand auf und griff nach ihrer Handtasche. »Melde dich, wenn du was aus Großefehn hörst.«
Als sie kurz darauf im Aufzug stand, massierte sie sich wieder mit den beiden Mittelfingern die Schläfen.
Eine halbe Stunde später betrat sie den Therapieraum, in dem Nils Kleinbauer schon auf sie wartete. Seit ihrem letzten Aufeinandertreffen hatte er sich nicht sehr verändert. Soweit sie es sehen konnte, war er nach wie vor schlank, das braune, lockige Haar war kurz geschnitten, die Haut in seinem länglichen Gesicht wirkte blass.
Man hatte ihm Handschellen angelegt, die mit einer Kette mit dem Stuhl verbunden waren, auf dem er saß, so dass er seine Hände zwar ein Stück weit bewegen, aber nicht von dem auf dem Boden festgeschraubten Stuhl aufstehen konnte.
Er sah Evelyn mit ausdruckslosem Gesicht entgegen, bis sie vor ihm stehen blieb und sagte: »Guten Morgen, Nils. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen.«
3
»Ja«, antwortete er. »Sie dachten sicher, Sie wären mich los, nicht wahr?«
Die Art, wie er das sagte, ließ Evelyn aufhorchen. Es klang lauernd. Sie setzte sich Kleinbauer gegenüber und beschloss, die Frage zu ignorieren.
»Gehen Sie noch regelmäßig zu Dr. Klarfeld?«
Kleinbauer lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Nein.«
»Warum nicht?«
»Bei Ihnen ging es mir besser, aber Sie wollten mich ja leider nicht mehr als Patienten haben.«
»Das stimmt nicht, und das wissen Sie auch. Sie haben eine medikamentöse Behandlung gebraucht, und die konnten Sie bei mir nicht bekommen. Ich kann keine Psychopharmaka verschreiben. Das ist der Grund, warum ich Sie an Dr. Klarfeld verwiesen habe.«
»Bei Ihnen ging es mir besser«, wiederholte Kleinbauer.
»Warum haben Sie die Frau getötet?« Evelyn schoss die Frage regelrecht ab und beobachtete dabei genau Kleinbauers Miene, doch er zeigte keinerlei Regung.
»Keine Ahnung. Ich habe irgendwann gemerkt, dass sie tot war.« Ein schiefes Grinsen legte sich auf sein Gesicht. »Aber ich war noch nicht fertig, also habe ich weitergemacht.«
Er will dich provozieren, sagte Evelyn sich, und das weitere Gespräch bestätigte ihre Meinung. Kleinbauer beantwortete jede ihrer Fragen mit Zynismus oder Aussagen, die darauf ausgelegt waren, sie herauszufordern.
Lediglich nach etwa einer Dreiviertelstunde, als Evelyn am Ende der Sitzung so tat, als lese sie laut mit, was sie gerade aufschrieb, und murmelte: »Patient tötete offenbar vollkommen grund- und motivlos«, sagte Kleinbauer mit geradezu sanfter Stimme: »Ich wollte nur eine Freundin, die mich liebt.«
Daraufhin sah Evelyn ihn an und sagte: »Danke, das war’s für heute.«
Beim nächsten Mal würde sie die Sitzung mit diesem letzten Satz von ihm beginnen, und sie hoffte, er würde darauf anspringen.
Nachdem Kleinbauer abgeholt worden war, packte sie den Block in ihre Tasche und verließ das Zimmer.
Auf dem Weg zu Dr. Gersmanns Büro kam ihr der medizinische Leiter der Klinik auf dem Flur entgegen.
»Ich wollte gerade zu Ihnen kommen«, erklärte Evelyn dem leicht untersetzten, dunkelhaarigen Mann, der für sein Alter von Mitte fünfzig eine erstaunlich glatte Gesichtshaut hatte. So glatt, dass hier und da hinter vorgehaltener Hand darüber spekuliert wurde, ob er mit Botox herumexperimentierte.
»Ich denke, Nils hat sich seit meinem letzten Kontakt mit ihm verändert, und das nicht unbedingt zum Positiven. Aber ich bin sicher, er wird mit mir über seine Tat reden.«
Gersmann nickte anerkennend. »Das klingt vielversprechend, wundert mich aber nicht. Ich wusste, wenn jemand zu ihm vordringen kann, dann Sie.«
»Danke«, sagte Evelyn und wollte sich schon abwenden, als ihr das Versprechen einfiel, das sie Tillmann gegeben hatte.
»Ach, sagen Sie, haben Sie zufällig gerade ein wenig Zeit?«
»Ja, worum geht es? Möchten Sie das weitere Vorgehen mit Kleinbauer besprechen?«
»Nein, ich …« Evelyn atmete tief durch und gab sich einen Ruck. »Es geht um mich. Um die Sache mit meinem Bruder.«
Gersmann hob sichtbar überrascht die Brauen und warf dann einen Blick auf seine Armbanduhr, bevor er sagte: »Kommen Sie.«
Ohne auf eine Reaktion zu warten, drehte er sich um und ging den Flur entlang auf sein Büro zu. Nachdem sie beide eingetreten waren, griff Gersmann zum Telefon, tippte darauf und sagte: »Verschieben Sie bitte den Termin, den ich um elf Uhr dreißig mit dieser Journalistin habe, auf heute Nachmittag. Mir ist etwas Wichtiges dazwischengekommen.« Er legte auf und deutete auf die Sitzgruppe aus drei bequemen Polstersesseln, die in der Ecke des großzügigen Büros um einen nierenförmigen Tisch herumstanden. »Bitte, setzen Sie sich, Evelyn.«
Nachdem sie Platz genommen hatten, nickte er ihr auffordernd zu. »Was kann ich für Sie tun?«
Evelyn überlegte, wo und wie sie beginnen sollte, und sagte schließlich: »Ich denke, ich schaffe es nicht, den Tod meines Bruders zu verarbeiten.«
Auf Gersmanns glatter Stirn zeigten sich Fältchen. »Seinen Tod? Ich dachte, er ist vor zwei Jahren in Frankreich verschwunden?«
»Ich glaube, dass er tot ist. Andernfalls hätte er es irgendwie geschafft, sich bei mir zu melden.«
»Hm … Ich muss gestehen, nur wenig darüber zu wissen. Möchten Sie mir erzählen, was genau damals passiert ist?«
Einem Impuls folgend, wollte Evelyn ihm sagen, dass es eine dumme Idee von ihr gewesen war, damit anzufangen, und dass sie lieber wieder gehen würde, doch dann sah sie Gerhard Tillmanns sorgenvolles Gesicht vor sich und dachte daran, dass sie es ihm schuldete, ihr Versprechen einzuhalten.
»Kann ich ein Glas Wasser haben, bitte?«
»Ja, natürlich.« Gersmann stand auf, ging zu einer Art Minibar, die in eine Regalwand hinter seinem Schreibtisch eingelassen war, und griff nach zwei kleinen Flaschen Wasser. Zusammen mit zwei Gläsern, die er aus einer Nische daneben nahm, kam er zurück und stellte alles auf dem Tisch ab.
Nachdem Evelyn einen großen Schluck getrunken hatte, lehnte sie sich zurück.
»Da gibt es im Grunde nicht viel zu erzählen, weil man so gut wie nichts weiß. Fabian war vor zwei Jahren im Juni gemeinsam mit seiner Frau auf dem Weg nach Spanien, als er irgendwo bei Dijon einen Unfall mit einem Reh hatte. Er hat mir eine WhatsApp geschickt und geschrieben, dass sie auf der Autobahn stehen und er gleich den ADAC anrufen wird, damit die einen Abschleppwagen schicken. Er würde sich später noch mal melden. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe.
Die französische Polizei hat dann festgestellt, dass sein Handy sich ein Stück hinter Dijon zum letzten Mal in einer Funkzelle angemeldet hat, danach verliert der weitere Weg sich im Nichts. Weder von ihm oder seiner Frau noch von ihrem Wohnmobil wurde irgendeine Spur gefunden.«
»Verstehe«, sagte Gersmann, nachdem er ein paar Sekunden lang darauf gewartet hatte, ob Evelyn weitersprechen würde.
»Und dieses schlimme Ereignis lässt Sie bis heute nicht los. Haben Sie Albträume?«
»Fast jede Nacht.«
»Wie sehen diese Träume aus?«
»Ganz schlimm. Und das Merkwürdige daran ist, dass nicht immer Fabian darin auftaucht, sondern es oft um mich geht. Und dass es fast immer die gleiche Situation ist, in der ich mich befinde. Ich bin eingesperrt in einem dunklen Raum und kann mich nicht bewegen. Ich habe fürchterliche Angst, weil ich nicht weiß, wo ich bin, und weil ich mich vollkommen allein in dem Raum befinde. Ich rufe und schreie, aber niemand scheint mich zu hören. Und dann irgendwann merke ich, wie eine Tür geöffnet wird. Ich kann nichts sehen, aber ich spüre den Luftzug und weiß, dass das, was in den Raum kommt, abgrundtief böse ist und mir etwas Schlimmes antun will. Dann beginne ich, wie von Sinnen zu schreien und immer wieder zu schreien …« Evelyn merkte selbst, dass sie sehr laut und sehr schnell gesprochen hatte. Deutlich leiser und langsamer redete sie weiter. »Und dann wache ich auf. Wahrscheinlich von meinen eigenen Schreien. Meist geschieht das mitten in der Nacht. Ich habe Angst davor, wieder einzuschlafen, weil ich weiß, was dann kommen wird. Aber irgendwann schlafe ich doch wieder ein, und prompt beginnen diese furchtbaren Bilder. Mal wird Fabian erschossen, mal mit einem Knüppel erschlagen … Auf jeden Fall sehe ich immer wieder, wie er umgebracht wird, und ich höre, wie er mich anfleht, ich soll ihm helfen, aber ich bin wie erstarrt.«
Evelyn spürte, dass ihr eine Träne über die Wange lief, und tupfte sie mit dem Handrücken weg.
Dr. Gersmann sah ihr eine Weile nachdenklich in die Augen, bevor er nickte. »Evelyn, wenn einer Ihrer Patienten Ihnen das erzählen würde, was Sie mir gerade mitgeteilt haben, was würden Sie ihm sagen?«
Sie dachte einen Moment nach, obwohl das nicht notwendig gewesen wäre. Gersmanns Frage hatte sie sich selbst schon unzählige Male gestellt, und sie war immer wieder zum gleichen Ergebnis gekommen: Sie würde diesem Patienten sagen, dass die Albträume das vollkommen logische Resultat des Traumas waren, das die Nachricht vom spurlosen Verschwinden des Bruders verursacht hatte. Erst das Eingesperrtsein als Synonym für das Gefühl der Einsamkeit und Leere, das durch das Verschwinden des Bruders entstanden war, dann die Vorstellung, was mit dem Bruder alles geschehen sein konnte, wobei das Unterbewusstsein die verschiedenen Möglichkeiten in den Träumen in den schlimmsten Farben ausmalte. Sie sagte Dr. Gersmann genau das und war insgeheim enttäuscht, dass ihm nichts anderes eingefallen war, als ihr eine Frage zu stellen, die jeder Psychologie-Student im ersten Semester lernte.