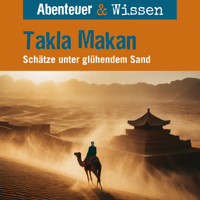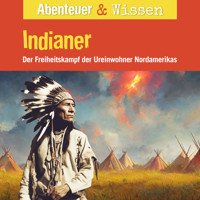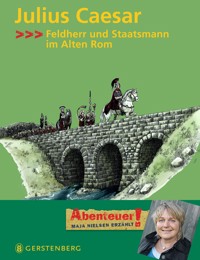Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Berlin 1961: Für Achim könnte es eigentlich nicht besser laufen – das Abitur hat er in der Tasche, einen Studienplatz sicher und Chris, das Mädchen, das er heimlich liebt, scheint auch ihn zu mögen. Doch über Nacht ändert sich alles. Mit dem Bau der Mauer schlägt das DDR-Regime einen härteren Ton an. Misstrauen, Verfolgung und Verhaftungen sind an der Tagesordnung. Als einer seiner Freunde im Gefängnis landet, fasst Achim einen schweren Entschluss: Er muss raus aus Ostberlin und alle, die er liebt, zurücklassen. Drüben angekommen, setzt er alles daran, Menschen aus der DDR bei ihrer Flucht zu unterstützen. Gemeinsam mit anderen Helfern gräbt er Tunnel von West- nach Ostberlin – in ständiger Angst, von der Stasi entdeckt zu werden, und voller Hoffnung, Chris eines Tages wiederzusehen. Ein packender Roman über die legendären Tunnelfluchten aus der DDR, erzählt nach einer wahren Geschichte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 Ost-Berlin, Dezember 1961: Grenzübergang Friedrichstraße
2 Chris
3 West-Berlin, Bahnhof Zoo
4 Ostsee, Insel Usedom, Sommer 1961
5 West-Berlin, Bahnhof Zoo, 21. Dezember 1961
6 Ost-Berlin, September 1961: Drei Wochen nach dem Mauerbau
7 Das Verhör in der Nacht
8 Die Entscheidung
9 Der Geburtstag
10 West-Berlin, Bahnhof Zoo, 21. Dezember 1961
11 Ankunft im Westen
12 Nachtschichten
13 Ost-Berlin, März 1961, Wohnheim: Der Besuch
14 Hundehalsband
15 Das Verhör
16 Die Selbstverpflichtung
17 IM Laborantin
18 Sascha
19 Die Verlobung
20 West-Berlin: Der umgebaute Opel
21 Ost-Berlin: Beas Flucht
22 West-Berlin: Schlag in die Magengrube
23 Bernauer Straße
24 Brief an Chris
25 Ost-Berlin: Ich will mit dem gehen, den ich liebe
26 West-Berlin: Der Spitzel
27 Wasser
28 Der Durchbruch
29 Der Mann im Ledermantel
30 Der verratene Tunnel
31 Die Nachricht, vier Tage später
32 Ost-Berlin: In Haft
33 Strafhaft
34 Freiheit
35 West-Berlin: Lebenszeichen
36 Lagebesprechung
37 Ost-Berlin, 3. Oktober 1964: Wieder eine Falle?
38 Strelitzer Straße 55
39 West-Berlin: Das Wiedersehen
40 Der dritte Mann
41 Der tote Grenzsoldat
42 Die Hochzeit
Anhang
Chronik der Berliner Mauer
Informationen zu Begriffen und Personen
Tipps für weiterführende Informationen
Maja Nielsen, 1964 in Hamburg geboren, absolvierte an der Hamburger Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ein Schauspielstudium. Seit 1998 arbeitet sie als Autorin, ihre Geschichten sind als Bücher, Hörbücher und Rundfunk-Features erschienen. Maja Nielsens erfolgreiche Abenteuer!-Reihe im Gerstenberg Verlag wurde vielfach ausgezeichnet. Für das Hörspiel Feldpost für Pauline erhielt sie 2009 den Deutschen Kinderhörspielpreis. Das gleichnamige Buch im Gerstenberg Verlag wurde zu einem Long- und Bestseller. Für das 2018 erschienene Buch Tatort Eden 1919 erhielt sie den Jugendbuchpreis Friedolin der Stiftung Weltethos.
Maja Nielsen und der Gerstenberg Verlag danken Joachim Neumann sehr herzlich für die Zusammenarbeit bei diesem Buch.
1
Ost-Berlin, Dezember 1961Grenzübergang Friedrichstraße
Er hält die dunkelbraune Aktentasche, die ihm der Kurier gegeben hat, fest in der Hand, als er die Friedrichstraße entlang auf den Grenzübergang zugeht. »Ernst Lämmli«, ruft er sich den Namen, der in seinem Pass steht, ins Gedächtnis. »Ich bin Ernst Lämmli, Schweizer, 17 Jahre, aus Zürich, geboren am 4. Juni.« Kalt ist es. Handschuhe hat er nicht dabei. Seine Finger fühlen sich eisig an und sein Atem bildet Nebelschwaden. Als er seine freie Hand in die Manteltasche schiebt, berühren seine Finger das Straßenbahnticket aus Zürich. In seiner Hosentasche klimpert etwas Schweizer Münzgeld. Der Kurier hat wirklich an alles gedacht: Pass, Geld, Fahrkarte – alles echt. Wenn sie ihn durchsuchen, werden sie keinen Verdacht schöpfen. »Nur das Maul aufmachen darfst du nicht!«, hat ihm der Kurier eingebläut. »Sobald du den Mund aufmachst, bist du geliefert. Dann merken sie, dass die Sache stinkt!« Klar – er hat keinen blassen Schimmer, wie Züricher Dialekt klingt. Er kennt keinen Schweizer. Er kennt noch nicht mal jemand, der einen Schweizer kennt. Er darf sich von den Grenzern nicht in ein Gespräch verwickeln lassen. Um keinen Preis. Falls es zum Verhör kommt, fliegt seine Tarnung auf.
Alles andere ist hieb- und stichfest. In der Nacht zuvor hat er sorgfältig sämtliche Schilder aus seiner Kleidung herausgetrennt. Dass seine Mutter die Klamotten im HO-Warenhaus am Alex gekauft hat, ist nicht mehr nachvollziehbar. Sogar seine Unterhose ist unverdächtig. Neutral wie die Schweiz. Nichts wird ihn verraten – solange er die Klappe hält.
In seiner Aktentasche befindet sich nichts, was auf seine Herkunft hindeuten könnte. Keine Geburtsurkunde, kein Zeugnis, kein Foto von seiner Familie. Er hat nichts von dem mitgenommen, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat. Bis auf eine einzige Sache. Er war schon fast unten an der Haustür, da war er noch mal umgekehrt. Er hatte die Tasche erneut geöffnet und behutsam den kleinen Teddy hineingelegt, den Chris ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Chris hatte das abgewetzte Kerlchen irgendwo gefunden und ihm das eingerissene Bein sorgfältig wieder angenäht. »Er humpelt zwar etwas, aber was macht das schon. Er soll dir Glück bringen. Alles Gute zum Geburtstag, Achim!«, hatte sie mit einem verschmitzten Lächeln gesagt, als sie ihm den Bären mit Schleife um den Hals überreichte. Und dann hatten sie sich geküsst. Zum ersten Mal.
Einen Glücksbringer kann ich heute wirklich verdammt gut gebrauchen, dachte er, als die Schlösser der Tasche zuschnappten und er endgültig das Haus verließ.
Chris weiß nichts von seinem Plan. Verabschiedet hat er sich auch nicht von ihr. Je weniger Menschen eingeweiht sind, desto besser. Nein, jetzt nicht traurig werden!, befiehlt er sich. Chris würde ihn vergessen und er sie sicher auch. Es war ja auch nicht wirklich etwas gewesen zwischen ihnen. Sie ist nur eine gute Freundin, die beste Freundin seiner Schwester. Na gut, der Kuss. An seinem Geburtstag. Aber es war ja nur der eine Kuss. Auch wenn er seitdem ständig daran denken muss. Sogar jetzt, wo er ganz andere Sorgen hat. »Mach’s gut, Chris! Für immer«, murmelt er kaum hörbar, als der Grenzübergang in Sicht kommt. Er wird sich neu verlieben. Irgendwann.
Als er jetzt auf den Posten zugeht, fühlt er nichts als kalte Angst. Angst, dass man seine gefärbten Haare erkennt. Angst, dass man die Angst in seinem Gesicht bemerkt. Aber dem Grenzer scheint nichts aufzufallen.
Ernst Lämmli sieht ihm auf dem Foto im Pass so ähnlich, als sei er sein Zwillingsbruder. Beide haben blaue Augen und beide blicken unbehaglich drein. Als stünden sie nicht gern im Mittelpunkt. Sogar die gleiche rundliche Gesichtsform haben sie. Nur eben, dass Lämmli blond ist und er selbst eigentlich dunkle Haare hat.
Also hatte er sich gestern gleich nach dem Treffen mit dem Kurier in der Drogerie am Alex Entfärber für die Haare besorgt. Und sich heute Morgen nach dem Duschen das Zeug auf den Kopf geklatscht und sorgfältig einmassiert. Aber als er nach der angegebenen Wartezeit das Handtuch lüftete und in den Spiegel sah, waren seine Haare nicht blond, sondern rot. Er sah aus wie ein Clown. Auffälliger ging es nun wirklich nicht. Was sollte er jetzt tun? Der Vater und die Schwester waren bereits zur Arbeit gegangen. Sie hatten sich verabschiedet wie jeden Morgen, um kein Aufsehen zu erregen. Nur die Mutter war noch in der Wohnung. Wie immer wusste sie Rat. »Katrin!«, sagte sie knapp, zog sich die warme Jacke an, reichte ihm eine Mütze und war bereits an der Tür. »Die geht wegen dem Baby gerade nicht auf Arbeit. Die bringt das wieder in Ordnung. Hat ja Frisöse gelernt. Und plappern wird sie bestimmt nicht.« Schließlich waren sie seit Ewigkeiten befreundet.
»Frag nicht warum, mach Achim blond«, hatte seine Mutter zu der überraschten Katrin statt einer Begrüßung gesagt, als die ihnen die Wohnungstür öffnete. Zum Glück waren Katrin und das Baby allein. Katrin nickte nur, stellte tatsächlich keine Fragen und machte sich gleich an die Arbeit. Der Säugling spielte auch mit. Einwandfrei. Der schlief während der gesamten Prozedur.
Als Achim schließlich so aussah wie der Schweizer, dessen Pass er von dem Kurier erhalten hatte, verließen sie Katrins Wohnung. Noch im Treppenhaus verabschiedete sich die Mutter von ihrem Sohn. Kurz und knapp. Ohne große Worte. Ohne Umarmung. Sie sagte einfach nur beiläufig: »Na, dann mach’s mal gut!« Er nickte seiner Mutter zu. Weg war sie. Drehte sich nicht mal mehr an der Haustür zu ihm um. Als wäre es kein Abschied für immer. »Der Junge braucht für das, was er vorhat, einen klaren Kopf«, hatte die Mutter allen eingetrichtert. Die Familie verkniff sich jede Gefühlsduselei. Und das war gut so, fand er. Es gab nun mal keine andere Lösung. Er musste weg aus diesem Land.
Er war aus der Haustür ins Freie getreten und hatte sich zum Alex aufgemacht. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, war dort jede Menge Betrieb. Die Straßenbahnen ratterten über den belebten Platz. Die Leute kauften wie verrückt Geschenke ein. Auf dem Weihnachtsmarkt konnte er im Gedränge unauffällig die Zeit totschlagen. Zu Hause in Oberschöneweide würde er mit seinen blonden Haaren nur dumm auffallen. Da wusste jeder, dass das nicht seine normale Haarfarbe war. Wie hätte er seinen Freunden seinen blonden Haarschopf erklären können? Gar nicht!
Der Grenzübertritt sollte erst am späten Abend erfolgen – bis dahin würde er sich auf dem Weihnachtsmarkt aufhalten. Abends war am Grenzübergang Hochbetrieb. Die ganzen Theaterbesucher aus dem Westen mussten dann zurück. Bis Mitternacht mussten alle Besucher über die Grenze gegangen sein.
Der Kurier hatte zu ihm gesagt: »Jeder, der vom Osten in den Westen geht, hat die Grenze ja schon einmal in umgekehrter Richtung passiert. Du musst dich also beim Übergang auskennen. Sonst fällst du den Grenzern sofort auf.« Er hatte ihm die verschiedenen Stationen, die er durchlaufen würde, daher haarklein erklärt.
»Vor dem Grenzübergang in der Friedrichstraße steht der erste Posten. Gleich unten vor dem Gebäude. Der will nur deinen Pass sehen. Die erste Passkontrolle ist schnell erledigt. Jedenfalls, wenn du kein Ostdeutscher bist. Die Ostler werden gar nicht erst reingelassen. Du bist Schweizer, dich lässt er durch. Du gehst dann durch einen Gang und kommst in einen Raum, wo sich der zweite Posten befindet. Zwei Männer. Einer davon ist mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Hinter dem Tresen steht der andere. Der nimmt dir deinen Pass ab und geht damit ins Hinterzimmer. Für die zweite Kontrolle brauchst du Nerven. Der mit der Knarre behält dich im Auge. Und dann lassen sie dich erst mal zappeln.«
»Wie lange?«, hatte er gefragt.
»Unterschiedlich«, hatte der Kurier geantwortet und mit den Achseln gezuckt. »Aber egal, wie lange sie dich hinhalten, werd nicht nervös! Im Hinterzimmer nehmen sie den Pass genau unter die Lupe. Sie prüfen, ob das Foto ausgetauscht wurde. Ob der Stempel auf dem Bild nachgemacht wurde. Blättern den Pass von vorne bis hinten durch. Kommen immer mal wieder raus und sehen dir prüfend ins Gesicht. Bleib die ganze Zeit über ruhig. Dein Pass ist sauber. Sie können nichts finden. Der Pass ist echt!«
Das war das Geniale an dem Plan. Der Pass war echt. Nur der Mensch war gefälscht. Aber darauf mussten die Posten erst einmal kommen. »Und danach?«, hatte er gefragt.
»Wenn du die technische Passkontrolle überstanden hast, dann lassen sie dich zu einer Treppe gehen, die zum Bahnsteig führt. Oben fährt die S-Bahn nach West-Berlin. Unten an der Treppe steht noch mal ein bewaffneter Doppelposten. Das ist die letzte Hürde. Da sehen sie sich deinen Pass zum dritten Mal an. Und dann untersuchen sie deine Tasche. Wenn ihnen bei deinen Sachen irgendetwas komisch vorkommt, können sie eine körperliche Untersuchung – eine Leibesvisitation – anordnen. Aber mit der Tasche ist ebenfalls alles in Ordnung. Mach dir also nicht allzu viele Gedanken.« Der Kurier hatte ihm zur Sicherheit noch eine abgerissene Kinokarte aus Zürich gereicht, die er als Lesezeichen zwischen die Buchseiten des Reiseführers von Ost-Berlin legen sollte.
Ja – es würde alles glattgehen. Solange er nicht mit den Grenzern sprach. Sollte es jedoch zu einem Verhör kommen, dann wanderte er direkt ins Gefängnis. Für sehr, sehr lange Zeit. Studieren lassen würden sie ihn hinterher auch nicht mehr. Sein Leben konnte er dann vergessen. »Keine Sorge«, hatte ihn der Kurier beruhigt. »Normalerweise kriegen sie die Zähne nicht auseinander. Eigentlich wird beim Übergang nicht groß gesprochen.« Eigentlich. Und was, wenn doch?
Gegen 22 Uhr hatte er den Weihnachtsmarkt schließlich verlassen.
Und nun geht es los. Er bewegt sich nicht schneller als diejenigen, die um diese Zeit noch auf der Friedrichstraße unterwegs sind, und auch nicht langsamer. Da ist der Grenzübergang. Er steuert auf den ersten Posten zu. Zeigt seinen Pass. Und ist durch. Der zweite Posten verhält sich ebenfalls exakt so, wie der Kurier beschrieben hat. Achim ist auf die prüfenden Blicke eingestellt. Nicht mal mit der Wimper zuckt er, als sie ihn immer wieder anstarren. Schließlich schiebt ihm der Grenzer wortlos den Pass zu und deutet auf den Ausgang zur S-Bahn. Bis hierhin ist alles gutgegangen. Jetzt die letzte Hürde: die Kofferkontrolle.
Der Posten ist kaum älter als er selbst. Sieht entspannt aus. Lockerer Typ, trotz Uniform. Mit dem wird es ja wohl keinen Ärger geben, denkt Achim. »Sie sind aus der Schweiz nach Berlin gereist, um sich unsere schöne Hauptstadt anzusehen?« Das war eine Frage, wird Achim klar. Sofort ist er alarmiert. Der junge Grenzsoldat sieht ihn an. Er erwartet eine Antwort! In der ersten Schrecksekunde schnappt Achim hörbar nach Luft. Hat der Typ mitbekommen, dass ihm gerade das Herz in die Hose gerutscht ist? Nee, der Grenzer hat die Nase in seine Tasche gesteckt und fischt etwas aus dem Reiseführer. Die Kinokarte aus Zürich. Jetzt sieht er ihn wieder an, immer noch in Erwartung einer Antwort. Panik steigt in Achim auf. Ein Grenzsoldat in Plauderlaune – das ist das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann. Angst breitet sich im ganzen Körper aus. Seine Beine fangen an, nervös zu kribbeln. Oben hält gerade eine S-Bahn. Die Türen öffnen sich rumpelnd. Am liebsten würde er seine Tasche schnappen und einfach wegrennen. Die paar Stufen zum Gleis hoch und ab in die Bahn. Aber da käme er sicher nicht weit. Der andere Posten hält die Maschinenpistole fest in den Händen, den Finger am Abzug. Was jetzt? Wo ist der Ausweg? Was kann er nur tun?
Und da fällt plötzlich alle Angst von ihm ab und er wird ganz ruhig. Er begreift, dass der Grenzer ihn nicht aushorchen will, der will sich einfach nur unterhalten. Der langweilt sich. Er muss ihm die Neugier irgendwie austreiben. Was ist noch mal die Frage gewesen? Ob er sich die Hauptstadt angesehen habe? Achim gibt ein zustimmendes Grunzen von sich. Das sollte dem Grenzer klarmachen, dass Achim nicht mit ihm plaudern will. Doch als sei er durch den vagen Grunzlaut zu einer Unterhaltung ermuntert worden, schiebt der Posten gleich die nächste Frage nach. »Hat es Ihnen denn bei uns gefallen?« Er stützt sich auf dem Tresen ab und beugt sich Achim erwartungsvoll entgegen. Es ist offensichtlich, dass er von dem jungen Schweizer ein Loblied auf die Sehenswürdigkeiten Ost-Berlins erwartet. Den Alex, die Karl-Marx-Allee. Dieses Mal mischt Achim dem Grunzen ein unfreundliches Knurren bei. Dabei sieht er gelangweilt an dem Mann vorbei. Seine ganze Haltung sagt: »Quatsch mich nicht an, du Suppenkasper. Ich bin Schweizer! Ein Mann von Welt. Ich will mich nicht mit dir unterhalten.«
Der Grenzposten hat es anscheinend endlich kapiert. Er knallt den Pass auf den Tresen und wendet sich grußlos ab. Achim kann gehen. Er nimmt die Papiere an sich und steigt in die nächste Bahn. Er lässt sich auf einen leeren Sitz fallen, nimmt die Aktentasche auf die Knie und sieht während der Fahrt starr geradeaus. Übelkeit steigt in ihm auf. Als er in West-Berlin am Bahnhof Zoo aus der Bahn aussteigt, muss er sich in den Abfalleimer, der auf dem Gleis steht, übergeben.
Danach setzt er sich benommen auf eine Bank. In einer Stunde wird ihn der Kurier hier treffen. Er wird den Schweizer Pass und die Aktentasche wieder an sich nehmen und ihn zur Notaufnahmestelle in Marienfelde begleiten. Jetzt ist er also im Westen! Die Spannung, die ihm seit Tagen im Nacken sitzt, fällt langsam von ihm ab.
Während er auf den Kurier wartet, fragt er sich, ob das richtig war, was er da gerade durchgezogen hat. Seine Gedanken wandern zurück zum Sommer. Da war die Welt für ihn im Großen und Ganzen noch in Ordnung. Besonders an dem Tag, an dem er Chris kennenlernte.
2
Chris
Es war ein heißer Julitag, als er Chris das erste Mal begegnete. Derselbe Tag, an dem er nach seiner Augenoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Er hatte endlich sein Schielen beheben lassen. Am Tag zuvor hatte der amerikanische Präsident John F. Kennedy seine berühmte Rundfunkansprache gehalten. West-Berlin sei eine Insel der Freiheit inmitten der kommunistischen Flut, hatte der Präsident gesagt. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung hinter dem Eisernen Vorhang. Und ein Schlupfloch für die Flüchtlinge.
Das einzige Schlupfloch, das es noch gab. Denn nur in West-Berlin konnten Ostdeutsche über die Grenze. Und zum Ärger der Russen nutzten Tausende Menschen eben dieses Schlupfloch zur Flucht.
Im Juli sprachen die Zeitungen von einem kalten Krieg, der jeden Augenblick heiß werden konnte. Kennedy hatte erklärt, dass Amerika für den bevorstehenden Kampf mit der Sowjetunion massiv aufrüste. In Berlin wusste jeder, dass der Kriegsschauplatz der Großmächte nicht Moskau oder Washington sein würde. Sondern Berlin.
Chris kam einen Tag nach der Rede des amerikanischen Präsidenten mit seiner jüngeren Schwester Bea zu ihnen nach Hause. Die Mutter hatte schon das Abendessen fertig. »Diese Zicke«, schimpfte sie lauthals, während sie die Teller auf den Tisch stellte.
»Wer – ich?«, fragte Bea, die gerade mit ihrer Freundin im Schlepptau zur Tür hereinrauschte.
»Nee, die Frau aus dem Konsum!«, antwortete die Mutter und musste herzlich über das Missverständnis lachen. Sie hatte sich über die Kassiererin im Lebensmittelgeschäft geärgert.
»Das ist Chris!«, stellte Bea das zierliche Mädchen mit den dunklen Locken der Familie vor. Chris war wie Bea Lehrmädchen an der Akademie der Wissenschaften. Die beiden wurden an der staatlichen Forschungseinrichtung zu physikalisch-technischen Assistentinnen ausgebildet. Sie unterstützten die berühmtesten Forscher Deutschlands im Labor bei ihren Versuchsaufbauten und an den Messgeräten. »Ich bin jetzt mal mindestens einen Kopf größer geworden!«, hatte seine Schwester stolz wie Bolle verkündet, als sie letztes Jahr ihren Lehrvertrag im Institut für Kristallstruktur-Forschung unterschrieben hatte. Chris hatte sie im Samstagskurs kennengelernt.
»Bea hat uns ja schon so viel von dir erzählt«, hieß die Mutter Chris willkommen. Die Eltern freuten sich immer, wenn sie ihre Freunde mit nach Hause brachten.
»Schön, dass du uns mal besuchst«, begrüßte auch der Vater den Gast.
»Und der Pirat da – das ist mein Bruder Achim!«, rief Bea aufgedreht.
Pirat deswegen, weil sein rechtes Auge nach der Operation mit einem Pflaster zugeklebt worden war. Das andere schielte noch etwas. Das musste sich erst noch kräftigen. Er sah bestimmt bescheuert aus mit seinem Schielauge. Das wurde ihm jetzt peinlich bewusst, wo dieses Mädchen vor ihm stand. Bea hatte schon einiges von Chris berichtet: dass sie total gut in Mathe war und mit ihr für die Prüfung lernte. Dass sie aus einem kleinen Dörfchen im Erzgebirge stammte und ihr Vater gestorben war, als sie noch ein Kind war. Manchmal fühlte sie sich in Berlin wie ein Landei. Deswegen hatten Bea und ihre Freundin Janna sich ihrer angenommen. Das Einzige, was Bea vergessen hatte zu erwähnen, war, dass Chris verdammt gut aussah. Oh Mann, was für schöne Augen, hatte Achim gedacht. Nachdenklich, wach, freundlich, klug wirkte sie. Kohlschwarze Locken rahmten ihr ernstes Gesicht ein. Sie gefiel Achim sofort. Auch ihr Kleid. Eigentlich gar nichts Besonderes, ein blaues schlichtes Kleid, aber es sah einfach gut an ihr aus. Betonte ihre blauen Augen. Und ausgerechnet an diesem Abend muss er so verpriemelt aussehen, wie man nach einer Augenoperation eben aussah. »Mein Bruder kommt gerade erst aus dem Krankenhaus«, erklärte Bea Chris seinen Zustand. »Seine Schule hat seine Klasse für eine ganze Woche in ein militärisches Übungslager der Nationalen Volksarmee geschickt. Und da hat er sich halt schnell mal eben das Auge operieren lassen, um dem zu entgehen.«
Chris sah Achim überrascht an. »Wirklich? Da legst du dich lieber unters Messer?«, fragte sie erstaunt nach. Sie hatte eine überraschend tiefe Stimme. Dieses Mädchen, so zierlich sie war, pustete sicher so schnell niemand um.
»Na ja, ich hätte mir nicht unbedingt den Arm amputieren lassen«, antwortete Achim mit einem schiefen Grinsen. »Die Augen-OP stand ohnehin irgendwann mal an.«
»Vielleicht nicht den Arm, aber den kleinen Finger schon«, übertrieb Bea mal wieder maßlos. »Mindestens. Mein Bruder hasst alles Militärische. Damit kannst du ihn jagen.«
»So, lassen wir jetzt mal das Gespräch über abgetrennte Gliedmaßen. Jetzt wird gegessen«, bestimmte der Vater trocken und setzte sich an den gedeckten Tisch. »Was gibt es denn heute, mein Schatz?«
»Würstchen mit Kartoffelsuppe. Nur leider ohne Würstchen«, redete sich die Mutter erneut in Rage. »Nun gab es schon mal die gute Fleischwurst im Konsum. Das ist ja selten genug. Und als ich die Wurst bezahlen will, da gibt diese doofe Zicke von Verkäuferin mir doch die Ware nicht! Und das, obwohl sie mich kennt und weiß, dass ich keine West-Berlinerin bin. ›Kein Ausweis, keine Wurst!‹, hat sie mich angeschnauzt. Ich hatte den blöden Ausweis zu Hause in der Schublage liegen!«
Ohne Ausweis konnte man sich in Ost-Berlin nicht mal einen Bleistift kaufen. Weil die Waren im Osten viel günstiger waren als im Westen, durfte man die nur einkaufen, wenn man nachweisen konnte, dass man auch hier wohnte.
»Die können die Waren so billig machen, wie sie wollen – die Leute hauen trotzdem in den Westen ab«, brummte der Vater, der als Werksleiter einer Schiffsbaufirma von Woche zu Woche ratloser wurde. »Bei uns im Betrieb kann kaum noch gearbeitet werden, weil fast alle Facharbeiter weg sind. Und ich kriege auch keinen Ersatz mehr ran – Handwerker sind Mangelware geworden.«
»Wenn sie den Handwerkern ihre Betriebe wegnehmen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn die in den Westen rübermachen!«, sagte die Mutter, während sie eine zweite Portion Suppe für alle in die Teller schöpfte. »Das haben sie nun von der Verstaatlichung!«
»Bei uns in der Akademie können sie ein großes Forschungsprojekt nicht mehr weiterführen, weil zwei wichtige Wissenschaftler weg sind«, sagte Bea. »Die werden jetzt als Verräter beschimpft. Ganz übel, wie man über die redet.«
Die Fluchtwelle, die gerade rollte, übertraf alles bisher Gekannte.
»Jeden Tag hauen im Schnitt tausend Leute nach West-Berlin ab, sagen sie im Rias. 30 000 Menschen im Monat!« Der sonst so vorsichtige Vater schien Chris auf Anhieb zu vertrauen. Sonst hätte er nicht offen vor ihr zugegeben, dass sie Westradio hörten. Dafür konnte man richtig Ärger bekommen. Sogar Gefängnisstrafen wurden neuerdings verhängt, wenn sie einen erwischten. »Irgendwann werden sie West-Berlin komplett abriegeln, um die Leute von der Flucht abzuhalten«, prophezeite er. »Bevor hier keiner mehr zum Arbeiten kommt.«
Bea musste herzlich lachen. »Vati, die können doch niemals alles abriegeln!«
»Stimmt, das geht nicht!«, widersprach auch Achim seinem Vater. »Wer sich hier auskennt, findet immer ein Schlupfloch nach drüben.«
»Na, dass du dich da mal nicht täuschst, mein Sohn. Der Deutsche ist gründlich.«
»So, jetzt gibt es noch ein Stück Käsekuchen als Nachtisch«, lenkte die Mutter das Gespräch weg von der Politik. Chris und Bea halfen ihr mit dem Geschirr, Achim durfte wegen seines operierten Auges nicht mithelfen. »Du läufst sonst noch mit der Suppenschüssel gegen die Wand«, zog ihn seine Schwester auf und boxte ihn in die Seite.
»Chris, was machst du denn in den Sommerferien? Hast du schon Pläne?«, hörte er die Mutter auf dem Weg in die Küche fragen.
Achim spitzte die Ohren. Er wollte unbedingt wissen, was die Elfe antwortete. Denn so sah Chris tatsächlich ein bisschen aus. Wie eine Elfe. Aber eine, die richtig anpacken konnte. Eine, auf die Verlass war.
»Also, ein paar Tage fahre ich natürlich zu meiner Familie ins Erzgebirge«, antwortete Chris. »Ich muss unbedingt sehen, was für Fortschritte meine kleine Schwester gemacht hat.«
»Wie alt ist sie denn?«
»Letzten Monat zwei geworden.«
»Das ist vielleicht ’ne Süße!«, mischte sich jetzt Bea ins Gespräch ein. »Chris, du musst meiner Mutti unbedingt mal das Foto zeigen, das bei dir im Wohnheim hängt.«
»Und was ich sonst mache, weiß ich noch nicht so genau. Mal sehen!«, sagte Chris gerade, als die drei mit Kaffee und Kuchen zurück ins Esszimmer kamen.
»Komm doch mit Achim und mir an die Ostsee«, schlug Bea vor. »Wir gehen zelten auf der Insel Usedom. Mit tausend Leuten. Die ganzen Abiturienten aus Achims Klasse. Und noch andere, die früher mal auf Achims Schule waren. Janna ist wahrscheinlich auch dabei. In meinem Zelt ist noch genug Platz. Du musst dir nur einen Schlafsack organisieren.« Janna war Beas andere hübsche Freundin von der Arbeit. Hase, Achims bester Freund, hatte sich total in sie verguckt.
»Einen Schlafsack?«, murmelte Chris bedauernd. »Hm. Hab ich nicht.«
»Ach, weißte«, fiel Achim sofort eine Lösung ein, »Hase würde dir bestimmt den Schlafsack von seinem kleinen Bruder ausleihen.«
Hase kam natürlich auch mit. Hoffte gerade inständig, dass auch Janna mit von der Partie war.
»Echt?«, fragte Chris und sah Achim lächelnd an. »Na, wenn das so ist – dann komme ich gern mit. Ich war noch nie an der Ostsee.«
»Na, Achim?«, fragte seine Mutter, als Bea und Chris in der Küche verschwunden waren, um dort zusammen für ihre Matheprüfung zu lernen. »Wie geht es dir denn jetzt mit deinem operierten Auge?«
»Gut!«, antwortete Achim.
»Wirklich – gut?«, fragte seine Mutter noch mal nach.
»Ja, wie ein Blinder, der plötzlich sehend geworden ist!«, sagte er mit einem kleinen Lächeln.
3
West-Berlin, Bahnhof Zoo
Auf dem Bahnsteig zu warten ist keine gute Idee. Es zieht wie Hechtsuppe. Eisig kalt ist es, aber Achim wagt nicht, vor das Bahnhofsgebäude zu gehen und sich an irgendeinem Bratwurststand aufzuwärmen. Verabredet ist verabredet. Am Ende verpasst er noch den Mann, den er treffen soll. Er ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben allein, ohne die Möglichkeit, seine Familie zu kontaktieren, wird ihm bewusst. Und es gibt kein Zurück mehr.
Er schlägt den Jackenkragen hoch und bläst sich warme Luft in die Hände. Wie schön warm es doch im Sommer war! An der Ostsee. Mit allen Freunden. Und mit Chris. Sofort kommt das geniale Gefühl vom Sommer aller Sommer zurück. Denn dass diese Ferien einzigartig waren, das war ihm schon damals klar. Auch wenn am Ende nichts mehr in ihrem Leben so war wie vorher.
4
Ostsee, Insel Usedom, Sommer 1961
Was für ein irres Glück sie mit dem Wetter hatten! Alles passte. Das Abi hatten sie in der Tasche. Achim hatte die Zusage aus Cottbus erhalten, gleich nach den Ferien konnte er sein Studium zum Bauingenieur beginnen. 16 Leute waren dieses Mal dabei: Bea und ihre beiden Freundinnen, Hase und Lampe, die schon letztes Jahr ihr Abi auf der Nansen-Oberschule gemacht hatten, und außer Achim noch zehn Freunde aus seiner Abschlussklasse. Alle freuten sich, dass das Leben jetzt endlich losging.
Der Mann vom Zeltplatz war klug genug gewesen, sie außerhalb der Hörweite der anderen Camper zu platzieren. Sonst hätte es todsicher ätzende Kommentare wegen der Musik gegeben. Amerikanische Musik! Damit fiel man politisch doch sofort negativ auf. Abends am Lagerfeuer wurde immer auf der Gitarre herumgeklimpert. Bei Hound Dog in der Rhythm-and-Blues-Version von Elvis grölten dann alle mit.
Hase und Janna waren gleich am ersten Tag der Ferien zusammengekommen. Und Achim und Chris – na ja, ein Paar waren sie nicht geworden. Aber gefunkt hatte es schon zwischen ihnen. Zumindest bei Achim. Chris und er unterhielten sich an der Ostsee viel miteinander. Bea redete meist mit, solange sich das Gespräch um die Forschungsprojekte an der Akademie der Wissenschaften drehte. Aber wenn es um Politik ging, verdrückte sie sich irgendwann und ging lieber mit den anderen schwimmen. Dann hatte Achim Chris für sich. Er genoss die Gespräche mit ihr. Sie hatte einen messerscharfen Verstand. Auch wenn sie viele Dinge, die gerade passierten, ganz anders als Achim sah. »Du beschwerst dich ständig, dass du in die FDJ eintreten musstest, um einen Studienplatz zu ergattern«, sagte sie mit einem leichten Augenrollen zu ihm.
Achim hatte den Satz seines Lehrers immer noch in den Ohren: keine Mitgliedschaft bei der FDJ – kein Studienplatz.
»Ja, das ist doch idiotisch!«, fuhr er auf. »Ich geh bestimmt nicht zu den Treffen. Freie Deutsche Jugend – was daran frei sein soll, wenn ich gezwungen bin, dort einzutreten, um einen Studienplatz zu kriegen – das muss man mir erst mal erklären. Was hat die Mitgliedschaft in dem Verein denn mit einem Studium zu tun?«
»Stimmt!«, gab ihm Chris recht. »Das ist idiotisch! Aber in Westdeutschland ist auch nicht alles Gold, was glänzt!«
»Natürlich nicht!«, räumte er ein. »Und woran denkst du jetzt dabei genau?«