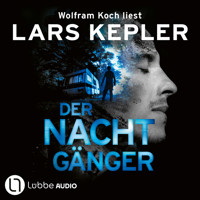6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein packender Roman im Italien der 1990er Jahre über das größte aller Spiele – das Spiel um Macht, Geld, Einfluss. Drei Männer, in Neapel, Mailand und Rom, ereilt das Schicksal: Pitagora Di Bene, skrupelloser Politiker und zynischer Philosoph, Gianni Corte, ein von hemmungslosem Ehrgeiz getriebener Manager mit Sinn für Frauen, und Corrado Spina, der beste der römischen Skandal-Journalisten und der charmanteste. Alle drei werden von ihren Machenschaften eingeholt und erfahren, dass sich das System von Korruption und Mafia längst verselbstständigt hat. Das System, in dem sie jahrelang erfolgreich und rücksichtslos ihre Ziele verfolgt haben, wendet sich gegen sie. Heinz-Joachim Fischer kennt Italien seit Langem als politischer Journalist. Deshalb kann er die Leser im »Turm des Griechen« hinter die Kulissen jener dunklen Zeit führen, die in Italien als die »Jahre des Schlamms« immer noch gegenwärtig ist: Ein gefährlich-schillerndes Bild der italienischen Gesellschaft, gestern und heute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Heinz-Joachim Fischer
Der Turm des Griechen
Roman
Der Turm des Griechen ist ein Roman. Weil die Handlung der Wirklichkeit und der Geschichte entsprechen soll, sind die beschriebenen Personen und Ereignisse der Gegenwart erfunden. Die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ist beabsichtigt, Gleichheit mit Personen und Ereignissen jedoch rein zufällig und daher auszuschließen.
Montag
1. Aussichtsreiches Arbeitstreffen auf einem Friedhof hoch über Neapel
Sie waren auf die Minute pünktlich.
An jenem Montagmorgen in Neapel.
Hoch über der Stadt, auf dem Weg zum Friedhof.
Kurz vor halb neun, genau um 8.28 Uhr, näherten sich auf der Via Nuova del Campo – einer für die aus der Stadt Kommenden mehrkurvigen, kräftig ansteigenden Ausfallstraße, einem für die anderen, von den Autobahnen Herandrängenden und vom Platz davor Einbiegenden auf den ersten Metern leicht abfallenden, geraden Fahrdamm – in beherrschtem Tempo zwei dunkle Limousinen einander. Die eine, von unten her, aus der Stadt, in fast schwarzem Grau, deutscher Produktion; die andere, von oben, von der Autobahn her, in tiefem Blau, italienischen Fabrikats. Die dunklen Wagen waren der gehobenen Mittelklasse oder der unteren Oberklasse zuzurechnen, je nach persönlichem Stand oder weithin gebräuchlicher Einstufung – was aus italienischer Sicht in Verbindung mit der Farbe stets und unweigerlich die Zuweisung in die Oberklasse zur Folge hatte, sowohl des Wagens als auch seiner Insassen, zumindest des im Innern rechts hinten vermuteten Besitzers. Beide Limousinen wurden von zwei kleineren, durch und durch unauffälligen Autos begleitet; der oberen Unterklasse oder unteren Mittelklasse zugehörig, wenn man überhaupt einer solchen Einordnung irgendeine Bedeutung beimessen, eine endgültige Festlegung sich jedoch noch vorbehalten wollte. Gleichviel.
Die vier Personenkraftwagen hielten langsam vor der Einfahrt zum Camposanto Santa Maria del Pianto. Der Name des Friedhofs, »Maria Schmerz« oder »Sankt Marien zu den Tränen« oder gar »Maria vom Weinen«, brachte in Neapel die ebendort hochverehrte Jungfrau und Gottesmutter Maria zunächst mit Jammern und Schluchzen, mit Leid und Kummer, mit Weh und Ach, Totenklagen und, kurz, allem Weltschmerz in Verbindung. Doch geschah dies, wie sofort im Interesse aller gläubigen und ungläubigen, abergläubischen oder aus langer Tradition seit der Antike vielleicht heidnischen Neapolitaner hinzugefügt werden muss, nur zum Zwecke des Linderns eben dieser Kümmernisse, der Überwindung aller menschlichen, allzumenschlichen Leiden.
So hätte ein aufmerksamer Beobachter, wie etwa der am eisernen Friedhofstor lehnende Chef der städtischen Angestellten, bemerkt, dass die zwei dunkelblaugrauen Limousinen gemächlich zum Stillstand kamen, nicht nur langsam, sondern feierlich-pietätvoll, gleichsam mit gefasstem Schmerz, während hinter ihnen, wie nicht anders zu erwarten, ein Teil des neapolitanischen Verkehrs sofort ungeduldig und chaotisch anbrandete. So war es. Und der Toten-Oberwächter hätte zurecht geahnt, von der Erfahrung vieler Berufsjahre belehrt, dass diese Besucher nicht nur voll Schmerz, sondern auch mit Hoffnung kamen. So konnte es sein.
Der Fahrer des von unten, aus der Stadt kommenden Wagens, des dunkelgrauen Mercedes E der Mittelklasse, ließ dem Chauffeur des von oben, vom Largo di Santa Maria del Pianto und von der Ausfahrt Secondigliano der Stadtautobahn anrollenden Autos, eines nachtblauen Lancia Thema, die Vorfahrt. Denn jener musste links einbiegen; der Erste hatte es jedoch »mit rechts« einfacher. So konnte er gefällig sein, zugleich schützendes Bollwerk gegen die sich von hinten beinahe drückend auftürmende Blechlawine. Das Tor des Friedhofs stand weit offen; die vier Autos fuhren, ohne angehalten zu werden, ein. Beinahe jedoch hätte ein junges Moped-Mädchen direkt den Weg in und auf den Friedhof angetreten, weil es flink noch rechts vorbei wollte – wohl nur die Namensherrin des Camposanto verhinderte ein Unglück zur Unzeit. Die Wagen schoben sich in den Hangfriedhof ein, in jenen zum Meer hin abfallenden Gottesacker, den die Stadt nach der Pest von 1866 zur Aufnahme der überreichen Todesernte angelegt hatte, und glitten die nun für alle abschüssige Straße weiter bergab, langsam, feierlich und pietätvoll. Der Friedhofswächter am Eingang hatte zufällig die Personen gezählt: in jedem Wagen zwei, zusammen also acht. Es war genau 8.30 Uhr.
Pitagora Di Bene, rechts hinten in dem blauen Lancia Thema, schaute nachdenklich auf die Uhr, während links und rechts Gräber, Denkmäler und Totenhäuschen vorbeizogen. 8.31 Uhr. So hatten sie es ausgemacht; daran musste man sich halten. Pünktlich zu sein war nicht die Höflichkeit der Könige, sondern in der Demokratie eine Frage der Macht, meinte Di Bene. Zu spät zu kommen, andere warten zu lassen, das signalisierte gleich von Anfang an, wer das Sagen hatte, wer nicht um die Gunst der anderen werben musste. Unpünktlich zu sein musste man sich leisten können. Zuweilen erhöhte Pitagora Di Bene die Wirkung einer verspäteten Ankunft, indem er mit freundlichem, glattem Lächeln, ohne das geringste Gefühl ehrlichen Bedauerns eine fadenscheinige Entschuldigung bot. Das steigerte den Machtunterschied.
In diesem Fall jedoch nicht. In dem kurzen Telefongespräch gestern, am Sonntag, hatten sie beide gesagt: Gegen halb neun. Gut, gegen halb neun. Das hieß in ihrem Fall, genau um 8.30 Uhr. Er war deshalb, um pünktlich zu sein, von seiner Turm-Residenz in Torre del Greco, einer der Vorstädte Neapels, viel zu früh losgefahren und musste daher auf dem letzten Platz vor dem Friedhof, dem Largo Santa Maria del Pianto, noch etwas warten. Da hatte er in der Zeitung diese Nachricht entdeckt. Pitagora Di Benes Miene verfinsterte sich etwas. Nun gut, die Anspielung auf eine seiner Aktivitäten musste nichts bedeuten. Trotzdem, immer diese Presse! Dann hellte sich sein Gesicht wieder auf bei dem Gedanken, Ferrante Malavita werde es wohl ebenso ergangen sein, und er lächelte. Niemand von ihnen beiden wollte im Nachteil, keiner durfte im Vorteil sein. 8.32 Uhr.
»Halt bei Enrico Caruso!«, sagte Di Bene zu seinem Chauffeur. Als er dessen Ratlosigkeit merkte, fügte er hinzu: »Dort vorn in der Kurve.« Er überlegte einen Moment, ob er seinem Fahrer, einem jungen Familienvater namens Fabio – Männer mit Familie fuhren immer vorsichtiger –, erklären sollte, wer Enrico Caruso gewesen sei, schüttelte dann jedoch den Kopf. Das Volk musste nicht alles wissen.
Pitagora Di Bene stieg aus dem Auto, spürte die Überraschung im zweiten Wagen, dem dunklen Mercedes, und ging rasch auf ihn zu. Er hatte mit Ferrante Malavita »im Friedhof auf dem Platz vor der Kirche« als Treffpunkt vereinbart. Das schien unverfänglich. Denn Di Bene wusste noch nicht, ob es ratsam war, mit Ferrante Malavita öffentlich gesehen zu werden. Zu Hause oder im Büro schon gar nicht. Ein Friedhof hingegen wirkte unverdächtig. Der Tod verband alle. Die Trauer war über jeden Verdacht erhaben. Am Ende des Friedhoffahrwegs lag die Kirche.
Pitagora Di Bene wollte bewusst die Initiative ergreifen, eigenen Sinn demonstrieren, auch wenn er den Anflug von Missmut auf Malavitas Gesicht sah.
»Lassen Sie uns noch ein paar Schritte gehen«, meinte er, gewinnend freundlich. »Außerdem können wir hier Enrico Caruso unsere Reverenz erweisen. Meinen Sie nicht auch, dass unser Landsmann der größte Tenor aller Zeiten ist? Nicht dieser Pavarotti aus dem Norden! Stellen Sie sich vor, die beiden in einem Duett! Was hätte das mit der modernen Technik für Aufnahmen ergeben! Enrico hätte Luciano an die Wand, was sage ich, in Grund und Boden gesungen. Aber leider ist unser Tenor schon tot, 1921 gestorben, gerade 48 Jahre alt. Schade, schade. Ach, was gäbe ich für eine moderne Aufnahme von Caruso!« Er half Malavita beim Aussteigen.
Auch das war Ferrante Malavita unwillkommen. Es zeigte ihm, dass er, der Baron Malavita, zehn Jahre älter und schwerfälliger war als Di Bene und damit, in diesem Punkt allerdings nur, unterlegen.
»Nun ja, unser Landsmann …«, murmelte der Baron, dem auch der harmloseste Versuch von Gleichmacherei zuwider war – sei es, dass er nicht mit einem Opernsänger, mochte der noch so berühmt sein und aus Neapel stammen, auf eine Stufe gestellt werden wollte, sei es, weil er diesem Di Bene nicht gönnte, sich als Neapolitaner zu fühlen. Der stammte, wie er sich erkundigt hatte, aus Crotone in Kalabrien, ganz unten im Süden, vor 55 Jahren dort geboren. Süditaliener war nicht Süditaliener. Und überhaupt war der eine nicht wie der andere, seine Familie nicht wie jene dieses Kalabresen. Um nur keine Vertraulichkeit aufkommen zu lassen, sagte der Baron, ohne eine Spur südlicher Verbindlichkeit ziemlich barsch: »Malavita.«
»Natürlich, wer sonst?«, entgegnete Di Bene keineswegs verdutzt und überhaupt nicht geneigt, sich seinerseits vorzustellen. Als Chef der führenden Partei der Region Kampanien, des Landes von Neapel, als einer der wichtigsten Politiker des Regierungslagers, mehrmals Minister, war er im ganzen Land bekannt, also auch diesem Baron. »Kommen Sie!«, ermunterte Di Bene und fasste Malavita fest am Arm, gab seinem Fahrer ein Zeichen und verneigte sich deutlich vor Enrico Carusos Denkmal, einem Geschenk, wie die Inschrift auswies, der Bewunderer des Tenors aus den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Neapolitaner hatten hier vor allem ihre knappe Erde zur Verfügung gestellt.
Die beiden Männer schritten nun Arm in Arm bedächtig bergab. Links und rechts sahen sie auf den Terrassen des Berghangs über Neapel Denkmäler und Totenhäuschen, Gräberwände, die als Stützmauern dienten, Todesstätten, die dem Leben nachtrauerten. Zwischen diesen Malen des Todes wurde der Blick immer wieder frei auf die lebendige Stadt am Golf, den vulkanischen Kegel des Vesuvs, der, wie es sich gehört, von einer Wolke umzogen war, auf die Inseln im Meer, die im Morgendunst eher zu ahnen als zu sehen waren.
»Ja, es war richtig«, meinte Pitagora Di Bene zufrieden, »dass meine Familie Crotone am Ionischen Meer verlassen hat und hierher nach Neapel zog. Welch wunderbare Stadt! Was für eine alte traditionsreiche ›Neu-Stadt‹! Obwohl …« Di Bene ließ Malavitas Arm los, und sein rechter Zeigefinger schnellte vor. »Obwohl es Crotone im Alter fast aufnehmen kann mit Ne-a-po-lis.« Er sprach langsam und nachdenklich die Silben des griechischen Namens.
Di Bene wäre jetzt überaus geneigt gewesen, das Historische auszuführen und philosophisch zu vertiefen. Nicht umsonst trug Pitagora Di Bene in seiner Partei den Beinamen »Philosoph«, »Philosoph aus Großgriechenland«. Großgriechenland, weil einst, lange vor Christi Geburt, griechische Kolonisatoren in Unteritalien ihre Heimat, nur größer, wiederzufinden meinten. Schade, dass Geist und Bildung einen nicht in den Adelsstand erheben, hatte Di Bene schon oft gedacht. So hätte er es jetzt leichter mit diesem neapolitanischen Baron.
»Vergleichbar im Alter, und natürlich auch, was das Temperament der Leute angeht«, setzte er unvermittelt hinzu. »Ich meine, Neapel und Crotone. Aber lassen Sie uns zu den Schwierigkeiten später kommen. Kennen Sie übrigens Crotone? Ziemlich weit unten in der Stiefelspitze. Nein?« Malavita hatte gar nichts gesagt. »Nun, vielleicht kommen Sie mich einmal im Sommer besuchen. Stets willkommen. Nein, nein, es ist nicht das Haus meiner Eltern. Ich habe es vor einigen Jahren gekauft, eine prächtige Villa, auf einem Hügel über dem Ionischen Meer. Übrigens, ja, auch über einem Friedhof.«
Di Bene hielt inne. Was erzählte er da eigentlich diesem für einen Neapolitaner wenig gesprächsbereiten Baron? Wollte er renommieren? Gleich versichern, dass man in Crotone nicht die bescheidenen Verhältnisse seiner Kindheit vorfinden würde, dass er selbst es zu etwas gebracht hatte, er, Pitagora aus Kalabrien, in ganz Italien bekannt? Um diesen Eindruck abzuschwächen, fügte er boshaft hinzu: »Die Villa gehörte verarmtem Adel. Die Leute hatten nur noch Geld für zwei Diener, aber nicht mehr für die Pasta.«
»Vermutlich ein günstiges Geschäft für Sie«, schloss der Baron den Ausflug nach Crotone hier ab. »Da trifft es sich gut, dass meine Familie in Neapel geblieben ist und ich, wie mein Großvater und Vater, nun Advokat bin. Seit genau 40 Jahren. So begegnen sich unsere Interessen.« Malavita verneigte sich leicht. »So kann ich dem Recht und damit Ihnen ein tüchtiger Anwalt sein.« Er neigte bei diesen Worten noch einmal seinen Kopf und bemerkte, dass sein linkes und Di Benes rechtes Hosenbein von einem Schlammspritzer verunziert waren. Sie mussten in ein durch das Bewässern des Friedhofs entstandenes Rinnsal getreten sein: Einer hatte den anderen beschmutzt. Aber wer wen? – schoss es Malavita durch den Kopf. »Wie Sie es wünschten«, endete er.
Di Bene lächelte, scheinbar freundlich wie zuvor.
»Erlauben Sie«, der Baron rückte näher und ergriff seinerseits den Arm des Politikers. »Erlauben Sie, dass ich der Erinnerung an meine verehrte Familie nachgebe. Hier ganz in der Nähe befindet sich die Gruft eines anderen Familienzweigs, der Malatesta. Ganz recht, mütterlicherseits. Geht bis ins Mittelalter zurück, bis zu Friedrich II., dem König und Kaiser. Natürlich, Malatesta, Malavita – das ›Mala‹ betrachten wir sozusagen als höchste Auszeichnung in unserem großen Geschlecht. Es wäre eine Schande, wenn wir das je verlieren sollten oder es ganz ausstürbe. Nein, nein, nicht dass ich die Gruft jetzt suchen will. Ich weiß gar nicht, wo sie genau liegt. Natürlich, ja, mit einem herrlichen Blick über die Stadt und das Meer. Aber den haben hier alle Toten, will sagen, die trauernden Hinterbliebenen. Nein, was mir durch den Kopf geht, das sind die Grabinschriften. Nein, nicht die Zahlen, obwohl, wenn man in mein Alter kommt – ich weiß, ich weiß, meine 65 Jahre sieht man mir nicht an.«
Doch! – dachte sich Di Bene, aber mir nicht meine 55.
»In meinen Jahren, Sie haben dafür noch Zeit, legt man Wert auf günstige Vergleiche, freut sich, dass man mit 50 jung nicht mehr sterben kann. Sehen Sie, das ist es, was mich bekümmert: dass manche junge Leute von Neapel nicht alt werden, erschossen, erstochen, einfach so. Sie werden davon gehört haben, in der letzten Woche. Gar nicht zu reden von den vielen, die keine Arbeit haben, auf der Straße leben, und – Gott und dem heiligen Gennaro, unserem verehrten Stadtpatron sei’s geklagt – fast gezwungen sind, ihren Lebensunterhalt zu nehmen, wo sie ihn finden. Da bricht es mir fast das Herz, wenn ich … Vorhin habe ich es gelesen: ›Felice‹, stand da, ›kaum 19 Jahre alt. Er ließ uns zurück, ohne das Lächeln des Lebens kennengelernt zu haben.‹ Ist das nicht tragisch, dass so viele Neapolitaner das Lächeln des Lebens nicht kennen?«
Bei diesen Worten waren Ferrante Malavita und Pitagora Di Bene, der Rechtsanwalt und der Politiker – beide etwa mittelgroß, der Erste mächtiger im Körperbau und daher selbst beim Bergabgehen kurzatmig schnaufend, der Zweite ab und zu nach seiner Gewohnheit in schwierigen Situationen mit Daumen und Zeigefinger die Nase fassend –, auf dem Vorplatz der Kirche angelangt. Beide blickten sich um. Dort die bröckelnde Fassade der Kirche Santa Maria del Pianto, die unansehnlichen Gebäude daneben. Gegenüber die Gräberwände mit den Namen der Familien: Balsamo, Basso, Cacace, Castaldo … Keine davon konnte Anspruch auf die Verwandtschaftstrauer der beiden Besucher und ihres Gefolges in den Autos erheben. Sie gingen auf die Balustrade des Terrassenplatzes zu und schauten hinaus auf Stadt, Land und Meer.
Genau unter ihnen wuchs das neue Geschäftszentrum von Neapel aus dem Boden. Glitzernde, gläserne Fassaden, mächtige Stahlskelette reckten sich schon in die Höhe, umkreist von beweglichen Kränen. Beide schauten fast mit Rührung auf diese Großbaustelle inmitten elender Viertel. Ein besonderes Wohlgefallen stieg in ihnen auf. Sie empfanden jenen Stolz, den Väter beim Anblick vielversprechender Söhne und Töchter hegen, selbst wenn diese nicht unbedingt im Schoß der geheiligten Familie gezeugt sein sollten.
Dann warf Malavita plötzlich ein:
»Sollten wir nicht zur Sache kommen?«
2. Ungeduldiges Warten am Telefon in einem eleganten Büro zu Mailand
Gianni Corte blickte ungeduldig auf die Uhr.
8.30 Uhr. Noch zu früh.
Diese Politiker! Diese Journalisten! Er schüttelte missbilligend den Kopf.
Jetzt würde er noch nicht anrufen können. Alle schliefen sie in den Tag hinein, lagen noch wohlig im Bett, während der werktätige Teil der Bevölkerung oder tüchtige Leute wie er längst an der Arbeit waren.
Gianni Corte drehte sich in seinem schwarzen Lederstuhl, einem Prachtstück von Chefsessel, und schaute zufrieden in seinem Büro umher – einer Prachtausführung des bekanntesten Mailänder Innenarchitekten, teuer und elegant, aufdringlich funktional und technisch auf dem neuesten Stand. Es wäre schwergefallen, in der schwarz-weißen Einrichtung mit einigen wenigen Farbakzenten einen Stilbruch zu finden, in der Reihe der Apparate eine Lücke zu entdecken. Mit Cortes eigenem Geschmack und seiner Arbeitsweise hatte das wenig zu tun. Er war weder stilsicher noch ein Perfektionist. Seine Talente waren von anderer Art. Mit diesen hatte er gewuchert.
Ausgangs- und Endpunkt des zufriedenen Rundblicks war die Fotografie seiner Frau Daniela auf dem Schreibtisch, ebenfalls einem Prachtexemplar seiner Art. Der Schreibtisch natürlich! Das Bild zeigte eine Frau mit schwarzen Haaren, braunen Augen, einem dezent rot geschminkten Mund, einer Nase und nur einem Ohr, wegen des Halbprofils, eine Frau also, an der auf den ersten Blick nichts auffällig und nichts genau zu bestimmen war. Nicht einmal, ob sie schön, hübsch oder gepflegt aussah, da das Bild natürlich von einem international berühmten Starfotografen stammte. So fiel die Aufmerksamkeit bald auf den breiten, fast einen halben Meter großen Silberrahmen, ein Prachtwerk aus Peru vom Ende des 18. Jahrhunderts, handziseliert, und – überflüssig deswegen den amtlichen Stempel zu prüfen – massiv Silber.
»Das Wichtigste in meinem Leben! Mein größter Schatz!«, pflegte Gianni Corte mit einer elegant-demonstrativen Handbewegung Besucher darauf hinzuweisen und meinte damit nicht das Edelmetall. Da hatte er zweifellos recht. Wenn er noch hinzugefügt hätte, »und in meinem Beruf, überhaupt für meinen ganzen Erfolg«, wäre er doppelt und dreifach im Recht gewesen. Denn Gianni Corte hatte sein Glück geheiratet. Sein Vermögen – was er beruflich vermochte und was er besaß – verdankte er seiner Frau.
Vor zehn Jahren, mit 30 Jahren, hatte er überraschend Daniela Ranelli, die vierte Tochter des reichsten Mannes von Ferrara, gewinnen können. Gewinnen, war der richtige Ausdruck. Denn so wie andere unbeirrt über Jahre hinweg immer dieselben Zahlen im Lotto ankreuzen, hatte er auf Daniela gesetzt und schließlich gewonnen. Talent für Frauen besaß er, kein Zweifel. Knapp 1,80 Meter groß, schlank, doch nicht dünn, gut aussehend, doch nicht schön, suchte er immer zu gefallen und gefiel meist. Seine Treue zu Daniela oder vielmehr zu seiner Lottozahl hatte sich rentiert. Sein hartnäckig festgehaltener Vorsatz, in die reichste Familie von Ferrara einzuheiraten, war aufgegangen. Wenn auch erst im zweiten Anlauf.
Gianni Corte wollte gerade wieder prüfen, auf seiner – natürlich – prächtigen Armbanduhr, ob nun endlich die Zeit für das Telefonat gekommen und seine Sekretärin schon da sei, als Eleonora klopfte und gleich ein Fax brachte.
»Vom Admiral«, sagte sie.
Corte war zu neugierig, was der »Admiral«, Cesare Terra, Chef des Familienunternehmens, des dritt- oder viertgrößten Privatkonzerns des Landes, und zugleich sein Schwager, von ihm wollte, als dass er mit der Sekretärin zuerst die üblichen Aufmerksamkeiten am Montagmorgen nach dem Wochenende gewechselt hätte. Er schaute sie nur aufmerksam-freundlich, doch zurückhaltend an. Ich sehe sehr wohl, besagte dieser Blick zu Eleonoras Zufriedenheit, dass Sie ein besonders hübsches Kostüm tragen und es Ihnen fabelhaft steht, aber … Gianni Corte hatte eben Talent für Frauen.
»Oh, Dottore«, sagte die Sekretärin überrascht, »Sie haben einen Fleck oben auf Ihrem Sakko. Irgendetwas muss Ihnen daraufgetropft sein. Ziehen Sie es aus! Das haben wir gleich«, meinte sie resolut.
Gianni Corte blickte mit leicht gerunzelter Stirn auf das Papier. Sein Schwager hatte für Montag 19 Uhr, also heute, eine Konferenz angesetzt. »Dringend, wichtig, unaufschiebbar« stand unterstrichen da. Was sollte denn das? Die Hauptsitzung der Unternehmensführung mit den wichtigsten Chefs der einzelnen Gesellschaften fand immer am Dienstagvormittag um 10 Uhr statt. Hätte der Admiral nicht noch ein paar Stunden warten können? War Cesare Terra nervös geworden? Umso wichtiger waren seine eigenen Anrufe, sagte sich Corte.
In diesem Moment klingelte sein Privatapparat. Also seine Frau. Danielas Stimme klang noch etwas verschlafen. »Bist du gut in Mailand angekommen?« Weil ihr erster Mann bei einem Unfall wegen zu schnellen Fahrens verunglückt war, hatte sie um ihn immer Angst, wenn er mit dem Auto unterwegs war. Sie musste deshalb etwas zur Beruhigung oder zum Schlafen nehmen – was ihr dann häufig, wie gestern, die Nachricht von seiner glücklichen Ankunft vorenthielt. Gianni Corte wollte sich schon kurz, wenn auch, Gewohnheit und Talent entsprechend, liebenswürdig fassen, als ihm einfiel, es könne nichts schaden, ein wenig ausführlicher zu werden.
»Es war sehr schön gestern am Sonntag mit dir und der ganzen Familie. Da weiß man doch, warum man die Woche über hart arbeitet.« Gianni übertrieb. »Ich war sehr traurig, dass ich abends noch wegfahren musste. Alles war so voll Harmonie.« Er trug wieder etwas dick auf.
»Schade, dass Cesare nicht dabei sein konnte. Ich gönne ihm ja sein Hobby. Aber etwas mehr Familiensinn, gerade im Privaten, würde uns alle wohl mehr freuen, nicht wahr? Hast du gemerkt, Daniela, wie deine größeren Schwestern jetzt ganz stolz auf dich sind? Wie sie dich gar nicht mehr als die Kleine betrachten, sondern dich ehrlich darum bewundern, wie du Haus und Kinder in der Hand hast? Schön, dass ihr euch so gut versteht! Sogar Adina hält plötzlich große Stücke auf dich. Sie hat es mir selbst gesagt. Vielleicht hast du gesehen, wie ich lange mit ihr gesprochen habe? Und sag mal, dein Bruder Antonio, er ist ja ganz vernarrt in dich. Na, das kann ich gut verstehen«, lachte Gianni so aufrichtig durchs Telefon, dass sich an diesem eher trüben Märztag – grau bei Corte in Mailand, grau auch im 250 Kilometer östlich in der Po-Ebene gelegenen Ferrara – Sonnenglanz auf die jüngste der Ranelli-Töchter legte. »Schließlich bist du die jüngste und schönste seiner Schwestern.«
»Du bist ein Schmeichler«, gurrte Daniela durchs Telefon, völlig überzeugt davon, dass Gianni die Wahrheit sagte. »Aber du hast ganz recht, Antonio mag mich sehr gern, und er hört auf mich …«
Während Gianni Corte mit warmer Stimme die durchaus nicht immer herzlichen Beziehungen unter den Geschwistern Ranelli in ein weiches Licht rückte, notierte und rechnete er auf einem Stück Papier, nicht zum ersten Mal in diesen Tagen:
Adina – 16 (Cesare)
Benvenuta – 16
Camilla – 16
Daniela – 16 (Gianni)
Antonio – 36
So hatte der legendäre Familienpatriarch und Unternehmensgründer Gabriele Ranelli das Erbe in seinem Testament geregelt. Auf die vier Töchter Adina, Benvenuta, Camilla und Daniela – A, B, C, D, nach dem Alphabet in der Reihenfolge der Geburt – entfielen je 16 Prozent der Anteile an der Familienholding. Dem Viertgeborenen, dem Sohn Antonio, kamen 36 Prozent zu. Das entsprach in etwa auch der Geschlechtereinschätzung des »Pater familia«, wie Gabriele Ranelli sich gern auf Latein nannte, indem er alle Konsequenzen dieser Bezeichnung der alten Römer willig auf sich nahm und entschieden durchsetzte, ohne Widerspruch. Wer den Patriarchen gefragt hätte, ob er damit nicht seine Töchter zurücksetze und gering achte, wäre mit Erstaunen bedacht worden. Vielleicht hätte er zur Antwort erhalten: »Das hängt von deren Männern ab. Ordentlich und fleißig müssen sie sein.« Dies war Ranellis Hauptkriterium für seine Schwiegersöhne, mit dem allerdings wichtigen, wenn auch stark einschränkenden Zusatz: »Und aus Ferrara müssen sie stammen.« Letzteres traf auf Gianni Corte zu.
»Also mein Schatz, eine gute Woche«, sprach Gianni zärtlich ins Telefon, während er seine Rechnung beendete.
»Adina – 16 (Cesare)«, »Benvenuta – 16«, »Camilla – 16« strich er durch, »Daniela – 16« und »Antonio – 36« hob er mit einem Filzstift hervor. So hatte es der Alte sich offenbar überlegt, dachte Corte. Aus der unterschiedlichen Bewertung seiner fünf Kinder nach dem Geschlecht hatte Ranelli schon zu Lebzeiten nie ein Hehl gemacht. In seinem Testament war er präziser geworden in seiner Ungerechtigkeit. Sein letzter Wille besagte: »Die Entscheidungen in der Familienholding müssen mit Mehrheit gefällt werden. Nur eine absolute Mehrheit ist eine Mehrheit.« Das hatte Gianni Corte sich zu Herzen, besser, ins feste Kalkül genommen.
Nach dem Tod des Patriarchen war mit einstimmigem Beschluss Cesare Terra – Adinas, der Erstgeborenen, Ehemann – vom »Kapitän« zum »Admiral« erhoben worden. Wegen seiner Segelleidenschaft hatte Cesare Terra stets Spitznamen aus der Seefahrt erhalten, obwohl der Konzern in seinen Geschäften erdverbunden war. Antonio, dem, als einzigem Sohn nach vier Töchtern geboren, das Kommando eigentlich zugefallen wäre, hatte in klarer Erkenntnis seiner Fähigkeiten und in weiser Selbstbescheidung sich auf die Führung der weltweiten Holzgeschäfte des Konzerns beschränkt. Er sei kein Stratege, dafür käme nur Cesare, Adinas Mann, in Frage, erklärte Antonio in der »Vereinigung der Zehn«, der Gruppe der fünf Ranelli-Kinder und ihrer Ehepartner. Zwei der Ehemänner waren inzwischen durch Scheidung und Neuheirat ausgewechselt worden, was zu Lebzeiten des Patriarchen undenkbar, zumindest von den Töchtern nicht durchzusetzen gewesen wäre, ein weiterer durch Tod zu Giannis Gunsten. Aber die neuen Männer änderten nichts an Cortes Rechnung. Geändert hatte sich inzwischen jedoch etwas anderes: Gianni Cortes Stellung.
Nun war es Zeit. Jetzt konnte er endlich anrufen. Er wählte die Nummer jenes Mobiltelefons, die er seit Tagen mit sich herumtrug und längst auswendig kannte. Er hatte Glück. Sofort kam er durch und musste nicht irgendeine aufregend trostreiche Amtsstimme vernehmen, die ihm mitteilte, dass der Teilnehmer im Moment nicht erreichbar sei.
Es wurde sogar abgehoben, doch am anderen Ende hörte er nicht die erwartete Stimme: »Ich bin der Chauffeur. Niemand kann den Presidente sprechen. Sie verstehen. Pietät. Er ist auf dem Friedhof.«
In einem Anflug von leichtem Entsetzen oder starkem Sarkasmus wollte Corte schon fragen: »Tot oder lebendig?«
Aber der Chauffeur, oder was immer der sonst noch war, fügte schon hinzu: »Wer spricht, bitte? Kann der Presidente Sie zurückrufen? Vielleicht in einer halben Stunde?«
»Danke, nein. Ich melde mich wieder.«
Cortes Spannung stieg. Er schob den Zettel mit den Namen seiner drei Schwägerinnen plus des direkten Schwagers Antonio und des durchgestrichenen, angeheirateten Gegenschwagers Cesare beiseite. Jetzt schien sein zweites Talent gefragt, denn aus begreiflichen Gründen konnte er sein erstes bei Adina, Benvenuta und Camilla schlecht ins Feld führen. Oder?
Dieses zweite Talent bestand darin, für den Mangel an eigenen bedeutenderen Fähigkeiten stets Ersatz zu finden, statt des geradlinigen mühsamen Hinarbeitens auf ein Ziel einen leichteren Umweg einzuschlagen, für seinen Aufstieg auf die Höhen von Macht, Geld und Einfluss andere einzusetzen, statt geduldiger, langwieriger Arbeit schlaue Abkürzungen sich auszudenken, und sei es das Einkalkulieren eines Lotteriegewinns.
Schon als Kind brauchte Giannino wegen dieses Ersatztalents sein Zimmer nicht aufzuräumen, weil sein Bruder das gern für ihn miterledigte. Warum, hätten beide heute noch nicht anzugeben gewusst, aber der kleine Gianni schaffte es immer. Als Kind war er beliebt. Als Schüler erzielte er mit einem geringen Wissen beachtliche Erfolge. Bei allen Prüfungen, die das Leben schon in jungen Jahren bereithält, kam er durch.
Während einer Klassenfahrt von Ferrara nach Mailand hatte ihn einst das vornehme Bankenviertel in der Nähe des Doms so sehr beeindruckt, dass er sich fest vorgenommen hatte, hier einmal eine elegante Stadtwohnung und ein prächtiges Büro zu besitzen. Zur Verwirklichung dieses Vorsatzes schienen ihm ein Rechtsstudium und eine Banklehre – der Vater war Notar in Ferrara und mit Zahlen konnte Gianni umgehen – allein nicht ausreichend. Um sicherzugehen, beschloss er, seine Klassenkameradin Daniela Ranelli zu heiraten. Das wäre, trotz des zu diesem Zweck eingesetzten Talents, beinahe schiefgegangen, weil Daniela einen anderen liebte und diesen auch heiratete, nicht ohne gewisse Bedenken ihres Vaters. Das war eine schwierige Zeit für Gianni Corte, in der ihm als Notlösung nur einfiel, in die Firma der Ranelli einzutreten und Assistent bei dem 20 Jahre älteren Cesare Terra, damals noch »Kapitän«, zu werden.
Als Danielas erster Mann jedoch verunglückte, sah Corte den Unfall – es war wirklich einer – als willkommene Schicksalsfügung an, und Daniela irgendwie auch. Der Familienpatriarch schien zwar auch von dem neuen Schwiegersohn nicht begeistert, aber er gab sich zufrieden, weil Gianni, was nicht zu leugnen war, aus Ferrara stammte und so die Wahl der Tochter wenigstens nicht nach Süden ausgriff. Vielleicht wollte der alte Ranelli auch dem Familienwappen seine vollständige Berechtigung zurückgeben, einem in vier Kreisen schwingenden »R«, wie er es sich selbst ausgemalt hatte. Die vier »Ringe« – auf Italienisch »anelli« – im geschwungenen »R« seines Namens stellten die verheirateten Töchter dar. Also mussten sie Ehemänner haben. Aus dem lange übersehenen und abgewiesenen Verehrer Danielas wurde der Ehemann, aus dem Assistenten Terras der Schwager Cesares. Nur, hatte Gianni Corte sich jahrelang geärgert, dass Cesare Terra auch als »Admiral« diese Änderung nicht recht zu beachten schien.
Damit musste jetzt Schluss sein, ermahnte sich Corte. Die letzten Wochen und Monate durften nicht umsonst gewesen sein. Er beauftragte Eleonora, dem Admiral auszurichten, dass er zur heutigen Sitzung leider nicht kommen könne, und griff wieder zum Telefon.
3. Stechende Kopfschmerzen eines besonderen Journalisten am Morgen in Rom
Das Telefon läutete.
Das Läuten drang in seinen Kopf und verstärkte die Schmerzen.
Corrado Spina schreckte hoch.
Er fasste benommen nach dem Apparat und stöhnte: »Nein!« Das Läuten dauerte an, die Schmerzen im Schädel wuchsen. Gepeinigt suchte Spina den richtigen Knopf. Nein, nicht, um das Gespräch an- und aufzunehmen. Daran war in seinem Zustand gar nicht zu denken. Zu einem anderen Wort als dem einen der Verweigerung war er unfähig. Sondern um das schreckliche Läuten und damit die verschärfte Marter in seiner rechten Gehirnhälfte loszuwerden. Mit Mühe wiederholte er: »Nein!«, und drückte noch einmal auf den Knopf des Handapparats. Er hörte nicht mehr, wie auf der anderen Seite »Moment doch!« gerufen wurde, ungeduldig, fordernd, fast befehlend. Das Läuten war weg, der Schmerz nicht. Corrado Spina ließ sich wieder ins Bett zurückfallen.
Wenige Sekunden später begann das Telefon einen neuen Angriff auf sein qualvolles Unwohlsein. Die ersten Schimpfwörter drängten sich ihm auf die Zunge. Doch Spina sagte kein einziges. Aus Prinzip nicht. Das fiel ihm immer noch schwer, selbst jetzt in seinem Zustand. Gerade jetzt. Immer noch waren zu dieser Kontrolle Energie und Willen notwendig. Aber er hatte sich einmal dazu verpflichtet, und dabei blieb es, selbst wenn alle diese bösen Worte aus ihm herauswollten. Er schob sie alle wieder über die Zunge zurück. Weil er es Billy versprochen und sich geschworen hatte.
Billy, eigentlich Isabella, war seine zweite Frau gewesen, und bevor sie sich endgültig von ihm trennte, hatte sie gesagt: »Du bist eigentlich ein netter Kerl. Aber dein Fluchen, dein dauerndes, nie aufhörendes Fluchen ist für mich unerträglich. Ich gehe.«
Er hatte ihr hoch und heilig versprochen, es nie wieder zu tun. Sie war trotzdem gegangen. Es musste wohl noch etwas anderes gewesen sein, weshalb sie ihn verlassen hatte. Er fühlte sich dennoch an sein Versprechen gebunden. Seitdem musste er ohne jene Worte auskommen, die manchmal etwas einfallslos den Stoffwechsel der Menschen im weitesten Sinn beschrieben, aber zuweilen sogar amüsant Schmutziges und Heiliges mischten. Seitdem konnte er nicht mehr seine persönlichen Einschätzungen und Gefühlsstürme mit Schimpfwörtern hinausjagen.
Das fiel ihm schwer – schwerer als anderen. Denn Corrado Spina war von Beruf Journalist.
Der Verzicht auf Schimpfwörter hatte freilich auch sein Gutes. Sicher, man konnte nicht sofort den ganzen Ärger oder Zorn der Welt um die Ohren schlagen, andere mit dem eigenen Unwillen anfallen. Man musste sich stattdessen, um nicht zu platzen, etwas Neues einfallen lassen. So wurde sein Denkvermögen trainiert, der Wortschatz größer und sein Stil gewandter. Corrado Spina hatte es zu seiner Verwunderung bemerkt.
Diese Nebenwirkung zeigte sich auch jetzt. Das sich selbst auferlegte Verbot, in das Telefon irgendeine Beleidigung für den Störer zu zischen, zwang ihn dazu, seinem Gehirn nicht nur das Schmerzempfinden zu überlassen, sondern dort auch die ersten Gedanken zu bilden. Sie richteten sich ausschließlich darauf, die Störung abzustellen, was durch bloßes Knopfdrücken und Auflegen des Handapparats, wie die Erfahrung vor wenigen Sekunden gezeigt hatte, nicht zu erreichen war:
»Nein, bitte, nein, in einer Stunde!«, stammelte er so erbarmenheischend, dass der andere sich zu besinnen schien und nur resigniert »Okay« sagte.
Jawohl, der andere. Das erkannte Corrado Spina auch in seinem Zustand, der in der Tat mitleiderregend war. Er schob den Handapparat auf die Halterung zurück und tastete dann, so schlaftrunken wie schmerzgeplagt, auf dem zweiten Bett umher. Es lag niemand darin. Corrado horchte mit zusammengepressten Augen. Dann fiel es ihm ein. Er war wirklich allein. Niemand konnte ihm also Trost spenden. Allerdings musste er auch keine Vorwürfe fürchten, zu denen seine dritte Frau, Costanza, neigte. »Ich habe es dir gleich gesagt«, war ein Standardsatz von ihr. Gewesen, für ihn. Denn auch mit seiner dritten Frau ging es nicht lange gut, und so hatten sie sich vor einigen Monaten getrennt. Er taugte wohl nicht für die Ehe, obwohl er sie nun schon dreimal erprobt hatte.
Seine gegenwärtige Freundin hieß Tiziana. Sie schien im Gegensatz zu Costanza eher gleichgültig gegenüber seinen beruflichen Angelegenheiten. Das schien ihm gut so. Er fühlte sich freier. Zumindest war es erst einmal bequemer. Ermahnungen brauchte er nicht.
Aber man hatte ihn gestern gar nicht ermahnt, fiel Corte ein. Niemand hatte ihm gestern Abend etwas dergleichen gesagt. Und er wusste überhaupt nicht, woher diese Kopfschmerzen kamen. Sicher, es war spät geworden. Doch das wurde es häufig in seinem Metier. Woher also diese verd… – verrückten Stiche im Kopf? Mit den Schimpfwörtern hatte Corrado gleich auch noch das Rauchen aufgegeben. Und er trank mäßig. Schon, damit ihm an Schnelligkeit der Gedanken nicht wieder genommen würde, was er durch den Verzicht auf Unflätigkeiten gewonnen hatte. Von Zigaretten und Alkohol konnten die Schmerzen also nicht herrühren. Aber woher auch immer dieses Stechen und Bohren, Drücken und Pressen da oben rechts kam – so weit war Spina nun schon –, als Erstes musste er es loswerden. Mit unwilligen, den Einsatz fast verweigernden Augen schaute Corrado auf die Uhr neben dem Bett. Kurz nach neun Uhr. Weder früh noch spät für ihn.
In der kleinen Küche seines Appartements nahm er aus der Thermoskanne den ersten Kaffee. Zwei Aspirin, zwei Togal dazu, um sicherzugehen. Noch leicht taumelnd ging er dann in den großen Wohnraum und kontrollierte mit einem Blick aus dem Panoramafenster, ob die Stadt Rom noch da war. Seine Wohnung lag auf der Collina Fleming, über der Stadt und dem Tiber, über dem Corso di Francia mit den Aus- und Einfallstraßen der Via Cassia und der Via Flaminia. Von seinem Appartement aus konnte Spina über das Häusergewirr bis zur Kuppel von Sankt Peter blicken. Rom existierte noch, auch im 2737. Jahr nach der Gründung[1], »ab urbe condita«, wie es offiziell hieß. Corrado Spina war stets mit der Zählung auf dem Laufenden. Er hielt seinen Kopf in der einen, die Tasse in der anderen Hand und sagte abwechselnd: »k. o. – o. k.«
Damit hatte er nicht nur seinen gegenwärtigen Zustand mit den besten Hoffnungen für die Zukunft auf eine kurze Formel gebracht, sondern auch sein journalistisches Lebenswerk bezeichnet, zumindest das vorläufige, da sein Alter von 44 Jahren durchaus noch zu weiteren Erwartungen berechtigte.
Corrado Spina war Herausgeber und Chefredakteur eines römischen »Nachrichtenmagazins«, wie im Titel ausgewiesen war. Dies selbst in Anführungszeichen so einfach stehenzulassen, würde in die Irre führen. Denn gewöhnlich – wenn auch nicht gerade jetzt, kurz nach neun Uhr, zumal die Schmerzenspfeile weiterhin seinen Kopf durchdrangen – zauberte das erste Wort »Nachrichten« auf dem Gesicht des »Magazin«-Chefs jenes Lächeln hervor, dem – ohne Übertreibung, bescheidener, damit wahrheitsgetreuer, also einfach nachrichtlich korrekt gesagt – nicht alle Frauen widerstanden. Und dies, obwohl oder weil – unergründlich ist der Frauen Gunst – Corrado, genau 1,76 Meter groß, kein schöner Mann war, sich sogar etwas nachlässig, wenn auch teuer kleidete und es mit dem Rasieren nicht immer genau nahm.
»Nachrichten, meine Güte«, pflegte Spina auflachend – in der Regel, nicht jetzt mit diesen Kopfschmerzen – zu sagen. »Wo kämen wir hin, wenn wir nur Nachrichten bringen wollten? Die Leute wollen doch gar keine Nachrichten, zumindest nicht nur. Alles andere als Nachrichten; das heißt, schon Nachrichten«, bequemte er sich manchmal zu einer Präzisierung. »Nachrichten, die sie sich wünschen, was sie als Nachricht, als Wahrheit präsentiert bekommen wollen. Also erfüllen wir ihnen diesen Wunsch. Mal so, mal so.«
Dazu war Corrado Spina bestens in der Lage, wenn auch nicht in seinem jetzigen Zustand. Seit seinem Kurzstudium – das er vorzeitig abbrach mit der plausiblen Erklärung, das Leben halte noch genügend Prüfungen bereit, deren Zahl müsse er nicht unnötig an der Universität durch Examina und vor allem durch die jeder guten Stimmung abträgliche Vorbereitung darauf vermehren –, seit seinen Studien also hatte er insgesamt dreiundzwanzigmal seine Stelle als Journalist gewechselt, bevor er mit seinem »Nachrichtenmagazin« vor fünf Jahren »stabil« geworden war, die »stabilitas loci« gewonnen hatte, wie es ein Freund mit Bildung genannt hatte, mönchische Ortsfestigkeit, ohne Mönch zu werden. Nach dem Grund des häufigen Wechselns befragt, antwortete er scherzhaft, doch einsichtig-überzeugend: Warum er denn als wahrer Patriot die Durchschnittsdauer einer italienischen Regierung übertreffen solle? Elf Monate im Schnitt, manchmal etwas mehr, manchmal auch wesentlich kürzer, länger hielt er es nirgendwo aus.
Nicht, weil Corrado Spina gekündigt worden wäre. Nein, fast alle hätten ihn behalten. Erstens, weil er ein »netter Kerl« war – wie schon das Urteil der Kronzeugin Billy besagte, deren mögliche Voreingenommenheit der Trennungsentschluss wieder voll ausgeglichen hätte; doch sie meinte es immer noch so. Zweitens, weil er ein Meister seines Fachs, ein »journalistisches Naturtalent« war, wie ihm sogar einmal einer seiner enttäuschten Professoren nach Jahren bescheinigt hatte. Die wahren Gründe für die beständigen Wechsel waren seine unstillbare Neugier und seine rastlose Kontaktfreude. Es drängte ihn stets zu Neuem, zu neuen Menschen, zu neuen Verhältnissen.
Dass Corrado Spina als »netter Kerl« galt, »trotz allem«, wie manche sagten, hing wohl auch damit zusammen, dass er Frauen gefiel. Warum? Dafür gab es ganz unterschiedliche, zum Teil widersprüchliche Erklärungen. Denn Spina war etwa als Herausgeber und Chefredakteur eines, sagen wir es mit einer vorläufigen und gütlichen Bezeichnung, »Halb-Nachrichtenmagazins« ein Mann der Öffentlichkeit, aber trotz – oder vielleicht gerade wegen – seines Berufs blieb er ein diskreter Mann, diskret fast bis zur Klaustrophilie. Was andere fürchten, was andere als Phobie bedrückt – er liebte es, das Verborgene. Es schien ihm zum Beispiel gänzlich unmöglich, in hellem Licht eine Frau zu lieben. »Das gehört nicht unter die Scheinwerfer«, meinte er immer und dämpfte die Beleuchtung, in der Hoffnung, die Betreffende würde das auch in übertragenem Sinn verstehen. Seine Frauen, insgesamt drei eheliche und ein paar Freundinnen – auch hier bitte keine übertriebenen Vorstellungen nach Journalistenmanier! –, waren fast immer damit einverstanden.
Corrado Spina hätte etwa auch niemandem gestattet, ihn jetzt am Morgen beim Kampf gegen den tobenden Kopfschmerz und die schlaffe Müdigkeit zu beobachten, nicht einmal mit Berufung auf das Informationsrecht aufklärungsbeflissener Bürger. »Meinen Kopf, meinetwegen …«, hatte er einmal eine Fotografin beschieden, die ihn um eine gefälligere, weitergehende Positur für den Artikel eines anderen Magazins bat. »Meinen Kopf, meinetwegen, den muss ich auch sonst hinhalten. Der Rest geht die Öffentlichkeit nichts an.« Und verbat sich das Ansinnen, seinen nackten Körper oder einen Teil davon abzulichten, selbst nicht »für einen guten Zweck; auch nicht, wenn es meinem Magazin letztlich zugutekommen soll«.
Die Fotografin besaß einen scharfen Blick. Denn Corrado Spina hatte einen, wie man höflich sagt, nicht uninteressanten, doch eher durchschnittlichen Intellektuellenkopf. Schwarze Haare mit einem Anflug von Grau, ein wenig blass und schmal im Gesicht, meist nachdenklich und missmutig dreinblickend, selbst wenn ihm gar nicht danach zumute war. Wie es sich eben angesichts der schwierigen Weltlage, der Probleme der Menschheit im Allgemeinen und der italienischen im Besonderen gehörte. Die Brillen wechselte er mit der Mode. Etwa zwei Dutzend hatte er in seinen Schubladen, weniger aus Eitelkeit, sondern weil er trotz seines unablässigen Neuerungsdranges sonst nichts – die Bartstoppeln zählten für ihn nicht – in seinem Gesicht ändern wollte. Das überlasse er der Zeit, meinte er. Doch er wusste, irgendeine Veränderung musste heutzutage sein.
Sein Kopf also zog die Blicke nicht auf sich. Daran wäre nichts Besonderes aufgefallen, bis zu dem Moment, da Corrado lächelte. Dieses offene, ein wenig schüchterne, gar nicht protzige Lächeln, ganz ohne Zähne zu zeigen, signalisierte sowohl seinen Gesprächspartnern, männlichen wie jenen weiblichen Geschlechts, dass es mit ihm nie langweilig sein würde. Unter Letzteren gab er, wie gesagt, nur wenigen Gelegenheit, seinen überraschend athletischen Körper kennenzulernen, aber immerhin doch so vielen, das heißt, zu vielen, als dass es seine drei ehelichen Frauen gleichgültig gelassen hätte.
Zum Lächeln hätte sich Corrado Spina jetzt nicht einmal bei Androhung von Prügelstrafe zwingen lassen, obwohl langsam, langsam der Kaffee und die vereinigten Ingredienzien der Tabletten ihre wohltuende Wirkung verrichteten. Was hatte ihm nur diese Kopfschmerzen beschert, fragte er sich noch einmal. Das Essen im Ristorante, nahe der Abgeordnetenkammer, mit ein paar Parlamentariern, war nicht »haute cuisine« gewesen, einfach, ordentlich, reichlich, römisch eben. Dann hatten sie noch »auf ein Glas« eine der Bars an der Via Veneto aufgesucht. Oder war es die Bar vom Hotel Plaza im Corso? Ja, vielleicht die. Irgendwann in dem lockeren Gespräch mit den Politikern war ein Unbekannter auf ihn zugetreten, hatte ihn gefragt, ob er der Chef des Magazins sei, und ihn dabei merkwürdig angeschaut. »Ist alles o. k.?«, hatte er diesen gefragt, weil er sich von dessen Blick unangenehm berührt fühlte. »Vielleicht o. k., vielleicht k. o.«, war als Antwort gekommen.
Das Wortspiel hatte ihn wiederum gefreut. Es hatte Schule gemacht in Rom. Es war sein Einfall gewesen, seinem Magazin vor fünf Jahren nicht einen bestimmten Namen zu geben, sondern ein schillerndes Signet. Wie auf manchen Kreditkarten zeigte die vordere Umschlagseite des Magazins in einem Kreis von genau neun Zentimetern Durchmesser links oben ein »o« und ein »k«, je nachdem wie man es hielt, zuerst das »o« oder zuerst das »k«. Das schillernde, je nach Blickwinkel sich ändernde Signet war etwas teurer im Druck, aber sehr wirksam. So konnte man »o. k.« lesen, was der italienischen Bewunderung für Angelsächsisches entgegenkam, oder »k. o.«, was überall in der Welt inzwischen seltener die Niederlage eines Boxers bezeichnete, sondern das Ende so mancher Karriere. Fertig, aus. Einmal »k. o.«, einmal »o. k.«, und alles ganz »nachrichtlich«. Eben ein »Nachrichtenmagazin«.
Mit seinem ambivalenten Programm hatte Spina einen beachtlichen Erfolg erzielt. So hatte sich o.k.-k.o. als Name eingebürgert. Er war ein gefürchteter und umschmeichelter Journalist geworden.
Spina fiel ein, dass der Anrufer vorhin auch »Okay« gesagt hatte. Er fühlte sich aber gar nicht so, sondern anders. Na, das würde sich ändern. Er versuchte vor dem Spiegel ein Lächeln. Es misslang. Vielleicht sollte er wieder einmal zu seinem gesundheitlichen Geheimrezept greifen. Seit etwa fünf Jahren – das fiel mit der Gründung seines Magazins zusammen – unterzog er sich von Zeit zu Zeit einer Fango-Kur. Schlammpackungen wirkten Wunder. Er würde seine Fango-Freunde anrufen. Allein war es nicht so lustig, in Gesellschaft zudem viel nützlicher. Schlamm hielt einfach Leib und Seele zusammen, dachte Corrado Spina und lachte auf einmal in den Spiegel.
4. Gianni Corte denkt an seine Frau und liebt seinen Familien-Schatz umso mehr
Gewöhnlich ging es im Büro am Vormittag turbulent zu. Gianni Corte war in der Ranelli-Holding zuständig für zwei Bereiche. Der erste umfasste in dem Mischkonzern das Spielzeug, das heißt, alle Betriebe und Unternehmen, die sich mit der Herstellung von Spielzeug und dem Handel damit beschäftigten. Das war nicht wenig, absolut für sich, doch als Teil des Konzerns von geringer Bedeutung.
Als Gianni Corte in den Ranelli-Clan eingeheiratet hatte, konnte er nicht länger nur der Assistent von Cesare Terra bleiben. Das wollte dieser nicht. Er selbst hätte nichts dagegen gehabt. Im Gegenteil. Er wäre ganz gern ausschließlich bei dem Kapitän geblieben, natürlich als der Erste der Helfer, gleichsam die rechte Hand, immer dabei, vielleicht nicht an allen Entscheidungen Terras direkt beteiligt, aber immer über alles informiert. Er hätte in Kauf genommen, direkter Befehlsempfänger des machtbewussten Kapitäns zu bleiben, dem von dem Patriarchen Ranelli bestimmt war, zum Admiral aufzurücken. Es hätte ihm nichts ausgemacht, weil Cesare Terra persönlich nicht herrschsüchtig war. So etwas sagten ihm nur Leute nach, die ihn nicht kannten. Terra übte vielmehr eine selbstverständliche Autorität aus, weil er überzeugt war, von Natur aus zum Herrschen und Kommandieren bestimmt zu sein, weil er glaubte, bei ihm gelte nicht die Frage, ob er der Erste würde, sondern nur, worüber er zu bestimmen hätte. An die Zeit als Assistent unter dem Kapitän erinnerte sich Gianni Corte ohne Ärger. Seine Stellung damals war auch nur als Übergangsphase und Notbehelf gedacht, weil sein eigentliches Ziel, Daniela, die Tochter des Konzernherrn, von einem andern erobert worden oder vielmehr diesem zugefallen war.
Gianni Corte schaute auf das Bild seiner Frau und trug seiner Sekretärin auf, mit den Anrufen – er hatte ihr beim Kommen schon eine umfangreiche Liste hingelegt – noch etwas zu warten, außerdem sollte sie ihn mittags in seinem Klub zum Essen anmelden.
»Müssen Sie nicht …«, begann Eleonora stockend. »Ich meine … Das heißt … Ich weiß, Sie haben … Aber …«
»Was ist, aber?«, fragte Gianni Corte durchaus freundlich, weil liebenswürdig und gefällig zu sein in seiner Natur lag und obwohl die Stimme der Sekretärin ihm verriet, dass ihr Einwand ihn verärgern könnte. »Sagen Sie nur, was Sie haben, Sie bekommen trotzdem einen Kuss.« Mit harmlosen Zärtlichkeiten war Corte stets großzügig und, da er bei der Verteilung auf Gerechtigkeit achtete, unverdächtig.
»Es ist …«, erklärte ihm Eleonora. »Als ich vorhin in Ferrara anrief und Roswitha, Sie wissen schon, der persönlichen Sekretärin des Admirals, Ihre Absage für das Treffen heute Abend ausrichtete, antwortete sie …«
»Also, was antwortete Roswitha?« Namen, nicht nur die weiblicher Personen, konnte sich Corte gut merken. Er wusste, um wen es sich handelte. Adina, Cesares Frau, sollte nur aufpassen.
»Sie meinte …«, fuhr Eleonora nach einigem Zögern fort. »Es kann sein, dass sie es dem Admiral schon berichtet hatte. Doch sicher bin ich nicht. Roswitha meinte, Sie sollten es sich noch einmal überlegen.«
»Gut, gut«, beruhigte Corte die Sekretärin, im Ton unverändert freundlich. »In jedem Fall haben Sie es der Zentrale in Ferrara gesagt. Melden Sie mich jedoch ruhig im Klub an! Sie werden mich doch nicht schon am Montag verhungern lassen wollen. 13 Uhr 30 im Palazzo Melzi in der Via Monte Napoleone.«
»Gern«, sagte Eleonora.
Vor die Wahl zwischen dem Admiral und Gianni Corte gestellt, hätte sie sich ohne Zögern auf die Seite ihres Chefs geschlagen. Nicht nur wegen der – übrigens eher flüchtigen, doch willkommenen – Küsse, sondern weil der Admiral, wenn er denn hier in Mailand auftauchte, immer verschlossen und gesprächskarg erschien, mit Wichtigerem als einer menschlichen, gar weiblichen Person beschäftigt. Eleonora hätte Gianni bevorzugt, auch wenn Cesare »ein sehr«, sie wiederholte es für sich, »ein sehr, sehr ansehnlicher Mann« war. Gianni Corte hingegen kam immer offen und nett auf sie zu. Außerdem musste sie wirklich darauf achten, dass ihr Chef regelmäßig aß. Er schien ihr viel zu schlank für sein Alter. Gut, besser als dick. Aber sie musste auf ihn aufpassen. Also meldete sie ihn im Klub an und widmete sich dann seinem Sakko. Der Fleck ging schwieriger weg, als sie gedacht hatte. Nun, zur Not hing im Schrank immer ein Ersatz für solche Fälle.
So, grollte Gianni Corte, er sollte es sich also noch einmal überlegen, ob er nicht doch besser nach Ferrara käme. Dafür war er nicht gestern Abend nach Mailand gefahren, um wenige Stunden später die 250 Kilometer wieder in umgekehrter Richtung zurückzulegen. Im Gegenteil. In dieser Woche sollte es sich entscheiden. Und deshalb hatte er sie früh begonnen. Nicht in Ferrara, sondern in Mailand.
Bei diesen höchst wichtigen Entscheidungen handelte es sich nicht um seinen ersten Verantwortungsbereich, den des Spielzeugs. Damals, nach seiner Einheirat in das Ranelli-Imperium und der Aufnahme in die »Vereinigung der Zehn«, war Gianni Corte auch in den Vorstand der Holding berufen worden. In der ersten Sitzung hatte sich Cesare Terra im Auftrag von Gabriele Ranelli an ihn gewandt und unbewegten Gesichts erklärt, Corte solle, Corte »wird nun mehr Ordnung in unseren Spielzeugladen bringen; das erfordert einen ganzen Mann«. Die anderen Familienmitglieder und die wichtigsten Manager hatten, scheinbar oder anscheinend überzeugt, beifällig genickt. Er selbst, Gianni Corte, hatte Zufriedenheit gezeigt, wie jemand, der sein Lebensziel gefunden hatte und sich nichts Schöneres vorstellen konnte, als Herstellung und Verkauf von Pinocchio-Figuren und Teddybären zu »optimieren«, auch so ein Wort aus Cesare Terras nicht sehr reichem Wortschatz.
Das gelang Gianni Corte übrigens durchaus. Der »Spielzeugladen« blieb zwar immer ein bescheidener Teil in dem riesigen Konzern. Wie hätte es anders sein können! Aber seine Zuwachsraten übertrafen häufig die der anderen Bereiche, was seines Schwiegervaters ursprüngliche Reserve ihm gegenüber minderte und Danielas Zutrauen zu ihm mehrte. Seine Erfolge mit dem Spielzeug hingen damit zusammen, dass er durchaus Fantasie zum Spielen besaß, für jenes nicht vorwiegend zielgerichtete, vom Zwang zur Leistung freie Leben. Und außerdem hatte er wenig Lust, sich übermäßig mit den beiden Kindern aus Danielas erster Ehe abzugeben, sah aber, dass diese durchaus beschäftigt werden mussten und mit immer neuen Einfällen auch befriedigt werden konnten. Der Stiefvater Gianni sah daher auch mit Sorge fürs Geschäft, dass die Kinder älter wurden.
Nein, wegen des »Spielzeugladens« hatte Gianni Corte nicht des Nachts seine Frau und Ferrara verlassen. Nicht wegen des ihm zugewiesenen Ressorts war er so früh von seiner Wohnung in der Via Bigli zu seinem Büro an der Piazza del Duomo gegangen. Gianni Corte öffnete mit einem Schlüssel die unterste Schublade seines Schreibtischs und bat seine Sekretärin, ihm keine Anrufe mehr durchzustellen. Da läutete sein Privattelefon.
»Wunderbar!«, jubelte Daniela, etwas munterer als kurz zuvor. »Du kommst heute Abend schon wieder zurück. Das hast du mir gar nicht gesagt. Du wolltest mich wohl überraschen, du Schlingel. Aber du weißt doch, dass ich dir treu bin. Außerdem, was kann ich in Ferrara schon anstellen? Also bis heute Abend! Dafür störe ich dich auch nicht länger.«
Bevor Gianni etwas erwidern oder fragen konnte, hatte Daniela schon aufgelegt. Er war versucht zurückzurufen, zu fragen, wer das denn bestimmt und ihr mitgeteilt habe. Aber dann hätte er sich auf irgendeine Diskussion oder Klärung einlassen müssen. Also ließ er den familiären Aspekt der Konferenz in Ferrara erst einmal in der Schwebe. Außerdem hatte er gelernt, Frauen nie etwas zu früh abzuschlagen. Besser einen anderen das Durchkreuzen eines Wunsches, die Zerstörung einer Illusion besorgen lassen.
Solche Weisheiten und viele andere mehr im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht hatte Gianni in traurigen Zeiten beim lateinischen Dichter Ovid gelernt, in dessen Ars amatoria, der »Liebeskunst«. Als Schüler hatte er Ovid gehasst, bis ihm ein Onkel eines Tages eine doppelsprachige Ausgabe, lateinisch-italienisch, geschenkt hatte. Oder war es ein verstorbener Großvater, in dessen Nachlass er dieses Werk fand, auf der Suche nach unterhaltsamer Lektüre? Egal, seitdem galt er als sehr passabler Lateinschüler, und, da er für andere altrömische Schriftsteller ebenso fündig geworden war – also traf wohl die zweite Version mit der Bibliothek des Verstorbenen zu –, festigte sich sein Ruf. Er hatte den Weg zur einfacheren Bewältigung des ungeliebten Lateinunterrichts gefunden und ließ andere wohldosiert daran teilhaben. Sein Lieblingsdichter aber blieb Ovid. Zunächst, weil er als Schüler die »andere Seite des Mondes«, die Mädchen also, besser verstand, beherzter »begriff«[2], wie Ovid doppeldeutig empfahl. Später, als Daniela in den Armen eines anderen lag, gab Ovid ihm Trost, dass er irgendwie schon noch ans Ziel kommen würde. Seitdem zierte Ovidi ars amatoria in der lateinischen, auf keiner Seite angestrichenen Ausgabe, die Schreibtische, an denen er Platz nahm.
Cesare Terra fragte ihn zwei Mal, was er denn da stehen habe, nahm zuerst das Büchlein kurz in die Hand und sagte: »Ach so, über Waffen. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.« Der Kapitän hatte sich aus dem Lateinunterricht »arma«, gleich »Waffen«, gemerkt. Bei Gianni Corte war das gar nicht so falsch. Beim zweiten Mal meinte Cesare, mit einem ebenso raschen wie ein wenig besorgten Blick, weil unnötiges Lesen die Augen verderbe: »Ach so, über Reederei. Na, weiß ich schon genug. Kann dir aber nicht schaden. Spielzeugschiffe, nicht schlecht.« Da war der Admiral beim italienischen »Armatore«, dem Reeder, hängengeblieben. Corte hatte verzichtet, zuerst als Assistent seinen Chef, dann als Ehemann von Daniela, seinen Schwager über den wahren Inhalt des Buches aufzuklären, nämlich dass zur Lebenskunst eben auch die Liebeskunst gehöre, geschweige denn, dass er ihn etwa mit Ovids güldenen Originalworten konfrontiert hätte. Bei Cesare lag ihm immer auf der Zunge: »Sei liebenswert, willst du geliebt sein. Schönheit allein und Stellung werden dir das nie verschaffen.« Die Sentenz wäre bei Cesare auch nutzlos gewesen. Um Anerkennung, gar um Liebe zu werben, kam diesem nie in den Sinn.
Das hingegen war Gianni Cortes Sache und im übertragenen Sinn sein zweiter Bereich in der Ranelli-Holding. Zunächst hatte sich niemand um das Werben gekümmert. Gabriele Ranelli war ein schweigsamer Mann, der es für überflüssig hielt, andere Leute über seine geschäftlichen Schritte zu informieren, für seine wirtschaftlichen Operationen zu werben, Kontakte zu pflegen, Lobbyisten auszuschicken, Public Relations zu machen, Pressearbeit zu treiben. All das galt ihm als notdürftig verschleierte Form der Prostitution.
»Die Ranelli-Holding braucht keinen Sprecher, sondern einen Steuermann«, pflegte er zu sagen. »Ein Steuermann redet nicht, sonst verliert er den Kurs.« Dafür hätte er bei keinem anderen begeistertere Zustimmung finden können, schweigende, versteht sich, als bei Cesare, dem Kapitän und späteren Admiral.
Immerhin, als Corte einmal in einer Vorstandssitzung fast widerstrebend darlegte, der Zug der Zeit erfordere, dass man sich eine PR-Abteilung zulege, angesichts des in neue Größen hineinwachsenden Konzerns, damit aber keine Forderung verband, sondern nur bescheiden bat, sich der Sache annehmen zu dürfen, wollte ihm niemand etwas in den Weg legen.
Er begann damit, ein paar junge Leute einzustellen, Fotografen, Werbespezialisten und Journalisten, in der Mehrheit junge Frauen. Alles lief als Unterabteilung in seinem »Spielzeugladen«. Er fand damit sogar das Wohlgefallen des Admirals, weil dessen Frau Adina plötzlich ihren Mann und sich selbst in den Zeitungen abgebildet fand und darauf viel stolzer war als auf ihren selbstverständlichen Reichtum. Natürlich hatte Corte den Auftrag für die Fotografien gegeben und sie kostenlos zur Verfügung gestellt: der Admiral bei der Werksbesichtigung mit Arbeitern, Cesare Terra beim Pferderennen mit seiner Frau, C. T. neben seiner Segeljacht zusammen mit der Mannschaft. Die Redaktionen waren froh, ihre langweiligen Wirtschaftsberichte illustrieren zu können. Jedes Lob von Cesare Terra vergrößerte die PR-Abteilung des »Spielzeugladens«, die langsam, langsam ihre Zuständigkeit auf alle Bereiche und besonders alle wichtigen Personen der Ranelli-Holding ausdehnte.
Selbstverständlich baute Gianni Corte den PR-Bereich nicht aus, um seine Schwägerin Adina zu erfreuen. Von Zeit zu Zeit musste er sogar seine Frau Daniela beschwichtigen, warum sie viel seltener in den Zeitungen erscheine, und er, Gianni, fast gar nicht. »Aber nein, meine Liebste! Cesare ist doch der Chef«, wehrte Gianni dann regelmäßig ab. Auch das sprach sich im Familienkreis herum, wie loyal er selbst bei den Eitelkeiten die Rangfolge respektierte.
Es ging ihm in Wirklichkeit um den Buchstaben R. »R« – nicht vierfach geschwungen wie für Ranelli, sondern »R« wie »Relazioni, Relations«. Es ging um Beziehungen, und die möglichst nicht publik, also ohne »P«, ohne Publikum, ohne die Öffentlichkeit. Im Besonderen warf Corte sein Augenmerk auf Politiker und Journalisten. Und da er, wie schon erwähnt, ein fast geniales Talent dafür besaß, gefällig zu sein und dadurch sein Ziel zu erreichen, hatte er ein untrügliches Gespür für die ihm geistesverwandten Politiker und Journalisten. Einen Gefallen zu erweisen, war ihm nie zu viel. So knüpfte er beharrlich an seinem Netz der Beziehungen. Es wuchs zu stattlichen Ausmaßen heran, weil zu Cortes freundlichem Wesen auch immer die Macht und das Geld der Ranelli-Holding traten.
Seinen Durchbruch »zu Hause« erzielte er, als der Admiral sich im Vorstand in einer für ihn ungewohnt langen und ungewohnt wütenden Rede darüber ausließ, dass bestimmte geschäftliche Operationen am Widerstand einer staatlichen Bank zu scheitern drohten. Zu den »Partecipazioni statali«, den Staatsbeteiligungen unter den Wirtschaftsunternehmen, gehörten fast alle großen Geldinstitute des Landes. Ob er da einmal tätig werden dürfe, hatte Gianni Corte, wieder ganz bescheiden, in der Konferenz gefragt.
»Es geht hier nicht um Spielzeug«, hatte ihn Cesare kurz angeblafft.
»Eben«, hatte Gianni, immer noch ganz freundlich, erwidert.
Schließlich entsprach man seiner Bitte. Weshalb hätte man sie ihm auch abschlagen sollen? Es schien Cesare ohnehin alles misslungen. Nach einer Woche konnte Corte im Vorstand berichten, ganz ohne Triumph in der Stimme, dass die Operationen vorankämen, dank den Verdiensten »unseres Admirals«. Die Anwesenden hatten aufgemerkt.
»Nein«, sagte Gianni Corte halblaut. »Es geht nicht um den Spielzeugladen«, und nahm die Papiere zur Hand.
Eleonora steckte den Kopf zur Tür herein und bedauerte, dass der Fleck nicht ganz weichen wollte. Er sei aber nicht groß. Er könne das Sakko auch so anziehen; niemand würde den Fleck auf dem Fischgrätenmuster bemerken.
5. Pitagora Di Beni – ein wahrer Philosoph aus Groß-Griechenland in Italiens Politik, und Baron Malavita wird Vorstandschef
Pitagora Di Bene hob beide Arme, als sei es selbstverständlich unter ernsthaften Männern des Südens unverzüglich zur Sache zu kommen und ihm nichts willkommener als eine rasche Erledigung aller anstehenden Probleme. Schwierigkeiten gab es allerdings. Sonst hätte der Baron Malavita nicht nach Jahren der fast gesichtslosen Kooperation auf einem persönlichen Treffen bestanden, dazu noch auf einem Friedhof. Und er nicht sofort eingewilligt, freilich mit einem Nebengedanken, der zur Hauptsache werden konnte. Aber Probleme wollte Pitagora nicht auf das Kommando eines anderen angehen.
»Lieber Freund«, sagte Di Bene deshalb voll Überzeugung, als sei er nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, Ferrante Malavita verdiene nun diese Bezeichnung, nach Jahren vertrauensvoller und erfolgreicher …
Hier stockte Pitagora in seinen Gedanken. Als begeisterter Freund der Antike, als in seiner Partei anerkannter Meister des Lateinischen, hätte er nichts dabei gefunden, das Wort »Komplizenschaft« zu verwenden. Das war abgeleitet von dem jahrhundertelang im gebildeten christlichen Abendland gänzlich unverfänglichen »complex, complicis«, gleich »Verbündeter«, und stand im Zusammenhang mit dem frommen Dichtern besonders geläufigen Ausdruck »Dii complices«, was Gläubigen wie Ungläubigen die Zustimmung aller europäischen Götter von der Antike bis in die Gegenwart sicherte. Aber natürlich war Di Bene der Bedeutungswandel des »Komplizen« geläufig und darum verdächtig. Ähnlich erging es ihm, als er bei seinem blitzschnellen Streifzug durch die alten Sprachen für das vergangene und zukünftige Bündnis mit Ferrante Malavita auf die Sprachwurzel »compages« stieß. Richtig ärgerlich wurde er, dass dieses unschuldige Wort dazu herhalten musste, zu Kumpanen und Kumpanei, im Italienischen sogar zu kommunistischen Genossen, »compagni«, entwertet und missbraucht zu werden.
Damit, mit Komplizen, Kumpanen oder Genossen, im sozusagen hergelaufenen, unter der Hand sich entwickelnden Sinn, hatten Pitagora Di Bene und Ferrante Malavita natürlich nichts zu tun. Komplizenschaft oder Kumpanei in der entarteten Bedeutung – Di Bene schüttelte sich – war ihrer Beziehung selbstverständlich fremd. Wirklich sehr bedauerlich, dachte Pitagora mit feinem, altphilologischem Stilempfinden, dass die Bedeutung der Worte so leicht ins Schlechte abglitt, zudem noch bei so Löblichem wie dem menschlichen Zusammensein.
»Ein Schuft sei, wer schlecht darüber denkt!«[3], hatte Pitagora auch hier wie immer das passende Wort parat. Man sollte eigentlich für Süditaliener, die zusammenhielten, einen ähnlichen Orden unter diesem Motto einführen, in sizilianischem Dialekt, überlegte Di Bene, auch dies im Nu, während er mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand wieder an seiner Nase zupfte. Wegen dieser Angewohnheit hieß der »Philosoph aus Großgriechenland« bei manchen in der Partei auch etwas respektlos »der Riecher«, was man aber auch als Kompliment verstehen konnte. Offiziell hieß er in Neapel der »Präsident«. Denn es war unvermeidlich, dass ein Mann seiner Bedeutung nicht Präsident von irgendetwas wurde. Und dann galt: einmal Presidente, immer Presidente. Di Bene konnte sich auf seinen Spürsinn verlassen. Seine Parteifreunde waren voll Vertrauen, wenn er sich an die Nase fasste.
»Lieber Freund«, wiederholte er und griff Ferrante Malavita, der sich ihm an der Balustrade entzogen hatte, aufs Neue und entschiedener am Arm. »Lieber Freund«, sagte er zum dritten Mal, »wir sind doch längst bei der Sache …«
Des Barons entschlossenes, angespanntes Gesicht wirkte einen Moment verdutzt. Dann gab sich Malavita einen Ruck. »Nicht, dass ich wüsste … Wir haben viel zu regeln … Sie sind im Verzug.«
Der Anklang eines Vorwurfs kam Pitagora Di Bene gelegen. Er konnte ihm Anlass bieten, bei seinem neuen Freund sogleich den Ruf als Philosoph zu begründen und in einem geistreichen Diskurs über das Wesen der Zeit, den Sinn von Verspätungen und die Kunst des Wartens vor dem Baron zu glänzen. Hier auf dem Friedhof wäre es passend und eindrucksvoll, das ganze Leben gleichsam als die hohe Schule des Wartens auf den Tod zu interpretieren.
Di Benes Gesicht hellte sich auf. Was dem Baron vorhin mit den Anspielungen auf Geburt und Familie billig war, das sollte ihm mit Ausflügen in das Reich des Geistes recht sein. Denn am liebsten betrieb Pitagora Di Bene die Politik als Philosoph, ganz recht, als Philosoph aus Großgriechenland, aus jener Stadt Crotone, in der vor zweieinhalb Jahrtausenden der große Pythagoras gewirkt hatte.[4] Und um Politik handelte es sich hier zweifellos. Er würde sich nicht davon abbringen lassen, auch nicht von einem Baron Malavita, seinen politischen Grundsätzen treu zu bleiben, und dazu gehörte nun einmal die Philosophie. Von seinem ureigenen Gebiet würde er sich nicht vertreiben lassen. Da hatte er sich schon bei ganz anderen durchgesetzt, mochten die auch ungeduldig und zappelig geworden sein und ihm seine Bildung übel nehmen. Er wusste, was er wollte.
Di Bene überlegte gerade, ob er dem Baron boshaft darlegen sollte, dass die Menschheit gut daran getan habe, die Zeitrechnung in Generationen, also die Einteilung des Vergangenen nach mehr oder weniger adligen Geschlechtern, als vor- und unwissenschaftlich aufzugeben und sich nach zuverlässigeren Kriterien zu richten. Da hätte er griechisch-jüdische Elemente miteinander verbinden und zugleich dem Adelsdünkel dieses Malavita eins auswischen können. Oder sollte er dem Christlichen, dem Friedhof hier im Zeichen des Kreuzes, seine Reverenz erweisen und lieber des Kirchenvaters Augustinus Betrachtung über die Zeit als Antwort auf den Verzugsvorwurf ins Gespräch bringen?
Da unterbrach Malavita kurz Pitagoras Startvorbereitungen für geistige Höhenflüge: »Können Sie nun? Oder können Sie nicht?«