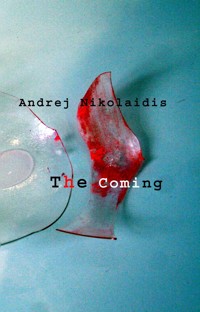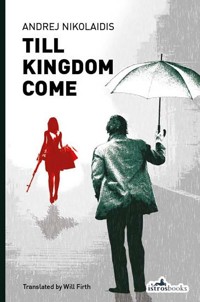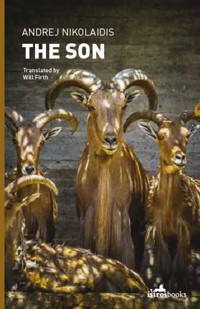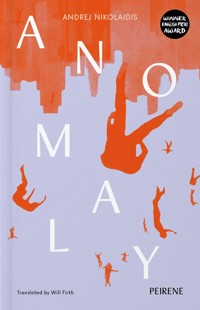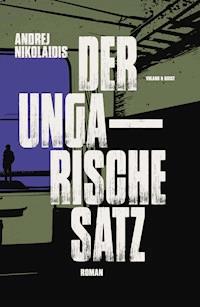
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andrej Nikolaidis' neuer Roman besteht aus nur einem einzigen langen Satz — den Gedanken des Erzählers, der mit dem Zug von Budapest nach Wien unterwegs ist. Sein Freund Joe hat sich in Budapest das Leben genommen, doch zuvor hat er den Erzähler beauftragt, seine Fälschung des mysteriösen letzten Manuskripts von Walter Benjamin an einen Wiener Sammler zu verkaufen. Der Gedankenfluss führt den Leser mitten hinein in die bewegende Geschichte von Joe, der in den neunziger Jahren aus Bosnien nach Montenegro geflüchtet ist, verwebt sie mit dem Flüchtlingsschicksal des großen deutsch-jüdischen Philosophen Walter Benjamin, von dessen Werk und tragischem Ende Joe wie besessen ist, und nimmt Bezug auf die aktuelle Situation der Flüchtlinge aus Syrien. Es geht Nikolaidis um universelle Themen: die Würde des Menschen, den Zynismus der Macht und die Ohnmacht der Bürger gegenüber einer anonymen EU-Bürokratie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Sonar 23
Originaltitel: Andrej Nikolaidis, »Mađarska rečenica«, erschienen bei Buybook, Sarajevo 2016
DEUTSCHE ERSTAUSGABE
1. Auflage 2018
Verlag Voland & Quist GmbH, Dresden und Leipzig, 2018
© by Verlag Voland & Quist GmbH
Korrektorat: Annegret Schenkel
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Satz: Fred Uhde
E-Book: zweiband.media, Berlin
ISBN: 978-3-86391-209-3
www.voland-quist.de
Andrej Nikolaidis wuchs als Kind einer montenegrinisch-griechischen Familie in Sarajevo auf und lebt in Montenegro. Er gilt als einer der einflussreichsten Intellektuellen der Region und ist bekannt für seine messerscharfen politischen Analysen und Kommentare. Nikolaidis veröffentlichte mehrere Romane, die u. a. ins Englische, Italienische, Türkische, Ungarische und Finnische übersetzt wurden. Auf Deutsch erschienen die Romane »Die Ankunft« und »Der Sohn« bei Voland & Quist. 2011 erhielt er den Literaturpreis der Europäischen Union, »Der ungarische Satz« wurde 2017 mit dem Meša-Selimović-Preis ausgezeichnet.
Margit Jugo studierte Theoretische und Angewandte Übersetzungswissenschaft, danach lebte und arbeitete sie in Sarajevo. Seither ist sie als literarische Übersetzerin für die Sprachen Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Montenegrinisch und als Vermittlerin der bosnisch-herzegowinischen Literatur im deutschsprachigen Raum tätig. Zu ihren Übersetzungen zählen unter anderem Werke von Andrej Nikolaidis, Mihajlo Pantić, Zoran Živković und Sanja Lovrenčić sowie zahlreiche Beiträge in Anthologien und Zeitschriften.
»Sie erschöpfen mich, diese Menschen, die ihre Empfindungen wie Blut ausspeien«, sagte er mir einmal …
Stefan Zweig, »Die Welt von Gestern«
Inhalt
TitelImpressumAutoreninfoInhaltAlles schien jetzt so unendlich weit entfernt, jeder Augenblick unserer Freundschaft, jetzt, da der Zug durch die ungarische Tiefebene glitt, mich von Budapest wegzog, hin nach Wien, weg von der Stadt, in der mein bester – oder sollte ich sagen: einziger – Freund sein Leben beendet hatte, hin zu der Stadt, in der er leben und, naturgemäß, enden wollte, sich hinausschleichen, wie er in seinen unzähligen Tiraden über die Größe Wiens sagte, wenn er die Gründe aufzählte, warum Wien die einzige Stadt sei, in der er in Würde leben könnte, er, für den eine würdevolle Existenz die einzig gerechtfertigte war, er, der auch in größter Armut, größter Verzweiflung und vollkommenster Ohnmacht aufrecht geblieben ist, er, der, wie gesagt wird, mit dem Leben – und dem Tod, dem Tod – seinen Worten treu geblieben ist, die er verschwendete, wie er sein Geld, seine Gesundheit, seine Hoffnung verschwendete, eine verschwenderische Art, in seinem Fall keine Eigenschaft, sondern eine stilistische, ethische, philosophische Entscheidung, die ihn letztlich dazu gebracht hat, sich ausgerechnet in Budapest hinauszuschleichen, völlig paradox, denn Ungarn steht allen weit offen, die das Land verlassen möchten, Ungarn kann man verlassen, wann und wie man will, schwer ist es, in das Land hineinzuschleichen, wie die syrischen Flüchtlinge bezeugen können, die in Kolonnen über das türkische Festland ziehen, auf dem griechischen Meer treiben, über mazedonisches und serbisches Land taumeln, um dann an der ungarischen Grenze auf Scharfschützen, Hunde und einen Zaun zu stoßen, auf faschistische Para-Militärs, eine Bevölkerung, die sich zur Verteidigung des Landes, der Nation und des Glaubens selbst organisiert, und dennoch hat er sich in Budapest hinausgeschlichen statt in Wien, dem mich der Zug jeden Augenblick näher brachte, der Zug, den er aufgab, als er sich aus Ungarn, aus der Zeit und allen Möglichkeiten hinausschlich, die für ihn längst keine Möglichkeiten zur Erlösung mehr waren, nur noch Möglichkeiten zur Katastrophe, wie in dem Brief stand, den er mir hinterlassen hatte, den der Anwalt mir aushändigte, von ihm beauftragt, mir sein verlorenes Manuskript von Walter Benjamin zu übergeben, für wenig Geld, wie ich annahm, denn Geld hatte er nicht besessen, und auch der Anwalt wirkte in seinem abgetragenen Anzug – einer türkischen Kopie italienischer Eleganz, und den chinesischen Pappsohlenschuhen, wie man sie bei uns für die Toten kauft, die allerdings auch nicht mehr aufstehen, um Spaziergänge zu unternehmen, während derer sie in einen Regen geraten könnten, der die Sohle aufweichen würde – wie der ärmste Anwalt in ganz Zentral- oder welchem Europa auch immer, er gab mir den Brief in die Hand, spreizte seine vom Tabak vergilbten Finger und ließ den Umschlag wie ein Almosen auf meine Handfläche herab, warf die Plastik-Aktentasche mit Benjamins Text, eigentlich Joes Text, eigentlich Joes Benjamin-Text auf den Tisch vor mir, lehnte sich dann an den abgewetzten, mit honigfarbenem Plüsch bezogenen Sessel und fragte, ihr beiden seid euch wohl nahegestanden?, worauf ich antwortete, ja, wir seien uns nahegestanden und stünden uns auch weiterhin nahe, anmerkte, die von ihm verwendete Vergangenheitsform sei absolut falsch und inakzeptabel, was ich nicht tolerieren würde, und zornig fragte, ob ihm das klar sei, woraufhin er lachte, nickte und absolut, absolutmurmelte, mir einen Pflaumenschnaps anbot, was ich angewidert ablehnte, sich den Schnaps selbst eingoss und mich fragte, ob ich die Tatsache, dass mein Freund tot sei, aus Optimismus oder aus Skepsis ablehne, womit mich diese gebeugte, schmutzige, nach Sliwowitz stinkende Kreatur wissen ließ, dass sie zu Sarkasmus imstande war, denn eigentlich fragte er mich damit, ob ich trotz der Beweise für Joes Tod noch Hoffnung hegte oder ob ich die Beweise für unzulänglich hielte, seinen Tod also aus rationaler Haltung heraus nicht akzeptierte, worauf ich entgegnete, formalrechtlich sei mein Freund nicht tot, Sie als Jurist müssten das wissen, falls Sie überhaupt Jurist sind, nicht jedenfalls, bis seine Leiche gefunden werde, woraufhin er lachte und sagte, dies – das Auffinden von Joes Leiche – könne schwierig werden, denn die Donau sei lang, breit und tief, und schön und blau noch dazu, aber das ist in diesem Fall unerheblich, genau so hat er es gesagt, weshalb es geschehen könne, dass mein Freund mich formalrechtlich überlebe, wie er besonders, fast übermenschlich boshaft betonte, es könne sogar geschehen, dass er ewig lebe, wonach ich schloss, dass es Zeit war, auseinanderzugehen, weil ich die Nähe dieses Wesens nicht länger ertragen konnte, das den Zynismus des Gesetzes selbst zu verkörpern schien, des Gesetzes, das immer auch ein Zynismus der Macht ist, weshalb das Gesetz die Emanation des Bösen ist, an das ich glaube, an das auch Joe glaubte und dieses Wort, das Böse, daher immer kursiv formatierte, weil er spürte, dass das Böse, oder das Böse immer da war, ganz nah, neben ihm, über ihm, vielleicht auch in ihm, ganz sicher in ihm, in jedem von uns, dachte ich und starrte auf die Pappelreihe, an welcher der Zug vorüberjagte, schnell genug, dass ich sie nur undeutlich sah, und langsam genug, dass ich sie allzu deutlich erkannte, denn alles, was wir aus einem fahrenden Zug sähen, sei für die Reise an sich völlig unbedeutend, eigentlich gehe es auch ohne all die dichtgrünen und regengetränkten Hügel, Wälder und Wiesen, an denen wir vorüberzögen, die Landschaft, die wir betrachteten, sei nur eine abgewandelte Aufzugmusik, ihrer Substanz beraubt, nur noch Dekor, schlimmer noch, der Dekor einer mechanischen Handlung, der Dekor der trivialsten aller Bewegungen, jeglichen Geheimnisses und jeglicher Bedeutung beraubt, wie Joe sagte, als wir mit dem Zug von London Richtung Leeds fuhren, und weiter nach Yorkshire hinein, Richtung Ilkley, wo das Literaturfestival stattfand, zu dem sie ihn eingeladen hatten, zu dem er mich eingeladen hatte, Richtung Ilkley, wo ich einmal mehr dem Spiel beiwohnte, in das er die Zuschauer hineinzog, wo er einmal mehr das Publikum verschlang wie eine Riesenschlange ihre Beute, die alten Menschen verschlang, die in der zwei Jahrhunderte alten anglikanischen Kirche zusammengekommen waren, um eine exotische Stimme aus dem Osten Europas zu hören, sie verschlang, ihnen jegliche Illusion aussaugte, alles, was dem Menschen im Leben Halt gab, um dann, was von ihnen übrig geblieben war, wieder auszuspeien, zurück in die auf den Altar ausgerichteten Holzbänke, dem sich zuzuwenden diese Menschen gewohnt waren, wenn sie Trost suchten, wenn sie jemanden brauchten, mit dessen Hilfe sie, was sie wussten, aber nicht wussten, was damit anzufangen sei, zu einer Geschichte woben, mit der sie weiterleben konnten, auf die sie sich stützen konnten wie ein Greis auf seinen Stock, wie ein Kind auf seine Mutter, und so immer vor den Altar getreten waren, von Kindesbeinen an, Arm in Arm mit den Eltern, bis ins Alter hinein, Arm in Arm mit dem Sprössling, bis er die vor dem Altar aufgebaute Bühne bestieg, las und sagte, was er zu sagen hatte, und in fünfundvierzig Minuten alles, was sie je vom Altar aus gehört hatten, wegwischte, desinfizierte und polierte und dann ging, und ich ihm hinterher, zurück ins Wheatley Arms, einen homemade Stout bestellte, sich an den Tresen lehnte und sagte, es ist gut gelaufen, es ist immer gut, wenn das Publikum keine Fragen hat, ich kann alles ertragen außer dem sogenannten Dialog, dem Vergeblichsten von allem, der aber so hochgehalten wird in unserer unseligen Zeit, die nicht einmal das Ende der Zeit ist, sondern nur das, was von der Zeit übrig ist, ein Zeitalter also, das dazu verdammt ist, die Abfälle der Kunst, der Philosophie, der Politik zu feiern und zu verherrlichen, ein Zeitalter, das bewundert, was in anderen Zeiten verspottet wurde, ein Zeitalter, das keine Scham kennt, da es selbst der schamhafte Rest der Zeit ist, ein Zeitalter aber, in dem über alles Dialog geführt wird, obwohl der Dialog noch nie etwas hervorgebracht hat, noch nie hat irgendjemand irgendjemanden per Dialog von irgendetwas überzeugt, dessen einziger Zweck darin liegt, den Konflikt, da er diesen nicht lösen kann, aufzuschieben, und dennoch führen alle Dialog und berufen sich dabei auf das Erbe der Antike, was nur bestätigt, dass die Menschen, statt von früh bis spät zu dialogisieren, ein Buch nehmen und lesen sollten, zum Text zurückkehren, der nichts anderes ist als ein Monolog, ein Buch nehmen und lesen, lernen, dass der heutige Dialog seine Wurzeln nicht in der Antike hat, sondern in vollkommener Ignoranz und einem Mangel an Überzeugungen, beides zugegeben unabdingbar für ein erfolgreiches Gespräch, das mit einem Kompromiss schließt, was bedeutet, dass der Mensch seine Meinung darüber, wovon er nichts weiß, ändert und von seiner Überzeugung, die er nicht hat, abrückt, weshalb Lesen für den Erfolg eines Gesprächs verheerend ist, denn einem Lesenden fällt es nicht im Traum ein, aufgeblasenen Narren zuzuhören, die fordern, ihre Meinung solle berücksichtigt werden, denn einen Lesenden, der Monolog, Wissen und Können gewohnt ist, stört der Lärm der Narren im Gespräch, stört ihn beim Lesen, stört ihn beim Denken, das aus dem Dialog ebenfalls vertrieben worden ist, denn wer ununterbrochen redet, hat keine Zeit zu denken, und so gelingt es dem Gedanken nicht, in die Welt vorzudringen, die unter der Tyrannei der Ignoranz röchelt, was die wahre Bezeichnung für die sogenannte Demokratie und die sogenannte öffentliche Meinung ist, warum auch, wenn man, um sich am Dialog zu beteiligen, nichts wissen oder denken muss, wenn es genügt, am Leben zu sein, weshalb sich alle, die etwas wissen, aus dem Gespräch zurückziehen, denn natürlich fällt es ihnen nicht im Traum ein, mit Horden von Dummköpfen zu debattieren, weshalb es schließlich möglich ist, dass sich die Fürsprecher des Dialogs auf seine antiken Wurzeln berufen, obwohl jeder, der Platon gelesen hat, weiß, wie die berühmten Dialoge des Sokrates aussehen, mit denen die Ignoranten ihre Dummheitsorgien legitimieren, die Dialoge des Sokrates, eigentlich Monologe des Sokrates, nach welchen dessen Schüler, wenn sie das Wort bekommen, »So ist es, Sokrates, so und nicht anders« sagen, so sieht die antike Wurzel unserer heutigen Toleranzkultur aus, und deshalb sage ich, dass es immer gut ist, wenn niemand etwas fragt, deshalb denke ich, dass öffentliche Lesungen ausschließlich in Kirchen abgehalten werden sollten, denn dort ist den Leuten schon beigebracht worden, zuzuhören und nichts zu fragen, so sagte er, oder hätte er sagen können, und bestellte noch eine Runde Stout, davon ausgehend, dass ich zahlen würde, dachte ich, und dieser Gedanke, dass ich zahlen würde, löste selbst jetzt noch Unbehagen in mir aus, während ich im Zug saß, der Richtung Wien jagte, dasselbe Unbehagen wie damals, als er das erste Mal zahl du gesagt hatte, 1992, im Café mit Blick auf den Hafen von Bar, einem Café voller Messing, Marmor, montenegrinischer Mafiosi und italienischer Zigarettenschmuggler, sein zahl du ist gewissermaßen der Refrain unserer Freundschaft, habe ich früher gedacht, als ich noch glaubte, er nutze mich schamlos aus, aber nichts unternahm, um ihn daran zu hindern, bevor ich begriff, dass eigentlich ich derjenige war, der ihn ununterbrochen ausnutzte, bevor ich begriff, dass ich meine gesamte sogenannte Kunst und meinen sogenannten großen Erfolg und Ruhm ihm verdankte, ohne den ich nie etwas erschaffen hätte, weil meine gesamte ach so gepriesene »Arbeit« nur eine Reaktion auf das war, was ich von ihm hörte und bei ihm las, bevor ich begriff, dass ich fortwährend seine Abfälle aufsammelte, Gedanken, die er achtlos aussprach und mit noch größerer Achtlosigkeit aufschrieb, ich habe diesen Abfall gesammelt, recycelt, unterschrieben und präsentiert, alles, was er in meiner Gegenwart weggeworfen hat, verkauft, ohne das geringste Zögern, das geringste Schamgefühl, habe es auch noch gewagt, mich ausgenutzt zu fühlen, es aus noch gewagt, wegen seines zahl du