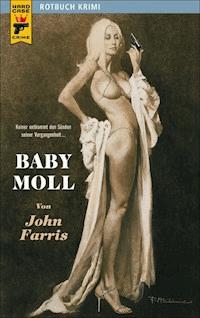6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spät an einem verschneiten November-Nachmittag hat Barry Brennan einen Auto-Unfall. Und von Anfang an ist alles mysteriös: Der junge Mann, den sie angefahren und leicht verletzt hat, kennt seinen Namen nicht, kann nicht sprechen und hat sein Gedächtnis verloren. Und: Er hat verblüffende Ähnlichkeit mit Barrys Verlobtem, Ned Kramer. Doch dieser ist vor einem Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen. Es hat beinahe den Anschein, als hätten Barrys Liebe und Sehnsucht nach Ned diesen jungen Mann ins Leben gerufen...
John Farris beschreibt in seinem erstmals im Jahr 1982 erschienenen Roman Der ungebetene Gast einen zutiefst verstörenden Fall von Psychoterror, Stalking und Obsession, der sich langsam steigert und schließlich in rauschhafter Gewalt eskaliert.
»Ein wunderbares Buch! Gruselig und aufregend. Ich habe es in einem Zug gelesen.«
- Stephen King
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
JOHN FARRIS
DER UNGEBETENE GAST
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER UNGEBETENE GAST
Der Unfall
Draven
Am Abend vor der Mittsommernacht
Das Buch
Spät an einem verschneiten November-Nachmittag hat Barry Brennan einen Auto-Unfall. Und von Anfang an ist alles mysteriös: Der junge Mann, den sie angefahren und leicht verletzt hat, kennt seinen Namen nicht, kann nicht sprechen und hat sein Gedächtnis verloren. Und: Er hat verblüffende Ähnlichkeit mit Barrys Verlobtem, Ned Kramer. Doch dieser ist vor einem Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen. Es hat beinahe den Anschein, als hätten Barrys Liebe und Sehnsucht nach Ned diesen jungen Mann ins Leben gerufen...
John Farris beschreibt in seinem erstmals im Jahr 1982 erschienenen Roman Der ungebetene Gast einen zutiefst verstörenden Fall von Psychoterror, Stalking und Obsession, der sich langsam steigert und schließlich in rauschhafter Gewalt eskaliert.
»Ein wunderbares Buch! Gruselig und aufregend. Ich habe es in einem Zug gelesen.«
- Stephen King
DER UNGEBETENE GAST
»Welch' ein Meisterwerk ist doch der Mensch!
Wie edel durch Vernunft!
Wie unbegrenzt an Fähigkeiten!
In Gestalt und Bewegung - wie bedeutend und Wundern würdig!
Im Handeln wie ähnlich einem Engel!
Im Begreifen wie ähnlich einem Gott!
Die Zierde der Welt!
Das Vorbild der Lebendigen!«
- William Shakespeare,
Hamlet, Zweiter Aufzug, zweite Szene
»What is mind? Doesn't matter.
What is matter? Never mind.«
- Bertrand Russell
Ron Preissman gewidmet,
den Freund und Partner beim Schattentheater
und in Sachen Laterna magica
HINWEIS: Tuatha de Dannan wird wie »Tutha-de-Danan« ausgesprochen
und Daoine Sidh wie »Thiena-schie«.
Der Unfall
1.
Claude Copperwell besaß ein Antiquitätengeschäft an der Hauptstraße von Anatolia im Bundesstaat New York. In einem Hinterzimmer fertigte er außerdem Rahmen für die Künstler aus der Gegend. Wenn Thomas Brennan ein Bild fertig hatte, das verkauft werden sollte (was nicht häufiger vorkam als zwei- oder dreimal im Jahr), brachte Tom oder irgendjemand, der gerade von der Farm in die Stadt fuhr, das neue Werk zu Claude. Greene House wurde kurz nach dem Erntedankfest vollendet. Tom beachtete das Bild eine Weile nicht - ging zur Jagd, spielte Pool-Billard, reparierte einen Traktor. Dann strich er noch ein paar Tage um sein Werk herum, betrachtete es prüfend, hatte aber keine Lust mehr, zum Pinsel zu greifen. Und damit wusste er, dass er alles gegeben hatte, was in ihm steckte. An einem Tag Anfang Dezember verstaute Toms Tochter Barry gegen fünfzehn Uhr das in eine alte Decke gewickelte Temperagemälde im Volvo-Kombi der Familie Brennan und fuhr die knapp achtzehn Kilometer nach Anatolia. Der Himmel war silbergrau. Es schneite ein wenig.
Seit fast dreißig Jahren ließ Thomas Brennan seine Bilder von Claude Copperwell rahmen. Nichts Neues also. Aber es musste jedes Mal ein kleines Ritual beachtet und vollzogen werden. Barry parkte vor der Hintertür. Inzwischen herrschte Schneetreiben. Dicht fielen die Flocken, prickelten kalt auf Barrys Wangen, wirbelten über die Straße hin. Barry ging nach drinnen und holte Claude. Claude trug das Bild - 76,2 x 152,4 cm, auf Holz gemalt - in seinen Arbeitsraum und stellte es auf eine alte, von Farben überkrustete Staffelei, die früher einmal Rockwell Kent gehört hatte.
»Das ist Greenes Haus, nicht wahr?« Tom Brennan hatte dieses Farmgebäude aus dem 18. Jahrhundert (oder Teile davon) schon oft gemalt.
»Ja.«
»Aber so was hat Tom, glaube ich, noch nie gemacht. Er hat ein paar Motive kurz vor oder kurz nach Sonnenuntergang gemalt - dieses späte Licht, nicht wahr. Aber das Bild hier ist richtig dunkel.«
»Unheimlich«, meinte das Mädchen.
Claudes Frau brachte ein Tablett mit Sherrygläsern und einer Karaffe und umarmte Barry.
»Es ist schon eine Ewigkeit her, seit wir dich zuletzt gesehen haben, Kind!«
»Ich war lange nicht mehr in der Stadt. Auf der Farm gibt's so viel zu tun.«
»Und ich dachte, du wärst auf dem College wie die anderen Mädchen auch.«
Barry zuckte die Achseln. »Vielleicht nächstes Jahr.«
»Meine Güte«, sagte Millicent, »das ist aber ein großes Format.« Sie betrachtete das Bild, kurz allerdings und fast scheu, ließ es bloß auf sich wirken und versuchte, es nicht vorschnell zu kategorisieren. Sie goss Sherry ein, und die drei lächelten sich an: zwei Zwerge und ein hochgewachsenes Mädchen. Claude hatte keinen Hals und keine Haare, die Augenbrauen ausgenommen, so buschig und schwarz, als seien sie geteert. Sein Gesicht sah gemeißelt aus, dabei wächsern und mit großen Poren in den Wangen - wie unvollendete Augen. Millicent war Engländerin, eine rosige und vergnügte Person. Sie engagierte sich gern für unpopuläre Dinge, nahm sich mit Begeisterung der Unterprivilegierten und Bedürftigen an; ihre Freundinnen, Freunde und Bekannten nannten sie »Wohlfahrtsmäuschen«.
Nun tranken die drei ihren Sherry und widmeten ihre Aufmerksamkeit Tom Brennans neuestem Werk. Barry kannte es bereits in- und auswendig. Sie hatte die Entstehung von Greene House vom Frühsommer an in allen Phasen miterlebt; erst die Tusch- und Bleistiftzeichnungen in einem Skizzenbuch, dann eine Reihe kleiner Aquarelle, einige davon in trocken-realistischer Manier - zwanzig oder mehr Versionen gipfelten in diesem eindrucksvollen Werk. Barry bewunderte das Bild ihres Vaters. Und gleichzeitig hatte sie das Gefühl, sie müsse davor zurückweichen.
Es war wie alle seine Gemälde (abgesehen von den Portraits) kühn in der Komposition und von ziemlich gedämpfter Farbigkeit und hatte die gewöhnlichen und unscheinbaren Dinge eines sehr kleinen Bereichs des Bundesstaates New York zum Gegenstand - jenes Bereichs, den Tom Brennan zu Fuß von seiner Farm aus durchmessen konnte. Das einzig Auffällige an Greenes Haus (es lag, beinahe vollkommen eingeschlossen von einem trostlosen Waldstück, in einer Senke zwischen zwei Hügeln) war ein sämtliche Proportionen sprengender, klobiger Anbau aus dem 20. Jahrhundert: eine vor den Unbilden der Witterung geschützte Veranda. Tom Brennan hatte diese Veranda mit ihrem kalten Licht hervorgehoben und das dunkle Haus in starker perspektivischer Verkürzung dargestellt, was einen Anschein von Bewegung schuf, von Fahrt; die kreideweiße, fast grell wirkende Ecke der Veranda, die leicht diagonal ins linke Drittel des Bilds hineinragte, erinnerte an den Bug eines Schiffes. Der Mond stand tief am Himmel, späte Stunde und spät im Jahr: in dem Waldstück lag Schnee, ein unregelmäßiges Streifenmuster.
In einem Armstuhl auf der Veranda saß eine Frau, die einen dicken Strickpullover trug. Sie saß auf der Kante und würde vermutlich gleich aufstehen - jedenfalls hielt sie mit beiden Händen die Armlehnen des Stuhls umfasst. Auf den ersten Blick sah sie bloß müde aus. Sie hatte das Gesicht zum Haus gedreht, als wollte sie jetzt nach drinnen gehen. Doch für Barry drückte die ganze Körperhaltung der Frau (und besonders der eine so seltsam vorspringende Ellenbogen) Furcht aus. Was erfüllte sie mit Schrecken? Ein Gedanke, der sie eben überfallen, ein Geräusch, das sie gerade gehört hatte? Etwas Natürliches? Oder nicht?
»Das ist ja Edie!«, sagte Millicent. Sie meinte die Frau auf dem Bild. Dann blickte sie Barry an und merkte, dass Barry noch gar nicht darauf gekommen war. Millicent sah eine kurze Verwirrung und gleichzeitig die Gesichtszüge, die Edie ihrer Tochter vererbt hatte: die hohe Stirn, die blassen, aber hinreißenden Wimpern, die etwas auf Himmelfahrt ausgerichtete Nasenspitze. Haut-, Haar- und Augenfarbe dagegen hatte sie von ihrem Vater. Sie war rotblond und jetzt auch rotgesichtig vom winterlichen Wetter und hatte königsblaue Augen, die so empfindlich waren, dass sich bei jeder Helligkeit eine Art Dunstschleier über sie legte.
»Weiß nicht«, sagte Barry und schaute noch einmal hin. »Kann schon sein.«
Edith Brennan war bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Barry war damals neun Jahre alt gewesen, und darum mangelte es ihrer Erinnerung sozusagen an Tiefenschärfe und an Genauigkeit. Es gab zu Hause einen ganzen Stapel Familienfotos, den sie manchmal zu Rate zog, wenn sie sich verloren fühlte auf ihrem doch recht einsamen Weg - achtzehn und ohne Mutter - und Orientierung suchte. Außerdem hatte sie in den Skizzenbüchern ihres Vaters viele, viele Studien von Edie in jüngeren Jahren gesehen: eine magere, ja hagere Irin, schwarzbraun und schlicht, aber mit einer angeborenen munteren Frechheit, mit Mutterwitz und jenem gutmütigen, nachsichtigen Lächeln, für das so mancher Mann einen Mord begehen würde. Und Edie war unpraktisch, weil sie zu viel von dieser Welt und von vergangenen Welten wusste. Sie lebte in ständiger Anspannung vor lauter Intuition, setzte sich unermüdlich für andere ein, verzehrte sich, da sie immer die Grenzen ihrer schwachen Leibeskräfte missachtete.
Barrys Augen brannten. Wie alle Mitglieder ihrer Familie ließ sie sich zu schnell von Gefühlen überwältigen. Sie trank ihren Sherry aus, lehnte nicht ab, als ihr noch ein Glas angeboten wurde, und bezwang das Selbstmitleid. Doch der Alkohol wirkte sich auch auf ihre Konzentration aus. Sie konnte jetzt nicht mehr so klar denken, ihr wurde kurz schwindlig, und überhaupt schwebte sie nun irgendwie im Ungewissen. Sie kehrte dem Bild ihres Vaters den Rücken und schlenderte zu der halboffen stehenden Tür, die zum Laden führte. Ein matter Schimmer von alten Spiegeln und dunklen Möbeln war zu sehen. Barry hörte Stimmen. Ein Mann und eine Frau unterhielten sich über Kunstgegenstände.
»Ich nehme an, das Bild ist bereits verkauft«, sagte Claude, sein Blick ruhte nach wie vor auf dem neuen Gemälde.
»Käufer gibt's massenweise«, meinte Millicent, »aber leider nicht genügend Brennans.«
Claude drehte sich um und schaute Barry an. »Sag der Galerie, Samstag in einer Woche ist das Bild gerahmt und kann abgeholt werden.«
Barry gab keine Antwort. Sie hatte einen jungen Mann im Laden gesehen. Er beugte sich gerade über einen Schaukelstuhl. Er hatte strohblonde lange Haare und trug eine orange und schwarz karierte Wolljacke. Barrys Herz machte einen Sprung, ihr rechter Arm hob sich in reflexartig jäher Bewegung. Sie verschüttete Sherry aus dem Glas, das sie in der Hand hielt, aber sie achtete nicht darauf. Zu dem jungen Mann trat nun seine Frau oder Freundin. Die Frau sprach leise mit ihm, deutete auf etwas Interessantes. Noch hatte er den Kopf nicht von dem Schaukelstuhl abgewandt. Barry konnte nach wie vor nicht sein Gesicht sehen.
»Barry?«, sagte Millicent.
Barry hörte ihren Namen durch das tönende Rauschen des Blutes in ihren Ohren. Sie drehte sich um und wäre beinah gestolpert, bekam gerade noch mit ihrer freien Hand den Türrahmen zu fassen und verschüttete wieder etwas Sherry.
Millicent blickte Barry an. Dann das Paar im Laden.
»Ned hatte auch so eine Jacke«, erklärte Barry mit sachlich-schwacher Stimme.
»Ach, Kind.«
»Selbst der blödeste Jäger könnte ihn nicht für ein Reh halten. Sagte er.« Barrys Schultern hoben sich ein wenig. Sie lächelte, traurig allerdings. Ihre Wangen brannten. Sie schaute Millicent starr an und musste sich das Stottern verbeißen: »Fü-für was haben sie ihn gehalten, als sie ihn einfach über den Haufen geschossen haben?«
Millicent ging zu ihr (es sah nicht sehr schnell aus), schloss flink die Tür, legte ihren Arm um Barrys Taille. Barry war niedergeschlagen. Der Aufschlag ihres Parkas war voll Flecken.
»Ich habe mit Sherry gekleckert. Tut mir leid.«
»Du musst drüber wegkommen. Wirklich.«
Barry nickte. »Ich weiß. Lag nur an der Jacke - und ein paar Sekunden sah er so aus wie Ned. Mehr war nicht.«
Millicent und Claude begleiteten sie zum Volvo. Binnen einer halben Stunde war die Stadt fast vollständig weiß geworden - abgesehen von den Glitzerketten und den pseudogoldenen Sternen an den Laternenpfählen. Die Erinnerung an Ned hatte Barry in die Abgründe ihres Kummers zurückgestoßen. Sie suchte nach ihren Schlüsseln, hatte sie zwischen den Fingern, ließ sie auf den kalten weißen Teppich ihr zu Füßen fallen.
Claude hob sie auf. »Fahr vorsichtig, ja? Laut Wetterbericht schneit es nämlich weiter. Sollen fünfzehn bis zwanzig Zentimeter werden heute Nacht.«
»Und richte Tom viele Grüße von uns aus«, sagte Millicent. »Ihr beiden müsst euch ja nicht immer wie die Eremiten aufführen. Kommt uns doch mal besuchen!«
»Machen wir. Ich versprech's.«
»Im Krankenhaus fragen schon alle: Wann gibt Barry wieder mal eine Vorstellung für uns?«
Barry zwang sich zu einem Lächeln. »Weiß ich noch nicht. Bald jedenfalls.«
Sie fuhr los. Nicht gerade übervorsichtig. Sie wollte bloß eins: weg aus der Stadt. Die Copperwells warteten im Schneetreiben, bis der Wagen nicht mehr zu sehen war.
»Sie hat immer noch diesen ganzen Kummer in sich«, sagte Millicent. »Richtig in sich reingefressen. Und das ist eine größere Tragödie als Neds Tod. Ich weiß nicht - warum kann Tom ihr nicht irgendwie helfen?«
»Künstler sind alle gleich. Tom lebt in einer anderen Welt. In seiner.«
»Vielleicht fahre ich mal am Nachmittag rüber und rede mit Barry.«
»Jetzt lass uns reingehen. Ich habe kalte Füße.«
Barry sehnte sich nach der Abgeschiedenheit der Farm, nach ihrem Zimmer mit dem milden Lampenschein. Sie fuhr zu schnell, verließ sich darauf, dass ihr die neuen Winterreifen an dem Kombi alle Scherereien ersparen würden.
Noch vor einer Stunde waren die Bäume an der Straße dürr und kahl wie Skelette gewesen. Jetzt hatten sie weiche Formen vom Schnee, der dicht und wild aus Nordwest gewirbelt kam. Die Scheibenwischer häufelten ihn am Rand der Windschutzscheibe zu halb durchsichtigen Platten auf.
Die zweispurige Landstraße, die von Anatolia zur Farm führte, verlief selten mehr als hundert Meter gerade. Es lagen Hügel am Weg, viele Hügel, und keinerlei nennenswerte Ansiedlungen. Ein paar Kilometer stadtauswärts führte die Straße mitten durch einen Staatspark mit einem kleinen, hübschen See, einem alten Abflusskanal und einer überdachten Brücke in einer Talmulde. An dieser Stelle kam eine Haarnadelkurve: zur Brücke hinunter und wieder steil hinauf zwischen Felsen und hohen Bäumen.
Barry kannte den Weg wie im Schlaf. Sie war diese Straße schon bei jedem Wetter gefahren. Bis zur Brücke begegneten ihr nur zwei Autos. Die Scheinwerfer des Volvo waren voll aufgeblendet. Barry hatte Kopfschmerzen. Sie fühlte sich ausgehungert, deprimiert, zum Hadern aufgelegt. Aber sie hatte niemand, mit dem sie sprechen, niemand, mit dem sie rechten konnte - zum Beispiel darüber, wie sinnlos Neds Tod gewesen war, einfach nur grausam und absurd. Hatten das die anderen alle schon vergessen? Ihr war es noch gegenwärtig; ein winziger Anstoß genügte, und sie hatte es wieder vor Augen. Trotzdem konzentrierte sie sich voll und ganz aufs Fahren. Es war keineswegs so, dass sie - wie Mrs. Prye häufig und boshaft bemerkte - ihren Kopf gleichsam unter dem Arm trug.
Später wurde Barry gefragt, was der junge Mann ihrer Meinung nach auf der Straße gemacht habe, wo es doch das einzig Vernünftige (oder sogar vom Selbsterhaltungstrieb Gebotene) gewesen wäre, aus dem Schneetreiben zu fliehen, auf der überdachten Brücke Schutz zu suchen und auf Rettung zu warten. Doch natürlich war nichts, aber auch gar nichts an Dravens Auftauchen vernünftig oder gar logisch, und er selbst konnte danach ebenfalls nicht erklären, was er getrieben hatte, bevor Barry ihn anfuhr.
Sie kam aus dem peitschenden, wirbelnden Schneesturm in die polternde Dunkelheit der Brücke mit ihrer einen Fahrspur. Hier segelten nur ein paar Flocken durch die Ritzen der Seitenbretter. Barry ging wohlweislich mit der Geschwindigkeit herunter und gab dann auf der anderen Seite wieder Gas, damit sie die Kurve und die Steigung schaffte.
Als sie die Brücke hinter sich hatte, sah sie ihn kurz im Scheinwerferlicht durch den sausenden Schnee. Ein unheimlicher Anblick: Er stand am Rand der Straße und hob die Hände. Entweder war es eine abwehrende Geste oder eine Gebärde der Überraschung, beides gleichermaßen mitleiderregend. Doch sein Gesicht war - soweit Barry das im Bruchteil einer Sekunde erkennen konnte - völlig ausdruckslos. Hätte er sich nicht bewegt, sie hätte ihn für eine Marmorstatue gehalten, eine griechische Plastik an einem grotesk falschen Ort, verwackelt und verwittert, leere Löcher anstelle der Augen. Aber er lebte, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und er hatte nichts an.
Barry riss das Lenkrad herum, trat kurz auf die Bremse, schleuderte seitwärts. Sie spürte, wie der rechte Teil der hinteren Stoßstange den Mann traf. Ihm auszuweichen war unmöglich. Sie hatte nur die Chance, ihn nicht zu töten. Und dann versuchte sie, den Volvo wieder unter ihre Gewalt zu bringen, indem sie in die Richtung der Schleuderbewegung steuerte. Sie war so sehr darauf bedacht, einen bösen Zusammenstoß zu vermeiden, dass der Unfall sie zunächst gar nicht richtig schockierte.
Der Volvo kam gute sechzig Meter weiter mitten auf der Steigung zum Stehen, etwas schräg, die vordere Stoßstange an dem Drahtseil zwischen der Straße und der Böschung, die steil zum Abflusskanal hin abfiel. Im Wagen befand sich eine rote Warnlampe. Man konnte sie anstelle des Zigarettenanzünders einstöpseln. Barry schloss sie an und stellte sie aufs Wagendach, damit jeder sie sah, der den Hügel hinauf- oder hinunterfuhr.
Und nun begannen ihre Hände zu zittern. Alles Blut wich aus ihrem Kopf. Die Knie gaben unter ihr nach. Sie musste sich wieder setzen. Wie betäubt saß sie da, den Kopf fast auf den Knien, die Wagentür offen. Schnee wehte herein. Der Gedanke an das, was sie getan hatte, bestürzte sie. Obwohl es sicher nicht nur ihre Schuld war.
Aber er war irgendwo da unten im Schnee. Bestimmt hatte er sich etwas gebrochen. Und wenn sie ihm nicht schleunigst half, hatte er keine Chance.
Barry griff zum Mikrophon des Autofunks. Ihr Bruder Dal hatte die Anlage auf dem Höhepunkt des allamerikanischen CB-Fiebers in den Wagen eingebaut. Sie wusste in - etwa aber nur in etwa -, wie man damit umging.
»Breaker breaker... hier Barry. Barry. Hört mich jemand? Ich bin bei der überdachten Brücke im Tremont-Park. Ich - ich hatte einen Unfall. Es ist jemand verletzt. Ich brauche Hilfe. Es soll sich bitte jemand melden.«
Sie hielt das Mikrophon in der Hand, blickte die Steigung hinunter, blickte zum Straßenrand, versuchte, etwas zu erkennen. Aber sie konnte nicht viel sehen. Ihre Reifenspuren, in den Schnee eingefräst bis auf die schwarze Teerdecke, wurden schon wieder weiß. Tränen liefen heiß über Barrys kalte Wangen. Es war fast so, als hätte es den Mann nie gegeben. Aber sie wusste, dass sie sich den dumpfen Anprall des schleudernden Volvo gegen lebendiges Fleisch nicht nur eingebildet hatte.
Eine Stimme quäkte ihr undeutlich entgegen. Barry fingerte hektisch am Tuner herum, sprach wieder ins Mikrophon.
»Bitte noch mal. Ich - ich hab's nicht ganz...«
Diesmal war die Stimme klarer, aber immer noch schwach.
»Äh, Barry Barry, hier Tidewater Lefty, zirka fünf Kilometer westlich von Brewster. Bitte ten-twenty angeben. Dann sag ich der Staatspolizei Bescheid.«
Barry nahm an, dass der Mann sich nach ihrem Standort erkundigt hatte, und gab ihn nochmals an.
»Äh, ten-four, Barry Barry. Halt die Ohren steif. Ich hol sofort Hilfe.«
»Die Polizei soll meinen Vater anrufen!«, schrie Barry ins Mikrophon. Doch es kam keine Antwort. Sie tat das Mikrophon an seinen Platz zurück. Ihre Finger kribbelten in den Autohandschuhen. Sie hatte nicht mehr das Gefühl, der Kopf werde ihr gleich von den Schultern purzeln. Adrenalin durchschwemmte sie und machte sie wach.
Barry schnappte sich die alte Decke aus dem Laderaum und ging die Steigung hinunter, oder, genauer gesagt: sie stolperte, glitschte, fiel zu Tal, rutschte auch ein Stück auf dem Hintern bis zu der Stelle, wo der Volvo den Mann gestreift hatte. Wie kam er eigentlich dazu, sich bei dem Wetter splitterfasernackt im Freien herumzutreiben? Ein Irrer vermutlich, dachte Barry. Und jetzt war sie beunruhigt. Aber nachdem sie ihn angefahren und fast überfahren hatte, konnte er ja wohl keine Gefahr für sie sein.
Er lag ein gutes Stück seitab von der Straße, auf halber Höhe der Böschung. Seine Haut war so weiß, dass sie sich kaum vom Schnee abhob. Er lag auf dem Gesicht. Sein Fall war von einem kleinen Weißdombaum gebremst worden - ein Arm hing schlaff im niedrigen Gezweig. Von Barrys Blickpunkt aus ähnelte er einem Stück Strandgut. Er wirkte so verloren wie ein Fisch an Land.
Barry stieg nach unten, zog die zusammengerollte Decke hinter sich her, hielt sich an Büschen und vorragenden Felsen fest. Unmittelbar oberhalb von dem Mann glitt sie aus, taumelte, prallte gegen ihn. Sie hörte ein leises Ächzen. Rührte er sich? Nein. Aber wenigstens lebte er noch. Barry betrachtete sein Gesicht, von dem sie nur einen Teil sehen konnte, seinen glatten muskulösen, jugendlichen Körper. Es gab ihr einen Stich, als sie feststellte, dass er ungefähr so alt war wie sie.
Er hatte schimmernde schwarze Haare, sehr dicht über den Ohren und im Nacken. Auf den ersten Blick vom Auto aus hatte es so ausgesehen, als habe er viel weniger Haare. Oder überhaupt keine. Seine Unterarme und Beine waren allerdings haarlos. Seine Fußsohlen hatten eine leicht purpurne Tönung. Weit konnte er nicht gelaufen sein. Keine Spur von Dreck an seinen Füßen. Es war freilich auch denkbar, dass der Schnee alles abgewaschen hatte. Barry sah kein Blut, keine Verunstaltung, die auf einen Knochenbruch hingewiesen hätte. Sie streifte einen Handschuh ab und befühlte vorsichtig seinen Nacken, dann sein Kreuz. Es bekümmerte sie, dass sein Körper nicht warm war, ja blutleer zu sein schien. Aus der Nähe betrachtet, begann sich seine Haut bläulich zu verfärben. Barry hatte an der High School ein bisschen Erste Hilfe gelernt. An ein paar Dinge konnte sie sich noch erinnern. Handelte es sich hier um einen Schockzustand oder um Unterkühlung? Egal, der Mann musste jedenfalls sofort ins Warme. Doch mochte er auch transportfähig sein, es war ein hoffnungsloses Unterfangen, ihn ohne Hilfe in den Volvo zu kriegen. Das merkte Barry gleich. Er war über einen Meter achtzig groß und wog, seinem athletischen Körperbau nach zu schließen, mindestens achtzig Kilo.
Barry rollte die Decke auf, breitete sie neben ihm aus, zögerte, biss sich auf die Unterlippe. Dann schob sie ihre Hände unter ihn und drehte ihn behutsam auf den Rücken. Sein rechter Arm löste sich aus dem Gezweig. Seine Augen waren geschlossen, seine Lippen leicht geöffnet. Barry legte ihre kalten Finger auf seine Halsschlagader. Ja, sie spürte einen Puls, aber sein Gesicht war so ausdruckslos, dass es sie ängstigte. Barry ließ kurz ihren Blick über ihn schweifen. Eine Prellung am linken Schenkel oberhalb des Knies, rötlichfleckig verfärbt. Dort hatte der Volvo ihn gestreift und ihn zum Glück nach rechts umgestoßen. Barry drückte vorsichtig gegen seinen Brustkorb, dann gegen seinen Unterleib. Hatte er innere Verletzungen? Sickerte Blut in die Bauchhöhle? Barry erinnerte sich an einen Freund aus Kindertagen. Eine Kuh hatte ihn getreten, und er war beinah an einem Milzriss gestorben. Doch Barry fühlte nirgendwo eine Schwellung. Der Hodensack des Mannes war blau vor Kälte und zusammengeschrumpelt. Sein stattlicher Penis lief spitz zu wie der von Michelangelos David.
Barry richtete sich auf, nestelte ihren Parka auf und zog ihn aus. Sie war höchstens zehn Zentimeter kleiner als der Mann und sie hatte lange Arme. Sie schaffte es, ihn in den mit Pelz gefütterten Parka zu zwängen. Dann wickelte sie ihn in die Decke, steckte sie um seine Füße herum fest. Reichen würde das allerdings nicht...
»Hallo! Ist da jemand?«
Barry streckte sich, blickte zur Straße empor. Sie sah den roten Schein der Warnlampe auf dem Kombi. Es dunkelte, und offenbar war es auch kälter geworden. Barry wischte sich Schnee von den Wimpern und schauderte; sie trug nur einen leichten Baumwoll- Sweater.
Aus dem Sturm tauchte eine Gestalt auf. Ein Mann. Er hatte eine Taschenlampe in der Hand.
»Hier unten!«, rief Barry. »Ich brauche Hilfe!«
Der Lichtkegel der Taschenlampe fiel aufs Gezweig des Weißdorns und auf das Gesicht des bewusstlosen jungen Mannes. Der Neuankömmling betrachtete einige Sekunden lang die Szenerie. Dann verschwand er plötzlich.
Barry setzte sich mutlos in den Schnee und fragte sich unter Zähneklappern, ob der Fremde jetzt einfach wieder wegfahren würde. Doch nach einer Minute war er zurück und stieg vorsichtig die Böschung hinunter mit seinen dickbesohlten Stiefeln. Über dem einen Arm trug er eine Seilrolle, unter den anderen hatte er eine zusammengefaltete Plastikplane geklemmt. Barry erkannte ihn, sprang auf, rutschte aus und konnte sich gerade noch fangen.
»Albert!«
Albert Tweedy hob den Kopf. »Barry?« Er war ein ungeschlachter junger Mann von zwanzig Jahren, ein Schulkamerad von Barry. Die erste Klasse hatten sie noch gemeinsam besucht, aber dann war er sitzengeblieben und immer weiter zurückgefallen. Vor einem Jahr war er von der High School abgegangen, um ein heimatloses Mädchen mit zwei kleinen Kindern zu heiraten. Seine Familie regte sich jetzt noch darüber auf. Aber Barry hatte gehört, dass es ganz gut klappte mit dieser Ehe - Albert war nett zu den Kindern.
Er kniete sich neben den anderen jungen Mann. Dann wandte er seinen Blick zu Barry. »Was ist denn passiert?«
»Ich - ich weiß nicht, wo er hergekommen ist. Auf einmal war er da, auf der Straße, und ich - ich hab ihn einfach nicht rechtzeitig gesehen, ich...«
Wieder kamen ihr die Tränen. Sie musste einige Male die Augen fest zusammenkneifen, um nicht loszuheulen. Albert betrachtete sie, dachte nach über das, was sie ihm zu sagen versuchte, nahm sich reichlich Zeit dafür. Er hatte extrem vorstehende, mit Pickeln gesprenkelte Kiefer und Schweinsäuglein. Jedermann hielt ihn für hoffnungslos dumm. Barry dagegen war schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass Albert gesunden Menschenverstand habe und guten Willens sei - er war nur ein bisschen langsam und unbeholfen in Gesellschaft. Aber wenn man etwas Geduld und Verständnis für ihn aufbrachte, zahlte sich das aus (wie bei den meisten Leuten).
»Hast du ihn überfahren?«
»Nein. Nur angefahren. Aber sein Bein - überm Knie - das sieht bö-böse aus. Ge-gebrochen vielleicht.«
Albert schlug die Decke auseinander. Als er entdeckte, dass der andere junge Mann nackt war, nahm er die Unterlippe zwischen die Zähne und hielt die Luft an. Aber er sagte nichts. Nach einer Weile wickelte er den anderen wieder in die Decke, drehte sich um, betrachtete die Böschung und überlegte.
»Ka-kannst du ihn tragen?«, fragte Barry.
Albert schüttelte den Kopf. »Lieber nicht. Der ist zu groß.« Er entfaltete die Plastikplane, die an den Rändern metallene Ösen hatte. Dann begann er, das Seil durch die Ösen zu ziehen. Barry erriet, was er vorhatte, und blickte bewundernd zu ihm auf. Sie zitterte wie Espenlaub.
Albert merkte es sofort. Er zog seine wattierte Jacke aus und gab sie ihr.
»Da-danke, es geht schon.«
»Na, nun nimm sie ruhig - mir macht die Kälte nichts aus.« Und tatsächlich schien er sogar ein wenig zu schwitzen bei seiner Arbeit. Barry schlüpfte in die alte Jacke, die dringend reinigungsbedürftig war.
»Was machen wir jetzt?«
»Also, das ist wie eine Hängematte, ja? Wir können ihn hier raufziehen, und er ist ganz fest eingewickelt. Er wird nicht geschüttelt und nichts. Ich meine, falls er sich was gebrochen hat.«
»Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn du nicht vo-vo-vor- beigekommen wärst, Albert.«
»Schon gut. Jetzt halt mal seinen Kopf fest, und ich zieh ihn auf die Matte.«
Gemeinsam schnürten sie den jungen Mann in die Plastikplane ein, bis seine Arme eng am Körper anlagen und seine Hände gegen die Oberschenkel gedrückt waren. Dann stieg Albert rückwärts die Böschung hinauf, keuchte vor Anstrengung, tastete hinter sich nach Büschen und Felsen, die seinen Händen Halt geben konnten. Das Seil hatte er um seine Leibesmitte geschlungen. Barry folgte ihm und betätigte sich sozusagen als Bremse: Wenn Albert stehenblieb, um sicheren Tritt zu fassen, hielt sie den Verletzten fest.
Sie waren fast oben, als sie eine Sirene hörten. Aus dem Tunnel der Brücke kam ein Polizeiauto. Albert hatte seinen Lieferwagen mit laufendem Motor auf der anderen Straßenseite stehenlassen. Er winkte den Polizisten mit seiner Taschenlampe her.
2.
Der Gesetzeshüter hieß Mix. Er war Mitte Dreißig, trug einen Mongolenschnurrbart und hatte vorquellende braune Augen, was ihm einen Ausdruck ständiger Angestrengtheit verlieh - so, als fände er selbst die alltäglichsten Routineangelegenheiten verteufelt kompliziert. Er wollte Barrys Führerschein sehen. Dann stotterte Barry (Albert stand hinter ihr, seine Unterlippe zwischen den Zähnen) eine kurze Erklärung der Ereignisse zusammen.
Mix beugte ein Knie, ließ sich nieder, holte eine bleistiftgroße Taschenlampe aus seiner Hemdtasche, öffnete das rechte Augenlid des Verletzten und leuchtete in die erweiterte Pupille. Sie zog sich zusammen. Freilich ein wenig langsam. Mix wickelte den jungen Mann aus seiner Umhüllung, betrachtete ihn ein paar Sekunden von oben bis unten, erhob sich und stemmte beide Hände in die Hüften.
»Sie sind Zeuge, oder wie?«, fragte er Albert.
»Er ist erst vo-vor ein paar Minuten vorbeigekommen«, teilte Barry dem Polizisten mit.
»Und Sie wissen nicht, wen Sie da angefahren haben?«
»Ich habe den Mann noch nie gesehen«, erwiderte Barry und wusste, dass Mix ihr kein Wort von dem glaubte, was sie ihm gesagt hatte.
»Okay. Ein Unbekannter also. Unfallschock vermutlich. Das Schlaueste ist, wir bringen ihn ins Krankenhaus. Und zwar mit Ihrem Kombi. Wenn wir jetzt noch auf den Krankenwagen warten - das dauert zu lang. Sind Sie einigermaßen okay? Ich meine, können Sie fahren?«
»Mhm.«
»Dann holen Sie den Wagen mal her.«
Dank Albert, der vorne anschob, bekam Barry den Volvo wieder auf die Straße. Drunten bei der Brücke warf Mix einen gründlichen Blick ins Wageninnere. Diesmal leuchtete er mit seiner großen Taschenlampe. Er studierte die Wagenpapiere, die Versicherungskarte. Und dann - es war zum Verrücktwerden - schnüffelte er weiter. Barry kam zu dem Schluss, dass er nach Rauschgift oder nach Kleidern suchte. Oder nach beidem. Er dachte also... Das Blut schoß Barry in die Wangen, und weil ihr so entsetzlich kalt war, begann sie wieder zu stottern.
»E-e-er ist nicht mit mir im Wagen gefahren«, sagte sie verärgert.
Mix gab keine Antwort. Er und Albert hoben den Verletzten in den Volvo. Albert erbot sich, mitzufahren und ein Auge auf ihn zu haben. Barry war dankbar dafür, dass er ihr Gesellschaft leistete. Sie fühlte sich immer noch reichlich flau. Aber vielleicht war jetzt das Schlimmste ausgestanden.
Mix fuhr voraus, dem Krankenhaus von Anatolia entgegen, Sirene an, die Blinklichter auf dem Dach desgleichen; blau und rot liefen sie um und um in der zunehmenden Dunkelheit, im Schneegestöber. Albert hockte hinterm Fahrersitz, hielt den Kopf des Verletzten fest, denn er sollte nicht hin und her rollen. Mix hatte betont, wie wichtig dies sei, falls die Halswirbelsäule lädiert wäre. Barry hatte die Heizung voll aufgedreht, was ihre Kopfschmerzen noch vermehrte. Ihr war schlecht, aber sie war fest entschlossen, nicht dem Drang nachzugeben, an den Straßenrand zu fahren und sich von Albert ablösen zu lassen.
»Na, wie sieht's aus?«
»Er ist nicht mehr so kalt.«
»Gut.«
»Weißt du, was ich glaube?«, fragte Albert zögernd, denn es pflegte niemand zu interessieren, was er glaubte.
»Nein. Was glaubst du denn, Albert?«
»Dass er irgendwo hier draußen gezeltet hat.«
»Ohne was an?«
»Vielleicht wollte er zum Schwimmen.«
»Bei dem Wetter?«
»Mein Onkel geht jedes Wochenende in Coney Island zum Schwimmen. Sogar im Januar. Und er ist schon dreiundsechzig. Ist so 'ne Art Verein, zu dem er gehört. Er sagt, eiskaltes Wasser ist gut für den Kreislauf. Und er ist topfit. Echt. Bloß 'n bisschen taub auf einem Ohr.«
Barry hatte eine andere Idee: »Vielleicht war das eine von diesen saudummen Mut-, Bewährungs- und sonstigen Proben.«
»Du meinst, von so 'ner Studentenverbindung?«
»Ja. Wäre nicht das erste Mal, dass sie hier in den Wäldern jemand praktisch ausgesetzt haben. Vielleicht wussten sie nicht, dass Schnee angesagt war.«
Als sie das Krankenhaus erreichten, war der Verletzte immer noch bewusstlos. Ein Arzt und zwei Schwestern warteten vor der Notaufnahme auf ihn. Dann schoben sie ihn auf einer Bahre mit Rädern nach drinnen. Barry und Albert standen herum und fühlten sich etwas überflüssig. Mix gab einer Schwester Tips zum Ausfüllen der Formulare. Viel konnte er ihr allerdings über den jungen Mann nicht sagen.
Dann wandte Mix sich an Barry: »Ein Kollege ist auf dem Weg hierher. Er möchte gern ein paar Worte mit Ihnen reden.«
»Ich verdrücke mich schon nicht. Aber ich möchte meinen Vater anrufen. Und was ist mit Albert? Er hat seinen Lieferwagen bei der Brücke stehenlassen.«
»Albert kann jederzeit gehen.«
Barry blickte Albert an und zuckte entschuldigend die Achseln. Aus der Notaufnahme hörte sie, wie eine Schwester den Blutdruck angab, einen äußerst niedrigen Wert. Ein Monitor piepte regelmäßig und rhythmisch. Offenbar der Herzschlag. »Können Sie mich hören?«, fragte der Arzt mit lauter Stimme. »Wie heißen Sie? Nennen Sie mir bitte Ihren Namen.« Barry, die ganz kribbelig war vor Neugier, ging langsam auf die Notaufnahme zu. Die aufsichtführende Schwester schüttelte streng den Kopf. Und so ging Barry dann mit Albert in die Eingangshalle und schaute sich nach einem Telefon um.
Mrs. Aldrich, die Haushälterin der Farm, teilte Barry mit, ihr Vater sei vor zehn Minuten von der Polizei benachrichtigt worden. Er sei auf dem Weg in die Stadt.
»Soll ich mit dem Abendessen warten?«
»Ja, bitte, Mrs. Aldrich. Ist Dal schon da?«
»Nein, noch nicht. Aber soviel ich weiß, hatte er fest vor, mit seiner Freundin zu kommen. Ach, und jetzt steht Ethan schon draußen und hupt - wenn wir jetzt nicht gleich losfahren, kommen wir bei uns zu Hause heute nicht mehr den Berg rauf. Es ist jedenfalls alles soweit fertig. Sie brauchen es nur noch in den Ofen zu schieben.«
»Vielen Dank, Mrs. Aldrich.«
In dem kleinen Laden in der Eingangshalle kaufte Barry Geschenke für Alberts Stiefkinder: einen Trommelaffen zum Aufziehen und eine Stoffpuppe mit schlottrigen Locken und einem auf gestickten Lächeln von Ohr zu Ohr. Sie hatte noch genügend Geld für eine Zeitschrift, die auf dem Titelblatt eine Freundin ihres Bruders zeigte, ein Fotomodell, und für ein Doppelstück Schokolade mit Füllung, eine Marke, der Barry seit Kindertagen geradezu süchtig die Treue hielt. Sie schlang den einen Riegel Schokolade gierig hinunter, aber ihr Magen protestierte. Also wickelte sie den anderen wieder ein und steckte ihn in ihre Handtasche.
»Jessie holt mich ab«, sagte Albert, als Barry zu ihm trat.
»Gut. Mein Vater ist auch auf dem Weg hierher. Albert, du hast diesem Mann wahrscheinlich das Leben gerettet. Allein hätte ich überhaupt nichts machen können. Die Sachen hier sind für die Kinder - okay?«
Barry ging zurück zur Notaufnahme, warf einen Blick durch die Tür. Der Patient lag noch drinnen. Barry sah ihn kurz. Er rührte und regte sich nicht. Auf dem Vorhang, der teilweise um den Behandlungstisch herumgezogen war, zeichneten sich drei Schatten ab: ein Arzt, eine Schwester, ein Mann mit Mantel. Und da war noch etwas. Auf dem Boden. Ein Bündel Stoff oder irgendwelche Fetzen, schwarz und orange und blutverschmiert. Reichlich unerwartet. Zu erinnerungsträchtig. Zu gegenwärtig. Barry war plötzlich, als streiften sie dunkle Schwingen, als käme ein Fieber über sie. Sie trat zurück und kniff sich in den Arm, um wenigstens teilweise ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Dann knöpfte sie sich die aufsichtführende Schwester vor, die abweisend zu ihren Fragen lächelte.
»Wie schlimm sind seine Verletzungen?«
»Das ist schwer zu sagen.«
»Warum ist er immer noch bewusstlos?«
»Sie brauchen sich wirklich nicht aufzuregen.«
»Ich brauche mich wirklich nicht aufzuregen? Was soll das denn heißen, bitteschön? Ich bin schließlich diejenige, die...«
Der Mann mit Mantel trat aus der Notaufnahme und lächelte Barry an. Er trug große runde und ungewöhnlich dicke Brillengläser. Seine Statur, sein schleichender Gang und seine leicht manische Art erinnerten an Fritz the Cat.
»Sie sind Barry? Ich bin Stewart Ivorson. Sie hatten früher Klavierstunden bei meiner Mutter.«
»Ja, stimmt. Wie geht es ihr?«
Er zog die Finger der rechten Hand krumm. »Sie hat Arthritis. Kann jetzt natürlich nicht mehr so viele Stunden geben. Wollen wir uns schnell da rübersetzen? Ich muss Sie ein paar Sachen zu dem Unfall fragen.«
Sie gingen auf eine Reihe von blauen und orangen Schalensitzen aus Plastik zu, die Barry an den Kindergarten erinnerten. Ivorson blätterte sinnend in seinem Notizbuch.
»Wissen Sie, wer er ist?«, erkundigte sich Barry.
»Nein, noch nicht. Im Park sind ein paar Kollegen und versuchen herauszufinden, wo er gezeltet hat. Falls er gezeltet hat.«
»Was sagt der Arzt?«
»Der ist verhalten optimistisch. Ja, schauen wir uns mal den Befund an. Ein Mann also, zirka zwanzig Jahre alt und in guter körperlicher Verfassung. Temperatur bei der Einlieferung knapp 35 Grad. Keine Erfrierungen, keine Unterkühlung. Pupillen reagieren, die anderen Reflexe sind auch normal. Offenbar kein Schädeltrauma. Ziemlich happige Quetschung am linken Bein zwischen Hüfte und Knie, möglicherweise Fraktur des Oberschenkels - der Patient wird in ein paar Minuten geröntgt. Die Atmung war zunächst flach, jetzt ist sie normal. Der Blutdruck ist ziemlich niedrig, sinkt aber nicht. Das heißt, er hat höchstwahrscheinlich keine größeren Blutungen. Aber er ist bewusstlos. Reagiert nicht, wenn man ihn anspricht, reagiert auch sonst nicht auf Sinnesreize. Wissen Sie, um welche Zeit der Unfall passiert ist?«
Barry teilte Ivorson mit, wann sie von Anatolia losgefahren war.
»Wenn wir die Straßenverhältnisse in Rechnung stellen, können wir also sagen, dass der Unfall ungefähr um zehn nach vier passiert ist. Für die Brücke gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40km/h. Kann es sein, dass Sie etwas schneller gefahren sind?«
»Ein bisschen, ja«, gab Barry zu.
»Also sagen wir, Sie sind knapp 50 km/h gefahren. Ich nehme an, Sie haben noch nicht daran gedacht, Ihre Versicherung zu benachrichtigen?«
»Heiliger Gott, nein! Ich hab's total verschwitzt! Aber vielleicht hat Vater...«
»Machen Sie's so bald wie möglich. Sie oder Ihr Vater. Okay, Barry, würden Sie mir dann bitte noch mal den genauen Hergang erzählen?«
Barry schloss für ein paar Momente die Augen. Sie versuchte, den Nebel aus ihrem Kopf zu vertreiben, sich den Unfall klar und deutlich ins Gedächtnis zurückzurufen. Eigentlich hätte sie dringend aufs Klo gemusst, aber sie wollte diese Befragung jetzt hinter sich bringen.
Sie konzentrierte sich und sah alles wieder vor sich: den dunklen Schacht der überdachten Brücke, den wirbelnden Schnee am anderen Ende, dann plötzlich die Gestalt auf der schmalen Straße, lebensgroß mit einem Mal und viel zu nah, den Kopf gedreht, die Hände erhoben... Aber nun war die Gestalt ein wenig anders, nun erinnerte sie irgendwie an Ned Kramer.
Barry erstarrte, hörte auf zu sprechen, blickte offenen Mundes und mit einem Ausdruck der Angst die Wand gegenüber an.
»Er wird am Leben bleiben. Er muss am Leben bleiben.«
»Nur keine Bange«, meinte Ivorson, Barrys Gesichtsausdruck missdeutend. »Die Sicht war schlecht, und Sie hatten fast keine Zeit zu reagieren. Ich würde sagen, Sie haben sich bemüht, sein Leben zu retten, und Sie haben Ihre Sache gut gemacht.«
Barry drehte ihren Kopf erschöpft zu Ivorson.
»Ich sitze nicht in der Tinte, oder?«
»Sieht nicht so aus, würde ich sagen. Ich habe jetzt alles, was ich fürs erste brauche. Also - warum fahren sie nicht nach Hause und ruhen sich ein bisschen aus?«
»Ich warte lieber auf Dad. Ich glaube, ich kann im Moment nicht fahren.«
Die Stationsschwester kam aus der Notaufnahme und brachte Barry ihren Parka wieder. Barry riss ihn der Schwester fast aus der Hand, denn ihr war kalt vor Schreck. Doch obwohl der junge Mann ihn beinah eine Stunde am Leib gehabt hatte, war das wie nie gewesen - er hatte nicht die kleinste Spur hinterlassen. Den Parka anzuziehen, war schlimmer, als zu erblinden; es war, als träte man in die schale Ewigkeit einer Gruft. Barry reagierte heftig. Sie schüttelte den Parka ab und ließ ihn auf einen Stuhl fallen.
Zwei Krankenpfleger rollten den jungen Mann aus der Notaufnahme. Jetzt deckte ihn vom Kinn bis zu den Knöcheln ein Laken zu. Seine Augen waren geschlossen, seine Hände über der Brust gefaltet. Er war sehr hübsch, aber leblos. Er kam Barry verzaubert vor, ein verwunschener Prinz.
Barry erhob sich, wie um der Bahre zu folgen. Sie wollte seine Augen offen sehen, wollte ihn atmen hören. Sie taumelte ein wenig, spürte an ihrer linken Schläfe - einem Schlag nicht unähnlich - einen hart pochenden Puls.
Und dann griff eine Hand nach ihr und stützte sie. Barry drehte sich um. Ihr Vater war da. Sie hatte ihn nicht kommen sehen. Er starrte den jungen Mann auf der Bahre an. Die Bahre wurde weitergerollt, verschwand. Ein Muskel in der Umgebung von Tom Brennans linkem Auge zuckte - wie meistens, wenn er aus seinem Atelier weggeholt oder aus schöpferischen Träumereien gerissen und mit einer Krise konfrontiert wurde. Er passte sich nur langsam (und manchmal heftig grollend) an die Realität der Welt an. Und Krankenhäuser hatte er immer schon gehasst.
Barry empfand es als Wohltat, sich eine Weile einfach mit geschlossenen Augen an ihn zu lehnen. Tom Brennan legte die Arme um sie. Sie konnte sich denken, was ihm durch den Kopf ging. Erinnerungen. Edie war nach ihrem Unfall hierher gebracht worden. Ein paar Minuten, ehe der Krankenwagen vor der Notaufnahme vorfuhr, war sie gestorben. Und der Fremde, der mit Edie im Wagen gesessen hatte, hatte sie bloß um eine halbe Stunde überlebt.
Tom drückte Barry an sich. »Bist du okay?«, fragte er.
»Ja. Einigermaßen. Mir wird nur hin und wieder ein bisschen flau.«
»Und wie geht es ihm?«
»Weiß nicht. Niemand sagt einem was Genaues. Aber immerhin - er lebt. Und ich darf jetzt nach Hause.« Sie blickte Ivorson Bestätigung heischend an. Ivorson nickte und streckte ihrem Vater die Hand entgegen.
»Mr. Brennan? Ich bin Stewart Ivorson von der Staatspolizei. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Sir. Ich war immer schon ein großer Bewunderer Ihres Werks.«
»Danke. Wird Anklage gegen Barry erhoben?«
»Das ist äußerst unwahrscheinlich.« Ivorson lächelte Barry beifällig an. »Ein Pfundskerl, Ihre Tochter. Also - ich lasse von mir hören.«
»Nichts wie weg hier«, sagte Barry dankbar.
3.
Tom war mit einem Chevrolet-Kleinlaster gekommen, einem Fahrzeug mit äußerst stabiler Radaufhängung, mit Reifen, die sich durch zwanzig Zentimeter Neuschnee fressen konnten, und mit einem Schneepflug, der das Gröbste beiseite räumte. Ein zehn Jahre alter Bluthund - er litt an Verdauungsstörungen und hatte eine Stimme wie Donnerhall - machte Barry Platz und legte sich dann wieder hin, wobei er den Kopf in Toms Schoß bettete. Eigentlich hieß der Hund Kipper, aber Barry hatte ihn seiner regen Darmtätigkeit wegen Gemeinheit getauft, und dieser Name war ihm geblieben.
Sie ließen den Volvo auf dem Parkplatz des Krankenhauses stehen und machten sich auf den Weg nach Hause. Aus Gemeinheits Darm drang einer seiner berüchtigten Winde. Barry ächzte und kurbelte das Fenster herunter.
»Er hält wohl nicht Diät, wie?«, sagte Barry anklagend.
»Der muss im Wald irgendwas mit Hautgout aufgegabelt haben.«
»Äh...«
Tom trug seine alte Kordsamtjacke, verschossene Kürbisfarbe, Lederflicken auf den Ellenbogen. Er war lang, dünn und blond, hatte eine sommersprossige Stirn und sprach mit einem leichten irischen Akzent, den er vor gut vierzig Jahren in die Vereinigten Staaten mitgebracht hatte. Er blickte Barry über den Rand seiner Augengläser an (zum Fahren brauchte er eine Brille).
»Möchtest du - oder kannst du - über den Unfall reden?«
»Ja. Aber lass uns warten, bis wir bei der Brücke sind.«
Tom nickte. Barry machte einen gefassten Eindruck auf ihn - ein bisschen müde, gewiss, aber sie schien nicht in eine von ihren stummen Grübelphasen abzudriften, die ihn so sehr störten und beunruhigten.
Am westlichen Ende der Brücke gab es eine kleine Parkbucht. Tom und Barry stiegen aus, ließen Gemeinheit im Wagen (der sich darüber bitter beschwerte) und gingen durch den langen, hallenden Schacht der Brücke. Tom hatte eine große Taschenlampe mit dabei.
Barry erklärte, was und wie es passiert war. Sie standen da, blickten den Abhang hinunter. Weiße Flocken tanzten im Lichtkegel.
»Komisch, dass er von der Brücke wegging, mitten ins Schneetreiben hinein«, sagte Tom.
»Wenn ich bloß wüsste, was er hier draußen gemacht hat!«
»Ich schließe mich Alberts Meinung an - ich glaube kaum, dass er von hier ist.«
»Vielleicht ist er aus dem Heim für schwer Erziehbare abgehauen«, vermutete Barry.
»Aus dieser Besserungsanstalt in Caimstown, meinst du? Aber das ist doch über dreißig Kilometer weg!«