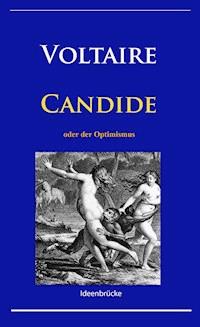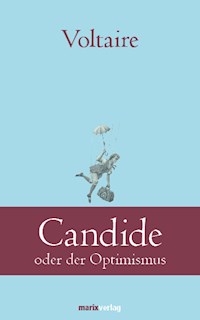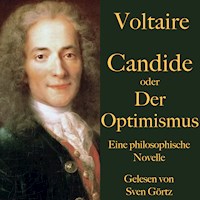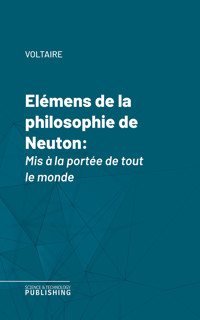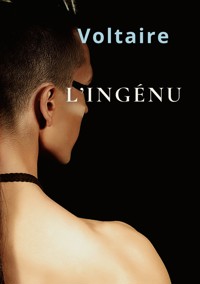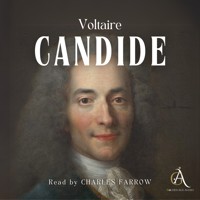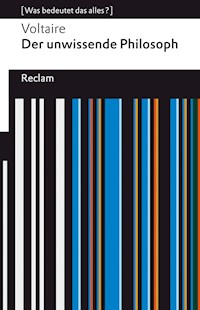
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek – [Was bedeutet das alles?]
- Sprache: Deutsch
Mit 72 Jahren veröffentlichte Voltaire diesen altersweisen Text: eine schelmische Einladung zum Philosophieren und zugleich eine Abrechnung mit der Philosophie – von Konfuzius und den alten Griechen über Descartes, Spinoza und Leibniz bis in seine Gegenwart. Im Gegensatz zu anderen verbirgt der unwissende Philosoph Voltaire die Widersprüche bei seiner Suche nach dem Wesen der Moral, der Freiheit des Willens, der Erkenntnisfähigkeit des Menschen nicht: ein Selbstportrait als Denker, der niemals aufhören darf, die Wahrheit zu suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Voltaire
Der unwissende Philosoph
[Was bedeutet das alles?]
Reclam
E-Book-Leseproben von einigen der beliebtesten Bände unserer Reihe [Was bedeutet das alles?] finden Sie hier zum kostenlosen Download.
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961991-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014169-4
www.reclam.de
Inhalt
Der unwissende Philosoph
I. Erste Fragen
II. Unsere Schwachheit
III. Wie kann ich denken?
IV. Muss ich unbedingt wissen?
V. Aristoteles, Descartes und Gassendi
VI. Die Tiere
VII. Die Erfahrung
VIII. Substanz
IX. Enge Grenzen
X. Unmögliche Entdeckungen
XI. Mit Recht verzweifelt?
XII. Schwachheit des Menschen
XIII. Bin ich frei?
XIV. Ist alles ewig?
XV. Intelligenz
XVI. Ewigkeit
XVII. Unbegreiflichkeit
XVIII. Das Unendliche
XIX. Mein Abhängigsein
XX. Nochmals Ewigkeit
XXI. Nochmals mein Abhängigsein
XXII. Eine weitere Frage
XXIII. Ein einziger allerhöchster Werkmeister
XIV. Spinoza
XXV. Absurditäten
XXVI. Über die beste der Welten
XXVII. Von Monaden usw.
XVIII. Die plastischen Gestalten
XXIX. Über Locke
XXX. Was habe ich bis hierher gelernt?
XXXI. Gibt es eine Moral?
XXXII. Wirklicher Nutzen. Wissen um die Gerechtigkeit
XXXIII. Ist allgemeine Übereinstimmung ein Wahrheitsbeweis?
XXXIV. Gegen Locke I
XXXV. Gegen Locke II
XXXVI. Die Natur ist sich überall gleich
XXXVII. Über Hobbes
XXXVIII. Allgemeine Moral
XXXIX. Über Zoroaster
XL. Über die Brahmanen
XLI. Über Konfuzius
XLII. Über die griechischen Philosophen, zunächst über Pythagoras
XLIII. Über Zaleukos
XLIV. Über Epikur
XLV. Über die Stoiker
XLVI. Philosophie und Tugend
XLVII. Über Äsop
XLVIII. Über den Frieden, der durch die Philosophie geboren wurde
XLIX. Weitere Fragen
L. Noch weitere Fragen
LI. Unwissenheit
LII. Weitere Unwissenheit
LIII. Die größte Unwissenheit
LIV. Lächerliche Unwissenheit
LV. Schlimmer als Unwissenheit
LVI. Anbruch der Vernunft
Zu dieser Ausgabe
Nachwort
Der unwissende Philosoph
I. Erste Fragen
Wer bist du? Woher kommst du? Was tust du? Was wird einmal aus dir? Das sind Fragen, die man allen Wesen im Universum stellen sollte, auf die uns aber keines eine Antwort gibt. Ich frage die Pflanzen, welche Kraft ihnen ermöglicht zu wachsen, und wie es sein kann, dass ein und derselbe Boden so unterschiedliche Früchte hervorbringt. Diese Wesen – stumm und empfindungslos, wiewohl mit einer gottgegebenen Fähigkeit beschenkt – überlassen mich meiner Unwissenheit und meinen vergeblichen Spekulationen.
Ich befrage jene Vielzahl unterschiedlicher Tiere, die alle ihren Antrieb haben und den auch zeigen, denen die gleichen Empfindungen eigen sind wie mir, die über ein gewisses Maß an Vorstellungen und Gedächtnis verfügen, dazu über alle Leidenschaften. Sie wissen noch weniger als ich, was sie sind, warum sie sind und was einmal aus ihnen wird.
Ich vermute, ja ich meine sogar glauben zu dürfen, dass die Planeten, die um die unzähligen Sonnen kreisen, welche das All anfüllen, von empfindungs- und denkfähigen Wesen bevölkert sind. Aber eine ewige Schranke trennt uns, und keiner jener Bewohner der anderen Himmelskörper ist je mit uns in Verbindung getreten.
Im Schauspiel der Natur1 sagt der Prior zum Chevalier, die Sterne seien für die Erde geschaffen und die Erde sowie auch die Tiere für den Menschen. Indes, da sich die kleine Kugel namens Erde gemeinsam mit den anderen Planeten um die Sonne dreht, da die regelmäßigen und gleichlaufenden Bewegungen der Gestirne auf ewig bestehen können, ohne dass Menschen existieren, da es auf unserem kleinen Planeten unendlich mehr Tiere als Wesen meinesgleichen gibt, denke ich, dass der Prior etwas zu sehr seiner Selbstverliebtheit frönt, wenn er sich schmeichelt, alles sei für ihn geschaffen worden. Ich habe beobachtet, dass der Mensch während seines Lebens von allen Tieren aufgefressen wird, wenn er wehrlos ist, und dass sie alle ihn nach seinem Tode weiter auffressen. Insofern fällt es mir schwer, einzusehen, dass der Prior und der Chevalier die Könige der Natur seien. Als ein Sklave all dessen, was mich umgibt, nicht als ein König, auf einen Punkt beschränkt und von der Unermesslichkeit umringt, beginne ich nun, nach mir selbst zu forschen.
II. Unsere Schwachheit
Ich bin ein schwaches Tier. Wenn ich geboren werde, besitze ich weder Kraft noch Wissen noch Instinkte. Ich vermag nicht einmal zu den Zitzen meiner Mutter hinzukriechen, was alle Vierfüßer können. Ein wenig Vorstellungsvermögen bekomme ich erst, wenn ich ein bisschen Kraft bekomme, sobald meine Organe sich zu entwickeln beginnen. Die Kraft wird stärker in mir bis zu der Zeit, da sie nicht mehr wachsen kann und mit jedem Tag schwächer wird. Auch jene Fähigkeit, Vorstellungen zu entwickeln, nimmt ebenfalls zu, bis es nicht mehr geht, und dann schwindet sie unmerklich nach und nach.
Was ist das für eine Mechanik, welche die Kraft meiner Glieder immerfort wachsen lässt bis zum vorherbestimmten Zeitpunkt? Ich weiß es nicht; und diejenigen, die ihr Leben damit verbracht haben, diese Sache zu ergründen, wissen darüber nicht mehr als ich.
Was ist jene andere Macht, die meinem Gehirn Bilder eingibt und sie in meinem Gedächtnis bewahrt? Diejenigen, die man dafür bezahlt, es herauszufinden, haben umsonst gesucht; wir alle wissen über die erste Ursache genauso wenig wie als wir in der Wiege lagen.
III. Wie kann ich denken?
Haben die Bücher, die in den letzten zweitausend Jahren geschrieben wurden, mich etwas gelehrt? – Uns ergreift manchmal die Begehr zu erfahren, wie wir denken, während uns nur selten die Begehr packt zu erfahren, wie wir verdauen, wie wir gehen. Ich habe meinen Verstand zu Rate gezogen; er solle mir sagen, was er sei; aber diese Frage hat ihn immer nur verwirrt.
Ich habe versucht, mit seiner Hilfe herauszufinden, ob die Kräfte, die mich verdauen lassen, die mich gehen lassen, dieselben sind wie jene, die mir Ideen eingeben. Ich habe nie begriffen, wie und warum diese Ideen sich verflüchtigen, wenn Hunger meinen Körper schwächt, und wie und warum sie wieder aufleben, sobald ich gegessen habe.
Ich habe einen so großen Unterschied festgestellt zwischen Gedanken und der Nahrung, ohne die ich nicht denken kann, dass ich zu der Annahme gelangte, es gebe in mir eine Substanz, die überlegt, und eine andere, die verdaut. Indessen, während ich ständig versuchte, mir zu beweisen, dass wir unser zwei seien, habe ich grob empfunden, dass ich nur ein Einziger bin, und dieser Widerspruch hat mir immer äußerste Pein bereitet.
Ich habe ein paar meiner Mitmenschen – es waren solche, die höchst fleißig die Erde, unsere gemeinsame Mutter, bebauen – befragt, ob sie nicht auch empfänden, aus zwei Wesen zu bestehen, ob sie dank ihrer Lebensweisheit entdeckt hätten, dass sie in sich eine Substanz besäßen, unsterblich, doch aus nichts gemacht, die ohne Ausdehnung existiert, die auf ihre Nerven wirkt, ohne sie zu berühren, und die gezielt sechs Wochen nach der Empfängnis2 in den Bauch ihrer Mütter gesetzt worden sei. Die Angesprochenen glaubten, ich wollte wohl scherzen, und setzten ihre Feldarbeit fort, ohne mir zu antworten.
IV. Muss ich unbedingt wissen?
Da ich also sah, dass ungeheuer viele Leute nicht nur keine Ahnung von den Schwierigkeiten hatten, die mich umtrieben, und an dem, was ihnen in den Schulen über den Menschen generell, über die Materie, über den Geist usw. erzählt worden war, keinen Zweifel hegten; da ich sah, dass sie oft darüber spotteten, was ich da wissen wollte, stieg in mir der Verdacht auf, es sei gar nicht notwendig, dass wir es wissen. Ich dachte nun, die Natur habe jedem Wesen das mitgegeben, was ihm zusteht, und dass die Dinge, die unser Verstand nicht erreicht, eben nicht zu unserem Erbteil gehören. Trotz dieser zeitweiligen Hoffnungslosigkeit habe ich jedoch nicht von dem Wunsch abgelassen, mir über diese Dinge Kenntnis zu erwerben, und meine Neugierde wird zwar immer wieder enttäuscht, ist aber unersättlich geblieben.
V. Aristoteles, Descartes und Gassendi
Aristoteles sagte als einer der Ersten, die Skepsis sei die Quelle der Weisheit.3 Descartes hat diesen Gedanken aufgegriffen, wenn auch verwässert. Die beiden haben mich gelehrt, nichts von dem zu glauben, was sie sagen. Namentlich jener Descartes, nachdem er zunächst den großen Zweifler spielte, spricht er nun in einem dermaßen affirmativen Ton über Dinge, von denen er nichts versteht. Er ist seiner Sache so sicher, wenn er sich in physikalischen Dingen gröblich irrt. Er hat sich eine ziemlich imaginäre Welt zurechtgezimmert. Seine Wirbel und seine drei Elemente4 sind von einer so enormen Lächerlichkeit, dass ich allem misstrauen muss, was er mir über die Seele sagt, nachdem er mich dermaßen falsch über die Körper belehrt hat. Soll man den doch preisen, großartig – vorausgesetzt, man dehnt das Lob nicht aus auf seine philosophischen Fabeleien, die heute in ganz Europa verachtet werden, und das wird auch so bleiben.
Er glaubt oder gibt doch vor zu glauben, dass wir mit metaphysischen Gedanken geboren werden. Da könnte ich ja gleich behaupten, Homer sei mit der Ilias im Kopf geboren worden. Es ist wohl wahr, dass Homer ein besonders gebautes Hirn besaß, empfänglich für poetische Ideen, bald schöne, bald unzusammenhängende, bald exzessive, und nachdem er die alle in sich aufgenommen hatte, komponierte er daraus schließlich die Ilias. Wir bringen, wenn wir geboren werden, den Keim all dessen mit, was sich später in uns entwickelt; aber wir haben zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr angeborene Ideen in uns, als Raffael und Michelangelo bei der Geburt Pinsel und Farben mitbrachten.
Descartes nahm an, um die disparaten Teile seiner Schimären zusammenzubringen, der Mensch denke ständig. Da kann man sich auch gleich vorstellen, die Vögel würden niemals aufhören zu fliegen und die Hunde zu rennen, weil Erstere eben die Fähigkeit haben zu fliegen und die Letzteren jene zu rennen.
Wenn man nur ein wenig seine eigene Erfahrung sowie jene des Menschengeschlechts zu Rate zieht, ist man bald vom Gegenteil überzeugt. Es dürfte keiner närrisch genug sein, fest zu glauben, er habe sein ganzes Leben lang gedacht, Tag und Nacht, ohne Unterbrechung, seit er ein Fötus war bis hin zu seiner letzten Krankheit. Die Vertreter dieses Gefabels haben sich mit der These herauszuhelfen versucht, man denke wohl ständig, aber es sei einem nicht bewusst. Da könnte man auch gleich sagen, man trinke, esse oder reite, ohne es zu wissen. Wenn wir nicht bemerken, dass wir Gedanken haben, wie können wir dann behaupten, wir hätten welche? Gassendi5 goss über dies verdrehte System gebührenden Spott. Und was war die Folge des Ganzen? Man erklärte Gassendi und Descartes zu Atheisten – weil sie ihren Verstand benutzten.
VI. Die Tiere
Aus der Annahme, dass die Menschen beständig Vorstellungen, Wahrnehmungen und Begriffsvermögen besitzen, folgt natürlich, dass auch die Tiere all dies dauerhaft besitzen; denn es ist unbestreitbar, dass etwa ein Jagdhund die Vorstellung von seinem Herrn in sich hat, dem er gehorcht; er weiß genau, welche Beute er ihm bringen soll. Es ist offensichtlich, dass er über ein Gedächtnis verfügt, und er kann auch ein paar Gedanken zusammenfügen. Wenn also das Denken des Menschen die Grundessenz seiner Seele ist, dann ist das Denken des Hundes auch die Grundessenz der seinen, und wenn der Mensch beständig Gedanken hat, dann haben zwangsläufig auch die Tiere welche. Um diese Schwierigkeit auszuräumen, verstieg sich der Erfinder der Wirbel und der geriffelten Materie6 zu der Behauptung, die Tiere seien bloße Maschinen, die nach Essen suchten, ohne Appetit zu haben, die alle Gefühlsorgane ihr Eigen nennten, ohne jemals die geringste Empfindung zu verspüren, die brüllten, doch nicht aus Schmerz, die ihr Vergnügen artikulierten, doch nicht aus Freude, die ein Gehirn besäßen, bloß um nicht die mindeste Idee zu empfangen, und die auf diese Weise ein ständiger Widerspruch seien.
Dieses System war ebenso lächerlich wie das andere, aber statt seine Überspanntheit bloßzulegen, warf man ihm Gottlosigkeit vor; man behauptete, dieses System stehe im krassen Gegensatz zur Heiligen Schrift, die doch in der Genesis sagt, Gott habe mit den Tieren einen Vertrag gemacht und werde von ihnen das Blut der Menschen zurückfordern, die sie gebissen oder gefressen hätten.7 Dies unterstellt doch eindeutig den Tieren Intelligenz und die Kenntnis von Gut und Böse.
VII. Die Erfahrung
Mengen wir niemals die Heilige Schrift in unsere philosophischen Dispute hinein: das sind zwei allzu heterogene Sphären, die keinerlei Bezug zueinander haben. Es geht hier nur darum zu prüfen, was wir aus uns selbst heraus wissen können, und das ist ziemlich wenig. Man stellte sich gegen den gesunden Menschenverstand, wenn man nicht zugäbe, dass wir nichts auf der Welt ohne die Erfahrung wissen; zweifellos sind wir nur durch eine Reihe tastender Versuche und durch anhaltendes Nachdenken zu einigen schwachen und vagen Vorstellungen über den Körper, den Raum, die Zeit, die Unendlichkeit, ja sogar über Gott gelangt. Wäre dem nicht so, würde es sich für den Urheber der Natur nicht lohnen, diese Vorstellungen allen Föten in die Hirne zu legen, wenn dabei nur ein Häuflein Menschen herauskäme, die davon Gebrauch machen.
Wir alle gleichen hinsichtlich der Gegenstände unserer Wissenschaft den unwissenden Liebenden Daphnis und Chloë, deren Leidenschaften und vergebliche Versuche uns Longus geschildert hat.8 Sie brauchten viel Zeit, um herauszufinden, wie sie ihr Verlangen befriedigen konnten, weil ihnen die Erfahrung fehlte. Dasselbe geschah bei Kaiser Leopold9 und beim Sohn Ludwigs XIV.10; sie brauchten erst Unterrichtung. Wären sie im Besitz angeborener Ideen gewesen, so wäre doch zu vermuten, dass die Natur ihnen die entscheidende und zur Erhaltung des Menschengeschlechts einzig notwendige nicht vorenthalten hätte.
VIII. Substanz
Da wir von nichts einen Begriff haben können außer durch Erfahrung, können wir unmöglich jemals wissen, was Materie ist. Wir berühren, wir sehen die Eigenschaften dieser Substanz, aber das Wort Substanz selbst – das, was sich darunter befindet11 – weist schon zur Genüge darauf hin, dass jenes Darunter uns auf ewig unbekannt bleiben wird. Was immer wir über seine äußere Erscheinung herausfinden – dieses Darunter wird immer noch zu entdecken bleiben. Aus dem gleichen Grunde werden wir nie aus uns selbst heraus wissen, was Geist ist. Das Wort bedeutet ursprünglich Hauch oder Atem12