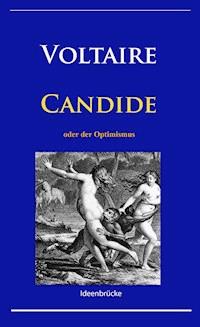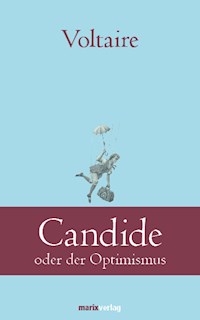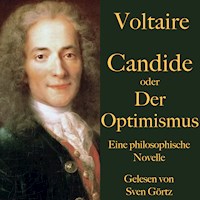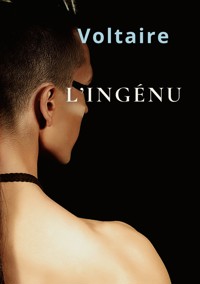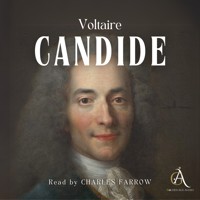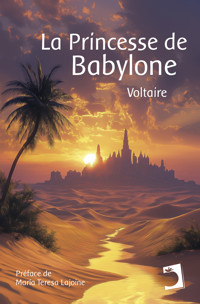Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Voltaires Biografie des berühmten Schwedenkönigs. Karl XII. führte während seiner Herrschaftszeit den Großen Nordischen Krieg, der mit dem Verlust der schwedischen Großmachtstellung in Europa endete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte Karls XII., Königs von Schweden
Voltaire
Inhalt:
Voltaire – Biografie und Bibliografie
Die Geschichte Karls XII., Königs von Schweden
Vorrede Voltaires zur Ausgabe von 1748.
Erstes Buch.
Zweites Buch.
Drittes Buch.
Viertes Buch.
Fünftes Buch.
Sechstes Buch.
Siebentes Buch.
Achtes Buch.
Die Geschichte Karls XII., Voltaire
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849615932
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Voltaire– Biografie und Bibliografie
François Marie Arouet de Voltaire, der vielleicht einflussreichste aller franz. Schriftsteller, geb. 21. Nov. 1694 in Paris, gest. daselbst 30. Mai 1778, war der Sohn eines Finanzbeamten, Arouet, der ihn in dem Jesuitenkollegium Louis le Grand erziehen ließ, sollte nach Beendigung der Gymnasialstudien (1711) die Rechte studieren, fand aber daran keinen Geschmack und wandte sich ausschließlich der Philosophie und den schönen Wissenschaften zu, worin ihn sein Pate, der Abbé de Châteauneuf, bestärkte, der ihn in die geistreichen und frivolen Zirkel der vornehmen Gesellschaft einführte. In diese Zeit fallen seine ersten Oden und der Entwurf zur Tragödie »Œdipe«. Um ihn auf andre Gedanken zu bringen, sandte ihn der erzürnte Vater 1713 als Pagen mit dem Marquis de Châteauneuf, der als französischer Gesandter nach Holland ging, nach dem Haag. Wegen eines Liebeshandels mit einem Fräulein Dunoyer, der Braut des Kamisardenführers Cavalier, nach Paris zurückgeschickt, wurde er Schreiber bei einem Anwalt. Bald darauf folgte er dem Marquis de Caumartin auf sein Landgut St.-Auge bei Fontainebleau; die Begeisterung seines Wirtes für Heinrich IV. und die genaue Kenntnis desselben vom Zeitalter Ludwigs XIV. gaben V. die ersten Anregungen zu zweien seiner Hauptwerke. Der Autorschaft einer nach Ludwigs XIV. Tod erschienenen Satire auf den Regenten verdächtig, musste er in die Bastille wandern (1717), wo er während seiner elfmonatigen Gefangenschaft die »Henriade« entwarf und die Tragödie »Œdipe« vollendete. Die begeisterte Aufnahme dieses Stückes bei der Ausführung (1718) söhnte ihn mit seinem Vater aus; hier signiert er auch zum ersten mal mit »V.«, dem Anagramm von Arouet l. j. (le jeune). Die unvorsichtige Teilnahme an einer Hofintrige hatte bald darauf seine Ausweisung aus Paris zur Folge. Er kam indessen 1720 zurück, um seine Tragödie »Artémire« ausführen zu lassen, die jedoch durchfiel. Nach dem Tode seines Vaters machte er eine Reise nach Holland mit Frau v. Rupelmonde, kehrte aber 1723 nach Paris zurück und ließ die »Henriade« u. d. T. »La Ligue, ou Henri le Grand« in Rouen (angeblich in Genf) drucken. Ein Streit mit dem Chevalier von Rohan-Chabot, der ihn durch seinen Bedienten prügeln ließ, und den er zum Zweikampf forderte, brachte ihn 1726 zum zweiten mal in die Bastille. Nach einigen Wochen erhielt er die Freiheit wieder, zugleich aber den gemessenen Befehl, das Königreich zu verlassen. V. wählte England zu seinem Aufenthaltsort (1726–29), studierte eifrigst die Literatur, Philosophie, Geschichte und Politik des Landes und begeisterte sich für Shakespeare. Hier schrieb er das Leben Karls XII. und die Tragödie »Brutus«, den Versuch über die epische Poesie und die philosophischen oder englischen Briefe, durch die er seine Landsleute mit den neuesten Ergebnissen der englischen Forschung und philosophischen Spekulation vertraut machte. Auf Verwendung seiner Freunde kehrte er 1729 nach Paris zurück. Wegen einiger Verse auf den Tod der Schauspielerin Lecouvreur, der die Geistlichkeit ein ehrliches Begräbnis verweigerte, fand er für geraten, eine Zeitlang unter fremdem Namen in Rouen zu leben, wo er seine »Histoire de Charles XII« und die »Lettres philosophiques« heimlich drucken ließ. Die letztern wurden 1734 durch Henkershand verbrannt. Von mehreren Tragödien, »Zaïre« (1732), »Eriphyle« (1732), »Adélaïde Duguesclin« (1734), die er damals schrieb, machte nur die erste Glück; auch »Brutus« (1731) war kühl aufgenommen worden. Das Gedicht »Le temple du goût« (1733), worin der Dichter die gepriesensten Schriftsteller seiner Zeit schonungslos beurteilte, machte großen Lärm und verschloss ihm die Pforten der Akademie. Um den allenthalben losbrechenden Angriffen zu entgehen, begab sich V. 1734 mit seiner gelehrten Geliebten, der Marquise du Châtelet, auf deren Landgut Cirey in Lothringen, wo er mit einigen Unterbrechungen 15 Jahre blieb. Hier entstanden die »Éléments de la philosophie de Newton« (1738); außerdem die berüchtigte »Pucelle d'Orléans«, dann die Tragödien: »Alzire« (1736), »Zulime« (1740), »Mahomet« (1741), »Mérope« (1743), das Lustspiel: »L'enfant prodigue«, die sieben »Discours sur l'homme« (nach Pope, 1738) u. a. Unterdessen war Voltaires Ruhm ein europäischer geworden. Der Kronprinz von Preußen (Friedrich II.) schrieb V. die schmeichelhaftesten Briefe und lud ihn zu einer Zusammenkunft ein; ja selbst Papst Benedikt XIV. genehmigte die Dedikation des (in Frankreich nicht zur Ausführung zugelassenen) »Mahomet« und segnete den Verfasser. 1746 verschaffte ihm ein Singspiel: »La princesse de Navarre«, zur Feier der Vermählung des Dauphins, den langersehnten Sitz in der Akademie und das Amt eines Historiographen. Doch Eifersucht gegen Crébillon und Ärger über die Hofintrigen gegen ihn veranlassten ihn, mit der Marquise du Châtelet nach Cirey zurückzugehen, von wo aus er häufige Besuche an dem Hofe des Königs Stanislaus in Lunéville abstattete, und wo er seine Tragödien »Sémiramis«, »Rome sauvée« und »Oreste« (1750), bestimmt, den Ruhm seines Rivalen Crébillon zu vernichten, und sein Lustspiel »Nanine« vollendete. Nach dem Tode der du Châtelet (1749) begab sich V. auf die wiederholten Einladungen Friedrichs II. 1750 nach Berlin, wo er eine Wohnung im Schloss, den Orden pour le mérite, den Kammerherrnschlüssel und 20,000 Livres Gehalt erhielt. Streitigkeiten mit Maupertuis, dem Präsidenten der Berliner Akademie, und seine eine, spottsüchtige, habgierige Natur störten jedoch bald sein gutes Verhältnis zum König; und als dieser seine Spottschrift gegen Maupertuis: »Diatribe du docteur Akakia« (1752) öffentlich verbrennen ließ, bat V. um seine Entlassung, musste sich aber auf der Rückreise 1753 in Frankfurt eine ziemlich gewalttätige Untersuchung seines Gepäcks nach den Gedichten Friedrichs gefallen lassen. Diese Behandlung hat V. dem König trotz ihrer Aussöhnung und des fortgesetzten Briefwechsels nie vollständig verziehen. Sein Berliner Aufenthalt war aber nicht unfruchtbar gewesen. Er hatte sein berühmtes Werk »Siècle de Louis XIV« (Berl. 1751, 2 Bde.) vollendet, seine Studien zu einer Universalgeschichte begonnen, die er nachher veröffentlichte in dem »Essay sur les mœurs et l'esprit des nations« (vollständig zuerst Genf 1756, 7 Bde.; deutsch von Wachsmuth, Leipz. 1867, 6 Bde.), und mehrere Tragödien geschrieben (»Amélie, ou le duc de Foix« u. a.), besonders aber das dem König gewidmete »Poème sur la loi naturelle« (1752, gedruckt 1756), das wiederum von dem Pariser Parlament zur Verbrennung verurteilt wurde. Da ihm der Aufenthalt in Paris noch immer verboten war, kaufte er ein Landgut bei Genf, »Les Délices«, dann die Herrschaften Tourney und Ferney in dem französischen Grenzländchen Gex. Hier verlebte der Patriarch von Ferney, wie er sich gern nennen hörte, die letzten 20 Jahre seines Lebens, umgeben von fürstlichem Luxus und im Genuss einer Rente von 140,000 Livres. Er erhob den armen Flecken nach und nach zur wohlhabenden Stadt und baute eine Kirche mit der Inschrift: »Deo erexit Voltaire«. Die bedenklichen Schwächen in seinem Charakter traten grell hervor, solange er noch danach strebte, Vermögen und Einfluß zu gewinnen. Später, wo ihm beides reichlich zu Gebote stand, stellte er seine Mittel und Geisteskräfte vorwiegend in den Dienst edler Zwecke, der Toleranz und der Aufklärung. Unerschrocken trat er als Hort und Verteidiger unschuldig Verfolgter auf und brachte es beispielsweise durch seine rastlosen Bemühungen dahin, dass der Prozess des unschuldig hingerichteten Jean Calas (s. d.) wieder aufgenommen und die unglückliche Familie der Armut und Schmach entzogen wurde. Dabei entwickelte er eine ungemeine literarische Tätigkeit. Zunächst lieferte er zahlreiche Artikel für die »Encyclopédie«. Als die wichtigsten seiner Schriften in dieser Epoche sind sodann hervorzuheben: der Roman »Candide« (1758); »Histoire de Russie sous Pierre I« (1759); »Idées republicaines« (1762); »Sur la tolérance« u. »Catéchisme de l'honnête homme« (1763); »Contes de G. Vadé«; »Commentaire sur Corneille«; das »Dictionnaire philosophique« (1764); mehrere Tragödien (darunter »Agathocle«, »Tancrède«, »Socrate«, »Irène«), Oden und eine Übersetzung des »Julius Cäsar« von Shakespeare (1764) etc. Im Februar 1778 besuchte der Vierundachtzigjährige noch einmal Paris, wo er mit Ehrenbezeigungen überhäuft wurde, aber, vielleicht infolge der dadurch veranlassten Aufregung, in eine Krankheit verfiel und starb. Die Geistlichkeit in Paris verweigerte ihm ein kirchliches Begräbnis, und sein Neffe Abbé Mignot, der ihn in der Abtei von Scellières beigesetzt hatte, ward sogar bestraft. 1791 wurden seine Gebeine auf Volksbeschluss im Panthéon beigesetzt. 1890 wurde ihm in Ferney eine Statue errichtet. Sein Bildnis s. Tafel »Klassiker der Weltliteratur II« (im 12. Bd.).
V. war Philosoph, Geschichtschreiber, gelegentlich Politiker, dramatischer und Romandichter. Den Grund zu seinen philosophischen und politischen Ansichten hat er in England gelegt. Seine sogen. philosophischen Schriften bestreiten wirkliche oder vermeinte Irrtümer oder Vorurteile oft mit kaustischer, unwiderstehlicher Schärfe, oft mit witzelnder Unkunde, oder sie tragen bald mit ermüdender Breite, bald mit absprechender Kürze den Locke-Condillacschen Sensualismus und Eudämonismus mit stetem Kampf gegen das Christentum vor. Indessen tritt er mit gleicher Entschiedenheit wie den christlichen Dogmen dem Atheismus entgegen und glaubt fest an das Dasein eines persönlichen Gottes. An den religiösen Gebräuchen teilzunehmen hielt er trotz seines freien Standpunktes für gestattet. Während er anfangs an die Freiheit des Willens glaubte, hat er sie später geleugnet. Noch schwankender urteilt er über die Unsterblichkeit der Seele. Als Politiker schätzt er die englische Verfassung als die beste. Er zuerst stieß den Ruf: »Freiheit und Gleichheit!« aus, definiert aber jene als nur vom Gesetz abhängig, diese als gleiche Berechtigung aller im Staate. Den Unterschied der Stände hält er für notwendig, verwirft aber bloße Geburtsvorrechte. Alles Heil erwartet er nicht von unten her durch eine Revolution, sondern von den Reformen einer aufgeklärten Regierung. Seine historischen Darstellungen ermangeln, bei trefflicher Anordnung des Stoffes und höchst geistreicher und ansprechender Darstellung, doch der Genauigkeit. Er war bei der wundersamsten Fülle von Kenntnissen ungründlich und oberflächlich, und wo nicht seine Unkunde zu Irrtümern führte, da taten es seine lebhafte Phantasie und sein Hass gegen Christentum und Kirche. Ein Meisterstück romanhafter Geschichtschreibung ist die »Histoire de Charles XII«. Wertvoll besonders durch Reichhaltigkeit des Stoffes und anziehende Darstellung ist auch der »Précis du siècle de Louis XV« (1768). Als Dichter zeichnete sich V. vor allem im Epigramm aus; sonst hat er weder in der Lyrik (am allerwenigsten in der Ode) noch in der Epik Großes geleistet. Die »Henriade« ist eine in wohllautenden Alexandrinern und mit glänzenden Deklamationen und Sentenzen reich ausgestattete, kalte historische Darstellung, die alles epischen Geistes ermangelt, und die »Pucelle« ein in sittlicher Beziehung höchst verwerfliches, auch in poetischer Hinsicht nicht bedeutendes Gedicht. Dagegen sind seine kleinen, meist satirisch gehaltenen Romane und Erzählungen (»Zadig«, »Micromégas«, »Candide«, »Jeannot et Colin«, »L'ingénu«, »La princesse de Babylone« etc.) ausgezeichnete Leistungen, eine wunderbare Mischung von Ernst und Scherz, bezaubernder Leichtigkeit und Anschaulichkeit. Trotz des großen Fleißes, den V. auf seine Tragödien verwandte, und trotz seiner Produktivität hat er doch die großen klassischen Muster, Corneille und Raeine, nicht erreicht. Im Lustspiel hat er den größten Erfolg mit dem »Enfant prodigue« davongetragen. – Von den zahlreichen Ausgaben seiner Werke, von denen einen beträchtlichen Teil sein ausgedehnter, bis ins höchste Alter fortgeführter Briefwechsel ausmacht, erwähnen wir nur die von Beaumarchais, Condorcet und Decroix (Kehl 1785–89, 70 Bde.), die vortreffliche von Beuchot, dem Bibliographen Voltaires (das. 1829–1841, 72 Bde.), ferner die von Furne (1835–38, 13 Bde.), Barré (1856–59, 20 Bde.), Hachette (1859 bis 1862, 40 Bde.; neue Aufl. 1900 ff.), Didot (1859, 13 Bde.), Moland (1877–85, 52 Bde.). Die deutschen Übersetzungen von Mylius u. a. (Berl. 1783 bis 1791, 29 Bde.), Gleich, Hell u. a. (Leipz. 1825–1830, 30 Bde.) sind unvollständig und nicht besonders gelungen; eine Auswahl in 5 Bänden besorgte Ellissen (das. 1854). Voltaires Briefwechsel ist am vollständigsten in Molands Ausgabe, Bd. 33–49, herausgegeben (10,439 Briefe).
Vgl. Bungener, V. et son temps (2. Aufl., Par. 1851, 2 Bde.); Maynard, V., sa vie et ses œuvres (das. 1867, 2 Bde.); Strauß, Voltaire (sechs Vorträge, 8. Aufl., Bonn 1896; Volksausg., Leipz. 1908; mit Einleitung von Sakmann, Frankf. 1906); Rosenkranz im »Neuen Plutarch« (Bd. 1, Leipz. 1874); Campardon, V., documents inédits (Par. 1880); J. Parton, Life of V. (Lond. 1881, 2 Bde.); Kreiten, V., ein Charakterbild (u. Aufl., Freiburg 1884); Mahrenholtz, Voltaires Leben und Werke (Oppeln 1885, 2 Bde.) und V. im Urteil seiner Zeitgenossen (das. 1883); Fa guet, Voltaire (Par. 1894); Käthe Schirmacher, V., eine Biographie (Leipz. 1898) und V., seine Persönlichkeit in seinen Werken (Stuttg. 1906); Crouslé, La vie et les œuvres de V. (Par. 1899, 2 Bde.); Tallentyre (Miß Hale), Life of V. (3. Aufl., Lond. 1905); Lanson, Voltaire (Par. 1906); Lord Brougham, V. et Rousseau (das. 1845); Horn, V. und die Markgräfin von Baireuth (Berl. 1865); Venedey, Friedrich d. Gr. und V. (Leipz. 1859); Desnoiresterres, V. et la société française du XVIII. siècle (2. Aufl., Par. 1887, 8 Bde.); Lucien Perey (Luce Herpin) und Maugras.La vie intime de V. aux Délices et à Ferney (das. 1885); E. Hertz, V. und die französische Strafrechtspflege im 18. Jahrhundert (Stuttg. 1887); Masmonteil, La législation criminelle dans l'œuvre de V. (Par. 1901); Vernier, Étude sur V. grammairien (das. 1888); Nourrisson, V. et le Voltairianisme (das. 1896); H. Lion, Les tragédies et les théories dramatiques de V. (das. 1896); Champion, V., études critiques (2. Aufl., das. 1897); Olivier, V. et les comédiens (das. 1900); Mangold, Voltairiana inedita (Berl. 1901); Calmettes, Choiseul et V. (Par. 1902); L. Robert, V. et l'intolérance (das. 1905); Bengesco, V.; bibliographie de ses œuvres (das. 1882–90, 4 Bde.).
Die Geschichte Karls XII., Königs von Schweden
Vorrede Voltaires zur Ausgabe von 1748.
Erinnern wir uns, daß nach Aristoteles die Ungläubigkeit die Grundlage aller Weisheit ist. Dieser Satz sollte ein Leitfaden für jeden sein, der die Geschichte liest, besonders die alte Geschichte.
Wie viele abgeschmackte Erzählungen, welch eine Menge von Fabeln schlagen dem gesunden Menschenverstande ins Gesicht! Nun denn, so glaubt eben nicht daran!
Es hat in Rom Könige, Konsuln, Dezemvirn gegeben, die Römer haben Karthago zerstört; Cäsar hat den Pompejus besiegt – alles das ist wahr. Wenn man euch aber erzählt, Kastor und Pollux hätten für dieses Volk gekämpft; eine Vestalin habe mit ihrem Gürtel ein auf den Sand geratenes Schiff wieder flott gemacht; ein Abgrund habe sich geschlossen, als Curtius sich hineinstürzte, so glaubt es nicht. Ihr leset überall von den Wundern, von den eingetroffenen Prophezeiungen, den wunderbaren Heilungen in den Tempeln des Aeskulap – glaubt es nicht! Aber hundert Zeugen haben das Protokoll über diese Wunder auf erzenen Tafeln unterzeichnet, die Tempel waren voll von Votivtafeln, welche die Heilungen beurkundeten. Glaubt, daß es Dummköpfe und Spitzbuben gab, die bezeugten, was sie nicht gesehen haben. Glaubt immerhin, daß fromme Leute den Priestern Aeskulaps ein Geschenk machten, wenn ihre Kinder von einer Erkältung genasen, glaubt aber ja nicht an die Wunder Aeskulaps, sie sind ebensowenig wahr, wie die des Jesuiten Xavier, dem ein Seekrebs sein Kreuz vom Grund des Meeres wieder heraufbrachte und der sich zugleich auf zwei Schiffen befunden haben will.
Aber die ägyptischen Priester waren ja alle Zauberer und Herodot bewundert ihre tiefe Wissenschaft in allen Teufelskünsten? Glaubt nicht alles, was Herodot sagt.
Ich mißtraue allem, was als Wunder auftritt. Darf ich aber die Ungläubigkeit so weit treiben, daß ich auch Tatsachen bezweifle, die zwar nicht über die Ordnung menschlicher Dinge hinausgehen, denen es aber an innerer Wahrscheinlichkeit gebricht?
So versichert Plutarch zum Beispiel, Cäsar sei ganz in Waffen in das Meer von Alexandrien gesprungen, habe dabei in der einen Hand Papiere gehalten, die er nicht naß werden lassen wollte, und sei mit der andern geschwommen. Glaubt keine Silbe von diesem Märchen des Plutarch; glaubt Cäsarn selbst, der in seinen Kommentarien kein Wort davon sagt; und seid überzeugt, daß wenn einer mit Papieren in der Hand ins Wasser springt, er sie auch naß macht.
Ihr findet in Quintus Curtius, Alexander und seine Generale seien über die Ebbe und Flut des Ozeans erstaunt gewesen, die sie nicht gekannt hätten. Glaubt es nicht!
Es ist sehr wahrscheinlich, daß Alexander im Rausche den Clitus getötet, daß er den Hephästion auf die Art geliebt hat wie Sokrates den Alkibiates, aber ist durchaus unwahrscheinlich, daß der Schüler des Aristoteles nichts von der Ebbe und Flut des Ozeans gewußt habe. Es gab Philosophen in seiner Armee; es genügte den Euphrat gesehen zu haben, der an seiner Mündung die Ebbe und Flut zeigt, um diese Erscheinung zu kennen. Alexander war in Afrika gereist, dessen Küsten vom Ozean bespült werden. Sollte sein Admiral Nearch so unwissend gewesen sein, daß ihm entging, was am Indus jedes Kind weiß? Derartige Albernheiten, die von so viel Schriftstellern nachgesprochen werden, bringen die Geschichtschreiber allzu sehr in Mißkredit.
Pater Mainburg erzählt hundert andern nach, zwei Juden hätten Leon, dem Isaurier, das Reich unter der Bedingung versprochen, daß er die Götzenbilder zertrümmere, wenn er Kaiser sein werde. Welches Interesse sollten denn diese zwei Hebräer dabei gehabt haben, daß die Christen keine Bilder verehrten? Wie konnten zwei solche arme Teufel ein Kaiserreich versprechen? Heißt es nicht den Leser durch derartige Fabeln beleidigen?
Man muß zugeben, daß Mézerai in seinem harten, gemeinen, ungleichen Stil unter die schlecht verdauten Tatsachen, die er bringt, manche ähnliche Abgeschmacktheiten mischt; bald läßt er Heinrich V. von England, der in Paris zum König von Frankreich gekrönt wurde, deshalb an Hämorrhoiden sterben, weil er sich auf den Thron unserer Könige gesetzt habe, bald muß der heilige Michael der Johanna d'Arc erscheinen!
Ich glaube nicht einmal Augenzeugen, wenn sie mir Dinge sagen, die dem gesunden Menschenverstande widersprechen. Der Herr von Joinville, oder vielmehr derjenige, welcher seine gallische Geschichte in das Altfranzösische übersetzt hat, macht mir nicht weiß, daß die ägyptischen Emire, nachdem sie ihren Sultan ermordet, dem heiligen Ludwig, der ihr Gefangener war, die Krone anboten; das ist gerade so wahrscheinlich, als wenn man aussagte, man habe die Krone Frankreichs einem Türken angeboten. Wie kann man nur glauben, daß Mohammedaner einen Mann zu ihrem Beherrscher haben erheben wollen, der in ihren Augen ein Häuptling von Barbaren sein mußte, den sie in der Schlacht gefangen hatten, der weder ihre Gesetze noch ihre Sprache kannte und der der Erzfeind ihrer Religion war!
Ich glaube ebensowenig an dieses Märchen des Herrn von Joinville, als wenn er mir sagte, der Nil trete zu Anfang Oktober bei la Saint-Remi aus seinen Ufern. Ebensosehr bezweifle ich das Geschichtchen von dem Alten vom Berge, der bei der Nachricht von dem Kreuzzug des heiligen Ludwig zwei Mörder nach Paris schickt, um ihn zu töten, wie er aber von seiner Tugend hört, am andern Tage zwei Kuriere absendet, um Gegenbefehl zu bringen. Das schmeckt denn doch zu sehr nach einem Märchen aus Tausend und eine Nacht.
Ich sage Mézerai, dem Pater Daniel und allen Geschichtschreibern ins Gesicht, daß ich nicht glaube, daß ein Regen- und Hagelsturm Eduard III. bekehrt und Philipp von Valois den Frieden verschafft habe. Die Eroberer sind nicht so fromm und schließen nicht Frieden wegen eines Regens.
Gewiß ist nichts wahrscheinlicher als ein Verbrechen; aber es muß wenigstens nachgewiesen sein. Bei Mézerai liest man von mehr als sechzig Fürsten, denen man Gift gegeben habe; aber er beweist es nirgends und ein Gerücht darf eben nur als Gerücht angeführt werden.
Ich glaube auch Titus Livius nicht, wenn er mir sagt, der Arzt des Pyrrhus habe den Römern angeboten, seinen Herrn gegen eine Belohnung zu vergiften. Die Römer besaßen damals kaum gemünztes Geld und Pyrrhus war reich genug, um die ganze Republik zu kaufen, wenn sie sich hätte verkaufen wollen. Die Stelle eines Leibarztes des Pyrrhus war jedenfalls einträglicher als die eines Konsuls. Ich werde deshalb diese Geschichte nicht eher glauben, als bis man mir beweisen wird, daß ein Leibarzt eines unserer Könige einem Schweizer Kanton den Antrag gemacht habe, seinen Kranken gegen eine Geldbelohnung zu vergiften.
Mißtrauen wir auch allen übertriebenen Behauptungen. Daß eine zahllose persische Armee durch dreihundert Spartiaten im Engpaß von Thermopylä aufgehalten worden sein soll, gibt mir kein Aergernis; die Terraingestaltung macht die Sache wahrscheinlich. Karl XII. schlägt bei Narwa mit achttausend kriegstüchtigen Soldaten achtzigtausend schlecht bewaffnete russische Bauern; das bewundere ich und glaube es. Wenn ich aber lese, daß Simon von Montfort mit neunhundert in drei Korps geteilten Soldaten hunderttausend Mann geschlagen habe, so wiederhole ich: das glaube ich nicht! Man hält mir entgegen, es sei ein Wunder; aber wird wohl Gott dem Simon von Montfort zuliebe ein Wunder getan haben?
Ich würde auch den Kampf Karls XII. zu Bender bezweifeln, wenn er mir nicht durch mehrere glaubwürdige Augenzeugen bestätigt worden wäre und wenn nicht der Charakter Karls XII. eine derartige heroische Tollheit wahrscheinlich machte.
Ebenso wie einzelne Tatsachen muß man oft auch das bezweifeln, was man über die Sitten und Gebräuche fremder Völker liest. Versagen wir auch hier unsern Glauben jedem alten oder neuen Schriftsteller, der uns Dinge auftischt, welche der Natur und dem Wesen des menschlichen Herzens entgegen sind.
Die ersten Berichte über Amerika sprachen nur von Menschenfressern; es war als ob die Amerikaner die Menschen so alltäglich fräßen, wie wir die Hammel. Die richtig gestellte Tatsache beschränkt sich darauf, daß eine kleine Anzahl Gefangener, statt von den Würmern von ihren Siegern gefressen wurde.
Der neue Puffendorf (Grand dictionnaire géographique par Bruzen de la Martinière), der ebenso voll Fehler ist wie der alte, erzählt: im Jahre 1589 habe ein Engländer mit vier Frauen, die sich aus einem Schiffbruch in der Straße von Madagaskar retteten, auf einer wüsten Insel gelandet und dort so wacker gearbeitet, daß man im Jahre 1667 diese Insel (die Pines-Insel) mit zwölftausend schönen englischen Protestanten bevölkert gefunden habe.
Die Alten und ihre zahlreichen und gläubigen Nachbeter wiederholen uns unaufhörlich, in Babylon, der geordnetsten Stadt der Alten Welt, hätten sich alle Frauen und Mädchen einmal im Jahre im Tempel der Venus preisgegeben. Ich kann mir recht wohl denken, daß man zu Babylon wie anderswo sein Vergnügen für Geld haben konnte; aber ich werde mich nie davon überzeugen lassen, daß in einer Stadt, wo damals größere Ordnung und Sittlichkeit herrschte als irgendwo, alle Familienväter und Ehemänner ihre Töchter und Frauen auf einen öffentlichen Markt der Unzucht geschickt und die Gesetzgeber ein so sauberes Geschäft förmlich verordnet haben. Man druckt täglich hundert ähnliche Albernheiten über die Gebräuche der Orientalen; und für einen Reisenden wie Chardin findet man eine Menge Touristen, wie Paul Lukas, Jean Struys und den Jesuiten Avril, der täglich tausend Personen bei den Persern taufte, deren Sprache er nicht kannte; und der erzählt, die russischen Karawanen gingen in drei Monaten zwischen China und Rußland hin und her!
Ein griechischer und ein lateinischer Mönch schreiben, Mohammed II. habe die ganze Stadt Konstantinopel der Plünderung preisgegeben, habe eigenhändig die Bilder Jesu Christi zertrümmert und alle Kirchen in Moscheen verwandelt. Um diesen Eroberer noch hassenswerter zu machen, setzen sie hinzu, er habe seiner Geliebten den Janitscharen zu Gefallen den Kopf abgeschlagen und vierzehn seiner Pagen den Bauch aufgeschlitzt, um zu sehen, wer von ihnen eine Melone gegessen habe. Hundert Geschichtschreiber schreiben diese jämmerlichen Fabeln nach; die europäischen Enzyklopädien wiederholen sie. Wenn man aber die wirklichen, von Prinz Cantemir gesammelten türkischen Annalen nachliest, so findet man, wie lächerlich diese Lügen sind. Man erfährt daraus, daß, nachdem der große Mohammed II. die Hälfte von Konstantinopel mit Sturm genommen hatte, er mit der andern in Verhandlung trat und sämtliche Kirchen unversehrt ließ; daß er einen griechischen Patriarchen ernannte, dem er größere Ehre erwies, als die griechischen Kaiser seinen Vorgängern jemals erwiesen hatten. Wenn man aber nur seinen gesunden Menschenverstand fragen will, wird man auch einsehen, wie lächerlich es ist zu glauben, ein großer, gelehrter und gebildeter Herrscher wie Mohammed II. war, werde achtzehn Pagen wegen einer Melone den Bauch aufschlitzen; und wer die Sitten der Türken nur halbwegs kennt, wird die Unsinnigkeit des Gedankens einsehen, daß die Soldaten sich in die Angelegenheiten, die zwischen dem Sultan und seinen Frauen vor sich gehen, gemischt und ein Kaiser jenen zu Gefallen seiner Geliebten den Kopf abgeschnitten habe. Aber so schreibt man jetzt allerdings die meisten Geschichten.
Mit der Geschichte Karls XII. ist es nicht so. Ich kann versichern, daß, wenn je eine Geschichte den Glauben des Lesers verdient hat, es diese ist. Ich stellte sie bekanntlich nach den Memoiren von Fabrice, de Villelongue und de Fierville, sowie den Berichten vieler Augenzeugen zusammen. Da aber diese Zeugen nicht alles sehen und manchmal schlecht sehen, verfiel auch ich in manchen Irrtum, nicht in betreff der wesentlichen Tatsachen, aber bei einigen Anekdoten, die an sich ganz gleichgültig sind, an die sich aber eine kleinliche Kritik mit Genuß angeklammert hat.
Ich habe seitdem diese Geschichte nach dem militärischen Tagebuch Adlerfelts, das sehr genau ist und auf Grund dessen ich einige Tatsachen und Daten richtig stellte, verbessert.
Ich habe auch die von dem Kaplan und Beichtvater Karls, Nordberg, verfaßte Geschichte zu Rate gezogen. Dieses Werk ist allerdings übel verdaut und schlecht geschrieben; es finden sich darin zu viel kleine, dem Gegenstand eigentlich fremde Dinge, während die großen Ereignisse so schwach dargestellt sind, daß sie klein werden. Seine Geschichte ist ein Gewebe von Schreiben, Erklärungen und Bekanntmachungen, wie sie in der Regel im Namen der Könige erlassen werden, wenn dieselben im Kriege begriffen sind. Solche Dokumente dienen aber niemals dazu, die Ereignisse bis auf den Grund kennen zu lernen; weder der Militär noch der Politiker kann sie brauchen und sie langweilen den Leser. Ein Schriftsteller kann sie bisweilen zu Rate ziehen, wenn er sich über irgend einen Punkt Aufklärung verschaffen will, wie ein Architekt sich bei einem Bauwerk auch des Schuttes bedient.
Unter den Dokumenten, womit Nordberg seine unglückliche Geschichte überladen hat, finden sich sogar falsche und abgeschmackte, wie der Brief des türkischen Kaisers Achmet, den dieser Geschichtschreiber »Sultan Pascha von Gottes Gnaden« nennt.
Derselbe Nordberg läßt den König von Schweden über den König Stanislaus etwas sagen, was dieser Monarch nie gesagt hat und nie sagen konnte. Er behauptet nämlich, Karl XII. habe auf die Einwürfe des Primas erwidert, Stanislaus habe sich auf seiner italienischen Reise viele Freunde erworben. Es ist aber gewiß, daß Stanislaus niemals in Italien war, wie mir dieser Monarch selbst versichert hat. Was wäre es auch, wenn ein Pole im achtzehnten Jahrhundert zu seinem Vergnügen Italien bereiste! Derartige unnütze Dinge muß der Geschichtschreiber weglassen, und ich bin froh, daß ich die Geschichte Karls XII. möglichst kurz gehalten habe!
Nordberg hatte weder Verstand noch Geist noch Kenntnis der Welt; eben deshalb hat ihn vielleicht Karl XII. zu seinem Beichtvater gewählt. Ich weiß nicht, ob er einen guten Christen aus diesem Fürsten gemacht hat, aber sicher hat er keinen Helden aus ihn gemacht, und Karl XII. wäre unbekannt, wenn man ihn nur aus Nordberg kennte.
Vor einigen Jahren ist eine kleine Broschüre unter dem Titel: Historische und kritische Bemerkungen über die Geschichte Karl XII. von Voltaire erschienen. Dieses Werkchen ist vom Grafen Poniatowski. Es sind Antworten auf Fragen, die ich während seines letzten Aufenthalts in Paris an ihn stellte. Sein Sekretär hatte eine zweite Abschrift davon gefertigt, die in die Hände eines Buchhändlers fiel, welcher nicht säumte sie abzudrucken. Ein holländischer Korrektor nannte sie »kritisch,« um sie besser an den Mann zu bringen. Es ist dies eine der kleineren Gaunereien des Buchhandels.
Ein Bediensteter von Herrn Fabrice, La Motraye, hat gleichfalls einige Bemerkungen über diese Geschichte drucken lassen. Unter den mancherlei Irrtümern und Kleinlichkeiten dieser Kritik finden sich auch einige wichtige und nützliche Bemerkungen. Ich trug Sorge, in den letzten Ausgaben, besonders in der von 1739 davon Notiz zu nehmen; denn in Sachen der Geschichte darf man nichts versäumen und muß, wo es möglich ist, Könige und Kammerdiener zu Rate ziehen.
Erstes Buch.
Kürze Geschichte von Schweden bis Karl XII. Seine Erziehung, seine Feinde. Charakter des Zaren Peter Alexjewitsch. Interessante Nachrichten über diesen Fürsten und das russische Volk. Rußland, Polen und Dänemark verbinden sich gegen Karl XII.
Schweden und Finnland bilden zusammen ein Königreich, welches ungefähr zweihundert Wegstunden breit und dreihundert Stunden lang ist. Es erstreckt sich von Süden nach Norden gemessen vom 55. bis zum 70. Grad. Sein Klima ist rauh; es gibt hier beinahe keinen Frühling, keinen Herbst. Neun Monate lang herrscht der Winter; auf eine außerordentliche Kälte folgt dann plötzlich Sommerhitze. Vom Monat Oktober an gefriert es. Jene unmerklichen Abstufungen, welche anderswo von einer Jahreszeit zur andern führen und den Wechsel erträglicher machen, sind hier unbekannt. Dafür hat die Natur diesem strengen Klima einen heitern Himmel, eine reine Luft gegeben. Fast beständig von der Sonne durchglüht, erzeugt der Sommer Blumen und Früchte in kürzester Zeit. Die langen Winternächte dagegen sind durch Morgenröte und Dämmerungen verschönert, die um so länger dauern, je weniger die Sonne sich von Schweden entfernt. Das Mondlicht aber, welches hier durch kein Gewölk getrübt und durch den Widerschein des Schnees, der rings die Erde bedeckt, noch vermehrt wird – wozu häufig noch Lichterscheinungen kommen, die dem Zodiakallicht ähnlich sind – bewirkt, daß man in Schweden bei Nacht so gut reist wie bei Tage. Das Vieh ist aus Mangel an Weiden kleiner als in den mittäglichen Ländern Europas. Die Menschen dagegen sind groß; der heitere Himmel erhält sie gesund, das rauhe Klima macht sie kräftig. Sie leben lange, wenn sie sich nicht durch den unmäßigen Genuß starker Liköre und Weine schwächen. Freilich scheinen die nördlichen Völker diese Getränke um so mehr zu lieben, je mehr die Natur sie ihnen versagt hat.
Die Schweden sind wohlgestaltet, kräftig, gewandt und fähig, die schwersten Arbeiten, Hunger und Not zu ertragen. Sie sind geborene Soldaten, voll Stolz und mehr tapfer als industriös. Der Handel, der ihnen allein geben kann, was die Natur ihnen versagt hat, wurde von ihnen lange Zeit ganz vernachlässigt und wird auch jetzt noch nicht tätig betrieben. Aus Schweden hauptsächlich, von dem noch jetzt ein Teil Gotland heißt, sollen jene Gotenheere hervorgegangen sein, welche einst Europa überschwemmten und es Rom entrissen, das fünfhundert Jahre lang dessen Beherrscher, Gesetzgeber und Tyrann gewesen war.
Die nördlichen Regionen waren damals weit bevölkerter, als sie es heutzutage sind, weil ihre Religion den Bewohnern Vielweiberei gestattete und sie dadurch in den Stand setzte, dem Staate mehr Kinder zu geben; und die Frauen selbst keine größere Schmach kannten als Unfruchtbarkeit und Müßiggang. Ebenso arbeitsam und ebenso kräftig wie ihre Männer wurden sie daher früher und länger von ihnen Mutter. Jetzt hat Schweden mit dem ihm noch gebliebenen Rest von Finnland nur vier Millionen Einwohner. Das Land ist unfruchtbar und arm. Schonen ist die einzige Provinz, in welcher Weizen wächst. Es gibt nicht mehr als neun Millionen Silbertaler im Lande. Die öffentliche Bank, die älteste in Europa, war ein Kind der Notwendigkeit, weil die Bezahlungen in Kupfer- und Eisenmünzen geschahen und dadurch der Münzverkehr zu schwerfällig wurde.
Schweden war bis zur Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ein freies Land. In diesem langen Zeiträume wechselte die Regierungsgewalt mehr als einmal, aber sämtliche Wechsel geschahen zugunsten der Freiheit. Die oberste Behörde trug den Namen König, ein Titel, mit welchem in den verschiedenen Ländern sehr verschiedene Machtbefugnisse verbunden sind. In Frankreich und Spanien bedeutet er die unumschränkte Gewalt, in Polen, in Schweden und England den Vorstand eines Freistaats. Jene schwedischen Könige vermochten nichts ohne den Senat; und der Senat hing wieder von den Ständen ab, die häufig zusammenberufen wurden. Die Vertreter des Volks in diesen großen Versammlungen waren die Edelleute, die Bischöfe und die Abgeordneten der Städte; später wurden auch die Bauern zugelassen, ein sonst ungerechterweise verachteter Teil des Volks, der fast im ganzen übrigen Norden Sklave ist.
Gegen das Jahr 1492 wurde dieses auf seine Freiheit so eifersüchtige Volk, das noch jetzt stolz darauf ist, vor dreizehnhundert Jahren unter Alarich Rom bezwungen zu haben, durch ein Weib und durch ein anderes weniger mächtiges Volk unterjocht.
Margarete Waldemars Tochter, die Semiramis des Nordens, Königin von Dänemark und Norwegen, eroberte Schweden durch Gewalt und List und vereinigte diese drei zu einem einzigen. Nach ihrem Tode zerrissen Bürgerkriege das Land; Schweden warf das Joch der Dänen ab, nahm es aber bald wieder auf, es hatte Könige und Administratoren. Zwei Tyrannen bedrückten es um 1520 auf eine furchtbare Art; der eine war Christiern II., König von Dänemark, ein Ungeheuer voller Laster ohne eine einzige Tugend, der andere war der Erzbischof von Upsala, der Primas des Reiches und ebenso grausam wie Christiern. Im Einverständnis miteinander ließen diese beiden eines Tages die Bürgermeister und Räte der Stadt Stockholm nebst vierundneunzig Senatoren greifen und durch Henkershand hinrichten, unter dem Vorwand, daß der Papst sie exkommuniziert habe, weil sie die Rechte des Staats gegen den Erzbischof verteidigt hätten.
Während diese beiden Menschen, welche die Lust an der Unterdrückung vereinte, die Teilung der Beute aber wieder entzweite, dem härtesten Despotismus, der grausamsten Rachgier frönten, änderte ein neues Ereignis die Gestalt des Nordens.
Gustav Wasa, ein junger Mann, der von den alten Königen des Landes abstammte, trat aus der Tiefe der Wälder Dalekarliens, wo er in Verborgenheit gelebt hatte und befreite Schweden. Er besaß eine jener großen Seelen, welche die Natur so selten bildet, und alle Eigenschaften, deren man bedarf, um die Menschen zu beherrschen. Sein vorteilhaftes Aeußeres, sein hohes Wesen verschafften ihm Anhänger, wo er sich zeigte. Seine Beredsamkeit, der eine edle Miene zu Hilfe kam, war um so ergreifender, je natürlicher sie schien; sein Genie unternahm Dinge, welche der gewöhnliche Mensch für verwegen hält, die aber in den Augen des großen Mannes nur kühn sind; sein Mut, sein unermüdlicher Eifer sicherte seinen Unternehmungen das Gelingen. Er war unerschrocken und zugleich vorsichtig, von einem milden Charakter in einer wilden Zeit und so tugendhaft, als ein Parteiführer nur immer sein kann.
Gustav Wasa war Christierns Geisel gewesen und gegen das Völkerrecht als Gefangener zurückbehalten worden. Aus seinem Gefängnis entwischt, irrte er als Bauer verkleidet in den Bergen und Wäldern von Dalekarlien umher. Er sah sich hier in die Notwendigkeit versetzt, in den Kupferbergwerken zu arbeiten, um sein Leben zu fristen und sich zu verbergen. In diesen unterirdischen Räumen faßte er den Plan, den Tyrannen vom Throne zu stürzen. Er entdeckte sich den Bauern; sie erkannten in ihm den Menschen höherer Natur, dem sich gewöhnliche Geschöpfe unwillkürlich unterordnen. In kurzer Zeit machte er aus diesen Wilden tüchtige Soldaten. Er griff Christiern und den Erzbischof an, besiegte sie zu wiederholten Malen und jagte beide aus Schweden. Nun erwählten ihn die Stände mit Recht zum König des Landes, dessen Befreier er geworden war.
Kaum saß er auf dem Throne, als er sich an ein Unternehmen wagte, das schwieriger war als Länder erobern. Die wahren Tyrannen des Reiches waren die Bischöfe; sie besaßen fast den ganzen Reichtum Schwedens und bedienten sich desselben nur, um die Untertanen zu bedrücken und die Könige zu befehden. Diese Macht war um so furchtbarer, als die Unwissenheit des Volks sie geheiligt hatte. Gustav Wasa ahndete jetzt an der katholischen Religion die Schlechtigkeit ihrer Priester. In weniger als zwei Jahren machte er Schweden lutherisch und zwar noch mehr durch die Ueberlegenheit seiner Politik als durch seine Regierungsgewalt. Nachdem er dies Reich so den Dänen und der Geistlichkeit, wie er zu sagen pflegte, abgewonnen hatte, regierte er glücklich und unumschränkt bis in sein siebzigstes Jahr und nahm ein ruhmvolles Ende, indem er seine Familie und seinen Glauben auf dem Throne des Landes ließ.
Einer seiner Nachkommen war jener Gustav Adolf, den man auch Gustav den Großen nennt. Dieser König eroberte Ingermanland, Livland, Bremen, Werden, Wismar und Pommern und außerdem noch über hundert Orte in Deutschland, die Schweden nach seinem Tode zurückgab. Er erschütterte den Thron Ferdinands II. und bot den Lutheranern in Deutschland die Hand, wobei ihn die Intrigen von Rom noch unterstützten, da dieses die Macht des Kaisers mehr fürchtete als die der Ketzerei. Er war es in der Tat, der durch seine Siege viel zur Demütigung des Hauses Oesterreich beitrug. Man schreibt den Ruhm dieses Unternehmens dem Kardinal Richelieu zu, der die Kunst verstand sich einen Namen zu machen, während Gustav sich damit begnügte große Taten zu vollführen. Er war im Begriff, den Krieg an die Donau zu verlegen, und vielleicht den Kaiser vom Throne zu stoßen, als er in seinem siebenunddreißigsten Lebensjahre in der Schlacht bei Lützen (16. November 1632) fiel. Er gewann diese Schlacht gegen Wallenstein und nahm den Namen eines großen Königs, die Liebe des Nordens und die Achtung seiner Feinde mit ins Grab.
Seine Tochter Christine, eine Frau von seltenem Geist, unterhielt sich lieber mit Gelehrten, als daß sie ein Volk regierte, welches nur Sinn für kriegerische Taten hatte. Sie machte sich dadurch, daß sie dem Throne entsagte, ebenso berühmt, als ihre Ahnen es durch Gewinnung und Befestigung desselben getan hatten. Die Protestanten haben kein gutes Haar an ihr gelassen, als ob man nicht, auch ohne an Luther zu glauben, große Tugenden haben konnte. Die Päpste dagegen frohlockten viel zu viel über die Bekehrung einer Frau, die doch vor allem Philosoph war. Sie zog sich nach Rom zurück, wo sie den Rest ihrer Tage inmitten der Künste verlebte, die sie so sehr liebte, und um derentwillen sie in einem Alter von siebenundzwanzig Jahren einem Königreiche entsagt hatte.
Vor ihrer Abdankung veranlaßte sie die schwedischen Reichsstände, an ihrer Statt ihren Vetter Karl Gustav X., den Sohn des Pfalzgrafen und Herzogs von Zweibrücken, zum König zu wählen. Dieser König fügte den Eroberungen Gustav Adolfs noch neue hinzu. Er führte seine Kriegsvölker zuerst nach Polen, wo er die berühmte Schlacht bei Warschau gewann, welche drei Tage gedauert hatte. Dann führte er lange Zeit einen glücklichen Krieg gegen die Dänen, belagerte ihre Hauptstadt, vereinigte Schonen mit Schweden und sicherte wenigstens eine Zeitlang dem Herzog von Holstein den Besitz von Schleswig. Als er später Unfälle erlitt und deshalb mit seinen Feinden Frieden schloß, kehrte er seinen Ehrgeiz gegen seine Untertanen. Er faßte den Plan, in Schweden die unumschränkte Monarchie einzuführen; starb jedoch in seinem siebenunddreißigsten Lebensjahre (den 13. Februar 1660) wie der große Gustav, ehe er dieses Werk des Despotismus zu vollenden vermochte, welches dann sein Sohn Karl XI. zum Schlusse führte.
Karl XI., Soldat wie alle seine Vorfahren, war noch despotischer als sie. Er nahm dem Senat seine Macht und erklärte ihn zum Senat des Königs, während er der Senat des Reichs gewesen war. Er war mäßig, tätig, arbeitsam, so daß man ihn hätte lieben können, wenn sein Despotismus die Gefühle seiner Untertanen nicht in Furcht verwandelt hätte.
Im Jahre 1680 heiratete er Ulrike Eleonore, Tochter des Königs Friedrich III. von Dänemark, eine tugendhafte Prinzessin, die eines größeren Vertrauens würdig gewesen wäre, als ihr Gatte ihr schenkte. Ihr entsproßte am 27. Juni 1682 der König Karl XII., der außerordentlichste Mensch vielleicht, der je gelebt. Er vereinigte in sich alle die großen Eigenschaften seiner Vorfahren und hatte keinen anderen Fehler, und kein anderes Unglück, als daß er diese Eigenschaften alle übertrieb. Von ihm soll hier erzählt werden, was über seine Person und seine Taten Sicheres festgestellt werden konnte.
Das erste Buch, das man ihm zu lesen gab, war das Werk von Samuel Puffendorf. Er sollte sich daraus beizeiten mit seinen Staaten und denen seiner Nachbarn vertraut machen. Zuerst erlernte er die deutsche Sprache, die er immer ebensogut sprach wie seine Muttersprache. Mit sieben Jahren verstand er bereits mit Pferden umzugehen. Anstrengende Uebungen, in denen er sich gefiel, und die auf seine kriegerischen Neigungen schließen ließen, kräftigten frühzeitig seinen Körper, so daß er die Strapazen zu ertragen vermochte, zu denen ihn sein Temperament hinzog.
Obschon in seiner Kindheit von sanfter Gemütsart, besaß er doch einen unüberwindlichen Eigensinn. Das einzige Mittel, ihn nachgiebig zu machen, war, wenn man seinen Ehrgeiz stachelte. Mit dem Worte Ruhm erlangte man alles von ihm. Er hatte eine Abneigung gegen das Latein. Als man ihm aber sagte, daß die Könige von Polen und Dänemark es verstünden, lernte er es schnell, und behielt genug davon, um es von da ab sprechen zu können. Auf die gleiche Art griff man es an, um ihn zum Studium des Französischen zu bestimmen; aber gleichwohl blieb er dabei, sich niemals dieser Sprache zu bedienen, selbst nicht mit den französischen Gesandten, die keine andere Sprache verstanden.
Sobald er einige Fortschritte im Lateinischen gemacht hatte, ließ man ihn den Quintus Curtius übersetzen; er gewann eine Vorliebe für dieses Buch, welche ihm der Gegenstand desselben weit mehr einflößte als dessen Stil. Als der Lehrer, welcher ihm diesen Schriftsteller erklärte, fragte, was er von Alexander halte, erwiderte der Prinz: »Ich möchte ihm ähnlich werden.« – »Aber,« entgegnete man ihm, »er hat nur zweiunddreißig Jahre gelebt.« – »Ach!« versetzte er, »ist denn das nicht genug, wenn man so viele Reiche erobert hat?« – Man verfehlte nicht, dem Könige, seinem Vater, diese Antworten zu hinterbringen, der ausrief: »Aus diesem Kind wird mehr werden, als aus mir geworden ist; er wird weiter gehen als der große Gustav!« – Eines Tages unterhielt er sich damit, im Zimmer des Königs zwei geographische Karten zu betrachten, wovon die eine eine ungarische, dem Kaiser durch die Türken entrissene Stadt, die andere die Hauptstadt von Livland, Riga vorstellte, welch letztere die Schweden schon vor hundert Jahren erobert hatten. Unter dem Plan der ungarischen Stadt standen die Worte aus Hiob: »Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobet!« – Als der junge Prinz diese Worte las, nahm er sofort einen Bleistift und schrieb unter den Plan von Riga: »Gott hat mir's gegeben, der Teufel soll mir's nicht mehr nehmen.« – So ließ dieser unbezähmbare Charakter schon in den unbedeutendsten Handlungen seiner Kindheit jene Züge zu Tage treten, welche originellen Geistern eigen sind und zum voraus ahnen lassen, was sie einst sein werden.
Er war elf Jahre alt, als er seine Mutter verlor. Diese Fürstin starb am 5. August 1693, wie man sagt an einer Krankheit, die sie sich aus Kummer über das Benehmen ihres Gemahls zugezogen hatte. Die Anstrengung, womit sie ihren Schmerz hierüber zu verbergen suchte, war zu viel für ihre Kräfte. Karl XI. hatte nämlich eine große Menge seiner Untertanen mittels eines Gerichtshofes, der den Namen Liquidationskammer führte und nur von seinem Willen abhing, ihres Vermögens beraubt. Zahllose durch diese Kammer zugrunde gerichtete Bürger, Edelleute, Kaufleute, Gutsbesitzer, Witwen und Waisen füllten die Straßen von Stockholm und erschienen täglich vor den Toren des Palastes, wo sie vergeblich ihre Klagen ertönen ließen. Die Königin unterstützte diese Unglücklichen mit allem, was sie besaß; sie gab ihnen ihr Gold, ihren Schmuck, ihre Mobilien, sogar ihre Kleider. Als sie nichts mehr zu geben hatte, warf sie sich ihrem Gemahl weinend zu Füßen und bat ihn, doch ein Herz für seine Untertanen zu haben. Aber der König erwiderte ihr streng: »Madame, wir nahmen Euch zur Gemahlin, um uns Kinder zu geben, nicht Ratschläge.« – Von diesem Augenblick an soll er sie mit einer Härte behandelt haben, die ihr Ende beschleunigte.
Er starb vier Jahre nach ihr, am 15. April 1697, im zweiundfünfzigsten Jahre seines Lebens und im siebenunddreißigsten seiner Regierung, als eben das deutsche Reich, Spanien und Holland einerseits und Frankreich andererseits die Entscheidung ihrer Händel seinem Schiedsrichteramt unterstellt und er das Werk der Versöhnung dieser Mächte bereits begonnen hatte.
Er hinterließ seinem fünfzehnjährigen Sohne einen nach Außen befestigten und hochgeachteten Thron, arme, aber kriegerische und gehorsame Untertanen, und wohlgeordnete, von geschickten Ministern verwaltete Finanzen. Bei seiner Thronbesteigung war Karl XII. nicht nur unumschränkter und friedlicher Regent von Schweden und Finnland, er beherrschte auch Livland, Carelien und Ingermanland, und besaß Wismar, Wiborg, die Inseln Rügen und Oesel, sowie den schönsten Teil von Pommern und das Herzogtum Bremen und Verden. Alle diese Eroberungen seiner Vorfahren waren seiner Krone durch langen Besitz und die feierlichen, vom Schrecken der schwedischen Waffen aufrecht erhaltenen Verträge von Münster und Oliva gesichert. Der unter den Auspizien des Vaters begonnene Frieden von Ryswick kam unter denen des Sohnes zum Abschluß. Schon mit Beginn seiner Regierung trat er so als Schiedsrichter Europas auf.
Die schwedischen Gesetze bestimmen, daß der König mit fünfzehn Jahren majorenn sein solle. Allein der in allem eigenmächtige Karl XI. setzte in seinem Testamente fest, daß sein Sohn erst mit dem achtzehnten Lebensjahre majorenn werden sollte. Durch diese Bestimmung begünstigte er die ehrgeizigen Pläne seiner Mutter Hedwig Eleonore von Holstein, Witwe des Königs Karl X. Diese Fürstin wurde durch den König, ihren Sohn, zur Vormünderin ihres Enkels, des jüngern Königs und zur Regentin des Königreichs erklärt, wobei man ihr einen Rat von fünf höheren Beamten zur Seite stellte.
Die Regentin hatte, so lange der König, ihr Sohn, regierte, an allen Staatsangelegenheiten teilgenommen. Sie war schon hochbejahrt, allein ihr Ehrgeiz, der größer war als ihre Kräfte und ihr Geist, ließ sie hoffen, die Süßigkeit der Macht noch lange unter ihrem Enkel zu genießen. Sie entfremdete ihn daher möglichst viel den Geschäften. Der junge Prinz verbrachte seine ganze Zeit auf der Jagd oder mit Truppenbesichtigungen. Bisweilen nahm er auch an den Uebungen derselben Anteil. Diese Art Unterhaltung schien nur die natürliche Wirkung der Lebhaftigkeit seines Alters zu sein. Sein Benehmen zeigte nichts, was die Regentin hätte beunruhigen können; diese Fürstin schmeichelte sich vielmehr, daß die Zerstreuungen solcher Uebungen ihn unfähig machen würden, sich mit Ernst und Fleiß zu beschäftigen, so daß sie desto länger die Regierung in Händen behalten würde.
Eines Tages im November desselben Jahres, da sein Vater gestorben war, hielt er eine Besichtigung über mehrere Regimenter ab, wobei ihn der Staatsrat Piper begleitete. Der König schien in tiefes Nachdenken versunken. »Darf ich mir die Freiheit nehmen zu fragen, worüber Eure Majestät so ernstlich nachdenken?« sagte Piper zu ihm. – »Ich denke,« erwiderte der Prinz, »daß ich mich würdig fühle, diese tapferen Leute zu befehligen, und ich wollte, daß weder ich noch sie Befehle von einem Weibe anzunehmen hätten.« – Piper ergriff die Gelegenheit sein Glück zu machen mit beiden Händen. Er hatte selbst nicht Ansehen genug, um es wagen zu können, ein so gefährliches Unternehmen, wie die Verdrängung der Königin von der Regentschaft und die Herbeiführung der Majorennerklärung des Königs war, in Gang zu bringen. Er schlug es deshalb dem Grafen Axel Sparre vor, einem kühnen Feuerkopf, der nach einer höhern Stellung strebte. Sparre glaubte ihm, nahm alles auf sich und arbeitete doch nur für Piper. Die Regentschaftsräte waren bald gewonnen. Sie wußten ja, daß sie beim Könige einen Stein im Brett haben würden, wenn sie die Ausführung dieses Planes beschleunigten.
Demgemäß begaben sie sich in corpore zur Königin und stellten ihren Antrag. Einen solchen Schritt hatte diese nicht erwartet. Die Reichsstände waren eben versammelt. Auch dort brachten die Regentschaftsräte die Sache vor. Niemand erhob seine Stimme dagegen. Die Sache ging mit einer so unaufhaltsamen Geschwindigkeit vorwärts, daß drei Tage nachdem Karl XII. den Wunsch ausgesprochen hatte, zu regieren, die Stände ihm bereits die Gewalt übertrugen. Die Macht und das Ansehen der Königin fiel in einer Minute. Sie zog sich ins Privatleben zurück, das ihrem Alter besser entsprach, wenn auch nicht ihrer Neigung. Der König wurde am darauffolgenden 24. Dezember gekrönt. Er hielt seinen Einzug in Stockholm auf einem mit Silber beschlagenen Fuchsen, das Zepter in der Hand und die Krone auf dem Haupte, unter dem Jauchzen eines ganzen Volks, das ja stets das Neue vergöttert und jeden jungen Fürsten mit den größten Hoffnungen begrüßt.
Der Erzbischof von Upsala hatte das Recht die Salbung und Krönung vorzunehmen; es war dies das letzte von den Vorrechten, welche seine Vorgänger sich angemaßt hatten. Als er der Sitte gemäß den Prinzen gesalbt hatte und nun die Krone erhob, um sie demselben aufs Haupt zu setzen, entriß sie Karl den Händen des Erzbischofs und krönte sich selbst, wobei er den Prälaten mit stolzen Blicken maß. Das Volk, dem jeder Schein von Größe imponiert, jauchzte der Handlung des Königs Beifall zu. Selbst diejenigen, welche am meisten unter dem Despotismus seines Vaters geseufzt hatten, ließen sich hinreißen den Sohn wegen dieser hochfahrenden Handlung zu rühmen, die ihnen doch ihre künftige Sklaverei voraussagte.
Sobald Karl der Herr war, schenkte er dem Rat Piper sein Vertrauen und übertrug ihm die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten. Bald war derselbe sein Premierminister, ohne daß er diesen Namen trug. Wenige Tage darauf ernannte er ihn zum Grafen, was in Schweden eine sehr hohe Würde und kein leerer Titel ist, den man ohne weiteres annehmen kann wie in Frankreich.
Die erste Regierungszeit des Königs erweckte keine günstige Meinung von ihm; es schien als ob ihn mehr seine Ungeduld als eine Berechtigung dazu auf den Thron geführt habe. Zwar zeigte er allerdings keine gefährliche Leidenschaft, aber sein Benehmen war doch nur eine Reihe jugendlicher Aufwallungen und eigensinniger Ausbrüche. Er schien faul und hochfahrend. Die fremden Gesandten an seinem Hofe hielten ihn sogar für einen mittelmäßigen Kopf und schilderten ihn ihren Monarchen als einen solchen. Schweden hatte die gleiche Ansicht von ihm. Niemand kannte seinen wahren Charakter, er kannte ihn selbst nicht, bis die Stürme, die plötzlich im Norden ausbrachen, seinen verborgenen Eigenschaften Gelegenheit gaben, sich zu entfalten.
Drei mächtige Fürsten wollten sich seine außerordentliche Jugend zunutze machen und beschlossen fast zu gleicher Zeit sein Verderben. Der erste war Friedrich VI., König von Dänemark, sein Vetter; der zweite August, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, der russische Zar, Peter der Große, war der dritte und gefährlichste. Es ist notwendig, auf die Ursache dieses Kriegs, der so große Ereignisse im Gefolge hatte, zurückzugehen und mit Dänemark zu beginnen.
Von den zwei Schwestern, die Karl XII. besaß, war die älteste an den Herzog von Holstein, einen jungen und ebenso tapfern als liebenswürdigen Fürsten vermählt. Bedrückt von dem König von Dänemark ging der Herzog mit seiner Gemahlin nach Stockholm und warf sich dem König in die Arme, den er nicht nur als Schwager, sondern auch als den Fürsten eines Volks, das stets einen unversöhnlichen Haß gegen die Dänen hegte, um Hilfe anflehte.
Das alte Haus Holstein, aus dem Hause Oldenburg entsprungen, war im Jahre 1449 durch Wahl auf den Thron von Dänemark gelangt. Die Reiche des Nordens waren damals Wahlreiche; das dänische wurde bald zum Erbreich. Einer seiner Könige, Christiern III., empfand für seinen Bruder Adolf eine Liebe oder eine Rücksicht, wie man sie unter Fürsten nicht leicht findet. Er wollte ihn nicht ohne Fürstentum sehen, und konnte doch deshalb seine eigenen Staaten nicht zerstückeln. In einem seltsamen Vertrag teilte er mit ihm die Herzogtümer Holstein-Gottorp und Schleswig und bestimmte darin, daß die Nachkommen Adolfs künftig zugleich mit den Königen von Dänemark in Holstein regieren sollten; daß die beiden Herzogtümer ihnen gemeinschaftlich gehören sollten, und daß der König von Dänemark in Holstein keine Aenderung vornehmen könne ohne den Herzog, noch der Herzog ohne den König. Diese sonderbare Union, wie übrigens schon einmal eine ähnliche mehrere Jahre lang in demselben Hause bestanden hatte, war seit fast achtzig Jahren eine Quelle beständiger Streitigkeiten zwischen der dänischen und der holstein-gottorpischen Linie gewesen. Die Könige hatten immer versucht die Herzoge zu unterdrücken und die Herzoge sich ganz unabhängig zu machen. Den letzten Herzog hatte ein solcher Versuch die Freiheit und den Herzogshut gekostet. Im Jahre 1689 hatte er durch Vermittlung von Schweden, England und Holland, in den Konferenzen von Altona beides wieder erlangt und diese Staaten hatten die Aufrechterhaltung des Vertrags verbürgt. Da aber ein Vertrag zwischen Fürsten häufig nichts anderes ist als die Unterwerfung unter die Notwendigkeit insolange, bis der Stärkere in der Lage ist den Schwächern niederzudrücken, so lebte der Zank unter dem neuen König von Dänemark und dem jungen Herzog heftiger als je wieder auf. Während sich der Herzog in Stockholm befand, erlaubten sich die Dänen bereits Feindseligkeiten im Lande Holstein und verbanden sich im geheimen mit dem König von Polen, um den König von Schweden selbst zu demütigen.
Friedrich August, Kurfürst von Sachsen, dessen Wahl zum Könige von Polen weder die beredte Zunge und die diplomatische Geschicklichkeit des Abbé de Polignac, noch die großen Eigenschaften des Prinzen von Conti, seines Mitbewerbers, vor zwei Jahren hatten verhindern können, war ein Fürst, der ebenso wegen seiner ungewöhnlichen Körperkraft als wegen seiner Tapferkeit und Galanterie bekannt war. Nach dem Hofe Ludwigs XIV. war der seinige der glänzendste in Europa. Nie gab es einen Fürsten, der großmütiger und freigebiger war und seine Geschenke mit größerer Anmut zu geben wußte. Er hatte die Hälfte der Stimmen des polnischen Adels erkauft und die andere Hälfte durch den Anmarsch einer sächsischen Armee erzwungen. Er glaubte seine Truppen auch ferner nötig zu haben, um fester auf dem Throne zu sitzen, aber es bedurfte eines Vorwands, um sie in Polen zu behalten. Er beschloß deshalb den König von Schweden in seiner Provinz Livland anzugreifen, und zwar bei folgender Veranlassung.