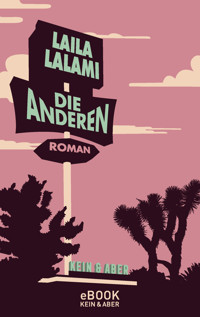19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 1527: Als der marokkanische Sklave, von seinem Besitzer Estebanico genannt, gemeinsam mit der spanischen Flotte in Florida ankommt, kann er nur staunen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich seine spanischen Herren ein Land nehmen, das offensichtlich anderen gehört – und zwar nur, indem sie diese Tatsache aussprechen, ganz egal, ob die Eingeborenen dies nun hören oder nicht. Nach dieser ersten, vermeintlich einfachen Eroberung stehen der spanischen Flotte jedoch Krankheit, Widerstand und Hunger bevor – und nur vier der Männer schaffen es, das Abenteuer zu überleben und darüber zu berichten. Einer von ihnen ist Estebanico. Denn warum sollten die spanischen Herren die Einzigen sein, die berichten dürfen? Als freier Mann und rückblickend setzt sich Estebanico an seinen eigenen Bericht und schildert die Begebenheiten der legendären Narvaez-Expedition im Jahr 1527 so, wie sie waren – oder zumindest so, wie er sich daran erinnern kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Laila Lalami wurde in Rabat geboren und hat in Marokko, Großbritannien und den Vereinigten Staaten studiert. Sie ist Pulitzer-Preis-Finalistin und Autorin von vier Romanen und zahlreichen Essays, die u.a. im Guardian und der New York Times erschienen sind. Die Anderen stand auf der Shortlist des National Book Award. Laila Lalami ist Professorin für Kreatives Schreiben an der University of California und lebt in Los Angeles.
ÜBER DAS BUCH
Das Jahr 1527: Als der marokkanische Sklave Mustafa gemeinsam mit der spanischen Flotte in Florida ankommt, kann er nur staunen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich seine Herren ein Land nehmen, das offensichtlich anderen gehört – und zwar nur, indem sie diese Tatsache aussprechen, ganz egal, ob die Eingeborenen es nun hören oder nicht. Nach dieser ersten, vermeintlich einfachen Eroberung stehen ihnen jedoch Krankheit, Widerstand und Hunger bevor – und nur vier der Männer schaffen es, das Abenteuer zu überleben und darüber zu berichten. Einer von ihnen ist Mustafa. Denn warum sollten die spanischen Herren die Einzigen sein, die die Geschichte weitergeben dürfen?
Laila Lalami führt uns in ein Abenteuer, in dem Sklaven zu Anführern und Anführer zu Sklaven werden, die Moral wegfällt und wiedergewonnen wird, die Menschen auf ihren innersten Kern reduziert werden, bis alle gleich sind, um gleich darauf Herrschaftsstrukturen wiederherzustellen. Ein Roman, der den Westen mit dem Blick aus dem Osten durchleuchtet und uns hinterfragen lässt, was wir als gegeben betrachten.
Für meine Tochter
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, seine Gebete und sein Segen seien auf unserem Propheten Mohammed und allen seinen Nachkommen und Gefährten. Dieses Buch ist das bescheidene Werk von Mustafa ibn Muhammad ibn Abdussalam al-Zamori, ein wahrheitsgetreuer Bericht über sein Leben und seine Reise von der Stadt Azemmur ins Land der Indianer, wohin er als Sklave gelangte und in dem Versuch, seine Freiheit zurückzugewinnen, Schiffbruch erlitt und viele Jahre verschollen blieb.
Da ich diese Schilderung lange nach den darin erzählten Begebenheiten aufgeschrieben habe, musste ich mich ganz auf meine Erinnerungen verlassen. Deshalb können die Entfernungen durcheinandergeraten oder Datierungen ungenau sein, doch kleine Fehler dieser Art bleiben in einer solchen Erzählung nun einmal nicht aus. Was alles andere betrifft, so erkläre ich, dass die Ereignisse beschrieben wurden, wie ich sie erlebt habe – auch diejenigen, die dem Leser aufgrund der Seltenheit ihres Vorkommens unwahr erscheinen mögen.
Den von meinen Gefährten zusammengestellten Bericht werde ich in Einzelheiten abändern. Seine Urheber waren drei kastilische Herren – mein rechtmäßiger Besitzer Andrés Dorantes de Carranza, mein Mitgefangener Alonso del Castillo Maldonado und Álvar Núñez Cabeza de Vaca, mein Rivale auf dem Gebiet des Erzählens, der die Darlegungen der Herren, den sogenannten Gemeinsamen Bericht, an die Audiencia in Santo Domingo sandte. Mich hat man im Gegensatz zu ihnen nie aufgefordert, unsere Reise durch das Land der Indianer vor dem spanischen Vizekönig zu bezeugen.
Obwohl ich den drei kastilischen Herren einen durchaus guten Charakter zubillige, glaube ich fest, dass sie, vom Bischof, dem Vizekönig und dem Marquis des Oaxaca-Tales bedrängt und den Gepflogenheiten ihres Standes folgend, bestimmte Ereignisse weggelassen, andere wiederum aufgebauscht haben, Einzelheiten verschwiegen oder aber dazuerfanden. Doch ich, der ich weder kastilischen Autoritäten verpflichtet noch an die Regeln einer Gesellschaft gebunden bin, der ich nicht angehöre, kann ungeschönt erzählen, was meinen Gefährten und mir widerfahren ist.
Jeder von uns, ob schwarz oder weiß, Herr oder Sklave, reich oder arm, Mann oder Frau, will nach seinem Tod in Erinnerung bleiben, und auch ich möchte fortbestehen jenseits der ewigen Dunkelheit, die mich erwartet. Sollte dieser Bericht durch einen glücklichen Zufall den Weg zu einem fähigen Schreiber finden, der es für angebracht hält, ihn mit der Feder festzuhalten, und dies ohne ihn auszuschmücken, außer mittels Kalligrafie oder bunter Miniaturmalerei in der Art der Türken und Perser, werden meine Landsleute eines Tages, so Gott will, von meinem erstaunlichen Abenteuer erfahren und ihm, wenn sie klug sind, dies entnehmen: die Wahrheit gehüllt in eine Geschichte.
1
Die Geschichte von La Florida
Im Jahr 934 nach der Hedschra, meinem dreißigsten Lebensjahr und dem fünften meiner Gefangenschaft, hatte es mich an den Rand der bekannten Welt verschlagen. Ich ging hinter Señor Dorantes, während wir durch eine dicht bewachsene Gegend marschierten, die er und die anderen Kastilier La Florida nannten. Wie es von meinem Volk genannt wird, weiß ich nicht, denn bis zu meiner Abreise aus Azemmur fanden Nachrichten aus jenem Land nur selten die Beachtung unserer Stadtschreier. Diese berichteten lieber von der Hungersnot, dem kurz zurückliegenden Erdbeben oder den Aufständen im Süden der Berberei. Ich denke aber, dass es in meinem Volk gemäß unseren Regeln der Namensgebung schlicht das Indianerland hieße. Die Indianer hatten sicherlich auch einen Namen dafür, doch den kannte weder Señor Dorantes noch ein anderer Teilnehmer der Expedition.
Señor Dorantes hatte mir gesagt, dass La Florida eine große Insel sei, größer als ganz Kastilien, und sich von der Küste, an der wir angelandet waren, bis zum Stillen Ozean erstrecke. Von einem Meer zum anderen, so hatte er es beschrieben. Das ganze Gebiet würde nunmehr von Gouverneur Pánfilo de Narváez regiert werden, dem Befehlshaber der Armada. Ich fand es unverständlich oder doch zumindest seltsam, dass der König von Spanien einen Untertan über ein Land herrschen ließ, das größer als sein eigenes war, doch diese Ansicht behielt ich natürlich für mich.
Wir marschierten nach Norden, auf das Reich Apalache zu. Indianer, die er gefangen genommen hatte, nachdem die Armada an der Küste von La Florida angelangt war, hatten Señor Narváez davon erzählt. Obwohl es nie mein Wunsch gewesen war, dorthin zu kommen, war ich erleichtert, als wir von Bord gehen konnten, denn die Fahrt über das Meer des Nebels und der Dunkelheit hatte jede Unannehmlichkeit bereitgehalten, die man von einer solchen Reise erwarten musste: bröseligen Schiffszwieback, trübes Trinkwasser und verdreckte Latrinen. Besonders die engen Schlafunterkünfte hatten Passagiere und Mannschaft reizbar gemacht, und fast täglich war es zu Streit gekommen. Doch das Schlimmste war der Gestank gewesen – der alles durchdringende Geruch ungewaschener Männer vermengt mit dem Rauch aus den Kohlenbecken und den Ausdünstungen von Pferdemist und Hühnerkot, die trotz täglicher Reinigung nicht aus den Ställen weichen wollten. Ein Gemisch wie ein Pesthauch, der jedem unter Deck entgegenschlug.
Ich war neugierig auf das Land, denn ich hatte von meinem Herrn und seinen Freunden viele Geschichten über die Indianer gehört, oder besser erlauscht. Ihre Haut sei rot und sie hätten keine Augenlider. Heiden seien sie, die Menschen opferten, zu böse aussehenden Göttern beteten und geheimnisvolle Tränke brauten, die ihnen Visionen machten, und sie gingen herum, wie Gott sie geschaffen habe, sogar die Frauen. Diese Behauptung war mir so unglaubwürdig erschienen, dass ich sie rundweg als Lüge abtat. Dennoch hatte mich das Land in seinen Bann geschlagen und war bald mehr als nur ein Reiseziel: ein fantastischer Ort, wie er nur dem Einfallsreichtum der Wandererzähler in den Suks der Berberei entsprungen sein konnte. Während der Fahrt über das Meer des Nebels und der Dunkelheit keimten solche Gedanken in einem auf, selbst wenn man die Reise nicht freiwillig unternahm. Die Bestrebungen der anderen färbten nach und nach unweigerlich ab.
Pro Schiff durfte nur eine kleine, aus Offizieren und Soldaten bestehende Gruppe landen. Als Kapitän der Gracia de Dios hatte Señor Dorantes zwanzig Männer ausgewählt, darunter diesen Diener Gottes, Mustafa ibn Muhammad, die in Ruderbooten an den Strand gebracht wurden. Mein Herr stand am Bug und hatte die eine Hand in die Hüfte gestemmt, die andere um den Knauf seines Schwerts gelegt, als posierte er für einen unsichtbaren Bildhauer. Keine Haltung hätte den Eifer besser zum Ausdruck gebracht, mit dem er Anspruch auf die Schätze der Neuen Welt erhob.
Der Himmel war gleichmäßig blau an diesem schönen Frühlingstag, das Wasser klar. Nachdem wir den Strand erreicht hatten, gingen wir langsam in Richtung eines Fischerdorfs, das von einem Matrosen auf dem Fockmast gesichtet worden war und etwa einen Armbrustschuss weit von der Küste entfernt lag. Was mir zunächst auffiel, war die Stille. Nein, das Wort trifft es nicht. Immerhin waren die Wellen zu hören, ein leichter Wind ließ die Palmwedel rauschen, und es kamen Möwen herbei, betrachteten uns voller Neugier und flogen flügelflatternd wieder davon. Und doch verspürte ich eine große Abwesenheit.
Das Dorf bestand aus zwölf in einem weiten Kreis angeordneten Hütten, die aus Holzpfählen gebaut und mit Dächern aus Palmblättern bedeckt waren. Die Abstände zwischen den Hütten waren breit genug, um zum Kochen und zur Lagerung von Nahrung genutzt zu werden. Rings um die Lichtung gab es mit frischen Scheiten bestückte Feuerstellen, und an einer Stange hingen drei gehäutete Hirsche, deren Blut noch tropfte. Doch das Dorf war verwaist. Trotzdem gab der Gouverneur den Befehl, die Siedlung gründlich zu durchsuchen. In den Hütten fanden sich Utensilien zum Kochen und Putzen, Tierhäute und Felle, getrockneter Fisch und Dörrfleisch sowie große Mengen Sonnenblumenkerne, Nüsse und Früchte. Die Soldaten nahmen sofort an sich, so viel sie nur konnten, umklammerten eifersüchtig ihre Beute und tauschten sie gegen anderes, das ihnen lieber war. Obwohl ich nichts nahm und deshalb auch nichts zu tauschen hatte, schämte ich mich, zum Zeugen des Diebstahls geworden zu sein und, unfähig, sie aufzuhalten, auch zum Komplizen der Leute.
Als ich mit meinem Herrn vor den Hütten stand, fiel mein Blick auf einen Haufen Fischernetze. Um mir die seltsame Knüpfung genauer anzusehen, hob ich eines hoch und entdeckte einen merkwürdigen kleinen Kiesel, den ich zunächst für ein Gewicht hielt. Doch die glatten Steinanker, die an jedem Netz hingen, sahen ganz anders aus als der gelbe, scharfkantige Kiesel. Ich überlegte, ob er ein Spielzeug sein könnte – eine Murmel oder Teil einer Rassel –, das versehentlich auf den Netzen liegen geblieben war. Ich hielt ihn ins Licht, um ihn besser zu betrachten, was Señor Dorantes natürlich bemerkte.
Hast du etwas gefunden, Estebanico?, fragte mein Herr.
Diesen Namen hatten mir die Kastilier gegeben, nachdem sie mich portugiesischen Händlern abgekauft hatten. Estebanico – eine Klangfolge, deren Fremdartigkeit mir nach wie vor in den Ohren knirschte. In Sklaverei geraten hatte ich nicht nur meine Freiheit aufgeben müssen, sondern auch den Namen, den meine Eltern für mich gewählt hatten. Ein Name ist etwas Kostbares, denn er enthält eine ganze Sprache, eine Geschichte, Traditionen und eine bestimmte Sicht auf die Welt. Verliert man ihn, verliert man auch all diese Dinge. Und das Gefühl, dass der Estebanico, den die Kastilier vor sich hatten, ein ganz anderer war als der Mensch, der ich wirklich war, hatte mich nie verlassen. Mein Herr riss mir den Kieselstein aus der Hand und fragte: Was ist das?
Das ist nichts, Señor.
Nichts?
Nur ein Kiesel.
Lass mich sehen. Er kratzte mit dem Fingernagel daran, und unter der dünnen Schmutzschicht kam ein helles Gelb zum Vorschein. Mein Herr war ein wissbegieriger Mensch, der ständig Fragen stellte. Vielleicht hatte er deshalb beschlossen, auf die Annehmlichkeiten seines stattlichen Hauses in Béjar del Castañar zu verzichten und sein Glück im Unbekannten zu machen. Seine Neugier auf die Neue Welt störte mich nicht, doch wenn er von seiner Heimatstadt sprach, wurde ich neidisch, denn dann schwang immer die Erwartung einer ruhmreichen Rückkehr mit.
Das ist nichts, sagte ich noch einmal.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Das ist bestimmt nur Katzengold.
Es könnte auch echtes Gold sein. Unschlüssig drehte er den Stein zwischen den Fingern. Dann fasste er einen Entschluss und lief zu Señor Narváez, der auf dem Dorfplatz darauf wartete, dass seine Männer die Suche beendeten. Don Pánfilo, rief mein Herr. Don Pánfilo.
Lasst mich Euch den Gouverneur beschreiben. Das Auffälligste an seinem Gesicht war die schwarze Klappe über dem rechten Auge. Sie ließ ihn furchterregend wirken, doch seine eingefallenen Wangen und das kleine Kinn glichen diesen Eindruck aus. Er trug fast immer, auch wenn es gar nicht nötig war, einen mit Straußenfedern geschmückten Helm aus Stahl. Über dem Brustharnisch spannte sich eine blaue Schärpe von der Schulter bis zum Schenkel, die an der Hüfte kunstvoll gebunden war. Obwohl er große Mühe auf sein Äußeres verwandte, war er manchmal so derb wie die niedrigsten seiner Soldaten. Einmal hatte ich gesehen, wie er sich ein Nasenloch mit dem Finger zustopfte und aus dem anderen einen langen Schleimstrahl in die Luft schnäuzte, während er mit einem seiner Kapitäne über die Schiffsvorräte sprach.
Señor Narváez nahm den Kieselstein mit gierigen Fingern entgegen. Wieder wurde das kleine Ding in die Sonne gehalten, und wieder wurde daran gekratzt. Das ist Gold, sagte er feierlich, und hielt den Stein wie eine Opfergabe auf dem Handteller. Als er weitersprach, klang seine Stimme heiser. Gut gemacht, Capitán Dorantes. Gut gemacht.
Aufgeregt umringten die Offiziere den Gouverneur, und ein Soldat lief zum Strand zurück, um seinen Kameraden von dem Goldfund zu berichten. Ich stand hinter Señor Dorantes, von seinem Schatten vor der Sonne geschützt, und obwohl ich sein Gesicht nicht sah, wusste ich, dass er vor Stolz strahlte. Ein Jahr zuvor hatte man mich in Sevilla an ihn verkauft; seitdem hatte ich ihn zu deuten gelernt und erkannte, ob er glücklich oder nur zufrieden, wütend oder leicht verärgert, besorgt oder sogar ein wenig beunruhigt war – Gemütsregungen, deren Zwischentöne mir zeigten, ob sie in Handlungen gegen mich münden würden. In diesem Moment beispielsweise freute er sich über meine Entdeckung, doch seine Eitelkeit verbot es ihm zu sagen, dass ich es war, der den Stein gefunden hatte. Jetzt galt es den Mund zu halten, sich eine Weile nicht bemerkbar zu machen und ihn den Entdeckerruhm ganz allein genießen zu lassen.
Kurz darauf befahl der Gouverneur, alles an Bord der restlichen Armada auszuschiffen. Drei Tage dauerte es, bis alle Menschen, Pferde und Vorräte auf den weißen Sandstrand gebracht waren. Immer mehr Männer trafen ein und gesellten sich jeweils zu Gleichrangigen: Der Gouverneur stand zumeist mit seinen Kapitänen zusammen, die allesamt Rüstung und federgeschmückte Helme trugen, der Missionskommissar plauderte mit den vier anderen in braune Kutten gekleideten Mönchen, die Kavalleristen stießen zu den Infanteristen, die ihre Waffen bei sich trugen – Musketen, Arkebusen, Schwerter, Lanzen mit Stahlspitzen, Armbrüste, Dolche und sogar Metzgerbeile. Eine weitere Gruppe bildeten die Siedler, zu denen Zimmerleute, Metallarbeiter, Schuster, Bäcker, Bauern, Händler sowie viele andere zählten, deren Berufe ich nie erfuhr oder rasch wieder vergaß. Es waren auch zehn Frauen und dreizehn Kinder dabei, die aneinandergedrängt rings um ihre Holztruhen standen. Nur die schätzungsweise fünfzig Sklaven, darunter auch dieser Diener Gottes, Mustafa ibn Muhammad, waren über den ganzen Strand verteilt; jeder von ihnen hielt sich dicht bei dem Mann, dem er gehörte, und schleppte das Gepäck seines Herrn oder bewachte dessen Habe.
Als sich endlich alle versammelt hatten, war der frühe Abend des dritten Tages angebrochen. Da Ebbe herrschte, hatten die nur noch kleinen Wellen einen dunklen Streifen Strand freigelegt. Es war kühler geworden, der Sand unter meinen Füßen fühlte sich kalt und feucht an. Hoch am Himmel hatten sich Wolken zusammengeballt und die Sonne in eine blasse, ferne Kugel verwandelt. Vom Meer zog dichter Nebel heran, der nach und nach die Farben aus der Landschaft auswusch und alles in Weiß- und Grautöne tauchte. Es wurde sehr still.
Der Notar der Armada, ein stämmiger, eulenäugiger Mann namens Jerónimo de Albaniz, trat vor, zog, den Blick auf Señor Narváez gerichtet, eine Schriftrolle in die Länge und begann mit tonloser Stimme den Text zu verlesen. Im Namen des Königs und der Königin, sagte er, tue ich euch zu wissen, dass dieses Land der Besitz Gottes ist, unseres Herrn, des einen und ewigen. Gott verlieh einem, der St. Petrus genannt wurde, das Amt, der Herr und Vorgesetzte aller Menschen der Welt zu sein, wo immer sie lebten und unter welchem Recht und Glauben sie wären. Der Nachfolger des heiligen Petrus in diesem Amt ist unser Heiliger Vater, der Papst, der dem König dieses Land unter unseren Füßen zum Geschenk gemacht hat. Deshalb bitten wir euch und fordern euch auf, die Kirche anzuerkennen als Herrin der ganzen Welt und den Hohenpriester, der Papst genannt wird, und den König und die Königin als Gebieter dieses Landes.
Nun unterbrach Señor Albaniz die Lesung und trank, ohne um Erlaubnis gebeten oder sich entschuldigt zu haben, einen Schluck Wasser aus einer Flasche, die an einem Riemen von seiner Schulter herabhing.
Ich beobachtete die Miene des Gouverneurs. Die Unterbrechung ärgerte ihn offensichtlich, doch er versagte sich jede Bemerkung, um das Ganze nicht noch weiter in die Länge zu ziehen. Vielleicht wollte er aber auch den Notar nicht verstimmen, denn ohne Notare und Archivare würde niemand von den Errungenschaften der Gouverneure erfahren. Dafür war ein gewisses, wenn auch geringes Maß an Geduld und Respekt erforderlich.
Señor Albaniz wischte sich ohne Eile mit der bloßen Hand über den Mund und setzte die Lesung fort. Tut ihr dies, werdet ihr gut tun, und ihr werdet von uns alle Liebe und Barmherzigkeit erfahren. Tut ihr es aber nicht oder schiebt es in bösartiger Weise auf, so wisst, dass wir euch bekriegen werden, wie wir nur können, und eure Frauen und Kinder in Gefangenschaft setzen und zu Sklaven machen, euer Hab und Gut von euch nehmen und euch alles Böse und allen Schaden antun werden, wie es in unserer Macht liegt. Sollte dies geschehen, so erklären wir, dass die Tötungen und Verluste zu euren Schulden gehen und nicht zu denen ihrer Hoheiten noch der Herren, die hier zugegen sind. Da wir euch dies nun verkündet haben, fordern wir den Notar auf, es schriftlich zu bezeugen, und die restlichen Anwesenden, ebenfalls Zeugen dieser Ermahnung zu sein.
Bis Señor Albaniz mit der Aufzählung der Versprechungen und Drohungen begonnen hatte, war mir nicht klar gewesen, dass sein Vortrag den Indianern galt, und ich hatte auch nicht verstanden, warum die Verkündung hier, auf diesem Strand, geschah, obwohl die Menschen, an die sie sich richtete, das Dorf längst verlassen hatten. Wie seltsam sich die Kastilier benehmen, wie durch und durch seltsam, hatte ich mir gesagt – sie glaubten etwas, indem sie es einfach behaupteten. Heute weiß ich, dass diese Eroberer wie so viele andere vor und zweifellos auch nach ihnen in ihren Reden nicht die Wahrheit sagten, sondern sie erschufen.
Endlich verstummte Señor Albaniz. Er überreichte Señor Narváez die Schriftrolle, das requerimiento, und wartete mit gesenktem Kopf, bis dieser das Dokument unterzeichnet hatte. Dann wandte sich der Gouverneur an die Versammelten und verkündete, das Dorf trage von nun an den Namen Portillo. Die Kapitäne neigten die Köpfe, und ein Soldat pflanzte die Standarte auf, ein grünes Stück Stoff mit dem Abbild eines roten Schildes in der Mitte. Das erinnerte mich an das Hissen der Fahne des portugiesischen Königs auf dem Turm der Festung von Azemmur viele Jahre zuvor. Obwohl ich damals ein kleiner Junge gewesen war, empfand ich noch immer die Demütigung jenes Tages, der das Schicksal meiner Familie verändert, unser Leben zerstört und mich aus meiner Heimat vertrieben hatte. Jetzt wiederholte sich die Szene am anderen Ende der Welt auf einer ganz anderen Bühne und mit anderen Menschen. Mich beschlich Angst vor dem, was vor mir lag.
Meine Befürchtungen bestätigten sich schon früh am nächsten Morgen, als hinter der Vorratshütte des Dorfs Unruhe aufkam. Ich musste Señor Dorantes die Haare schneiden und hatte gerade damit begonnen, seine dichten strohblonden Locken zu kürzen. Auch sein Bart war gewachsen, doch der sollte ungestutzt bleiben. Hier, an den Rändern des Reichs, erschien es ihm nicht mehr wichtig, gepflegt auszusehen. Oder er ließ ihn sich wachsen, weil er es konnte und die Indianer nicht, so hieß es zumindest. Ich gebe zu, dass ich nicht danach fragte, sondern mich über einen Dienst weniger freute. Als wir Soldaten rufen hörten, sprang Señor Dorantes auf die Beine und lief, noch das weiße Leinentuch um den Hals, über den Dorfplatz, um nachzusehen. Ich folgte ihm mit meiner Schere aus Sevilla in der Hand. Wie sich erwies, hatten die Soldaten mehrere im Gebüsch versteckte Indianer entdeckt und vier von ihnen ergriffen.
Es waren vier Männer, alle nackt. Ich hatte schon auf den Inseln Cuba und La Española Indianer gesehen, als die Armada dort einlief, um die Vorräte aufzustocken, doch nie aus solcher Nähe. Weil ich es nicht gewohnt war, Männer zu sehen, die sich ohne Scham in ihrem natürlichen Zustand bewegten, starrte ich sie zunächst an. Sie waren groß gewachsen, hatten breite Schultern, und die Farbe ihrer Haut erinnerte an Erde nach dem Regen. Ihr langes Haar glänzte, und sie trugen jeweils am rechten Arm und am linken Bein Tätowierungen, Zeichen, die ich nicht verstand. Einer schielte wie mein Onkel Omar und blinzelte ständig, um die Fänger ansehen zu können, ein anderer ließ den Blick über das Dorf schweifen und vergegenwärtigte sich, was sich seit unserer Ankunft verändert hatte: Vor dem Bethaus war ein großes Kreuz aufgestellt worden, auf dem Dorfplatz hing an einer Stange die Standarte des Gouverneurs, und rings um den Kreis der Hütten standen Pferde an frisch in den Boden gerammte Pfähle gebunden. Wegen der Geschichten über die Indianer, die mir bis dahin zu Ohren gekommen waren, hatte ich ganz und gar Unglaubliches erwartet, feuerspeiende Dschinn oder Ähnliches, doch diese Männer erschienen mir vollkommen harmlos, erst recht im Vergleich mit den kastilischen Soldaten. Trotzdem wurden sie gefesselt und zu Señor Narváez geführt.
Der Gouverneur zog den kleinen Goldbrocken, den ich gefunden hatte, aus seiner Tasche, legte ihn auf die geöffnete Hand und fragte: Woher habt ihr dieses Gold?
Die Gefangenen betrachteten ihn gelassen; zwei erwiderten etwas in ihrer Sprache. Ich konnte damals noch kein Muster in diesen Lauten erkennen – wo endete ein Wort und wo begann das nächste? Da ich in Azemmur, einer Handelsstadt, aufgewachsen war, hatte sich in mir die Liebe zur Sprache und auch – man sehe mir diesen Moment der Unbescheidenheit nach – eine Leichtigkeit im Umgang damit gebildet. Deshalb machte mich die Sprache der Indianer neugierig, obwohl sie mir nichts von dem bot, was sich beim Erlernen neuer Idiome bis dahin als hilfreich erwiesen hatte: vertraute Laute, ähnliche Wörter, eine gleich klingende Satzmelodie. Der Gouverneur nickte gemächlich, was mich verwunderte. Als hätte er die Indianer genau verstanden und wäre sogar derselben Ansicht wie sie.
Doch dann fragte er noch einmal: Woher habt ihr dieses Gold?
Die Soldaten hinter ihm sahen zu und warteten. Hoch in den Bäumen zwitscherten Vögel, ohne sich von der drückenden Hitze am Tirillieren hindern zu lassen. Vom nahen Strand drang das beruhigende Rauschen der Wellen herüber, und in der Luft lag Rauch – irgendwer hatte bereits das Feuer für den almuerzo entfacht. Die Indianer gaben dem Gouverneur auch diesmal die gleiche Antwort. Jedenfalls nahm ich das an; sie hätten ihn aber genauso gut ihrerseits etwas fragen, ihn zum Kampf auffordern oder mit dem Tod bedrohen können, falls er sie nicht freiließe.
Nachdem der Gouverneur ihnen höflich zugehört hatte, wandte er sich an seinen Pagen und sagte: Sperr sie in die Vorratshütte und bring mir eine Peitsche.
Señor Dorantes kehrte zu seinem Stuhl zurück, und ich musste ihm wie immer folgen. Wir sprachen beide kein Wort. Nachdem ich sein restliches Haar geschnitten hatte, reichte ich ihm einen kleinen Spiegel und hielt einen weiteren hinter seinem Kopf in die Höhe. In den einander zugekehrten Spiegeln sah ich sein und mein Bild. Mein Herr war mit dem Haarschnitt zufrieden, drehte sein Gesicht hierhin und dorthin und nickte anerkennend. Sein Bart reichte fast bis zu der Narbe an der rechten Wange, von der er einmal in meiner Anwesenheit seinen Gästen bei einem Abendessen stolz berichtet hatte. Sie stamme von einer Jahre zurückliegenden Verwundung, die er in Kastilien bei der Niederschlagung eines Aufstands gegen den König davongetragen habe. Mich hatte meine Knechtschaft zwar gelehrt, stets unbeteiligt zu wirken, doch nun erkannte ich im Spiegel, dass meine Augen meine Angst verrieten. Ich sagte mir, dass ich mich nur für die Fischernetze der Indianer interessiert und nicht nach Gold gesucht hatte, doch der von mir entdeckte Kiesel war nun der Grund dafür, dass vier Männer, die mir nie etwas Böses getan hatten, ausgepeitscht wurden. Wie mein Herr, musste auch ich so tun, als hörte ich die Schreie nicht, die kurz darauf aus der Vorratshütte drangen. Schon nach kurzer Zeit wurde daraus eine lang gezogene, schmerzerfüllte Klage, die ich glaubte in der Tiefe meiner Seele widerhallen zu hören. Dann herrschte Stille, die nur vom grässlichen rhythmischen Schnalzen der Peitsche unterbrochen wurde.
Als ich Señor Dorantes etwas später in seine Stiefel hineinhalf, hörte ich, wie sich sein jüngerer Bruder Diego, ein stiller Junge von sechzehn oder siebzehn Jahren, nach der Begegnung des Gouverneurs mit den Indianern erkundigte. Es erstaunte mich immer aufs Neue, dass diese beiden Männer leibliche Brüder waren, denn sie hatten ganz unterschiedliche Wesen: so schüchtern und arglos der eine, so kühn und listig der andere. Zeigte sich der eine in seinen Freundschaften wählerisch, so war der andere bereit, schnell zu lieben und schnell zu hassen. Dennoch hatte sich Diego den Bruder in allen Dingen zum Vorbild genommen. Auch er trug sein Wams oben aufgeknöpft und den Helm nach hinten geschoben wie ein erschöpfter Soldat und versuchte sich einen Bart wachsen zu lassen, auch wenn sich an seinen Wangen bisher nur einzelne stoppelige Stellen zeigten. Wann hat Don Pánfilo ihre Sprache gelernt, hermano?, fragte Diego. War der Gouverneur schon einmal in La Florida?
Señor Dorantes warf ihm einen belustigten Blick zu, fand die Frage aber offenbar harmlos, denn er beantwortete sie sofort. Nein, er ist wie wir alle zum ersten Mal hier. Aber er hat viel Erfahrung mit den Wilden. Er kann sich ihnen recht gut verständlich machen und erfährt fast immer, was er erfahren möchte.
Das ergab für mich keinen Sinn, aber ich sagte nichts. Mir war klar, dass mein Herr es nicht gut aufnehmen würde, sollte jemand in Abrede stellen, dass der Gouverneur die Sprache der Indianer fließend beherrschte. Denn die Alten lehren uns: Besser ein lebender Hund als ein toter Löwe.
Diego ließ nicht locker. Aber warum muss er sie dann auspeitschen?
Weil die Indianer geborene Lügner sind, erwiderte Señor Dorantes. Nehmen wir die vier dort drüben. Wahrscheinlich sind sie Spione, die uns auskundschaften und über uns berichten sollen. Fast unmerklich war mein Herr von einem vergnügten zu einem leicht gereizten Tonfall übergegangen. Er stand auf und strich mit dem Finger am oberen Schaftrand der Stiefel entlang, damit die Hosenbeine glatt in den Stiefeln steckten. Um die Wahrheit aus den Indianern herauszuholen, sagte er, braucht man die Peitsche.
Der Gouverneur hatte die vier Gefangenen so lange ausgepeitscht, bis er sicher war, die ganze Wahrheit erfahren zu haben, die er nun in einer abendlichen Zusammenkunft aller Offiziere verkünden wollte. Sie trafen sich in der größten Hütte des Dorfs, dem Bethaus, das leicht hundert Menschen fasste. Geladen waren aber nur etwa zwölf hochrangige Männer: der Kommissar, der Schatzmeister, der Sachwalter, der Notar sowie die Kapitäne und damit auch Señor Dorantes. Zuvor hatte man mehrere hölzerne Pantherstatuen mit gelb bemalten Augen und Gewehrschaft-Keulen in den Armen ebenso entfernt wie die Handtrommeln, die meiner Vermutung nach bei heidnischen Zeremonien zum Einsatz kamen. Das Bethaus war also leer. Bis auf die Decke: Mit einem Blick nach oben sah ich, dass sie mit einer Unmenge Muscheln verziert war, deren Innenseiten nach außen hingen und einen schwachen Schimmer auf den Boden warfen.
Die spanischen Offiziere ließen sich der Reihe nach auf den im Kreis angeordneten indianischen Hockern nieder. Der Page des Gouverneurs hatte ein weißes Tuch über eine lange Bank gebreitet und an jedes Ende einen Kandelaber mit brennenden Kerzen gestellt. Nun trug er das Essen auf – gerösteten Fisch, gekochten Reis, gepökeltes Schweinefleisch sowie frische und getrocknete Früchte aus der Vorratshütte des Dorfs. Beim Anblick dieses Mahls verspürte ich so großen Hunger wie seit vielen Tagen nicht, doch ich musste warten. Meine magere Ration würde ich erst erhalten, wenn die anderen gegessen hatten.
Señor Narváez stellte sich vor seine Offiziere und erklärte, der Goldkiesel stamme aus einem mit Wohlstand gesegneten Reich namens Apalache, das zwei Wochenmärsche nach Norden entfernt sei. In dessen Hauptstadt befänden sich große Mengen an Gold, Silber, Kupfer und anderen Edelmetallen. Ringsum würden ausgedehnte Mais- und Bohnenfelder bestellt, und in dem Fluss, der die Stadt durchfließe, gebe es viele Arten von Fischen. Die Aussagen der Indianer, die der Gouverneur den Notar Señor Albaniz festzuhalten bat, hätten ihn davon überzeugt, dass das Reich Apalache dem des Moctezuma an üppigen Schätzen in nichts nachstehe.
Die Nachricht schlug ein wie eine Kanonenkugel. Alle erschauerten, und ich gestehe, dass es auch mir den Atem verschlug, denn von dem reichen Herrscher und seinem mit Gold und Silber verkleideten Palast hatte ich bereits in Sevilla viel gehört. Die Begeisterung der Kapitäne steckte mich an, und ich begann mit offenen Augen zu träumen. Was, wenn die Kastilier die Stadt eroberten? Was, wenn Señor Dorantes zu einem der reichsten Männer in diesem Teil des Imperiums werden würde? Mich ergriff die verwegene Hoffnung, er könnte dann als Geste der Dankbarkeit oder des guten Willens oder um sein Gold und seinen Ruhm zu feiern, den Sklaven freilassen, der ihn auf diesen Weg gebracht hatte. Wie leicht ich in solche Fantastereien verfiel! Ich würde La Florida auf einem Schiff mit Ziel Sevilla verlassen und von dort nach Azemmur segeln, in die Stadt am Rande des alten Kontinents. Ich würde nach Hause zurückkehren, zu meiner Familie, würde sie alle umarmen und mich von ihnen umarmen lassen, mit den Fingern über die raue Kante der gefliesten Mauer im Innenhof streichen, das Rauschen des Oum er-Rbia hören, wenn er im Frühling vom vielen Schmelzwasser angeschwollen war, würde in warmen Sommernächten, wenn der Duft reifer Feigen in der Luft hing, auf dem Dach unseres Hauses sitzen. Ich würde wieder die Sprache meiner Vorväter sprechen und Trost in den Traditionen finden, die aufzugeben man mich gezwungen hatte. Dass nichts von alldem versprochen oder auch nur angedeutet worden war, schwächte meine Sehnsucht nicht. Und in einem Anflug von Gier vergaß ich, welchen Preis andere für meinen Traum zu zahlen hätten.
Die Offiziere erhoben die Gläser und dankten dem Gouverneur für die guten Neuigkeiten, und die Sklaven, unter ihnen dieser Diener Gottes, Mustafa ibn Muhammad, schenkten Wein nach. (Leser, es fällt mir nicht leicht zu gestehen, dass ich die Gläser mit dem verbotenen Getränk auffüllte, doch ich habe nun einmal beschlossen, alles zu berichten und nicht einmal eine so kleine Einzelheit wegzulassen.) Es gebe allerdings, sagte der Gouverneur und hob die Hände, um die Versammlung zum Schweigen zu bringen, ein Problem. Die Armada sei zu groß: vier Karavellen und eine Brigantine, sechshundert Männer und achtzig Pferde, fünfzigtausend arrobas Vorräte und Waffen. Die Schiffe seien auf der bevorstehenden Mission nicht einsetzbar.
Er habe daher entschieden, die Mission in zwei Kontingente von annähernd gleicher Größe aufzuteilen. Das erste – die Flottenabteilung mit den Matrosen, den Frauen, Kindern und allen, die an einer Erkältung oder an Fieber litten oder aus einem anderen Grund zu schwach waren für die Weiterreise – werde entlang der Küste von La Florida zur nächstgelegenen Stadt in Neuspanien segeln, dem an der Mündung des Río de las Palmas gelegenen Ort Pánuco, dort vor Anker gehen und warten. Die zweite Abteilung – alle körperlich tüchtigen Männer, die gehen, reiten oder Nahrung, Wasser, Waffen und Munition tragen könnten – werde durchs Landesinnere nach Apalache marschieren, die Stadt sichern und dann eine kleinere Gruppe losschicken, die sich mit der Flottenabteilung treffen werde. Der Gouverneur forderte die Kapitäne auf, die besten unter ihren Männern auszuwählen.
Schweigen senkte sich über die Versammlung. Dann begannen mehrere Kapitäne gleichzeitig Einwände gegen den Plan zu erheben. Ein junger Mann, ein guter Freund meines Herrn, tat sich dabei besonders hervor. Dieser Señor Castillo hatte sich der Expedition kurzerhand angeschlossen, nachdem er bei einem Festessen in Sevilla davon gehört hatte. Weil er stark näselte, klang er wie ein Kind; obendrein war er ein schmächtiger Mensch und sah so aus, als wäre er keine zwanzig. Er erhob sich und fragte, ob es nicht zu riskant sei, alle Schiffe und Vorräte wegzuschicken, während wir ins Landesinnere marschierten.
Wir haben keine Karten, gab er zu bedenken. Keine Möglichkeit, für Nachschub zu sorgen, sollte die Mission länger dauern als erwartet, und unsere Piloten sind sich nicht einig, wie weit Pánuco entfernt ist. Er sprach freimütig und ohne jede Spur von Feindseligkeit. Die anderen, die den Plan ebenfalls ablehnten, waren verstummt und stillschweigend übereingekommen, ihn für sie alle reden zu lassen.
Stimmt, wir haben keine Karten, erwiderte Señor Narváez freundlich, aber wir haben die vier Indianer. Die padres werden sie unsere Sprache lehren, damit sie uns als Wegweiser und Dolmetscher dienen. Was die Dauer der Mission betrifft, so habt Ihr mit eigenen Augen gesehen, wie schlecht bewaffnet die Wilden sind. Wir werden nicht lange brauchen, um sie zu bezwingen. Der Gouverneur trug an diesem Abend keine Rüstung, sondern ein schwarzes Wams, an dessen Ärmeln er ständig zupfte, um sie gleich darauf wieder gerade zu streichen. Überlegen wir jetzt, wie wir uns aufteilen.
Señor Castillo fuhr sich mit den Fingern durch das dichte braune Haar – eine Angewohnheit, die seine Nervosität verriet. Verzeiht, Don Pánfilo, sagte er, aber ich bin noch immer nicht davon überzeugt, dass wir die Schiffe fortschicken sollten, trotz der Tatsache, dass sich die drei Piloten nicht auf die Entfernung einigen können.
Wir sind nicht weit vom Hafen von Pánuco entfernt, entgegnete der Gouverneur. Dem Oberpiloten zufolge sind es von hier nach dort nur zwanzig legua, die beiden anderen schätzten die Strecke auf fünfundzwanzig. Das würde ich nicht als Uneinigkeit bezeichnen.
Soll das heißen, dass Ihr die Schiffe einfach so wegschicken wollt?
Der Gouverneur blickte Señor Castillo mit seinem heilen Auge durchdringend an. Genau das soll es heißen.
Was, wenn sie sich auf dem Weg zum Hafen verirren? Einige hier haben viel Geld in die neuen Schiffe gesteckt. Wir können uns ihren Verlust nicht leisten.
Ihr müsst mich nicht über die Kosten der Schiffe belehren, Castillo. Auch ich habe mein ganzes Geld in die Expedition investiert. Mit einem Blick in die Runde forderte der Gouverneur die Anwesenden auf, sein gespieltes Erstaunen zu teilen. Mein Plan ist sehr einfach, señores. Wir marschieren ins Reich Apalache, die Schiffe warten in einem sicheren Hafen, und die Mannschaft kann alle benötigten Vorräte beschaffen. Diese Strategie habe ich schon vor fünfzehn Jahren in meinem Cuba-Feldzug angewandt. Mit einem wehmütigen Lächeln in Erinnerung an den früheren Ruhm richtete er den Blick auf Señor Castillo und fügte hinzu: Als Ihr wahrscheinlich noch in den Windeln gelegen habt.
Señor Castillo setzte sich wieder. Sein Gesicht war hochrot.
Dem jungen Kapitän erschien der Plan des Gouverneurs tollkühn, doch ich wusste, dass er mehrfach erprobt war. Bevor Hernán Cortés auf Tenochtitlán marschiert war, um die Reichtümer Moctezumas einzufordern, hatte er seine Schiffe im Hafen von Veracruz versenkt. Und sieben Jahrhunderte zuvor hatte Tariq ibn Ziyad an der spanischen Küste seine Landungsboote verbrannt. Eigentlich war Señor Narváez’ Plan sogar umsichtig; schließlich schickte er die Schiffe nur fort, damit sie im nächstgelegenen Hafen auf uns warteten und mit neuen Vorräten beladen wurden. Deshalb teilte ich die Befürchtungen von Señor Castillo nicht und grollte dem Mann sogar ein wenig, weil er die Reise ins Reich des Goldes und damit die Erfüllung meines Traums von der Freiheit hinauszögern wollte.
Nun richtete Señor Castillo das Wort an Señor Cabeza de Vaca, der ihm gegenübersaß. Seid Ihr nicht auch der Ansicht, dass wir damit ein unnötiges Risiko eingehen würden?
Señor Cabeza de Vaca war der Schatzmeister der Expedition. Er hatte dafür zu sorgen, dass der König seinen Anteil an jedwedem in La Florida erlangten Vermögen erhielt. Gerüchten zufolge stand er dem Gouverneur sehr nahe, weshalb ihn die meisten Männer fürchteten, auch wenn sie sich hinter seinem Rücken über seinen ungewöhnlichen Namen lustig machten und ihn Cabeza de Mono nannten, weil seine Ohren abstanden wie die eines Affen. Señor Cabeza de Vaca verschränkte nun seine Hände mit den weißen zarten Fingern und den sauberen Nägeln – die Hände eines Edelmanns.
Ja, es ist ein Risiko, sagte er. Es gibt immer eines. Doch die Indianer dieser Gegend wissen jetzt, dass wir hier sind. Wir müssen unverzüglich aufbrechen, bevor der König der Apalache eine große Armee gegen uns einrichten oder eine Allianz mit seinen Nachbarn schmieden kann. Die Gelegenheit, Apalache für Seine Majestät in Besitz zu nehmen, darf nicht vergeben werden. Señor Cabeza de Vaca sprach mit der Arglosigkeit eines Mannes, der unter dem Bann hochfliegender Ideen steht, die er sich nicht durch schnöde Bedenken wegen irgendwelcher Schiffe verwässern lassen will. Einige Kapitäne nickten zustimmend, denn der Schatzmeister war ein erfahrener Mann, der wohlüberlegte Entscheidungen traf und großen Einfluss auf sie hatte.
Die restlichen Anwesenden schwiegen. Señor Narváez räusperte sich. Einer muss das Kommando über die Schiffe haben, während wir nach Apalache marschieren. Wenn sich Castillo also nicht ins Landesinnere wagt …
Der Vorschlag des Gouverneurs barg eine kaum verhüllte Beleidigung.
Don Pánfilo!, entgegnete Señor Castillo mit verzerrter Miene und erhob sich, bereit zur Verteidigung seiner Ehre.
Er kommt mit, erklärte Señor Dorantes. Er hatte die Hand an Señor Castillos Ellbogen gelegt, damit sein Freund seinen eigenen Ruf nicht weiter schädigte.
So geschah es, dass die Schiffe zum Hafen von Pánuco geschickt wurden, während der Gouverneur die Offiziere und Soldaten, die Ordensbrüder und Siedler, die Träger und Diener tief in die Wildnis von La Florida führte – eine lange Kolonne von dreihundert Seelen auf der Suche nach dem Reich des Goldes.
Das Land um uns herum war flach und dicht bewachsen. Wo das Sonnenlicht durch das Blätterdach drang, leuchtete es mattgrün, manchmal auch gelblich. Zwar dämpfte der weiche Boden das Klappern der Hufe, doch die Lieder, die die Soldaten heiser grölten, das Klirren der Offiziersrüstungen, das Scheppern der Werkzeuge in den Taschen der Siedler kündeten von unserem Marsch durch die grüne Wildnis. Oft lag hinter den Bäumen ein stiller, von frei liegenden Wurzeln umgebener Sumpf, über den sich schleimige Äste beugten. Nach jeder Durchquerung war ich von Kopf bis Fuß mit grauem Schlamm bedeckt, der an den Beinen und zwischen den Zehen verkrustete. Der Juckreiz trieb mich fast in den Wahnsinn.
Als wir einmal durch einen großen Sumpf wateten, rief ein Sklave namens Agostinho – ein Mann wie ich, den die Gier und die Umstände von Ifriqiya nach La Florida verschlagen hatten –, man solle ihm mit dem schweren Leinensack auf seinem Kopf helfen. Auf dem Weg zu ihm kam ich an mehreren weißen Blüten vorbei, die einen berauschenden Duft verströmten. Ringsum blubberte der Sumpf, als würde er in aller Ruhe tief Atem holen. Ich griff gerade nach dem Leinensack, da schoss ein grünes Ungeheuer aus dem Wasser und grub seine Zähne in Agostinho. Ich hörte deutlich seine Knochen brechen. Ein Schwall Blut stieg an die Oberfläche, und Agostinho wurde, den Mund zu einem stummen Schrei geöffnet, unter Wasser gezogen. So schnell mich meine Beine trugen, lief ich ans Ufer. Mein Herz war von dem gleichen maßlosen Grauen erfüllt, das ich als kleiner Junge empfunden hatte, wenn meine Mutter an frühen Winterabenden Schauergeschichten erzählte, Geschichten von Kindern, die sich in den Wald hineinwagten und unweigerlich von absonderlichen Wesen gefressen wurden. Sobald ich wieder trockenen Boden unter den Füßen hatte, brach ich zusammen und sah gerade noch, wie die Bestie mit klopfendem Schwanz im schlammigen Wasser verschwand.
Weder die Sprache der Kastilier noch meine kannte zu dieser Zeit ein Wort für das Tier. Wer davon sprechen wollte, musste sich mit einer Umschreibung begnügen und es »Das Wassertier mit der Schuppenhaut« nennen – ein schwerfälliger Ausdruck, der nicht lange taugte, nachdem sich die Spanier zu Herren über La Florida erklärt hatten. So begannen sie, alles neu zu benennen, als wären sie der allwissende Gott im Garten Eden. Der Gouverneur ging zu dem Sumpf zurück und fragte, wessen Sklave der Mann gewesen sei und was sich in dem Leinensack befunden habe, und irgendeiner berichtete ihm, dass Agostinho der Sklave eines Siedlers gewesen sei und der Sack Töpfe, Geschirr und Küchengeräte enthalten habe. Nun gut, erwiderte der Gouverneur gereizt und verkündete, das Tier heiße von nun an el lagarto, weil es wie eine riesenhafte Eidechse aussehe. Diesen Namen musste der Notar nicht vermerken; keiner würde ihn je vergessen.
Die lagartos waren nicht die einzigen Beschwernisse auf dem Marsch des Gouverneurs. Die Essensrationen waren sehr klein ausgefallen; jeder Mann hatte nur zwei Pfund Zwieback und ein halbes Pfund gepökeltes Schweinefleisch erhalten, Diener und Sklaven die Hälfte. Kein Wunder, dass sich die Männer ständig zusätzliche Nahrung vor allem in Form von Hasen- und Hirschfleisch suchten. Doch schon bald verbot der Gouverneur denen mit Bögen oder Musketen, sie für die Jagd einzusetzen, um Munition aufzusparen, falls die Indianer von Apalache Widerstand leisteten. Ich selbst hatte keine Waffe, nur meinen Wanderstab, mit dem ich hin und wieder in einem Vogelnest stocherte und mir die Eier nahm. Gelegentlich pflückte ich die Früchte der Palmen, die hier kleiner waren und dickere Stämme hatten als die in der Heimat, oder kostete die Beeren unbekannter Sträucher, anfangs immer nur eine, höchstens zwei. Erst dann wagte ich, größere Mengen zu essen.
Solche Sorgen kannte Señor Dorantes natürlich nicht. Weil er eigenes Geld in die Expedition eingebracht hatte, erhielten er und die anderen Investoren größere Essensrationen. Er saß bequem auf seinem Pferd Abejorro – einem grauen Andalusier mit klugen Augen, dunklen Beinen und guter Körperhaltung – und plauderte mit seinem jüngeren Bruder Diego, um die Langeweile zu vertreiben. Eigentlich war ihm jedoch die Gesellschaft von Señor Castillo lieber, und er trieb sein Pferd oft an, damit es wieder zu der weißen Stute seines Freundes aufschloss. Ich musste laut dem Befehl von Señor Dorantes immer einen Schritt hinter ihm gehen. Es genügte ihm nicht, dieses erstaunliche Land zu durchqueren und sich seinen Anteil am Reich des Goldes zu sichern – er benötigte obendrein einen Zeugen seiner Bestrebungen. Er sah sich im Mittelpunkt von etwas Großem und Neuem und brauchte ein Publikum, auch wenn es für ihn nicht mehr zu tun gab, als zu marschieren.
Nach etwa zwei Wochen gelangten wir eines schönen Morgens an einen breiten Fluss. Die Sonne färbte seine Oberfläche gleißend weiß, doch vom Ufer aus sah man, dass er sehr schnell floss und man im klaren Wasser die schwarzen Kiesel auf dem Grund zählen konnte. Als der Gouverneur verkündete, er werde dem Fluss wegen der vielen schwarzen Steine den Namen Río Oscuro geben, hörten die Männer kaum hin, sondern riefen agua, por fin, riefen gracias a dios und déjame passar, hombre!
Señor Dorantes stieg ab. Ich führte Abejorro ans Wasser und watete selbst hinein, um mir den grauen Schlamm von den Beinen und aus den Sandalen zu waschen. Ich dachte, wir würden nun eine Weile am Ufer rasten, doch der Gouverneur befahl seinen Zimmerleuten, sofort mit dem Bau von Flößen zu beginnen, auf denen die Nichtschwimmer – der Großteil der Männer – übergesetzt werden sollten. Obwohl die Tage jetzt, im Spätfrühling, länger waren, leuchtete die Sonne schon dunkelgelb, als die Flöße fertig waren und die erste Gruppe den Fluss überquerte.
Das andere Ufer war flach und kahl. Nur hier und da ragten Grasbüschel aus dem Boden. Doch schon ein Stück weiter zeigte sich erstes Grün, und die Wildnis setzte sich fort. Die Kiefern am Horizont wogten im kühlen Wind, der durch den groben Stoff meines Hemds drang, während ich Abejorro sattelte und ihm über den Hals strich. Die Offiziere und Soldaten, die als Erste über den Fluss gebracht worden waren, standen dicht beieinander. Der Gouverneur war in ein langes Gespräch mit dem Kommissar vertieft und hielt sein Gesicht dabei seitlich geneigt, als könnte er nur auf einem Ohr hören. Señor Dorantes zeigte Señor Castillo, wie man den Kürass so band, dass er nicht am Kinn scheuerte, und zwei andere Männer stritten sich um ein Paar Sporen.
Plötzlich traten Indianer hinter den Bäumen hervor und blieben schweigend im Gras stehen. Einige waren nackt, einige trugen mit blauen und roten Mustern bemalte Tierhäute über der Scham. Sie hatten zwar Waffen dabei – Speere, Bögen und Schleudern aus Tierknochen und im Feuer gehärtetem Holz –, bedrohten uns aber nicht. Insgesamt waren es ungefähr hundert. Eine Weile betrachtete jede Seite die andere mit der Neugier eines Kindes, das sich zum ersten Mal im Spiegel sieht. Dann saß der Gouverneur gemächlich auf, und die berittenen Offiziere taten es ihm gleich. Der Page zog die Fahnenstange aus dem Boden und reckte sie in die Höhe. Die Standarte des Gouverneurs flatterte im Wind.
Albaniz, rief der Gouverneur.
Señor Albaniz war nicht nur der offizielle Notar, dem die sichere Verwahrung aller Verträge und Gesuche oblag, sondern hatte auch die Aufgabe, in den nächsten Monaten den gesamten Verlauf der Expedition festzuhalten. Seine Anwesenheit bei dieser ersten Begegnung mit einem ganzen Indianervolk brachte die Erinnerung an meinen Vater zurück, dessen Traum es gewesen war, dass ich, genau wie er, Notar werden würde, Zeuge und Protokollant wichtiger Vorkommnisse im Leben anderer Menschen. Ich spürte, dass mich dieser väterliche Wunsch, den ich viele Jahre zuvor so unbedacht und sorglos zurückgewiesen hatte, nie loslassen würde und mir überall, selbst in diesem fremden Land, wieder und wieder in den Sinn käme. Vielleicht aber hat sich der Traum meines Vaters am Ende ja doch erfüllt, denn immerhin verfasse ich – aus ganz eigenen Gründen – diesen Bericht über die Narváez-Expedition.
Fordert die Wilden auf, mich nach Apalache zu bringen, sagte der Gouverneur, der es als unter seiner Würde empfand, die Indianer selbst anzusprechen.
Mit dem Ausdruck eines Dieners, dem eine beschwerliche Aufgabe anvertraut wurde, saß Señor Albaniz ab und trat vor. Dies, sagte er hinter sich deutend, ist Señor Pánfilo de Narváez, kraft der Zuwendung seiner Heiligen Königlichen Majestät neuer Gouverneur dieses Landes unter unseren Füßen. Es ist sein Wille, in das Reich Apalache zu ziehen, um mit dessen Oberhaupt über wichtige Dinge für unsere Länder zu sprechen, und er wünscht, dass ihr ihn dorthin bringt.
Ob die Indianer die Anordnung des Notars nicht verstanden hatten oder nicht befolgen wollten, ließ sich nicht erkennen. Jedenfalls blieben sie stumm. Ich versuchte, ihren Anführer auszumachen, hätte aber nicht sagen können, ob er der Mann mit dem Kopfschmuck aus Wildtierborsten oder der mit den meisten Tätowierungen war.
Bringt uns in das Reich Apalache, sagte Señor Albaniz, diesmal lauter, denn er legte dabei die Hände um den Mund, damit seine Stimme weiter trug. Einer der Indianer ging in die Hocke, um in aller Ruhe den Anblick des Mannes zu genießen, der in metallener Kleidung und mit einem Federhut auf dem Kopf vor ihm schrie und gestikulierte.
In das Reich Apalache!, brüllte Albaniz.
Mittlerweile hatten die Flöße das Wasser erneut überquert. Weitere Leute kamen an Land – Soldaten, Siedler, Diener und die Gefangenen. Schweigend gesellten sie sich zu uns. Nun überstieg unsere Zahl die der Indianer.
Hört auf, Albaniz, sagte der Gouverneur und befahl mit einem Blick hinter sich: Bringt die Gefangenen.
Die Order wurde weitergegeben, und kurz darauf führte ein Fußsoldat die Gefangenen vor. Weil ich stets bei meinem Herrn und somit an der Spitze der langen Kolonne gewesen war, hatte ich die Gefangenen seit unserem Aufbruch im Fischerdorf Portillo nicht mehr zu sehen bekommen. Nun trotteten sie heran, die Hände mit einem Strick gefesselt, dessen anderes Ende am Gürtel des Soldaten hing. Ihre Körper waren von den kreuzweise gelegten Peitschenhieben gezeichnet, und sie waren stark abgemagert, denn sie hatten die kleinsten Rationen erhalten. Einer hielt den Kopf auf eine Weise gesenkt, die mir erst unnatürlich erschien, bis ich anstelle seiner Nase ein Loch mit einem Rand aus verkrustetem Blut und Schleim bemerkte und begriff: Er konnte die Fliegen, die ihn erbarmungslos umschwirrten, wegen der Fessel nicht verscheuchen. Ich fühlte, dass ich etwas sah, was ich nie hätte sehen sollen, und wandte den Blick schnell von dem Grauen ab.
Nachdem die Gefangenen neben Señor Albaniz zum Stehen gekommen waren, richtete sich dieser direkt an einen von ihnen. Pablo, sagte er, erklär diesen Leuten, dass sie uns nach Apalache bringen sollen.
Der mit Pablo angesprochene Mann, ein junger Bursche, dem man das lange, glänzende Haar geschoren hatte und dessen Schultern mit Blasen bedeckt waren, sagte etwas in seiner Sprache. Schon nach den ersten Wörtern kam von den Indianern her ein Speer durch die Luft geflogen. Der Fußsoldat, der Pablo am Arm gepackt hielt, griff sich an die Kehle, wankte vornüber und stürzte zu Boden. Ein Pfeil hatte seinen Hals durchschossen, die Spitze ragte am Nacken heraus. Der Soldat riss den Mund auf, doch nur das Gurgeln des Bluts darin war zu hören. Sofort brachen die Indianer in lautes Geheul aus, das mich vor Angst beinahe lähmte.
Mein Gott, sagte Señor Albaniz, drehte den Kopf und sah sich nach seinem Pferd um.
Ándale!, rief der Gouverneur.
Señor Dorantes trieb sein Pferd an. Abejorros Schweif strich mir über die Brust, als ich mich umwandte und nach Deckung suchte. Doch es gab kein Versteck. Ich wollte zum Fluss zurücklaufen, aber die Menge der vorwärtsdrängenden Kastilier schob sich so kraftvoll gegen mich, dass ich in die Knie ging. Über mir explodierte die Luft vom Lärm der Musketen. Ein Soldat neben mir, ein Junge von fünfzehn, sechzehn Jahren, hob seine Waffe und feuerte, traf jedoch einen Kameraden. Hinter mir näherten sich die indianischen Krieger, deren unverständliche Schreie keiner Übersetzung mehr bedurften.
Irgendwie gelangte ich vor einen Haufen Marschgepäck – Kisten mit Zimmermannswerkzeug – und duckte mich dahinter. Hier bin ich sicher, sagte ich mir. Gleich darauf hörte ich jemanden ächzen und sah hinter einem Gestrüpp zu meiner Linken einen Siedler im Kampf mit einem Indianer. Der Siedler hatte eine Maurerkelle ergriffen und versuchte, den Indianer damit zu treffen, verfehlte ihn aber. Der Indianer verfolgte sein Ziel unbeirrt, holte mit seinem Kriegsbeil aus und trennte den Arm seines Gegners mit einem einzigen Hieb am Ellbogen ab. Ein weiterer Hieb, der diesmal dem Kopf galt, brachte den Siedler zu Boden. Seine Augen waren noch immer geöffnet.
Der Indianer drehte sich um und hielt Ausschau nach dem nächsten Gegner. Ich presste meinen Rücken an eine der Kisten. Als er mich entdeckte, war er erstaunt – ein schwarzer unter lauter weißen Männern. Die Farbe meiner Haut, die sich so sehr von der der anderen unterschied, ließ ihn innehalten. Außerdem hatte ich wie erwähnt keine Waffe. Unschlüssig, ob er mich töten oder davonkommen lassen sollte, entschied er sich letztendlich für das Erste und ging mit erhobenem Beil auf mich los. Noch bevor er zuhauen konnte, rollte ich mich zur Seite, und er fiel auf meine Hüfte. Sein langes Haar hing in meine Augen, ich konnte nichts mehr sehen. Aber ich roch ihn – seinen Schweiß, seine atemlose Wut, den um die Lenden gebundenen Gürtel aus Schlangenhaut. Als wir auf dem Boden miteinander rangen, drückte ich ihm meinen Handballen gegen den Kiefer, rutschte jedoch an der bartlosen Haut ab. Er schlug mich, und obwohl ich zurückschlug, gelang es ihm auf die Beine zu kommen und erneut mit dem Beil auszuholen. Ich glaubte mein letztes Stündlein gekommen, da sandte Gott eine verirrte Musketenkugel und brachte ihn damit zu Fall. Im Sturz streifte er mich mit seinem Beil, das mir, wenn auch nicht tief, ins Bein schnitt. Ich schrie auf. Was ich rief, weiß ich nicht mehr – wahrscheinlich gar nichts. Es war wohl ein Schrei der Erleichterung, denn ich hatte dem Angriff standgehalten. Ich packte die Waffe am Griff, beschwichtigte meine Angst und beschloss, mich zu verteidigen.
Ich erhob mich auf die Knie und spähte über die Kisten hinweg auf das Schlachtfeld. Soldaten in Rüstung schossen mit Armbrüsten und Musketen, die Indianer wehrten sich mit Speeren und Pfeilen. Hier und da hatten die Indianer unserer Seite bereits schlimmen Schaden zugefügt – ein Kastilier mit rostigem Helm saß schwankend auf seinem Pferd und umschloss mit beiden Händen den Speer, der in seinen Schenkel eingedrungen war; einen anderen hatte ein Stein aus einer Schleuder niedergestreckt. Doch die meisten Verwundungen erlitten die Indianer. Einer – ich sehe ihn noch vor mir – versuchte mit beiden Armen, die Gedärme zurückzuhalten, die aus seinem Bauch quollen. Ein anderer schrie, während ein Soldat rittlings auf ihm saß und seinen Körper mit dem Streitkolben zerschmetterte.
Obwohl ich kein Krieger war und nichts vom Kämpfen verstand, erkannte ich, wie ungleich die Schlacht war und dass die Indianer unmöglich gewinnen konnten. Ich suchte die staubige Wiese nach meinem Herrn ab, dem Mann, mit dem mein irdisches Schicksal verknüpft war. Wo war er? Plötzlich sah ich ihn hinter der Linie der Armbrustschützen auf seinem Pferd mit dem Schwert auf die Schulter eines Indianers eindreschen, dass das Blut spritzte. Der Mann fiel auf die Knie und wurde von Abejorro zertrampelt, als Señor Dorantes das Tier zum nächsten Indianer trieb. Auch die anderen Reiter griffen inzwischen zu dieser Methode und walzten alle Indianer vor ihnen in wildem Ansturm nieder.
Ein Horn erklang, und die Indianer zogen sich zurück. Da die Sonne mittlerweile untergegangen war, konnte ich die Gesichter der Gefallenen kaum erkennen. Bei meinem Gang über das Schlachtfeld leiteten mich die Laute der auf die Indianer einschlagenden Soldaten und der Geruch von Staub und Rauch mehr als meine Augen. O Gott, dachte ich, was mache ich in diesem seltsamen Land in einer Schlacht zwischen zwei fremden Völkern? Wie konnte es so weit kommen? Auch als Fackeln entzündet und Namen gerufen wurden, stand ich noch dort, reglos und wie betäubt. Siedler und Mönche wagten sich aus der Deckung, hinter Kisten, Bäumen und sogar hinter Leichen hervor. In unserem Rücken toste der Río Oscuro auf seinem steten Weg zum Ozean.
2
Die Geschichte meiner Geburt
Meine Mutter sagte einmal, ich sei für ein Leben auf Reisen bestimmt, und nannte als Beweis die Vorzeichen am Tag meiner Geburt. Mein Vater, ein frisch zugelassener Notar und ebenso ehrgeizig wie jung, sah damals keine Möglichkeit, in Fès ordentlich Geld zu verdienen. Die Stadt war nämlich voller aus Andalusien Geflohener, Muslime und Juden, die vor der erzwungenen Konversion geflüchtet waren, und unter den Exilanten befanden sich viele berühmte Rechtsgelehrte und erfahrene Notare. Als mein Vater schließlich erfuhr, dass Melilla, das einen knappen Dreitagesritt entfernt lag, der kastilischen Krone zugefallen war, kam ihm sofort der Gedanke, dass nun noch mehr Flüchtlinge in die Stadt kämen und es noch weniger Arbeit geben würde. So beschloss er, mit meiner Mutter in seine südlich gelegene Geburtsstadt Azemmur zu ziehen. Dort wohnten seine Brüder, die er ohne sich schämen zu müssen um Hilfe bitten konnte, falls er jemals Hilfe bräuchte.
»Die Geschichte meiner Geburt« begann jedoch lange bevor ich in diese Welt purzelte. Sie begann, als ein Reich im Niedergang begriffen war und ein anderes aufstieg. Sie begann wie tausend andere Geschichten in Fès. Meine Mutter Heniya war das jüngste von neun Kindern, das einzige Mädchen und der Liebling meines Großvaters. Als sie fünfzehn wurde, erlaubte er ihr, einen reichen Teppichhändler zu heiraten, der, so dachte er, gut für sie sorgen würde. Doch nur drei Monate nach der Hochzeit starb der Händler bei einem Streit mit zwei mekhazniya des Sultans. Der zweite Mann meiner Mutter, ein kluger alter Schneider, starb wiederum kaum ein Jahr nach der Hochzeit an hohem Fieber. Natürlich waren Unglücksfälle und Krankheiten Teil des Lebens, doch Heniya hatten sie schon in jungem Alter härter getroffen als andere. Die Leute begannen über die glücklose Braut zu reden, die mit siebzehn schon zweimal verwitwet war. Und die in der Stadt kursierenden Gerüchte wurden, wie es jede gute Geschichte verdient, immer weiter ausgeschmückt: Meine Mutter sei zwar ein junges Mädchen von einzigartiger Schönheit, beispielloser Tugend und ungewöhnlicher Begabung, spiele die Laute und rezitiere Gedichte, aber wie sehr doch in ihren Ehen vom Pech verfolgt! Als mein Großvater von der Geschichte hörte, glaubte er sie sofort, obwohl meine Mutter eher unscheinbar und nicht im Geringsten musikalisch war. Er hatte bereits die Hoffnung verloren; nun sah er einen einfachen Weg, dem Fluch zu entrinnen. Statt eines alten, wohlhabenden Ehemannes brauchte seine Tochter einen jungen, gesunden. Mein Großvater war von Beruf Kerzenmacher, ein beliebter Mann, zu dessen Kundschaft das Hospiz el-Maristan, die Madrasat el-Attarin und der Hammam as-Seffarin zählten. Als er eines Morgens eine Lieferung Kerzen in die Universität al-Qarawiyin brachte, erblickte er Muhammad, meinen Vater, der in der Eingangshalle an einem Pfeiler lehnte.
Mein Vater hatte sich nur angelehnt, weil ihm der Rücken wehtat, doch im Halbdunkel des frühen Morgens wirkte er wie ein nachdenklicher, ernster Student. Mein Großvater ließ den Bronzeleuchter herunter, setzte die neuen Kerzen ein und begann dabei eine Unterhaltung mit dem jungen Mann. So erfuhr er, dass mein Vater die Scharia studierte, später einmal Notar werden wollte, und – das war das Interessanteste – in einem Gästehaus wohnte. Das alles deutete mein Großvater als ausnehmend günstig: Muhammad war ehrgeizig, würde bald ein eigenes Auskommen haben und sicherlich bereitwillig bei der Familie seiner Ehefrau leben, da er in Fès keine Verwandtschaft hatte. Mein Großvater kam zu dem Schluss, dass Muhammad die perfekte Partie für seine Tochter war.
Mein Vater war zwar wirklich groß und gut gebaut, doch sein Äußeres verbarg seine wahre Natur. Als Kind hatte er die Masern nur knapp überlebt und sich danach jede Krankheit geholt, die in Azemmur wütete. Schwamm er im Fluss Oum er-Rbia, erkältete er sich, auch im Sommer. Lief er mit seinen Freunden durch die Gassen der Medina, fiel er garantiert hin und verstauchte sich den Knöchel. Ging er barfuß herum, traf sein großer Zeh unweigerlich auf einen Nagel, der zufällig dalag. Er stammte zwar aus einer Zimmermannsfamilie, doch sein Vater hatte früh erkannt, dass es sinnlos wäre, ihn anzulernen wie seine anderen Kinder. So war Muhammad in der Schule und danach an der Qarawiyin gelandet. Das Studieren war die einzige Tätigkeit, bei der er weder krank wurde noch sich verletzte.
Als sich mein Vater und Heniyas Vater zum ersten Mal begegneten, sah jeder im anderen etwas Wünschenswertes. Muhammad hatte bereits von Heniyas legendärer Schönheit und ihren zahlreichen Talenten gehört und wollte seine Neugier unbedingt stillen. Mein Großvater wiederum glaubte, dass der hübsche junge Mann den Fluch seiner glücklosen Tochter endlich brechen könnte. Es folgten eine Einladung zum Tee, ein kurzer Blick hinter den Vorhang, und wenig später waren meine Eltern verheiratet. Nachdem sich mein Vater von dem Schreck der Erkenntnis erholt hatte, dass meine Mutter nicht Scheherezade war, wollte er das Beste daraus machen. Er schloss sein Studium ab, ging auf die von Erkältungen, Fieberanfällen und Erschöpfungszuständen unterbrochene Suche nach Arbeit und stellte fest, dass überall schon Leute aus Granada saßen. Sie waren nicht nur geschult und erfahren, sondern hatten auch etwas Exotisches an sich, das meinem Vater vollkommen fehlte. Als Melilla an die kastilische Krone fiel, kehrte er gemeinsam mit meiner Mutter, die mich unter dem Herzen trug, nach Azemmur zurück. Bei seinen Schwiegereltern, die sich nebenbei gesagt ihrerseits gerade von dem Schreck erholten, dass mein Vater kein Antara auf dem edlen Ross war, rief das große Bestürzung hervor.
Auf dem langen Weg nach Azemmur, den mein Vater zu Fuß zurücklegte und meine Mutter auf dem schwarzen, mit Tragekörben beladenen Esel, der ihr zur Hochzeit geschenkt worden war, hatten sie das Gefühl, von einem Ende des Landes ins andere gejagt zu werden, denn ihnen folgten ständig dunkle Wolken. Der Herbst hatte in jenem Jahr früh begonnen. Es war ungewohnt kühl, und weil es häufig regnete, kamen sie nur langsam voran. Erst nach zwei Tagen erreichten sie am frühen Abend die Mündung des Oum er-Rbia. Azemmurs elf Minarette am anderen Ufer müssen ihnen wie elf herzlich grüßende Gastgeber erschienen sein. Sie hatten es bestimmt eilig, ins Haus meines Onkels zu kommen, heiße Suppe zu essen und sich an der Feuerstelle zu wärmen. Doch erst einmal setzten sie sich unter einen Feigenbaum und warteten auf die Fähre. Als sich meine Mutter plötzlich unwohl fühlte, sagte sie meinem Vater nichts, denn die Geburt stand ihrer Berechnung nach zwei Monate später an.
Die Fahrt über den Fluss dauert normalerweise nicht lange, doch an jenem Tag begann es schon zu dämmern, als mein Vater und die anderen Reisenden den Preis ausgehandelt und ihre Habe auf die Fähre geschafft hatten. Kurz vor der Abfahrt erschienen zwei portugiesische Reiter, die eine Gefangene hinter sich herzogen. Die Stadt Azemmur war schon seit Jahren ein Vasall Manuels des Glücklichen, und die von den portugiesischen Steuern geknechteten Passagiere hielten den Anblick der beiden Krieger kaum aus. Noch unerträglicher wurde es, als sich erwies, dass die Gefangene eine von ihnen war, eine junge Frau, der man den Schleier entrissen und die Hände mit Ketten gefesselt hatte. Gesicht und Arme waren von roten, mit Blasen bedeckten Striemen gezeichnet.
Die beiden Soldaten waren groß, und ihre Rüstung und die Helme wirkten schwer, womöglich zu schwer für die Überfahrt. Denn die Fähre war klein – die zwischen zwei Feluken gespannte hölzerne Plattform, die von einem zum anderen Ufer gezogen wurde, bot nur etwa zwölf Menschen Platz –, und schnell wurde klar, dass eins der Tiere von Bord gehen musste, wenn die Soldaten mit ihren Pferden mitfahren wollten. Der Fährmann bat die beiden zu warten, bis er zurückkäme, doch sie weigerten sich.