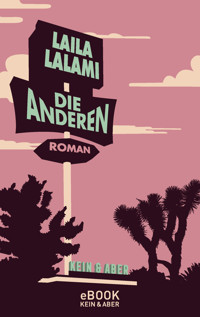
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ihr Vater eines Nachts vor seinem Diner in der kalifornischen Wüste angefahren und getötet wird, glaubt Nora nicht an einen Unfall. Gemeinsam mit Jeremy, einem alten Schulfreund, stellt sie Nachforschungen an und stößt dabei auf Dinge, die ihren Vater in komplett neuem Licht zeigen. Was hatte er zu verbergen? Und was hat das mit seinem Tod zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Laila Lalami wurde in Rabat geboren und hat in Marokko, Großbritannien und den Vereinigten Staaten studiert. Sie ist Pulitzer-Preis-Finalistin und Autorin von vier Romanen und zahlreichen Essays, die u. a. im Guardian und der New York Times erschienen sind. Die Anderen stand auf der Shortlist des National Book Award. Laila Lalami ist Professorin für kreatives Schreiben an der University of California und lebt in Los Angeles.
ÜBER DAS BUCH
Als ihr Vater eines Nachts vor seinem Diner in der kalifornischen Wüste angefahren und getötet wird, glaubt Nora nicht an einen Unfall. Gemeinsam mit Jeremy, einem alten Schulfreund, stellt sie Nachforschungen an und stößt dabei auf Dinge, die ihren Vater in komplett neuem Licht zeigen. Was hatte er zu verbergen? Und was hat das mit seinem Tod zu tun?
Für A. und S.
Nora
Mein Vater wurde in einer Frühlingsnacht vor vier Jahren getötet, während ich in der Ecknische eines kurz zuvor eröffneten Bistros in Oakland saß. Wann immer ich an jenen Augenblick denke, sehe ich diese beiden miteinander völlig unvereinbaren Bilder vor mir: mein Vater nach Luft ringend auf dem rissigen Asphalt und ich beim Champagnertrinken mit meiner Mitbewohnerin Margo. Wir feierten, weil die Jerome Foundation Margo ein Stipendium gewährt hatte, damit sie ein neues Kammermusikstück komponieren konnte. Es war für sie bereits die zweite große finanzielle Zuwendung in diesem Jahr. Wir hatten Miesmuscheln bestellt, teilten uns ein Hauptgericht und ließen es ziemlich spät werden. Als der Kellner uns zu einer Mousse au Chocolat als Dessert zu überreden versuchte, klingelte mein Handy.
An alles Folgende habe ich keine deutliche Erinnerung. Offenbar teilte ich Margo die Nachricht mit. Offenbar zahlten wir, zogen unsere Mäntel an und legten die fünf Häuserblocks zwischen dem Bistro und unserer Wohnung zu Fuß zurück. Irgendwie muss ich es geschafft haben, eine Reisetasche zu packen. Die Fahrt nach Hause auf dem Freeway 5 und das neblige Dunkel, das die Mandel- und Orangenplantagen verhüllte, sind mir dagegen ebenso klar in Erinnerung geblieben wie die ständig wechselnden Erklärungen, die ich mir auf dieser Fahrt zusammenträumte: Vielleicht hatte die Polizei die Leiche falsch identifiziert oder das Krankenhaus die Patientenakte meines Vaters mit einer anderen verwechselt. Obwohl das weit hergeholt war, klammerte ich mich daran. Trotz des Scheinwerferlichts konnte ich nicht mehr als sechs Meter weit sehen, doch im Morgengrauen lichtete sich der Nebel, und als ich die Mojave erreichte, war die Sonne aufgegangen und der Himmel strahlend blau.
Beim Betreten meines Elternhauses war nur das Klappern meiner Absätze auf dem Travertinboden zu hören. Auf dem Tischchen beim Eingang lagen ein Reader’s Digest, ein gelbes Kunststoffarmband, an dem mehrere Schlüssel hingen, und eine Sonnenbrille, der ein Glas fehlte. Eine der gerahmten Fotografien an der Dielenwand hing schief. Meine Mutter saß auf dem Wohnzimmersofa und starrte das schnurlose Telefon in ihrer Hand an, als hätte sie verlernt, es zu bedienen. Ich rief »Mom?«, aber sie blickte nicht auf. Als könnte sie mich nicht hören. Sie trug noch das weiße T-Shirt und den schwarzen Gi vom Karatetraining am Abend zuvor. Auf dem Polsterhocker lag ihre achtlos hingeworfene Trainingsjacke. Der Drache am Rückenteil leuchtete knallrot.
Damals kam es mir vor, als lebte mein Vater noch – wegen der halb leeren Marlboro-Packung auf dem Fensterbrett, der abgenutzten Pantoffeln unter dem Couchtisch und der Nagespuren am Kugelschreiber, der aus dem Kreuzworträtselbuch herauslugte. Jeden Moment würde er, nach Kaffee und Hamburgern riechend, hereinkommen und sagen: Du glaubst gar nicht, was mir ein Gast heute erzählt hat! Dann würde er mich neben dem Sessel stehen sehen und rufen: Nora! Seit wann bist du da? Seine Augen würden vor Freude strahlen, seine Bartstoppeln würden mich kitzeln, wenn er mich auf beide Wangen küsste, und ich würde erwidern: Gerade erst angekommen.
Doch niemand erschien in der Tür, und der Schmerz fuhr mir wie eine Faust in den Magen. »Ich verstehe das nicht«, sagte ich und meinte damit, dass ich es nicht fassen konnte. Fassungslosigkeit war das einzige konstante Gefühl gewesen, seit ich die Nachricht erhalten hatte. »Ich habe doch gestern noch mit ihm telefoniert.«
Endlich regte sich meine Mutter und wandte mir ihr Gesicht zu. Ihre Augen waren rot gerändert, ihre Lippen rissig. »Du hast mit ihm telefoniert?«, fragte sie überrascht. »Was hat er gesagt?«
In der Diele klapperte die Abdeckung am Briefschlitz, und mit dumpfem Knall landete die Post auf dem Boden. Die Katze in ihrem Weidenkorb hob kurz den Kopf; dann schlief sie weiter.
»Was hat er gesagt?«, fragte meine Mutter noch einmal.
»Nichts. Er wollte nur ein bisschen plaudern, aber ich musste in den Unterricht zurück und wollte mir vorher noch einen Kaffee holen. Ich habe ihm gesagt, dass ich zurückrufe.« Meine Hand flog an meinen Mund. Ich hatte die Chance verpasst, noch ein Mal mit ihm zu reden, noch ein Mal seine fürsorgliche Stimme zu hören – nur wegen eines bitteren Kaffees im Pappbecher, hastig hinuntergestürzt, bevor ich wieder vor eine Prepschool-Klasse treten musste, die sich gelangweilt durch die Odyssee quälte.
Auf der Straße raste ein Motorrad vorbei und brachte die Fensterscheiben zum Zittern. Nervös öffnete ich den Verschluss meiner Armbanduhr und ließ ihn wieder einrasten. Die düstere Stille kehrte zurück. »Was hat Dad denn so spät im Restaurant gemacht?«, fragte ich. »Normalerweise schließt doch Marty ab.«
»Er wollte noch die neuen Glühbirnen eindrehen. Marty durfte nach Hause gehen.«
Und dann? Dann musste er abgeschlossen haben und losgegangen sein. Vielleicht hatte er mit seinen Schlüsseln gespielt, so wie immer, wenn er in Gedanken versunken war. Oder eine Textnachricht auf dem Handy hatte ihn abgelenkt. Das Auto, das ihn über den Haufen fuhr, hatte er jedenfalls erst bemerkt, als es zu spät war. Hatte er gelitten? Hatte er um Hilfe gerufen? Wie lange hatte er auf dem Asphalt gelegen, bis sein Atem schwächer wurde? Plötzlich fiel mir die Party bei unseren Nachbarn ein, als ich vier war. Sie hatten ihren Garten umgestaltet und prahlten vor meinen Eltern mit der neuen Grillstelle und der neuen Sitzlandschaft. Meine Schwester hatte keine Lust, sich mit mir abzugeben, sie wollte lieber mit den älteren Kindern spielen. Ich jagte zwei Libellen hinterher, und als ich eine mit der Hand zu fangen versuchte, fiel ich in den Pool. Das Wasser war eiskalt und schmeckte nach Mandeln. Es zog mich mit solcher Kraft nach unten, dass ich meinen letzten Atemzug kommen sah. Es dauerte nur eine Sekunde, bis mir mein Vater nachsprang, doch in dieser einen Sekunde erstarrten meine Arme und Beine, meine Brust brannte, und mein Herz blieb fast stehen. Diesen Schmerz empfand ich jetzt wieder. »Irgendwas stimmt da nicht«, sagte ich nach einer Weile. »Da geht Dad ein einziges Mal als Letzter und wird überfahren und getötet?«
Ich bemerkte zu spät, dass ich etwas Falsches gesagt hatte. Meine Mutter begann zu weinen. Das heftige, haltlose Schluchzen trieb ihr das Blut ins Gesicht und ließ ihre Schultern beben. Ich ging durchs Wohnzimmer, räumte den eingerollten Gebetsteppich aus dem Weg, setzte mich zu ihr und hielt sie so fest, dass ich ihre Zuckungen spürte. Alles an der Situation fühlte sich falsch an – dass ich an einem Werktag im Frühling in diesem Haus war, dass ich meine Schuhe anbehalten hatte, sogar dass ich meine weinende Mutter tröstete. Bei uns war mein Vater der Tröster. Immer wenn mir etwas zugestoßen war, ging ich als Erstes zu ihm – ob als Achtjährige mit meinen aufgeschürften Knien oder, wie erst im Monat zuvor, weil ich wieder einmal einen Kompositionswettbewerb verloren hatte.
Meine Mutter schnäuzte sich mit einem zerknitterten Taschentuch. »Als ich von deiner Schwester zurückgekommen bin, war mir schon klar, dass etwas nicht stimmt. Ich habe ihr Karate-Aufnäher für die Kinder gebracht, und sie hat mich gefragt, ob ich zum Abendessen bleibe. Danach kam ich nach Hause, und er war nicht da.«
Auf dem Sessel, in dem mein Vater immer saß, war noch der Abdruck seines Körpers zu sehen. Als wäre er nur kurz ins Nebenzimmer gegangen.
»Was hat die Polizei gesagt?«, fragte ich. »Gibt es irgendwelche Hinweise?«
»Nein. Die Frau von der Polizei hat mir nur eine Menge Fragen gestellt. Ob er Geldprobleme hatte, ob er Drogen genommen, gespielt oder Feinde gehabt hat. Solche Sachen. Ich habe Nein gesagt.«
Die Fragen verwunderten mich, weil sie so anders waren als das, was mir durch den Kopf ging: Wer hatte am Steuer des Wagens gesessen, wie war mein Vater angefahren worden und warum die Fahrerflucht? Ich blickte aus dem Fenster und sah, wie sich zwei Amseln nacheinander auf die Stromleitung setzten. Der Nachbar von gegenüber ließ die Luft aus dem riesigen Osterhasen, der wochenlang in seinem Vorgarten gestanden und Dreck angesetzt hatte. Während unter den Schuhen des Mannes die weißen Löffel in sich zusammenfielen, starrte mich das Tier mit grotesk verzerrten Augen an. Der Wind peitschte die Fahne am Mast, und die Sonne brannte gnadenlos.
Jeremy
Ich hatte damals Schlafprobleme und ging immer schon um fünf Uhr morgens ins Fitnesscenter, gleich wenn es öffnete. Meine Ärztin meinte, regelmäßige Bewegung würde helfen, aber auch heiße Bäder, lichtundurchlässige Vorhänge, Lesen, Kamillentee. Also nahm ich ausgiebige Bäder, las vor dem Schlafengehen und schüttete Kamillentee in mich hinein. Trotzdem lag ich meistens wach und lauschte dem in der Stille tickenden Wecker. Wenn du jetzt einschläfst, sagte ich mir, bekommst du immerhin noch vier Stunden Schlaf oder drei oder zwei. Als könnte man sich mit Vernunft zum Einschlafen bringen. Kurz vor fünf stand ich dann immer auf und fuhr zu Desert Fitness.
An jenem Morgen hatte ich bereits das Cardio-Training hinter mir und machte gerade meine Crunches, als Fierro reinkam. Weil im Studio kaum etwas los war, freute ich mich über ein bisschen Gesellschaft, obwohl Fierro kein anderes Thema kannte als seine Ex. Mary und er hatten sich kurz zuvor getrennt, was er allerdings nicht recht wahrhaben wollte. Weil er so viel laberte, verzählte ich mich und musste zwei Mal abbrechen und neu anfangen, bevor ich mir sicher war, meine Trainingseinheit vollständig absolviert zu haben. Fünfzig Standard, fünfzig Reverse, fünfzig Double und fünfzig Bicycle Crunches. Obwohl mein Dienst erst in zwanzig Minuten begann, ließ ich die Bizeps Curls vorsichtshalber aus und ging gleich zum Bankdrücken über. Beim Gewichtstemmen vertrage ich keine Hektik. Nachdem ich hundert Kilo aufgepackt und mich hingelegt hatte, kam Fierro und legte, ohne mich zu fragen, noch mal zwei Fünf-Kilo-Scheiben drauf.
»Was soll das?«, fragte ich.
»Alter, wenn du’s nicht ordentlich machst, brauchst du’s überhaupt nicht zu machen.« Er stellte sich hinter die Bank, um mich gut im Blick zu haben. Lauerte geradezu. Er trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck One Shot, One Kill. Die Ärmel hochgeschoben, damit man seine Muskeln gut sah.
»Und ordentlich heißt, so wie du es machst, ja?«
Er neigte mir sein linkes Ohr zu, das gute. »Was?«
»Vergiss es.« Entweder stritt ich mich jetzt mit Fierro, oder ich fing mit den Gewichten an und kam pünktlich zur Arbeit.
»Gestern Abend hab ich rausgefunden, dass Mary die Zündkerzen im Mustang nicht gewechselt hat, obwohl ich es ihr mindestens drei Mal gesagt hab. Die ruiniert mir noch den Wagen. Alter, wenn du nicht mehr kannst, leg ’ne Pause ein.«
Ich pumpte weiter, obwohl mir der Schweiß auf der Stirn stand. Die Genugtuung wollte ich Fierro nicht geben. Seit unserer gemeinsamen Zeit bei den Marines konkurrierten wir miteinander. Als eine Blondine im schwarzen Gymnastikanzug reinkam, verfolgte Fierro sie reflexartig mit den Augen, bis sie in der Umkleide verschwunden war, und sog laut die Luft ein. »Ich hab Mary gesagt, dass ich die Scheidungspapiere erst unterschreibe, wenn sie mir die Schlüssel gibt.« Es klang, als wäre er stolz darauf, dass er sich endlich gegen sie wehrte.
»Aber es ist doch ihr Wagen«, erwiderte ich. Nach unserer Rückkehr aus dem Irak war ich ein paarmal in dem Mustang mitgefahren. Ich hatte immer hinten gesessen und Whiskey aus dem Flachmann getrunken, während Mary uns in irgendeine Bar oder einen Klub brachte, in den wir wollten. Wenn sie abbog oder die Spur wechselte, geriet der kleine versilberte Engel am Rückspiegel ins Schwingen. Als sie einmal von einem Junggesellinnenabschied in Vegas erzählte, an dem sie mit Kolleginnen von der Arbeit teilgenommen hatte, unterbrach Fierro sie und behauptete, sie hätte ihm davon nie was gesagt. Das war eine ihrer ersten Auseinandersetzungen gewesen, und dann stritten sie einfach weiter, sogar heute noch, nach der Trennung.
»Ihr Wagen? Und wer hat die Anzahlung gemacht? Wer hat die mickrigen Radkappen gegen Chromfelgen ausgetauscht? Wer hat erst diesen Sommer Redline-Reifen aufgezogen?« Er deutete mit dem Daumen, der nach einem Bruch vor vielen Jahren ziemlich schief war, auf seine Brust. »Ich. Ich.« Dann hielt er beide Hände über die Hantelstange. »Mach ’ne Pause, Gorecki.«
»Brauch ich nicht.« Für eine Pause blieb keine Zeit. Verspätetes Erscheinen bei der Arbeit hätte mir einen Anschiss von Vasco eingebracht, der in letzter Zeit nur darauf wartete, dass ich einen Fehler beging. Dann konnte er sagen, er müsste noch mal einen Blick auf den Dienstplan werfen und warum ich nicht eine andere Schicht übernähme. Keine Ahnung, warum mich der Kerl so hasste. Schweigend machte ich die letzten Wiederholungen. Dann setzte ich mich auf und verschnaufte. Mein Hemd war völlig durchgeschwitzt und klebte an der Brust.
»Du hast mir doch erzählt, dass sie einen Neuen hat«, sagte ich.
»Was? Mann, warum muss die Musik hier drin immer so laut sein?«
»Du hast mir erzählt, dass Mary einen Neuen hat.«
»Ja, stimmt.«
»Dann kommt sie nicht zurück. Unterschreib endlich die verdammten Scheidungspapiere.«
»Fuck, ich denk nicht mal dran. Sie glaubt, sie kann lustig weitermachen und die Vergangenheit ausradieren, als wär nie was gewesen. Als wär ich nie gewesen. Aber da irrt sie sich.« Er packte noch mal zehn Kilo auf jede Seite, legte sich hin und führte in gleichmäßigem Rhythmus und ruhig atmend seine Reps aus.
Ich wischte mir mit dem Handtuch übers Gesicht und sah ihm eine Weile zu. Seit der Trennung von Mary verbrachte er wesentlich mehr Zeit im Gym als davor. Manchmal trainierte er sogar zwei Mal täglich. »Übrigens, meine Schwester macht eine Grillparty«, sagte ich. »Kommst du mit?«
»Klar, wenn das für sie okay ist.«
»Natürlich ist das okay. Allein habe ich keine Lust. Du würdest mir einen Gefallen tun.«
»Gut. Wann?«
»Übermorgen.«
Zehn Minuten später ratterte mein Jeep durch die Morgenstille. Die aufgehende Sonne färbte den Himmel rostrot, und auf dem Highway 62 ließ ich das Fenster runter, um den letzten Rest kalte Morgenluft zu spüren. Wie aufblitzende Augen gingen die Lichter der Diners und Coffee Shops an. In der Dienststelle wechselte ich in meine Uniform und eilte zum Besprechungsraum, nur um festzustellen, dass ich der Letzte war und der Sergeant mit dem Briefing bereits begonnen hatte. Ich setzte mich und vermied jeden Blickkontakt mit Vasco, während er mit monotoner Stimme die restlichen Berichte der vergangenen Nacht herunterleierte.
»Messerangriff in der Shadow Morning Road 5500. Der Tatverdächtige war wütend, weil seine Mutter zu einem Mann ziehen wollte, den sie erst seit Kurzem kennt, zog das Messer und versetzte dem Freund der Mutter drei Stiche in den Arm. Hundeangriff in der Bermuda Avenue 3200. Der Besitzer ließ seinen Pitbull trotz wiederholter Ermahnungen unangeleint im Garten herumlaufen, das Tier sprang über den Zaun und attackierte das Nachbarskind. Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Höhe der Kreuzung 8300 Chemehuevi und Highway 62. Über den Wagen ist bisher nichts bekannt. Nächtliche Schmierereien an der Highschool, schon zum zweiten Mal in dieser Woche. So, das wärs.« Während er die Unterlagen in einem Ordner verstaute, wanderte sein Blick über die anwesenden Deputys. »Noch was. Die Bowden-Sache wird im Netz rauf und runter diskutiert. Da sehen die Leute ein zehnsekündiges Handyvideo und glauben, sie wüssten genau, was passiert ist. Darauf achtet ihr gar nicht. Wir sind nicht dazu da, uns von irgendwelchen Onlinekommentaren beeinflussen zu lassen. Konzentriert euch auf euren Job.«
Vasco hatte es offenbar eilig, denn er verließ den Besprechungsraum, ohne mein verspätetes Erscheinen zu kommentieren. Muss ein Glückstag sein, dachte ich. In meiner Schicht war dann auch wenig los. Eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung, eine Überprüfung eines geparkten Fahrzeugs, ein vorzeitig beendeter Notruf, der sich als Versehen entpuppte, und Marci Jamison, die einen weiteren Versuch startete, ihr Ativan und Percocet als gestohlen zu melden, um an ein neues Rezept zu kommen. Als ich abends meine Uniform auszog, ging ich in Gedanken alles durch, was noch zu erledigen war. Ich musste einiges für Ethnologie lesen, einen historischen Aufsatz für die Abschlussprüfung durcharbeiten und meine Englisch-Seminararbeit per E-Mail abgeben. Auf dem Weg zum Ausgang kam ich am Whiteboard mit den laufenden Fällen vorbei. Ein Name auf der Tafel ließ mich abrupt stehen bleiben. Guerraoui.
Efraín
Ich habe gesehen, wie es passiert ist. Ziemlich dumm, denn das hat mir nur Probleme bereitet. Und noch dümmer, dass ich es Marisela erzählt habe. Ich war in dieser Nacht mit dem Rad auf dem Highway 62 unterwegs und fuhr von der Arbeit nach Hause, als mir plötzlich die Kette raussprang. In Arizona hatten wir noch ein Auto, einen Toyota Corolla, für achthundertfünfundsiebzig Dollar einem Platzanweiser von unserer Kirche abgekauft, aber der ging kaputt, kurz nachdem wir hierhergezogen waren, und wir hatten kein Geld für die Reparatur oder gar für einen neuen. Da waren mal eben so achthundertfünfundsiebzig Dollar weg. Manchmal beschwert sich Marisela, es würde uns immer schlechter gehen, obwohl die Leute doch in dieses Land kommen, damit sie es besser haben. Ich tue mein Möglichstes, sage ich dann, mehr geht nicht. Dass wir besser dran wären, wenn wir nicht ihre beiden Schwestern in Torreón unterstützen müssten, sage ich nicht. Und das Fahrrad ist gar nicht so schlecht – ich habe es kostenlos von Enrique gekriegt und komme damit so gut wie überallhin. Nur die Kette ist ein Problem.
Folgendes geschah in jener Nacht: Ich musste anhalten, weil die Kette rausgesprungen war. Ich schob das Rad auf den Gehweg gleich bei der Kreuzung Chemehuevi Way und Highway 62, und stellte es auf den Sattel. Eine Kette aufziehen ist zwar kinderleicht, aber es war dunkel; außerdem bin ich weitsichtig und konnte kaum etwas sehen. Weil ich meine Brille weder für meinen Tagesjob als Teppichreiniger noch für meinen Abendjob in der Motelwäscherei brauche, habe ich sie praktisch nie dabei. Ich kniete mich also hin und zog die Kette nach Gefühl auf, immer schön ein Glied nach dem anderen. Das dauerte seine Zeit, und als ich fertig war, hatte ich schmutzige Hände. Damit kein Öl an die Hose kam, richtete ich mich vorsichtig auf und spreizte dabei die Arme ab, als würde ich im Dunkeln nach etwas greifen. In diesem Moment hörte ich, wie ein Auto ziemlich schnell auf die Kreuzung zufuhr, und gleich danach einen dumpfen Knall. Bums. Als ich aufblickte, bog der Wagen schon in die Seitenstraße ein, und der alte Mann war von der Motorhaube gerollt und mit dem Gesicht nach unten im Rinnstein gelandet. Und der Wagen blieb nicht mal stehen, sondern düste einfach weiter, als wäre er nur über eine Dose oder eine Plastikflasche gefahren.
»Du musst die Polizei anrufen«, sagte Marisela.
Ich ging zur Küchenspüle und drückte mir einen Tropfen Spülmittel auf die Hand, um die Schmiere wegzuschrubben. »Hast du vergessen, was mit Araceli passiert ist?«, fragte ich. Araceli wohnte in Tucson ein paar Häuser weiter in unserer Straße. Eine kräftige Frau mit Lockenmähne und einer gackernden Lache. Sie meldete der Polizei, dass ihr Nachbar seine Frau schlug, und als sie ihre Zeugenaussage machen sollte, kam heraus, dass sie keine Papiere hatte. Bevor sie auch nur kapierte, was überhaupt los war, stand die Einwanderungsbehörde auf der Matte. In Kalifornien geht es zwar angeblich anders zu als in Arizona, hier gelten andere Gesetze, heißt es, aber warum das Risiko auf sich nehmen?
»Du bist einfach weggefahren?«, fragte Marisela, eine Hand an der Wange. Im hellen Licht der Küchenlampe wirkten die Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken dunkler als sonst. Auch nach zwölf Jahren Ehe machen mich diese Sommersprossen immer noch an. Ich konnte sie nicht belügen. Ich senkte den Blick und schrubbte weiter. Sie kam näher und fragte noch mal, mit empörter Stimme: »Du hast ihn einfach da liegen gelassen?«
Nein, so konnte man es nicht sagen. Ich hatte mein Handy aus der Tasche geholt – die ganze Tastatur bekam Schmiere ab –, doch dann fiel mir ein, dass man meinen Anruf zurückverfolgen konnte. Deshalb sah ich mich um und versuchte zu entscheiden, wo ich um Hilfe bitten könnte. Da stand ein Diner mit einem hellen Neonschild, aber innen war alles dunkel, nur der Schriftzug Geschlossen blinkte rot und blau. Aber die Bowlingbahn daneben war noch geöffnet. Ich hatte mich gerade auf den Weg dahin gemacht, als plötzlich eine Joggerin auf die Kreuzung zulief, eine Frau in Shorts, mit blondem Pferdeschwanz und aufgesetzten Kopfhörern. Sie konnte zwar nichts gehört haben, würde aber gleich den Highway auf Höhe Chemehuevi überqueren, den Mann auf der anderen Straßenseite entdecken und die Polizei rufen. Deshalb stieg ich auf mein Rad und fuhr nach Hause. »Du hast ihm also nicht geholfen?«, sagte Marisela.
»Was hätte ich schon tun können?«, sagte ich, während ich meine Hände mit einem Stück Küchenpapier abtrocknete. Unter den Fingernägeln steckte immer noch Schmiere. Ich ging ins Schlafzimmer und zog die Arbeitskleidung aus – ganz leise, um die Kinder nicht zu wecken, die im Bett unter dem Fenster schliefen. Elena war damals acht und Daniel sechs. Amerikanische Staatsbürger, alle beide, nur um das klarzustellen. Alles, was ich tat, machte ich für sie. Oder alles, was ich nicht tat, besser gesagt.
Ich nahm mir ein frisches Handtuch vom Stapel auf dem Bett und ging duschen. Das Wasser war warm, und ich schloss die Augen, aber sofort sah ich wieder den alten Mann mit dem Gesicht im Rinnstein vor mir. Ein Knie lag seltsam verdreht unter dem anderen, und ein Arm steckte unter der Brust, als wollte sich der Mann darauf stützen. Jetzt, mit geschlossenen Augen, sah ich neue Einzelheiten. Dinge, die ich im ersten Schock nicht wahrgenommen hatte. An dem Strommast hinter dem Mann hing auf Augenhöhe ein gelber Werbezettel. Und ungefähr eineinhalb Meter darunter leuchtete das weiße Haar des Mannes, dessen hellgrünes Hemd sich vom grauen Asphalt abhob.
Ich öffnete die Augen unter dem Wasserstrahl. Nein, sagte ich mir, ich habe keinen Unfall gesehen. In Wirklichkeit hatte ich gesehen, wie ein Mann auf den Boden fiel und ein weißes Auto in die Nacht hineinfuhr, und nicht mal bei der Farbe war ich mir sicher. Vielleicht weiß, vielleicht silberfarben. Aber die Marke oder das Modell – keine Ahnung. Und das Kennzeichen hatte ich mir auch nicht gemerkt. Was hätte ich denn tun sollen? Das Einzige, was ich gesehen hatte, war ein Mann, der auf den Boden gefallen war.
Nora
Ich duschte, wischte über den beschlagenen Spiegel und registrierte im feuchten Glas, dass ich anders aussah. Abwartend. Ich konnte nicht glauben, dass das Leben ohne meinen Vater weitergehen würde, dass am nächsten Morgen die Sonne wieder aufgehen, meine Mutter am Küchentisch sitzen, die Katze ihr Futter fressen, die Nachbarin mit ihrem Rollator die Straße hinuntergehen würde. Das letzte Mal war ich an Thanksgiving zu Hause gewesen, und obwohl das nur fünf Monate zurücklag, konnte ich mich kaum an den Besuch erinnern. Nach dem Festtagsessen hatten wir ein, zwei Partien irgendeines Brettspiels gespielt, wir waren ins Cinema 6 gegangen, und mein Vater und ich hatten eine Wanderung im Joshua Tree Nationalpark gemacht, doch ansonsten ist mir nichts Besonderes in Erinnerung geblieben. Vier ganz normale Tage.
Das Anziehen dauerte lange. Ich streifte mir ein Kleid über, legte mir einen Gürtel um und band mir die Uhr ans Handgelenk, aber weil bei jedem Gegenstand die Gedanken zu wandern begannen, bevor ich zuknöpfen, festschnallen oder schließen konnte, waren meine Haare fast trocken, als ich das Schlafzimmer verließ und in die Küche ging. Plötzlich flog die Haustür auf, und Salma, Tareq und die Zwillinge stürmten herein. Die Erwachsenen trugen Einkaufstüten, die beiden Achtjährigen umklammerten ihre Tablets. »Tante Nora!«, rief Zaid, lief zu mir und umarmte mich, während Aida wortlos die Arme um meine Taille schlang und mich fest drückte.
Ich hielt die beiden und staunte wieder einmal darüber, wie groß sie seit dem letzten Mal geworden waren. Und es gab weitere kleine Veränderungen: Die Psoriasisflecken an Aidas Ellbogen hatten sich ausgedehnt, und an Zaids Handrücken klebte ein Captain-America-Tattoo. Als mein Vater und ich den Kindern einmal an einem warmen Frühlingstag beim Planschen im aufblasbaren Pool zugesehen hatten, fragte er mich: Was liegt einem mehr am Herzen als ein Kind? Ich dachte kurz nach, dann gab ich auf und fragte: Was? Ein Enkelkind, sagte mein Vater. Jetzt würde er seine Enkelkinder nie wieder sehen, nie wieder mit Zaid ein Lego-Raumschiff bauen oder Aida beibringen, wie man Kreuzworträtsel löste.
»Seit wann bist du hier?«, fragte meine Schwester, während sie die Einkaufstüten auf den Boden stellte.
»Seit heute früh«, antwortete ich.
Weil Salma so unglaublich blass war und ihr getupftes T-Shirt und die schwarze Hose viel zu weit wirkten, dachte ich schon, sie wäre krank. Doch der Gedanke verflog, als sie näher kam. Kaum hatten wir uns in die Arme geschlossen, begann sie zu weinen, und ich tröstete sie, so wie ich kurz zuvor meine Mutter getröstet hatte. Salmas Mann stand abwartend daneben. Als ihm klarwurde, dass sich die Sache in die Länge ziehen würde, bat er die Zwillinge, ins Wohnzimmer zu gehen, und holte eine Schachtel Kleenex aus dem Gästebad.
»Tut mir leid, dass ich es dir texten musste«, sagte Salma, »aber du bist einfach nicht rangegangen.«
»Ich war essen. Ich habe weder das Handy klingeln hören noch deine Nachricht gesehen. Ich habe es von Mom erfahren.«
»Hast du an den Kaffee gedacht?«, fragte meine Mutter von der Wohnzimmertür her. Ihre Augen waren winzig klein und ihre Wangen hellrot geädert.
»Ja, Mama«, sagte Salma.
Ich nahm eine der Papiertüten und folgte meiner Mutter und meiner Schwester in die Küche. An der Wand über dem Gewürzregal hing ein gerahmtes Bild, das ich in der zweiten Klasse gebastelt hatte, ein Baum aus schwarzen Bohnen. Jeder Ast war mit einem Namen beschriftet. Daddy, Mommy, Salma, Nora. Ich war der Ast unten rechts. Am Edelstahlkühlschrank hingen fünf, sechs Zeichnungen von Salmas Zwillingen und ein magnetischer Whiteboard-Kalender ohne einen einzigen Termin. Tareq nahm ein Blatt Papier und einen schwarzen Filzstift aus dem kleinen Schreibtisch am Fenster, der als Ablage für Rechnungen und Zeitschriften diente.
»Was schreibst du?«, fragte Salma.
»Ein Schild für den Diner.« Er hielt das Blatt in die Höhe, auf dem in Großbuchstaben Wegen eines Todesfalls in der Famlie geschlossen stand. »Das kleben wir an die Tür.«
»Da fehlt ein I«, sagte ich.
Er drehte das Blatt um und sagte achselzuckend: »Egal. Ist ja nur ein Schild.«
»Es ist nicht egal. Dad würde das stören. In solchen Dingen war er pingelig.« Ich blickte zu meiner Schwester. »Weißt du noch, wie er damals alle Speisekarten neu drucken ließ, weil er im Steak Special einen Druckfehler entdeckt hatte? Die Kunden würden es bemerken und ihn für einen Idioten halten, hat er gesagt.«
»Ja, ich erinnere mich.«
Tareq quetschte ein kaum sichtbares I zwischen das M und das L. »So, fertig«, sagte er, nahm die Restaurantschlüssel und ging durch die Küchentür hinaus. An die Arbeitsfläche gelehnt, betrachtete ich meine Mutter, die gerade Kaffeepulver in die Maschine füllte und den Inhalt jedes Löffels sorgsam glatt strich, bevor sie ihn hineinkippte. Sie ging so umsichtig und präzise vor, als hinge von dieser Arbeit sehr viel ab.
»Ich habe nachgedacht«, sagte ich. »Der Polizei zufolge hat man ihn im Rinnstein des Chemehuevi Way gefunden. Demnach musste der Fahrer extra an den Straßenrand ausscheren, um ihn zu erwischen.«
»Deshalb gehen sie ja davon aus, dass der Fahrer betrunken war«, sagte Salma. Sie hatte, beabsichtigt oder nicht, oft einen belehrenden Ton, wenn sie mit mir sprach. Diesmal fiel es ihr offenbar selbst auf, denn sie fügte rasch hinzu: »Oder es war ein Marine. Die rasen immer zum Standort in Twentynine Palms, um pünktlich da zu sein. Wenn die spät dran sind, fahren sie wie die Irren.«
Meine Mutter ließ den Deckel der Kaffeemaschine zuschnappen und begann mit dem Rücken zu mir, die Papiertüten in Rechtecke zu falten und auf der Arbeitsfläche zu stapeln. Für mich war das ein Signal, nicht mehr über den Unfall zu sprechen. Sie hatte mir alles, was sie wusste, längst gesagt.
Den restlichen Nachmittag über arbeiteten wir schweigend. Wir nahmen die Tassen und Untertassen für den Kaffee und die kleinen blauen Gläser für den Tee aus der Vitrine, wuschen Minzeblätter und packten die Snacks aus, die Salma gekauft hatte. Wenn das Telefon klingelte, hob einer von uns ab und beschrieb den Weg zum Haus. Nach einer Weile kam Tareq vom Restaurant zurück, legte die Schlüssel auf die Arbeitsfläche und fragte: »Wer macht jetzt die Buchführung?«
Ich hob den Blick von den Servietten, die ich gerade faltete. »Welche Buchführung?«
»Wer kümmert sich um die Gehaltsabrechnungen und die Bezahlung der Lieferanten? Wenn der Diner geschlossen ist, gerät alles in Rückstand.«
»Dir geht es in dieser Situation ernsthaft ums Geld?«
»Nora«, sagte Salma vorwurfsvoll.
»Was denn? Du hast ihn doch gehört.«
»Er stellt durchaus vernünftige Fragen. Nicht jeder kann es sich leisten, den Kopf in den Wolken zu tragen wie du.«
Den Kopf in den Wolken tragen. Die Redewendung zog sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Begonnen hatte es, als ich neun oder zehn war und mich so in meine Bücher vertiefte, dass ich den Ruf zum Abendessen nicht mitbekam. »Du trägst den Kopf in den Wolken«, sagte meine Mutter dann, aber meistens klang es liebevoll. Als ich einige Jahre später nach der Schule im Diner mithalf, wurde die Bemerkung allerdings zum harschen Tadel: »Du hast dem Gast falsch herausgegeben, du trägst den Kopf in den Wolken.« Und als ich mich wieder ein paar Jahre später gegen das Medizinstudium entschieden hatte, wurde aus dem Tadel eine Anklage: »Du ruinierst dir dein Leben, benti. Du trägst den Kopf in den Wolken!«
Den Kopf in den Wolken zu tragen, war meine Art, mit dem Leben klarzukommen. Das war mir früh bewusst geworden – schon an meinem ersten Tag in der Yucca Mesa Elementary, als Mrs Nielsen fröhlich die Liste mit den Namen der Kinder vorlas, es aber nicht fertigbrachte, »Nora Zhor Guerraoui« auszusprechen. Für den Mittelnamen nahm sie zwei Mal Anlauf, stockte und blickte missbilligend auf die Ansammlung von Konsonanten. Die anderen Kinder, vereint im Staunen über das Wort, an dem die Lehrerin gescheitert war, wurden ganz still. Mrs Nielsen schob ihre Lesebrille an die Nasenspitze und schielte zu mir herüber. »Ein sehr ungewöhnlicher Name. Woher kommst du?«
In der Pause schwärmten die Kinder aus und fanden in Grüppchen wieder zusammen – die Soldatenkinder, die Pastorenkinder, die Kinder aus der Wohnwagensiedlung, die Hippiekinder –, Gruppen, in denen ich keinen Einzigen kannte und kein Einziger mich. Ich hielt mich hinter der blauen Mauer neben den Schaukeln und sah aus der Ferne zu. In der Cafeteria aß ich den Zalouk, den mir meine Mutter in einer Pausendose mitgegeben hatte, während die anderen Schülerinnen am Tisch miteinander tuschelten. Plötzlich wandte sich Brittany Cutler an mich, ein hübsches blondes Mädchen mit Zopffrisur und strahlendem Lächeln, und fragte: »Was isst du da eigentlich?«
Unendlich dankbar für die Gelegenheit, schließlich doch noch mit jemandem reden zu können, blickte ich auf und antwortete: »Aubergine.«
»Sieht aus wie Kacka.«
Die anderen Mädchen kicherten, und den ganzen restlichen Schultag hindurch war ich für sie die Kacka-Esserin. Irgendwann sollten wir uns alle im Kreis um Mrs Nielsen setzen, weil sie uns aus Rapunzel vorlesen wollte, aber niemand mochte neben mir sitzen. Dann spielte Mrs Nielsen »Twinkle, Twinkle, Little Star« auf dem Xylofon und fragte, ob wir wüssten, welches Lied das sei, und ich sagte: »Das ist das lila und grüne Lied.« Mrs Nielsen erwiderte: »Nein, Nora, der Stern funkelt, der ist nicht lila oder grün. Du musst die Farben lernen!« Ich traute mich nicht, ihr zu sagen, dass ich nun mal diese Farben sah, wenn ich die Melodie hörte. Als mein Vater mich abholte, lief ich ihm entgegen und warf mich in seine Arme, als wäre er mein Retter. Er trocknete meine Tränen, brachte mich nach Hause und erlaubte mir, vor dem Abendessen Oreos zu naschen.
Doch in die Schule musste ich am nächsten Tag trotzdem. Ich lernte das Alphabet, lernte das Treuegelöbnis und lernte, fiesen Mitschülern aus dem Weg zu gehen. Im Unterricht war ich still. Mittags saß ich allein am Tisch. Das Schweigen hüllte mich in Sicherheit, ließ mich jedoch einige Monate später im Stich, als Mrs Nielsen zu der Überzeugung gelangte, ich hätte eine Lernstörung. An einem sonnigen Maivormittag beorderte sie meine Mutter ins Klassenzimmer und bombardierte sie mit Begriffen wie »ausgeprägter Mutismus«, »soziale Angststörung« und »Oppositionsverhalten«. Meine Mutter verstand nur Bahnhof. Da erklärte Mrs Nielsen ihr im Flüsterton: »Mit Ihrer Tochter stimmt etwas nicht.« Ich saß auf einer gelben Matte in der Ecke, spielte, lauschte und wartete darauf, dass meine Mutter sagte: »Mit meiner Tochter ist alles in Ordnung.« Doch sie nickte nur sehr langsam, so als sähe sie die Sache ähnlich.
Als mein Vater abends nach Hause kam und erfuhr, was passiert war, bezeichnete er die Lehrerin als Idiotin. Hmara nannte er sie, »Esel« – ein Wort, mit dem er sonst nur Fernsehmoderatoren bedachte, mit denen er während der Acht-Uhr-Nachrichten stritt. Dann nahm er sich ein Bier aus dem Kühlschrank und ging die Rechnungen durch, die auf der Arbeitsfläche lagen. Ich starrte meine Mutter an, um ihre Reaktion nicht zu verpassen, die auch prompt erfolgte. »Ach, und du weißt mehr als die Lehrerin, ja?«
»Über meine Tochter weiß ich ganz sicher mehr.«
»Salma hatte in der Vorschule nie solche Probleme. Sie war immer die Beste.«
»Es gibt keine Probleme, Maryam.«
»Wenn sie nie den Mund aufmacht, muss sie das Jahr wiederholen, hat die Lehrerin gesagt.«
»Nein, muss sie nicht.« Er fuhr mir mit der Hand durchs Haar. »Nor-eini, versuch, im Unterricht etwas zu sagen, okay?«
Doch die durch meine Mutter übermittelte und verstärkte Drohung der Lehrerin ging mir nicht aus dem Kopf. Sprach ich nicht, würde ich das Jahr wiederholen müssen, und wiederholte ich, bliebe mir der tägliche Anblick von Brittany Cutler und ihrer Gefolgschaft erspart. Also wiederholte ich das Vorschuljahr und lernte noch einmal das Alphabet und den Treueschwur. Nur zählte zu meinen Mitschülerinnen diesmal Sonya Mukherjee, ebenso schweigsam und ebenso Außenseiterin wie ich. Als ich in die erste Klasse kam, hatte ich eine Freundin.
Anschluss an Gleichgesinnte, nämlich Musiknerds, fand ich aber erst in der Middleschool. Weil ich immer von Farben sprach, wenn es um Musik ging, hatte mich mein Vater im Sommer zwei Jahre zuvor zum Klavierunterricht bei Mrs Winslow angemeldet, einer Nachbarin, die an der University of Southern California Musik gelehrt und sich in der Wüste zur Ruhe gesetzt hatte. Sie gab meiner Sicht auf die Welt einen Namen: Synästhesie. Und mit dem Begriff kam die Erkenntnis, dass an mir nichts falsch war, dass ich diese Klangerfahrungen mit vielen anderen teilte, darunter auch viele Musiker und Musikerinnen. Beim Vorspielen für die Aufnahme in die Schulband trug ich Bachs Menuett in G-Dur vor und wurde sofort genommen, ebenso Sonya mit ihrer Flöte. Es gab noch einige andere talentierte Kinder – Lily, Jeremy, Manuel und Jamie –, Kinder, die nicht als Erstes »Was bist du?« fragten, sondern »Was spielst du?«. Über dem Lehrerpult hing ein Plakat mit der Aufschrift: Hast du gestern geübt? Übst du heute? Wirst du morgen üben? Die strenge Disziplin und die langen Proben schweißten uns zusammen. Und viel reden musste ich auch nicht – ich musste nur spielen.
Einmal wurde die Jazzband zu einem Auftritt beim Sommerfestival in Palm Springs eingeladen. Ich trat aufs Podium, ging zum Klavier und tat, was mir mein Lehrer geraten hatte: Stell dir vor, du würdest nur für einen einzigen Menschen spielen, das nimmt dir die Nervosität. Ich sah meinen Vater an, der in der ersten Reihe mit seitlich geneigtem Kopf auf meinen Auftritt wartete, schloss die Augen und begann zu spielen. Während meine Finger über die Tasten glitten, hatte ich das Gefühl, mit meinen Bandkollegen zu sprechen. Ich rief Manuel am Schlagzeug etwas zu oder beantwortete Lilys Bass eine Frage. Das Gespräch zwischen uns wurde so intensiv, und ich vertiefte mich so sehr in unsere vielfarbige Unterhaltung, dass mich der einsetzende Applaus fast erschreckte. An diesem Abend war ich glücklich. Ich fühlte mich vollständig.
Das Gefühl, anders zu sein, verschwand trotzdem nie ganz. Ich hatte es besonders dann, wenn man mich fragte, welcher Kirche ich angehörte, wenn meine Mutter auf dem Schulparkplatz mit mir sprach oder wenn die Geschichtslehrerin eine Frage über den Nahen Osten stellte und sich alle Blicke erwartungsvoll auf mich richteten. Dass meine Eltern sich nicht verstanden und es zu Hause ständig Streit gab, machte die Sache nicht besser. Wann immer eine Tür zugeknallt oder ein Teller geschmissen wurde, sperrte ich mich in mein Zimmer ein und hörte Musik. Ich träumte vom Erwachsenwerden, vom College, von der Flucht aus der Wüste. »Warum trägst du nur ständig den Kopf in den Wolken?«, sagte meine Mutter.
Plötzlich roch ich den dampfenden Kaffee, spürte die steif gestärkte Serviette in meiner Hand, das Gewicht meines an der Arbeitsfläche lehnenden Körpers. »Ich trage den Kopf nicht in den Wolken«, sagte ich. »Ich glaube nur einfach nicht, dass das Thema Geld am heutigen Tag angebracht ist.«
»Wir reden hier nicht über Geld, sondern über Babas Restaurant, das ihm unglaublich am Herzen lag, wie du selbst eben erst betont hast«, entgegnete Salma.
»Das meine ich nicht.«
»Sondern?«
»Dass es gut wäre, wenn dein Mann ein bisschen mehr Feingefühl an den Tag legen würde.«
»Er wollte doch nur helfen.«
Die Türklingel ertönte, und ich zuckte zusammen. Salma ging öffnen. Ihre Armbänder klirrten dabei so regelmäßig, als würde sie bewusst einen Rhythmus einhalten. Während ich die letzten Servietten faltete, wuchs der Schmerz in meiner Brust. Ich war erst seit einem Tag hier, und schon wurde gestritten. Und ich verstand nicht, warum die Leute schon jetzt kamen. Nach der Beerdigung wäre genug Zeit gewesen. Ich konnte die Geschichte nicht mehr hören, die jedem neuen Besucher erzählt wurde – die Geschichte von der Lehrerin, die beim abendlichen Joggen meinen Vater bewusstlos auf der Straße gefunden hatte. Dass kurz darauf der Krankenwagen eintraf, doch zu spät, weil mein Vater schon tot war. Ich wollte nicht gefragt werden, wo ich war, als es passierte, oder wie ich die Nachricht erfahren hatte. Es ödete mich an, den Freundinnen meiner Schwester die Hand zu schütteln, ich hatte ihre gedämpften Stimmen satt. Nach einer Weile zog ich mich auf die Terrasse zurück.
Jeremy
Als ich vor ihrem Haus ankam, stand die Tür offen, und lautes Stimmengewirr drang nach draußen. Einige der Leute redeten in einer Sprache, die mir bekannt vorkam, ohne dass ich sie verstand. Vor dem Eingang sah ich mehrere Paar Schuhe und überlegte, ob ich meine auch ausziehen sollte. Aber was, wenn sie gar nicht da war? In der Diele hingen gerahmte Fotos, auch eins von unserer Highschooljazzband. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich noch nie bei ihr zu Hause gewesen war. Zehn Jahre hatte mein Bild an dieser Wand auf mich gewartet.
Im Wohnzimmer standen lauter Fremde in kleinen Gruppen herum und tranken Tee aus winzigen blauen Gläsern. Ihre Mutter saß auf dem Sofa und unterhielt sich konzentriert mit einem alten Mann, der ein schwarzes Jackett und eine weiße Gebetskappe trug. In der Küche klingelte das Telefon. Jemand rief nach einem Glas Wasser und einer Kopfschmerztablette. Es war laut und eng, und ich fühlte mich fehl am Platz. Mit einem Mal war ich mir nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee gewesen war, direkt von der Dienststelle herzufahren. Dann sah ich sie auf der Terrasse.
Froh, von den Leuten wegzukommen, ging ich durch die Glastür nach draußen. Es dämmerte schon, der blaue Himmel färbte sich schwarz. Am Holzzaun leuchteten die hellroten Blüten der Wildblumen wie die Glutreste eines sterbenden Feuers. Die Dielen knarzten unter meinen Schritten. Als ich ihren Namen rief, drehte sie den Kopf zu mir. Ihr schwarzes Haar umspielte ihre Schultern, und ihre Augen waren noch genauso dunkel, ihr Blick genauso direkt wie in meiner Erinnerung. Sie trug ein grünes Kleid mit einem schmalen Gürtel. Im gelben Licht, das aus dem Wohnzimmer auf die Terrasse fiel, wirkte ihre Haut golden. »Mein aufrichtiges Beileid.«
Sie sah mich schweigend an, und mir schoss der schreckliche Gedanke durch den Kopf, dass sie sich nicht an mich erinnern könnte. Doch dann kam sie, barfuß, mit leichten, leisen Schritten auf mich zu und umarmte mich. Herzlich, dachte ich später am Abend, als ich in der Badewanne saß. »Danke, dass du gekommen bist, Jeremy«, sagte sie. Während sie sich von mir löste, spähte sie ins Wohnzimmer, wo jemand aufgeschrien hatte und vom Chor der anderen Trauernden beruhigt wurde. Dann sah sie mich wieder an, diesmal fast verzweifelt. »Würdest du – kannst du ein bisschen bleiben?«
»Klar.« Ich setzte mich neben sie auf die Holzbank. Obwohl mir der Besuch so wichtig gewesen war, hatte ich mir nicht überlegt, was ich außer der Beileidsfloskel sagen könnte. Ich entschied mich für etwas Schlichtes. »Dein Vater war ein guter Mensch.«
»Danke.« Sie berührte mich leicht am Arm.
»Bei den Nachmittagsproben hat er uns oft zugehört. Dir. Das hat sonst kein Vater und keine Mutter getan.«
Sie schlug die Beine übereinander – ihre langen, braunen Beine. Die Zehennägel waren rot lackiert. Ich zwang mich, den Blick abzuwenden, klopfte auf meine Tasche, versuchte, mich zu erinnern, wie viele Zigaretten ich heute schon geraucht hatte. Weniger als fünf. Mein neues Tageslimit. »Darf ich rauchen?«
»Nur zu.«
Ich zündete mir eine Zigarette an und blies den Rauch weg von ihr, aber der Wind machte mir einen Strich durch die Rechnung. Seit einer Woche wehten heftige Santa Anas durchs Tal und brachten Hitze, Staub und die Rufe wilder Tiere aus den Bergen. Zwischen den Böen drang das Gemurmel aus dem Wohnzimmer auf die Terrasse.
»Wie hast du das mit meinem Dad erfahren?«, fragte sie.
»Eine Kollegin von mir bearbeitet den Fall.«
»Bist du Detective?«
»Deputy Sheriff. Scheint dich zu überraschen.«
»Ich dachte immer, du würdest mal Lehrer werden. Im Leistungskurs Englisch hast du die besten Aufsätze geschrieben.«
Allerdings hatte ich auch nur diesen einen Leistungskurs gehabt. In Wirklichkeit war ich nicht gut gewesen in der Highschool. Immer abgelenkt, sagten die Lehrer. Doch es war keine mangelnde Konzentration, sondern Erschöpfung. Nach der Schule arbeitete ich, kümmerte mich um meine Schwester und blieb fast jede Nacht auf, bis mein Vater nach Hause kam. Das Unterrichtsgefasel der Lehrer erschien mir weniger wichtig. Im Leistungskurs Englisch durften wir immerhin Romane lesen, und gelesen hatte ich schon immer gern. Ich zog an der Zigarette und versuchte, mich mit Noras Augen in einem Klassenzimmer voller Kinder zu sehen, schaffte es aber nicht. Ein anderer Weg als der, den mein Leben bereits eingeschlagen hatte, war für mich nicht mehr vorstellbar. »Man landet nicht immer da, wo man es erwartet hat«, sagte ich. »Und du?«
»Ich bin Musikerin. Komponistin.«
»Das finde ich plausibel.« Gab es etwas Selbstverständlicheres als Nora am Klavier? Sie war immer ein bisschen zu früh im Musikunterricht erschienen und immer ein bisschen später als die anderen gegangen. Hatte jedes Stück perfekt vom Blatt gespielt und warten müssen, bis wir anderen es hinbekamen. »Kann man deine Kompositionen irgendwo hören?«
»Nein, eigentlich nicht.« Sie zögerte. »Also, ich habe zwar ein paar Sachen aufgenommen und online gestellt, aber ich bekomme keine Plattenverträge oder Aufträge von Orchestern. Mein Geld verdiene ich als Vertretungslehrerin.«
Aus irgendeinem Grund hatte ich das Bedürfnis, die Enttäuschung zu lindern, die in ihrer Stimme mitschwang. »Das ändert sich bestimmt bald.«
Sie lachte leise. »Das glaubst auch nur du.«
Dann schwiegen wir lange, aber es war keine unangenehme Stille. Draußen, im Dunkeln sitzend, sahen wir alles, was drinnen im Haus vorging. Es fühlte sich so innig an, als würden wir etwas Geheimes oder sogar Verbotenes miteinander teilen. In der Küche stellte ihre Schwester einen frischen Kessel auf den Herd und sagte etwas zu den beiden Frauen, die an der Arbeitsfläche lehnten. Ein älteres Paar betrat das Wohnzimmer mit Glasschüsseln in den Händen, die mit Aluminiumfolie überspannt waren. Drei Mal klingelte das Telefon, bevor jemand hinging und abhob.
»Wartest du darauf, dass die sich endlich alle verziehen?«, fragte ich.
»Es war ein grauenhafter Tag. Ich halte das Gerede nicht mehr aus.«
»Wer sind diese Leute?«
»Der Mann neben meiner Mutter ist mein Onkel. Er hat einen Freund aus der Moschee in Los Angeles mitgebracht, der ihr mit dem Begräbnis helfen soll. Die zwei, die in der Küche Kaffee trinken, sind unsere Nachbarn. Und die anderen sind größtenteils Freundinnen meiner Schwester.«
In der Pinyon-Kiefer heulte eine Eule. Nora zog die Knie an die Brust und schlang die Arme darum. »Ich kann nicht weinen«, sagte sie.
»Konnte ich nach dem Tod meiner Mutter auch nicht. Zumindest nicht gleich.« Ich drückte die Zigarette aus.
»Kann ich eine von dir schnorren? Du bringst mich in Versuchung.«
Als ich ihr Feuer gab, sah ich an der Innenseite ihres Handgelenks einen tätowierten Spruch, konnte ihn aber nicht entziffern, weil es so dunkel war und ihre Hände so stark zitterten. »Es wird dich wahrscheinlich nicht trösten«, sagte ich, »aber Detective Coleman, die Kollegin, die den Fall bearbeitet, ist wirklich gut. Die findet den Dreckskerl, der das getan hat.«
»Uns hat sie jedenfalls nichts gesagt. Mein Dad wird ganz in der Nähe seines Restaurants überfahren, und sie findet keinen einzigen Hinweis auf den Täter.«
»Sie wird etwas finden. Das braucht seine Zeit.«
»Ich habe es kommen sehen.«
»Wie meinst du das?«
»Ich wusste, dass etwas Schreckliches passieren würde. Erinnerst du dich, wie nach dem 11. September das Lokal in Brand gesetzt wurde? Den Täter haben sie nie gefunden. Danach hat mein Dad eine riesige US-Flagge vor dem Diner aufgestellt, wie zum Beweis dafür, dass er zu den Guten gehörte. Ich habe ihm immer wieder gesagt, er soll verkaufen, aber er hat sich geweigert. Weiß der Himmel, warum er so gern hier gelebt hat.«
Sie führte eine Art Selbstgespräch, haderte mit der Vergangenheit, als könnte sie etwas daran ändern. Als ließe sich die Vergangenheit ändern. Genauso war es mir nach dem Tod meiner Mutter ergangen. Eines Spätnachmittags kam ich vom Baseballtraining nach Hause – noch voller Stolz, weil mein Coach meinen Swing gelobt hatte, noch erregt vom Anblick Maddie Clarkes, die mich im Minirock von der Tribüne aus angefeuert hatte, noch mit einem Grinsen im Gesicht wegen der Witze meiner Teamkameraden – und fand meine Mutter bewusstlos auf dem Boden in der Diele liegen. Der Träger ihrer Handtasche spannte sich quer über ihre Brust, die Post hielt sie noch fest in der Hand. Ich raste zum Telefon und versuchte, mich an den Erste-Hilfe-Unterricht zu erinnern, den ich zwei Jahre zuvor, in der Siebten, belegt hatte. Sollte ich nach dem Puls tasten? Sie anders lagern oder auf der Seite liegen lassen? Vorsichtig drehte ich sie auf den Rücken, klopfte ihr auf die Wangen, knöpfte den Kragen auf. Es gelang mir sogar, einen Puls zu fühlen, aber ich bekam sie nicht wach. Auch die Sanitäter, die wenig später eintrafen, schafften es nicht. Als mein Vater und meine Schwester im Hi-Desert Medical Center eintrafen, war sie bereits tot. Lungenembolie. Bis heute erinnere ich mich unfassbar deutlich, wie mein Vater in einem farblosen Krankenhausgang einem Arzt erklärt, dass es sich um einen Irrtum handeln muss, sie hätte doch nur ganz leicht gehustet.
Doch es war kein Irrtum. Sie war tot. War nicht mehr da, als ich am späten Abend in unser dunkles, leeres Haus zurückkehrte. Sie rief mich nicht vom Schlafzimmer aus, sagte nicht »Warum bist du noch auf? Geh jetzt schlafen, morgen ist Schule!«. Am nächsten Morgen stand sie nicht mit einer Tasse Kaffee in der Küche und blickte durchs Fenster auf den neuen Tag. Sie sagte nicht: »Hast du den Müll gestern rausgebracht? Irgendwas stinkt hier.« Sie verstrubbelte mir nicht das Haar und fragte, ob ich gut geschlafen hätte. Ich schlief überhaupt nicht, weder in der ersten Nacht noch in vielen, vielen folgenden. Ihre Abwesenheit wog zu schwer, als dass ich sie meinen Träumen überlassen konnte.
Meine Tanten Aurora und Estella kamen mit dem Auto aus El Monte, mein Onkel Paul mit dem Flugzeug aus Oregon, um am Begräbnis teilzunehmen. Sie kauften mir einen schwarzen Anzug, halfen mir, die Krawatte zu binden, und erzählten Geschichten, die ich noch nie gehört hatte. Ich erfuhr, dass meine Mutter einmal den zweiten Platz in einem Tanzwettbewerb beim Orange County Fair gewonnen hatte, dass sie während des Staatsexamens für das Lehramt unter einem Hautausschlag litt, auf der Geige jede noch so komplizierte Melodie nach Gehör spielen konnte und, als Ashley erst drei Monate alt war, allein nach Sorona zu einer Cousine fuhr, die sich in Schwierigkeiten befand. Die Geschichten sollten mich trösten, doch sie quälten mich nur. Ich sehnte mich danach, dass die Leute endlich gingen. Als sie es schließlich taten, war das Haus wieder leer, und ich wünschte mir, sie wären geblieben. In der Schule brachte ich überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Die Mitglieder der Jazzband überreichten mir eine von allen unterschriebene Beileidskarte, doch wenn sie sich über das von mir verpasste Frühlingskonzert unterhielten, fühlte ich mich ausgeschlossen. Einige Jungs aus dem Baseballteam erklärten, es tue ihnen sehr leid, mieden mich jedoch in der Mittagspause, als wäre meine Trauer ansteckend. Und wenn ich nach Hause kam, saß mein Vater im Dunkeln, trank und starrte vor sich hin. Die Stille war so dicht, so erbarmungslos, dass Ashley abends immer öfter bei den Johnsons aß, einer lauten, chaotischen Familie im übernächsten Haus.
»Genügen dir Cornflakes zum Abendessen, Dad?«, fragte ich.
»Ganz wie du meinst«, antwortete mein Vater.
Um die Stille im Wohnzimmer zu füllen, schaltete ich den Fernseher ein, bevor ich mich an die Hausaufgaben setzte. Die Geräuschkulisse war seltsam beruhigend, störte allerdings meine Konzentration. Immer wieder las ich dieselben drei, vier Zeilen im Schulbuch, während meine Gedanken zu vergangenen Tagen zurückkehrten, als meine Mutter noch gelebt hatte und gesund gewesen war. Nie wieder würde sie mir beim Baseballspielen zusehen – für die Aufnahme ins Team hatte ich wahnsinnig hart trainiert. Nie wieder würde sie mein Gitarrenspiel fachmännisch korrigieren, nie wieder so tun, als fände sie meine dummen Witze lustig. Mir wurde erst nach ihrem Tod bewusst, wie nah wir uns gestanden hatten.
Dann besuchte Ashley immer häufiger einen beliebten Bibelkreis, der jeden Dienstag und Donnerstag in der Kirche der Johnsons stattfand. Wenn sie zurückkam, strahlte sie etwas Sattes aus, das nicht allein vom Essen herrühren konnte, das es vor jeder Zusammenkunft gab. Meine Eltern waren zwar in die Kirche gegangen, hatten aber nicht jedes Gespräch mit Bibelzitaten gespickt, keine religiösen Broschüren unter den Nachbarn verteilt oder, wie die Johnsons, beim Thema Evolution die Augen verdreht. Inzwischen verließ mein Vater sonntags nicht mal mehr das Haus.
»Dad, soll ich Makkaroni mit Käse machen?«, fragte ich.
»Ganz wie du meinst.«
Weil ich nun immer früh nach Hause ging, um mich ums Abendessen zu kümmern, fehlte ich zu oft beim Training und wurde zu Beginn der zehnten Klasse aus dem Baseballteam geworfen. Als al-Qaida im September Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers steuerte, richtete sich mein Vater in seinem Sessel auf und sah sich zum ersten Mal aufmerksam etwas im Fernsehen an. Ab da dröhnte Fox News so laut durchs Haus, dass ich mich nur noch in mein Zimmer verkroch – vorgeblich um Hausaufgaben zu machen, in Wahrheit aber vor allem zum Lesen oder Gitarrespielen. Meine Noten wurden schlechter.
Meine Kochkünste dafür umso besser. Fast jeden Abend stand Punkt sieben ein Hauptgericht mit Beilage auf dem Tisch. Mein Vater aß alles, was ihm vorgesetzt wurde. Ashley dagegen hatte es immer eilig, zu den Johnsons zurückzukehren, und leerte ihren Teller so gut wie nie. Das übernahm ich dann für sie, weshalb ich stark zulegte, und zwar hauptsächlich an den falschen Stellen. In der Schule glaubte ich ständig, alle würden auf die Brüste starren, die sich unter meinem T-Shirt abzeichneten. Grüßte ich Maddie Clarke, brummte sie angewidert zurück. Nur wenige Monate zuvor hatte ich die anderen Jungs um einen ganzen Kopf überragt; jetzt war ich auf eine Art sichtbar, die mir kurioserweise das Gefühl gab, unsichtbar zu sein. Die Tage verschwammen in ihrem immer gleichen mechanischen Ablauf: aufstehen, zur Schule gehen, nach Hause gehen, Abendessen machen, schlafen, von vorn beginnen.
Vor dem Tod meiner Mutter war mein Studienwunsch Logopädie gewesen. Ich hatte als Kind unter einer Artikulationsstörung gelitten, eine monatelange Therapie machen müssen und nie vergessen, wie gut die Überwindung dieser Störung für mein Selbstbewusstsein gewesen war. Und da meine Mutter Englisch als Fremdsprache unterrichtet hatte, fand ich es passend, ebenfalls einen Beruf zu ergreifen, in dem ich Kindern helfen konnte. Doch als ich im Dezember meines letzten Highschooljahrs eine schriftliche Zusage für einen Studienplatz an der staatlichen Universität bekam, war meine Begeisterung bereits abgeflaut. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Logopädie überhaupt das Richtige für mich wäre.
»Dad, was meinst du? Wie soll ich mich entscheiden?«, fragte ich.
»Das überlasse ich ganz dir.«
Es fiel mir schwer zu akzeptieren, dass ich meine eigene Mutter, mein eigener Vater geworden war. Ich kaufte ein, kochte, erledigte die Wäsche. Als Ashley ihre erste Periode bekam, ging ich mit ihr Tampons kaufen. Weil mein Vater mittlerweile oft knapp bei Kasse war, nahm ich einen Teilzeitjob in der Eisdiele an. Trotzdem reichte es nie, sodass ich jeden Monat entscheiden musste, welche Rechnung ich bezahlte und welche nicht. Aber dieses eine Mal wollte ich unbedingt, dass mein Vater mir eine Richtung vorgab, mit mir sprach, mir half, meine Zukunft zu planen. Und wenn er das schon nicht schaffte, sollte er zumindest auftauchen, einfach auftauchen. Vor jedem Konzert der Jazzband der Yucca Valley High School heftete ich einen Flyer an den Kühlschrank, auf dem das Datum und der Veranstaltungsort mit Leuchtstift markiert waren. Während ich mit meiner Gitarre die Bühne betrat, ließ ich in der Hoffnung, meinen Vater zu sehen, den Blick über die hinteren Sitzreihen wandern. Doch im Gegensatz zu Noras Vater kam meiner nie. Noch jetzt erinnerte ich mich an den heftigen Neid, der mich beim Anblick des ganz vorn sitzenden Mr Guerraoui überkam. In seinen Augen lag Stolz – etwas, das ich von meinem Vater nicht kannte.
Ich sah zu Nora hinüber. An ihrer Zigarette hing ein langes Stück Asche.
»Vorsicht, du verbrennst dich noch.«
Sie betrachtete die Zigarette, als hätte sie das Ding noch nie gesehen. Durch die leichte Armbewegung fiel die Asche ab und verteilte sich auf ihrem Handrücken. Nora wischte sie weg und richtete den Blick wieder aufs Wohnzimmer. Mittlerweile waren außer ein paar wenigen Leuten alle gegangen. Nora stand auf. »Noch mal vielen Dank, dass du gekommen bist, Jeremy«, sagte sie. Dann führte sie mich durchs Haus und brachte mich zur Tür.
Diesmal blieb ich nicht vor dem Foto in der Diele stehen.
Maryam
Um wach zu bleiben, schaltete ich das Radio ein und suchte die Sendung von Claudia Corbett auf KDGL, die normalerweise mittags läuft und die ich mir anhöre, während ich Kartoffeln schäle oder Petersilie hacke. Aber weil die Sendung so beliebt ist, wird sie abends um zehn wiederholt. Damals rief eine junge Frau an und erzählte, sie hätte erst vor einem halben Jahr geheiratet, doch ihr Mann und sie würden ständig streiten. Er wollte nach Portland ziehen und Naturfotograf werden, sie in Salt Lake City bleiben und weiter bei einer Versicherung arbeiten, und keiner gab nach. »Jetzt hören Sie mal gut zu«, sagte Claudia streng, wie sie es manchmal tut, wenn ein Anrufer ins Schwafeln kommt und nicht einsehen will, was klar auf der Hand liegt. »Kein Mensch hat je behauptet, dass die Ehe ein Kinderspiel ist. Die Ehe ist harte Arbeit.«
Als wir vor fünfunddreißig Jahren nach Amerika gezogen sind, hat mich vieles erstaunt. Waffenläden gleich neben Friseursalons, ineinander verwickelte Schnellstraßen, Leute, die anklopfen und über Jesus reden wollen, zwanzig verschiedene Milchsorten im Supermarkt, Schilder, auf denen Denken Sie nicht mal im Traum daran, hier zu parken steht. Einmal habe ich Driss so ein Schild gezeigt und gesagt: Hier gibt es sogar Schilder, die einem verbieten, bestimmte Sachen zu denken! Über die Talkshows habe ich mich auch gewundert, weil die Amerikaner im Fernsehen so gern Geständnisse machen. Männer sprachen über ihre Affären oder ihre Alkohol- oder Spielsucht, Frauen über ihr Gewicht, über Schönheitsoperationen oder uneheliche Kinder. Sogar Teenager kamen zu Wort – meistens ging es darum, wie schrecklich ihre Eltern waren. Und alle redeten so, als wäre es das Normalste der Welt. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen. Der Fernseher stand auf dem Vorratsschrank ganz hinten im Donut-Shop, und während ich Geschirr spülte oder den Boden wischte, sah ich mir Sally oder Donahue an, die nachmittags liefen, wenn im Laden nichts los war. Mein Bruder hatte mir den Tipp gegeben, mein Englisch mit Fernsehgucken zu verbessern, und ich lernte wirklich viele neue Wörter, zum Beispiel Vaterschaftstest, künstliche Befruchtung und AIDS-Epidemie. Mit der Aussprache hatte ich allerdings Schwierigkeiten. Ich sagte »tree«, wenn ich »three« meinte, oder »adder«, wenn ich »other« sagen wollte. Da musste ich viel üben. In Casablanca hatte ich meine beiden Schwestern, meine drei Onkel und acht Cousinen und Cousins, aber hier in Kalifornien nur meinen Bruder, und der wohnte zweihundert Kilometer weit weg. Wie weit das war, merkte ich erst, als wir ihn nicht mehr jeden Tag besuchten, sondern nur noch ein Mal im Monat, wenn überhaupt. Das war für mich das Schwierigste am Leben in Amerika, so weit weg zu sein. Ich fühlte mich wie ein Waisenkind.





























