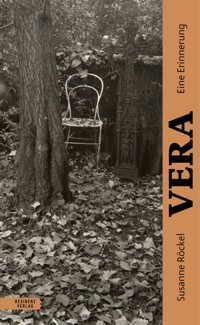Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hier hat eine große Erzählerin aus einer grimmigen Geschichte einen grandiosen Roman gemacht. Die Mitglieder einer wissenschaftlich orientierten Familie werden durch eine zufällige Entdeckung auf einem Kirchenbild in den schwer durchschaubaren Mythos eines Vogelgottes hineingezogen – mit einem Sog, dem sie so wenig widerstehen können wie der Leser dieser Geschichte. Spätestens als sich herausstellt, dass dieser Mythos eben nicht nur ein Mythos ist. Es ist eine sagenhafte, aber elende Gegend dieser Erde, wo die Verehrer des Vogelgotts leben, die ihm allerdings weniger ergeben als vielmehr ausgeliefert zu sein scheinen.In diesem unwiderstehlichen Roman entpuppt sich eine geheime Welt als die unsere, in der die Natur ihre Freundschaft aufkündigt und wir ihrer Aggression und Düsternis gegenüberstehen.Das ist nicht die übliche Jung und Jung Literatur, werden manche denken. Beim Lesen und vor allem Weiterlesen fragt man sich, warum man das Buch nicht aus der Hand legen kann, zumal hier nicht mit altertümlichen Spannungselementen gearbeitet wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
© 2018 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlagbild: Shutterstock.comUmschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comISBN 978-3-99027-214-5eISBN 978-3-99027-160-5
SUSANNE RÖCKEL
Der Vogelgott
Roman
INHALT
Prolog
I Im Land der Aza
II Die Madonna mit der Walderdbeere
III Kinderträume
PROLOG
… Es war, wie mir bald klar wurde, jene sagenhafte Gegend, von der ich bei den Großen meines Fachs schon so viel gelesen hatte. Während die ramponierte Lok in irgendein Depot geschleppt wurde, erhielt ich mehrere Angebote ortsansässiger Taxifahrer mit Schnauzbärten und schmutzigen Gummistiefeln, die wünschten, mich über die kurvigen und schlaglochreichen Bergstraßen zum nächsten Bahnhof zu fahren, doch nach einem Blick gen Himmel, der ungewöhnlich hell und rein zu werden versprach, beschloss ich, an Ort und Stelle zu bleiben und mir in dem Dorf Z., das mir gezeigt wurde – wie es unregelmäßig und schief zwischen den Felszacken hing, ähnelte es dem Brutplatz eines Wanderfalken –, eine Unterkunft zu suchen.
Der Weg schlängelte sich zwischen Wiesen, Wäldchen und Äckern in sanfter Steigung aufwärts. Auf den ersten Blick war mir die Landschaft malerisch erschienen, doch während ich mit meinem schweren Gepäck voranrückte, bemerkte ich, dass mir die Erinnerung an die gelesenen Bücher den Blick getrübt hatte. Pechstein und von Boettiger hatten vom abwechslungsreichen Anblick der bestellten Felder geschwärmt, von grünen Hügeln, sprudelnden Quellen, reizenden Hainen, von der erhabenen Silhouette der Felsenberge am Horizont. Droste hatte – besonders diese Stelle seiner Lustreisen eines Vogelnarren war mir im Gedächtnis geblieben – den melodiösen Gesang der fleißigen Bäuerinnen beschrieben, der sich mit dem frommen Jubel der Lerchen mischt. Ich fand nichts von alldem. Neben dem monotonen Grillengezirp ließen sich weder menschliche noch Vogelstimmen hören, und die Felder wurden offenbar schon seit Jahren nicht mehr bestellt. Ich sah die Reste von Zäunen, Heuschobern, Unterständen für Tiere und ähnliche Anzeichen ehemaliger landwirtschaftlicher Tätigkeit, doch waren sie sämtlich bis zum Boden eingesunken und von Disteln, Quecken, Brennnesseln überwuchert. Ein einst schmuckes Bienenhaus mit farbig gestrichenen Anflugbrettern hatte man offenbar zu zerstören und in Brand zu setzen versucht; die herausgerissenen Kästen steckten halb vermodert in der Erde. Die Hecken glichen undurchdringlichen Stacheldickichten, und die Wäldchen waren so lange nicht mehr gelichtet worden, dass sie sich zu wahren Wildnissen entwickelt hatten, in denen das Totholz weißlich leuchtete. Die einstigen Quellen waren versandet, und ein kleiner See, der am Fuß eines Hügels gegen verschilfte Ufer schwappte, hatte trübes, faulig riechendes Wasser, dessen Genuss ich mir trotz großen Durstes versagen musste. Einzelne hohe, oft kahle Bäume sah ich da und dort, manche mit geborstenen, zersplitterten Stämmen; andere mit wie abrasierten Wipfeln. Auf den höchsten Bäumen machte ich die Silhouetten einer Gruppe großer Greifvögel aus, doch sparte ich mir die Mühe, den Feldstecher herauszuholen, um sie genauer zu erkennen; wenn ich mich erst einmal im Dorf eingerichtet hätte, werde noch reichlich Gelegenheit dazu sein, sagte ich mir. In den Hügeln klafften da und dort riesige Löcher, die ich mir nicht erklären konnte. Noch seltsamer waren die Felsbrocken, die überall verstreut waren. Sie sahen aus wie Splitter des steinigen Gebirges, das hinter dem Dorf aufragte, und auf ihren sonnenbeschienenen Abbruchflächen bemerkte ich Eidechsen in großer Zahl (leuchtend grün auch häufig Lacerta viridis). Die Häuser des Dorfes, das nun nicht mehr fern lag, hatten dieselbe Farbe wie diese Steine, sie waren aus grauem Holz gebaut und hatten graue Dächer, und sie wirkten nicht weniger verwahrlost und abweisend als das Land ringsum.
Das Gewicht meiner Ausrüstung zwang mich, immer wieder innezuhalten. Es war heiß geworden, und mein Hemd war durchgeschwitzt. Von der hoch liegenden Ansiedlung aus musste man mich längst gesehen haben, doch vergeblich hielt ich nach einem Menschen Ausschau, der mir beim Tragen des schweren Rucksacks und des Koffers behilflich sein konnte. Ein Graben zog sich am Rand des Weges hin. Er war voller Abfall. Aber ich bemerkte nicht nur verrottete Kleidungsstücke, einzelne Schuhe und andere Reste gewöhnlichen Zivilisationsmülls, sondern auch große rostige Metallteile, eine verschimmelte Pistolentasche, etwas, was halb im Boden steckte und wie eine Granate aussah, und an einer Stelle ein verbranntes, verbogenes Gewehr. Im Verbund mit den vorhergehenden Beobachtungen schien der Gedanke nahezuliegen, dass es in dieser Gegend in nicht allzu ferner Vergangenheit kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hatte, deren Werkzeuge in diesem Graben verfaulten. Ich hatte nichts davon gehört oder gelesen – obwohl ich regelmäßig unser Tagblatt las und als einer der Ersten im Kollegium sogar einen Fernsehapparat besaß –, ich wusste nicht, wofür hier gekämpft und vielleicht getötet worden war, was Menschen dazu bewogen hatte, auf das Verderben anderer zu sinnen und sich mit der Waffe in der Hand auf ihre Nächsten zu stürzen. Wieder einmal wurde mir schmerzlich die Zersplitterung unserer Welt bewusst, deren einzelne Teile nichts voneinander zu wissen und noch weniger voneinander zu lernen scheinen, nichts jedenfalls, was über die oberflächlichen Bedürfnisse von Fremdenverkehr und Handel hinausgeht. Ich musste an meinen Vater denken, der mir in seinen letzten Jahren so oft vom Krieg erzählt hatte, daran, dass er sich von seinen Vorgesetzten und nicht weniger von seinen Kameraden abgestoßen gefühlt hatte wie von Teufeln; und daran, dass in der langen Gefangenschaft die Liebe zur Natur, insbesondere zu den Vögeln, in ihm gewachsen war, die er mir vererbt hat. Auch für mich war die Natur in ihrer schönen Ordnung, deren Glieder letztlich »alle zum Leben wirken«, wie der Dichter sagt, Zuflucht und Trost; es war mir zur Gewohnheit geworden, in den wenigen freien Stunden, die der Beruf mir ließ, Flora und Fauna eifrig zu studieren, auch wenn ich mir die Meinen damit nicht gewogen machte, und angesichts der eigentümlichen Verwundungen dieser Landschaft tröstete mich der Gedanke, dass die Natur auch hier schon bald für Erneuerung und heilsames Vergessen sorgen würde.
Das Dorf, das ich nach dem mühevollen dreistündigen Fußmarsch endlich erreichte, war schmutzig und machte einen düsteren Eindruck. Alles sprach von Rückständigkeit und bitterer Armut. Die grauen Häuser hatten Fundamente aus fest gefügten Steinen, doch die Stockwerke wirkten so primitiv, so hastig und kunstlos gebaut, dass es aussah, als könnte der nächste Sturm sie mühelos in ihre Einzelteile zerlegen. Allerdings war es offenbar gerade diese meinen menschlichen Maßstäben so wenig genügende Bauart, die den lieben Vögeln in höchstem Maße nützlich vorkam. Während ich eine schmale schattige Gasse bergauf ging, wurde mir klar, dass sie sich in ungewöhnlich großer Zahl hier heimisch fühlten. In den Rinnsteinen, den breiten Steinfugen, den Löchern und Höhlungen der Wände und zwischen den wie erschöpft aneinanderlehnenden Häusern bemerkte ich ihre Nester. Wo ich auch hinsah, schwirrten Aves aller möglichen Gattungen und Arten ein und aus, überall zeigten sie sich in lärmender Geschäftigkeit. Die Zahl der in bodennahen Ritzen und Spalten, in einzeln hervorwuchernden Büschen und auf den unregelmäßig gepflasterten Wegen herumhüpfenden Sperlinge war kaum zu schätzen, es mussten viele Hundert sein. Darüber, auf Dächern und Antennen, flogen Dohlen, Elstern, Stare, Finken, Meisen, Zeisige und noch vieles mehr, was ich nur flüchtig wahrnahm und nicht gleich prüfen konnte. Durch die Luft stürzten mit schrillen Rufen zahllose Mauersegler, und auf den zwischen den Gebäuden gespannten Drähten saßen junge Schwalben. Es wurde mir nun auch bewusst, dass Menschen um mich waren, die mich beobachteten. Aus den dunklen Fensterlöchern traten ausdruckslose Gesichter ins Licht, und hinter mir sammelte sich eine Reihe zerlumpter Kinder, die mir in Gesellschaft ihrer stummen, struppigen Hunde im Abstand von einigen Metern misstrauisch folgten.
Ich wählte ein Haus, dessen verwitterte Inschrift auf der Vorderfront es als »Hotel International« auswies. Unter seinem löchrigen grauen Ziegeldach klebten die Nester einer Mehlschwalbenkolonie, und die muntere vielstimmige Unterhaltung der anmutigen Tiere war für mich der schönste Willkommensgruß. Ich trat durch die Tür und befand mich in einer Art Glasveranda mit weißen gehäkelten Vorhängen. Ein schwarzer alter Tisch stand in der Mitte, darum herum einige Hocker. In der Wand waren Fächer eingelassen, in denen grobes gelbliches Steingutgeschirr Platz fand. Alles war still, niemand schien mein Kommen bemerkt zu haben. Ich rief ein paarmal leise in Richtung der engen Treppe, die an der Breitseite des Raumes in den ersten Stock führte, aber niemand antwortete. Wie entlegen kam mir plötzlich das kleine Land vor, das ich Heimat nannte und dem ich doch mit so viel Freude entflohen war. Und ich selbst, mit meiner weißen glatten Haut, meiner unnützen Beschäftigung, von Landsleuten und Familie gänzlich abgesondert, musste ich den hier Ansässigen nicht vorkommen wie ein Simpel? Nach einer quälend langen Zeit öffnete sich endlich eine Tür, und eine junge Frau kam herein. Mit einem Blick umfasste ich hinter ihr einen Hof mit aufgespannter nasser Wäsche, pickenden Hühnern, Kaninchenställen und einem rostigen Blechbottich, der wohl zum Schnapsbrennen diente. Die Frau war stark und breitschultrig, und unter ihrem Kopftuch hing ein langer blonder Zopf zwischen ihren Schulterblättern herab. Merkwürdiger noch als ihre raue, krächzende Stimme waren ihre Augen, große, runde, dunkle Augen, die mich mit ungeheuerlicher Feindseligkeit anstarrten. Vergeblich versuchte ich mich ihr verständlich zu machen. Sie verstand kein Wort der heutigen bekannten Verkehrssprachen (die ich, wie ich mir schmeicheln darf, sämtlich fließend spreche), sodass unsere Unterhaltung auf Gesten beschränkt blieb. Ich begriff, dass es keine Zimmer und kein Essen gab und dass sie mich allerhöchstens für eine Nacht notdürftig unterbringen könne. Da ich viel zu erschöpft war, um mich nach etwas anderem umzusehen, ließ ich mich zu dem Zimmer führen und hoffte, dass sich für meinen knurrenden Magen noch Abhilfe finden lassen würde.
Das Zimmer war ein großer Raum mit mehreren Fenstern und niedriger Decke, vollgestellt mit grobgezimmerten Betten ohne Matratzen und Decken. Dass hier einmal viele Menschen gelebt hatten, zeigten Schriftzüge und eingeschnitzte Zeichen auf den Bettgestellen; vielleicht waren es Soldaten gewesen. In einem Nebenraum war ein Wasserhahn mit Gartenschlauch und ein Loch im Boden als Abort. Ich stellte meine Sachen ab und ließ klares kaltes Wasser aus dem Schlauch über meinen Rücken laufen. Danach fühlte ich mich besser. Die Fenster boten eine spektakuläre Aussicht. Ich sah einen grünen Hang mit Obstbäumen und dahinter sehr nah den schroffen Fels der Berge. Als ich etwa dreißig Meter entfernt auf dem Dach eines alten Schuppens einen bräunlichroten Vogel mit langem, gebogenem Schnabel und schwarz-schweiß gebänderten Flügeln erblickte, durchfuhr mich ein freudiger Schreck. Hastig griff ich nach dem Feldstecher und konnte mich bald vergewissern, dass es sich tatsächlich um einen Wiedehopf handelte, der wohl das Herz jedes Vogelliebhabers höher schlagen lässt.
Bis zum Einbruch der Dämmerung beschäftigte mich dieses eigenartige Tier, das mit seinem langen Schnabel im Gras stocherte, um ein ihm folgendes fast ausgewachsenes Junges mit Raupen und Grillen zu füttern; immer wieder sah ich beide Vögel in der Pracht ihrer aufgestellten fächerförmigen Federhaube, und im Streiflicht der untergehenden Sonne gelangen mir einige schöne fotografische Aufnahmen. Nach beendeter Fütterung flog der Altvogel auf einen Pfosten, und ich hörte das dumpfe, weittragende Up-up-up, von dem sein wissenschaftlicher Name Upupa epops abgeleitet ist. Ich brauchte das Glas nicht mehr. Reglos am Fenster stehend, war ich ganz dem Anblick der vor meinen Augen ruhig hin und her spazierenden, sich höchstens zu kurzen Flügen auf benachbarte Dächer aufschwingenden Vögel hingegeben. Welch ein Privileg schien es mir zu sein, diesen wunderbaren Wesen eine Zeit lang nahe sein zu dürfen. Fast kam es mir vor, als hätte nicht ich sie aufgespürt, sondern als hätten sie mich hierher gerufen, und es war mir auf einmal ganz begreiflich, dass dem Wiedehopf in östlichen Glaubenstraditionen die Rolle des Boten und Seelenführers auf mystischen Wegen zugeschrieben worden ist.
Es wurde dunkel, und mein knurrender Magen zwang mich, auf Nahrungssuche zu gehen. Meine Wirtin war nirgends zu sehen, ebenso wenig gab es Anzeichen einer Küche oder Kochgelegenheit. In den Gassen des Dorfes waren nur noch die Hunde unterwegs, und als ich die Tür eines Ladens öffnen wollte, in dem grelles elektrisches Licht ein ärmliches Viktualienangebot beschien, sprangen mehrere dieser Köter mit wütendem Gebell auf mich zu und drängten mich mit gebleckten Zähnen zurück. Ich hatte nichts, mit dem ich mich ihrer erwehren konnte, versuchte aber, mit Geschrei auf meine Notlage aufmerksam zu machen. Es bewirkte zwar, dass die Hunde knurrend von mir abließen und sich vor dem Eingang des Ladens hechelnd niederließen; Menschen kamen mir aber nicht zu Hilfe – ich sah im Gegenteil ringsum Gesichter hinter Fensterscheiben vor mir zurückweichen. Enttäuschung und Empörung ließen mein Herz schneller schlagen, ich durchmaß das Dorf in schnellem Schritt und gelangte auf die ansteigende Wiese, auf der ich eben noch den Wiedehopf gesehen hatte. Ich lief weiter bis zu einem kleinen Buckel, von dem aus das ganze weite Land vor mir lag. Weiße Wolkenschlieren am Himmel erinnerten mich an eine bekritzelte Schultafel. Doch als die Sonne unterging, nahmen sie die Farben von Flammen an, die den einförmig hellgrauen Himmel umgriffen, um dann in Zeitlupe in unregelmäßige orange-gelb-schwarze Flecken und Spritzer zu zerreißen und wie ein erstarrter Funkenregen in der Luft zu verharren. Von der Erde stieg Rauch auf, es war die Nacht, deren Schwärze allmählich auch das letzte matte Orange am Himmel verschlang. »Es bricht die neue Welt herein und verdunkelt den hellsten Sonnenschein«, diese Verse fielen mir ein, die ich vor Kurzem gelesen haben musste, doch ich verscheuchte die traurigen Gedanken, die dabei in mir aufsteigen wollten. Seit Langem hatte ich es mir zum Prinzip gemacht, eine missliche Lage so zu betrachten, dass sich doch irgendetwas Gutes für mich herausholen ließ, und so sagte ich mir jetzt, dass die Begegnung mit dem Wiedehopf schließlich den ganzen mühseligen Abstecher wert gewesen sei. Ich würde meinen Freunden etwas zu erzählen haben! Gleich am nächsten Morgen, so nahm ich mir vor, würde ich das ungastliche Dorf wieder verlassen, entweder ein Auto auftreiben oder zur Not zu Fuß den nächsten Bahnhof erreichen, um dort auf den Schnellzug zu warten. Die Stadt B., mein ursprüngliches Reiseziel, war keine hundert Kilometer entfernt; ein komfortables Hotelzimmer erwartete mich.
Im Dorf herrschte vollständige Dunkelheit. Alle Lichter, die in der Dämmerung noch da und dort geleuchtet hatten, waren verschwunden, und in der Stille der Nacht lösten sich die Konturen der Häuser auf und verschwammen mit der tiefen Nacht. Zum Glück habe ich ein sehr gutes Orientierungsvermögen, doch meine Angst vor den Hunden hatte keineswegs nachgelassen, und so tastete ich mich zaghaft abwärts. Einmal sah ich etwas Helles neben meinem Kopf und wurde von etwas Weichem gestreift. Gleich darauf vernahm ich ganz in der Nähe die charakteristischen zischenden Drohrufe einer Schleiereule (Tyto alba). In größerer Höhe – oberhalb des Pfostens, auf dem nachmittags der Wiedehopf gesessen hatte – schienen noch mehr Nachtvögel zu jagen; einmal hörte ich das wütende Fauchen einer Waldohreule, dann das langgezogene Glissando eines Steinkauzmännchens und an anderen Stellen die Rufe weiterer Vertreter der so oft als Unglücksvögel verkannten Vertreter der Strigiformes, die hier offenbar einen besonderen Tummelplatz gefunden hatten. Endlich befand ich mich wieder in meiner Unterkunft. Auch hier war alles stockfinster. Kein Mensch ließ sich sehen. Im Zimmer wollte ich ein Streichholz anzünden, aber ich fand den Rucksack nicht, in dessen Seitenfach sich die Streichhölzer befanden, und so zog ich mich aus und ließ mich einfach auf das ertastete Bett am Fenster fallen. Nach unruhigem Schlaf wurde ich gegen Morgen durch einen ungeheuren Aufruhr im Hof wach. Hähne krähten, Gänse schrien, Hunde bellten, und ein schreckliches Geraschel verriet den Einfall eines nächtlichen Jägers ins Revier der Haustiere. Von Menschen hörte ich indessen keinen Ton, sodass ich auf den absurden Gedanken kam, der Eindringling müsse mit ihrer Billigung sein blutiges Werk verrichten. Oder waren die Menschen gar nicht da? Schliefen sie vielleicht nicht in ihren Häusern, sondern frönten an irgendeinem geheimen Versammlungsort dunklen Leidenschaften? Sobald das erste Morgenlicht über den Bergen erschien und die Hauswand gegenüber wieder sichtbar werden ließ, lachte ich über diese bizarren Spekulationen und stellte fest, dass stundenlanges Fasten im Verbund mit der fremden Umgebung wohl eine ungewohnt starke Phantasietätigkeit bei mir ausgelöst hatte.
Mein Bett stand parallel zu den Fenstern. Das Dorf lag noch im Schatten, während die taufeuchten Dächer schon in der Sonne glänzten. Schlaftrunken sah ich hinaus und erstarrte: Über der grauen Felsenkette war mit ausgebreiteten Schwingen ein großer Vogel aufgetaucht. Und was für ein Vogel! Die Schönheit seiner Gestalt, die Leichtigkeit und Eleganz seines schwebenden Fluges schlugen mich sofort in Bann, und mit angehaltenem Atem verfolgte ich jede Bewegung dieses unbeschreiblich majestätischen Tiers. Mein Jagdinstinkt war geweckt. Denn mir war klar, dass es sich um etwas Besonderes handeln musste. Weihen und Milane schloss ich sofort aus, da sie sich nicht in solcher Höhe bewegen. Konnte es ein Stein- oder Schreiadler sein (oder ein seltenerer Aquila heliaca)? Nein, auch wenn sich die Silhouette ähnelte, war dieser Vogel doch viel größer. Wegen der Kopfform konnte man an einen Schmutzgeier (Neophron percnopterus) denken; die weiteren Merkmale, die ich mit zusammengekniffenen Augen ausmachte – der lange, keilförmige Stoß, die riesigen Flügel, der helle Kopf –, legten einen Lämmer- oder gar Mönchsgeier (Aegypius monachus) nahe; doch die Form der Schwungfedern, die Farbe des Gefieders ließen mich gleich wieder daran zweifeln. Wie ich es auch drehte und wendete, die Einzelheiten passten nicht zusammen, und ich kam zu keiner befriedigenden Lösung. Blitzschnell schossen mir die abenteuerlichsten Möglichkeiten durch den Kopf, flüchtig dachte ich sogar an die furchterregende, dämonisch wirkende Harpyie (Harpia harpyja), der der Vogel mit seinen breiten Flügeln, dem mächtigen Kopf entfernt glich, doch da ihr Verbreitungsgebiet bekanntlich auf der anderen Seite des Globus liegt, führte auch diese Spur nicht weiter. Als ich mich zur Seite beugte, um wie gewohnt den Feldstecher aus dem Rucksack zu ziehen, griff ich ins Leere.
Ich hatte den Rucksack eigens deshalb unter das Bett geschoben, um ihn während der Nacht in der Nähe zu haben. Man musste ihn mir schon gestohlen haben, als ich mich am Vortag auf die Suche nach etwas zu essen gemacht hatte. Er enthielt Dinge von allergrößtem Wert, die gleichzeitig meine gesamte Forscherexistenz symbolisierten: mein liebes altes Fernglas, das mein Vater mir zum Examen geschenkt hatte; das erst vor Kurzem erworbene Spektiv; meine gute Leica; außerdem das unabdingbare Bestimmungsbuch und einen klappbaren Habichtfangkorb. Als Präparator verließ ich mich vor allem auf diesen praktischen Apparat, mit dessen Hilfe ich schon viele herrliche Stücke hatte erbeuten können. Der Verlust der Ausrüstung war ein empfindlicher Schlag für mich. Mit meinem mageren Lehrergehalt hatte ich lange dafür sparen müssen; manches, was ich als Ehemann und Vater meiner Familie hätte zukommen lassen können, war in die teuren Utensilien geflossen – kurz: Dieser Rucksack war das Beste, was ich besaß. Das Gefühl, von den Leuten des Dorfes grundlos zurückgewiesen zu werden, steigerte sich angesichts dieses ungeheuerlichen Raubes zu hitziger Wut. Doch nachdem ich eine Weile wie blind das Zimmer und die Umgebung abgesucht hatte, wurde mir bald die Sinnlosigkeit meines Tuns klar. Mein Rucksack war weg, und ich konnte auf niemanden hoffen, der mir half, ihn wiederzufinden.
Immerhin, den Koffer hatten sie mir gelassen. Und in diesen Koffer hatte ich aus einem seltsamen Impuls heraus kurz vor der Abreise noch das kleine Fangnetz zwischen die Wäschestücke geschoben, an das ich mich jetzt erinnerte.
Mit diesem Fangnetz in Händen stand ich am Fenster, bis ich meine Seelenruhe wiedergefunden hatte. Nein, ich durfte jetzt nicht kapitulieren. Die großen Vögel – allmählich erkannte ich, dass es zwei oder noch mehr waren, die gemeinsam jagten – zogen vor meinen Augen in der Höhe ihre majestätischen Kreise. Sie waren das Beste, das Größte, das Wunderbarste, was mir je begegnet war; sie waren das, wovon jeder träumt, der sich unserer Zunft je angeschlossen hat, das Besondere und Einmalige, das die vielen langen Stunden fruchtlosen Wartens und Beobachtens in der ersten Morgenfrühe, zusammengekrümmt im einsamen Tarnzelt oder im Unterholz, rechtfertigt, das Unerhörte, nach dem jeder von uns sich sehnt, auf das jeder von uns hofft, wenn er, aufgeschreckt durch eine nicht gleich einzuordnende Silhouette, ein erstaunliches Flugmanöver, einen befremdlichen Ruf, das Fernglas zückt – um mit einer gewissen Enttäuschung immer nur wieder auf die erwartbaren Arten zu stoßen.
Meine Reise hatte sich also doch gelohnt. Während ich das Fangnetz prüfte und die Schuhe schnürte, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Sie bezogen sich auf Konkretes und Naheliegendes; ich fragte mich, wie ich meinen Vogel möglichst unbemerkt transportieren konnte, wie ich ihn durch den Zoll bekam usw. Dass ich ihn fangen würde, daran bestand für mich nicht der geringste Zweifel. Natürlich bedauerte ich, den Habichtskorb nicht benutzen zu können, aber ich hatte genug Erfahrung, um zu wissen, dass es mir auch ohne dieses sichere Hilfsmittel gelingen würde. Ich sah ihn vor mir. Ich würde ihn mit halb ausgebreiteten Flügeln darstellen, auf einem rauen, malerischen Stein, etwas geduckt, aber wach und gespannt, in der typischen Haltung eines Greifvogels, der im Begriff steht, sich in die Luft zu erheben. Er würde zwischen meinen besten Präparaten den Ehrenplatz einnehmen; mit seinem gesträubten weißen Kopf, seinem starken Schnabel würde er die Bussarde, Falken, Sperber und Milane meiner Sammlung überragen, ja, sie würden sich ihm gegenüber unbedeutend und trivial ausnehmen wie Diener vor ihrem Herrn. Der unergründliche Blick seiner schwarzen, glänzenden Glasaugen würde jeden Betrachter das Fürchten lehren – und ich wäre der Schöpfer dieses beeindruckenden Werks! Ich sah schon die bewundernden Blicke meiner Freunde vor mir, dieser Angsthasen und Stubenhocker, die den kleinen Kreis der Ornithologischen Gesellschaft bildeten, mit ihren Wandertreffs, ihren Vorträgen und Diaabenden – ach, wie hilflos und armselig waren unsere Versuche gewesen, uns der Natur zu nähern, dieser geheimnisvollen Fremden, die, je mehr man von ihr weiß, nur umso unergründlicher wird … und doch hat dieses alte Gesetz noch keinen Menschen davon abgehalten, mehr über sie wissen zu wollen … und ich würde nun Gelegenheit haben, mich vor ihnen allen auszuzeichnen und unsere Zunft einen großen Schritt voranzubrigen …
Unter solchen Gedanken trat ich aus der Tür. Ich sah weder Menschen noch Hunde, und sogar die Vögel schienen sich zurückgezogen zu haben; von ihrer munteren Regsamkeit am Vortag war jedenfalls nichts mehr zu spüren. Die Stille war voller Feindseligkeit, doch niemand behelligte mich. Erst als ich die letzten Häuser erreichte und den Hang mit dem alten Telefonpfosten vor mir sah – dahinter wand sich ein schmaler Pfad in langen Schleifen stetig bergauf –, wurde ich aufgehalten.
Bevor der Mann in mein Gesichtsfeld trat, wich ich zurück. Ich hatte einen leichten Geruch wahrgenommen, der mich auf unbestimmte Weise reizte, alarmierte, erschreckte. Es war ein Geruch nach etwas Unzuträglichem, Fauligem, ein Geruch, der aus dem Tierreich kam und sofort tiefste Abneigung in mir weckte. Er haftete an dem Unbekannten, schwächte sich allerdings ab, als er zu reden begann, sodass er mich bald gar nicht mehr störte (oder war das schon der Effekt der Gewöhnung?). Der Mann war kleiner als ich, aber überaus kräftig und stämmig, hatte schwarzes, dichtes Haar, eine niedrige Stirn und tief liegende Augen, und unter der bleichen, sorgfältig rasierten Haut sah man den Schatten des dunklen Barts, der sich von den starken Wangenknochen bis zu dem muskulösen Hals zog. Äußerst gepflegt, europäisch gekleidet, begrüßte er mich akzentfrei in meiner Sprache und kannte sogar – was mich aufs Äußerste verunsicherte – meinen Namen.
»Darf ich Sie bitten, mich zu begleiten, Herr Weyde«, sagte er. »Es dauert nicht lange.«
Man hätte ihn für einen Fremdenführer halten können, doch seine diskrete Aufforderung klang eher wie der Befehl eines Polizisten oder Geheimagenten, dem unbedingt Folge zu leisten ist. Ich war abgestoßen, verblüfft, sprachlos – und, wie ich gestehen muss, auch unbändig neugierig. Mit überraschend gewandten, fast tänzerisch-leichten Bewegungen ging er mir voran und führte mich zu einem Haus – es war mir zuvor nicht aufgefallen –, das besser gebaut und höher war als die anderen Gebäude im Dorf. Im Innern war es kühl, still, doch man hörte entfernte Stimmen und metallische, irgendwie bedrohlich wirkende Geräusche. Über eine abgetretene Treppe gelangten wir in einen weiten, unregelmäßigen, feierlich wirkenden Raum, in den durch ein kuppelartiges Oberlicht der helle Tag fiel. Flüchtig sah ich mit Schlössern versehene Kisten auf dem Boden und darüber an großen Haken Kleidungsstücke, die ich zunächst für lange, zottige Flickenmäntel hielt. Erst ein paar Minuten später – wir waren schon im nächsten Raum – machte ich mir klar, dass die grau-braun-weißen Flicken, die ich gesehen hatte, in Wahrheit Federn waren.
Der nächste Raum war klein und wohnlich. Die Wände waren weiß verputzt, durch das große Fenster blickte man auf das pittoreske Felsengebirge. Schöne alte Teppiche lagen auf dem Boden und auf den Bänken an der Wand, und auf einem Tischchen standen Teetassen und eine Schale mit Gebäck bereit. Der Unbekannte wies mir einen Sitzplatz an. Angesichts der verführerischen Leckereien überwältigte mich der Hunger, und ich stürzte mich auf die klebrigen Kuchen, die allerdings meinen Hunger nicht stillen konnten, ihn mir vielmehr erst recht fühlbar machten. Mein Gegenüber goss mir Tee ein und sah mit unangenehmer Miene zu, wie ich gierig aß und trank. Dann stellte er fest: »Deshalb sind Sie hier«, und zeigte zum Fenster.
Ich traute meinen Augen nicht: Da war er wieder, der unbekannte Vogel, das herrliche Wesen, das noch keinen Namen hatte. Es schwebte verblüffend nah über den letzten Krüppeltannen des Hangs.
Die Stimme meines Gastgebers drang an mein Ohr. Doch ich bin außerstande, in wörtlicher Form wiederzugeben, was er mir sagte. Das alles war so überraschend, so rätselhaft, dass ich zunächst kaum begriff, worum es überhaupt ging. Was er sagen wollte, war, dass man mir den Fang des Vogels nicht erlaubte. Dass ich, wenn ich das Verbot nicht achtete, mit einer Strafe zu rechnen hätte. In wessen Namen sprach er? Wer hatte ihm seine Autorität verliehen? Jedenfalls wurde mir klar, dass die Leute in diesem wie von der Zeit vergessenen Dorf den sonderbaren Greif als eine Art Gott verehrten. Sie schrieben ihm überirdische Kräfte zu und glaubten, ihm Gehorsam zu schulden. Der Stämmige schien eine Art Wächter oder Gesandter zu sein, der sich für berechtigt hielt, anderen Weisungen zu erteilen. Er sprach von »wir«, von »unseren Bergen«, »unseren Pflichten«.
Musste ich mir das alles anhören wie ein dummer Junge? »Sie reden immer von ›wir‹«, rief ich ihm zu, »aber Sie vergessen mich! Ihr seid nicht mehr allein – denn jetzt bin ich da!« Übermütig lachte ich ihm ins Gesicht. Plötzlich erkannte ich, dass sich unter seinem feinen Anzug ein unansehnlicher grober und schmutziger Körper verbergen musste. Er zeigte wieder zum Fenster: Der Vogel war so nah, dass er fast das Fenster streifte – aber im nächsten Augenblick sah ich ihn nicht mehr – er musste in einem rasanten Manöver abgedreht haben. Die Hand meines Gegenübers lag im Schoß. Jetzt hob er sie – erneut schwebte der Vogel heran und drehte seinen imposanten Kopf hin und her – um beim nächsten Handsenken blitzschnell zu verschwinden. Ich beobachtete diesen sinnverwirrenden Hokuspokus eine Weile und spürte, dass ich immer wütender wurde. Glaubte dieser Mensch wirklich, mich mit seinen Zauberkunststücken beeindrucken zu können? Wer war er? Und warum sollte ich mehr in ihm sehen als ein hässliches, stinkendes, aufdringliches Scheusal, das versuchte, mich von dem abzubringen, was ich mir nun einmal vorgenommen hatte?
Ich ließ mich nicht von ihm aufhalten – weder von ihm noch von den anderen, deren Anwesenheit ich schattenhaft wahrnahm, während ich mich wieder hinausführen ließ. Diesmal ging es über eine wacklige Außentreppe direkt auf die Gasse.
»Dann also auf Wiedersehen«, sagte der Unheimliche ganz ruhig, während er mich mit einem kalten, stechenden Blick bedachte.
Ich war immer noch voller Ärger, fühlte mich provoziert, beleidigt, aufgebracht bis zur Erbitterung, und konnte mich nicht dazu überwinden, die Hand zu nehmen, die er mir hinstreckte. Da tippte er mich mit einem Finger ganz leicht an und traf den Stoff meiner Jacke genau dort, wo in der Innentasche das Fangnetz steckte. Es war natürlich Zufall – es war nichts –, und doch empfand ich die leichte Berührung wie Feuer und krümmte mich unwillkürlich, als hätte mich ein glühendes Messer gestochen. Im nächsten Augenblick war es vorbei, und ohne zu zögern strebte ich von ihm fort, den Felsen zu, über denen die geheimnisvollen Vögel kreisten. Die schmerzhafte Empfindung verschwand aber nicht ganz. Obwohl ich mich vergewissert hatte, dass mein Äußeres völlig unversehrt war, drängte sich mir immer wieder die absurde Vorstellung auf, dass ich mit der kleinen Berührung der haarigen Hand irgendwie markiert oder gezeichnet worden war. Verwirrung, Unruhe mischte sich in die Entschlossenheit, mit der ich von meinem Kontrahenten wegstrebte. »Kontrahent«? Wie kam ich dazu, den Unbekannten so zu bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir unser kurzes Treffen in diesem Moment wie ein Kampf vorkam, ein Duell um einen Gegenstand, den ich ebenso wenig benennen konnte wie die Ursache der seltsam erhobenen, mit der Energie der Neugier, dem Feuer des Zorns gemischten Stimmung, in die ich geriet, als die grauen Felsen, von tiefschwarzen Rissen und Spalten zerklüftet, mit dürren, verkrümmten Gewächsen und verharschten Schneefeldern an den Schattseiten, wie unübersteigbare Wände vor mir auftauchten.
Bald war das Dorf nicht mehr sichtbar, und ich wanderte mit gleichmäßigem Schritt bergauf. Immer wieder lachte ich laut, als die Mienen meiner Freunde schemenhaft vor mir auftauchten, dieser so wackeren und wissbegierigen Männer, mit denen ich stumme Zwiesprache hielt. Wer von ihnen hätte nicht genauso gehandelt wie ich? Waren wir nicht alle dazu entschlossen, dem Zauber trügerischer Mythen zu widerstehen, strebten wir nicht nach neuen Entdeckungen, nach erweitertem Wissen, besserem Begreifen? Begriff und Besitz aber sind miteinander verwandt; und wie wir als beflissene Forscher alles taten, um zu bemeistern, was uns durch immer neue Rätsel herausforderte, indem wir uns um die treffende Bestimmung bemühten, schien uns auch der Wunsch nach Bereicherung unserer Sammlungen, Abbilder des ungeheuren Reichtums der Natur, tief eingewurzelt zu sein. Was trieb mich also? Ich hätte das Nächstliegende tun können, hätte, statt mich auf diesen ebenso strapaziösen wie riskanten Aufstieg zu begeben, den Weg zum nächsten Bahnhof einschlagen können, wie ich es mir am Abend des vorigen Tages vorgenommen hatte, aber das stand nun – selbst wenn ich die Prüfungen gekannt hätte, die mich noch erwarteten, das Ausharren unter dem Felsvorsprung, die nächtliche Kälte, zitternde Muskeln, quälender Hunger und Durst – völlig außer Frage. Der Raub des Rucksacks und dann das seltsame Geplänkel mit dem Unbekannten hatte mein Jagdfieber erst richtig entfacht. Ich wollte diesen Vogel nicht nur benennen. Ich wollte ihn haben. Und ich sollte ihn bekommen …
Der beste Jäger geht mit kaltem Blut vor, sagt man, doch im Grunde folgt er einer inneren Weisung, einem Instinkt, der ihn hellwach und scharfsichtig und seinem tierischen Gegner ebenbürtig werden lässt. Er nähert sich diesem Gegner, verliert dabei sein höheres Selbst und sinkt zurück auf die Stufe eines primitiven Seins, auf dem Mensch und Tier noch nicht scharf geschieden sind. Mir wuchsen Kräfte zu, von denen ich selbst nichts gewusst hatte. Jede Angst war verflogen. Statt der zerstreuten Gedanken und oberflächlichen Empfindungen des Normalzustands war nur noch eins in mir lebendig: das Verlangen, die Beute aufzuspüren, zu fangen und zu töten. Nach einigen Stunden sah ich einen Punkt über mir kreisen. In einiger Entfernung einen weiteren. Auch ohne Feldstecher wusste ich, dass ich das Revier des Vogels erreicht hatte, und nun dauerte es nicht mehr lange, bis ich den Horst ausfindig gemacht hatte und mir eine geeignete Strategie für mein Vorhaben überlegen konnte.
Es gab aber, bevor es zum letzten, entscheidenden und erfolgreichen Schritt kam, ein Vorkommnis, das mich für einen Moment aus der Bahn warf, etwas Unerklärliches und zutiefst Beängstigendes, eine Art Traum im Wachzustand. Wie sich zeigen sollte, hatte es am Ende stärkere Auswirkungen auf mein Leben als der Fang selbst. Ich sprach mit keinem Menschen darüber, aber ich konnte es nicht vergessen, und die Freude an meiner Sammlung, die durch die herrliche Trophäe unter Fachleuten bald Berühmtheit erlangte, war mir auf immer vergällt.
Die Hänge waren steinig, und immer wieder kollerten schwere Steine in einer Staubwolke nach unten, sodass ich mich, sobald ich das Geräusch über mir hörte, an die tief im Schatten liegende Wand drücken musste, um nicht getroffen zu werden. Mit Mühe war ich über einen astreichen entwurzelten Baum geklettert, der den Weg versperrte, als ich den großen Greif plötzlich vor mir sah. Leicht geduckt, mit halb ausgebreiteten Schwingen, hockte er in genau der Haltung, die ich mir für die Präparation vorgenommen hatte, auf einem aufragenden Felszacken mir gegenüber und starrte mich an. Die Entfernung betrug etwa zwanzig Meter. Ich sah das prachtvolle, schillernde Gefieder, das mir einmal grau-braun, einmal schwärzlich vorkam, den weißen Kopf, die runden Augen unter den knöchernen Vorsprüngen des Schädels – diese Augen, deren Schärfe das Menschenauge um ein Vielfaches übertrifft –, ich sah den mächtigen Schnabel, die dolchspitzen gelben Krallen – und im selben Moment hörte ich auf, ich selbst zu sein. Es war, als ob ich mich plötzlich mit seinen Augen sehen könnte. Mein Tun schien mir ebenso gespenstisch wie lächerlich und vergeblich zu sein, da es an dem grundsätzlichen Faktum meiner Schwäche, meiner Unterlegenheit nichts änderte. Meine Neugier hatte mich hierher geführt; meine Wissbegierde rechtfertigte das Sakrileg; mein Jagdinstinkt, das brennende Verlangen, mich mit diesem Tier zu messen und es als Abbild zu besitzen, hatten mir Kraft und Ausdauer verliehen, aber jetzt fiel das alles in sich zusammen wie ein Feuer, dem man den Sauerstoff entzieht. Ich spürte die tiefe Ermattung meines Körpers im Schatten, während der Vogel sich ohne Eile in den Abgrund fallen ließ, die majestätischen Schwingen ausbreitete und, in der abendlichen Sonne glänzend, ruhig unter mir schwebte. Als ich ihn aus den Augen verlor, fühlte ich mich so einsam wie nie zuvor. Die Einsamkeit ließ mich erstarren. Meine Arme und Beine waren eiskalt und bewegten sich nicht mehr, und meine Gedanken verloren ihren Zusammenhang. Die äußere Welt – meine nächste Umgebung – Steine, Staub, gelbe Flechten, Ameisen, ein Mauseloch – kam mir fremder vor als die Oberfläche des wüstesten Planeten. Ich hörte meine Zähne aufeinanderschlagen. Die Vorstellung, im kalten Schatten dieser Felsen unsichtbar zu werden, verloren zu gehen, zu verschwinden, ließ mich nicht mehr los. Ja, ich würde verschwinden – und mit mir meine Kinder und deren Kinder –, vom Licht vergessen, würden unsere Konturen sich auflösen, unsere Körper würden mit dem Schatten der Erde verschwimmen, und die Finsternis des Universums würde uns aufsaugen und verschlucken – dieser Gott aber, dessen Machtbefugnis ich nicht mehr bezweifeln konnte, er würde bleiben …
(Konrad Weyde, Der Vogelgott.Unveröffentlichtes Manuskript)
IIM LAND DER AZA
Niemand hat mich gebeten, diesen Bericht zu schreiben, und ich fürchte, er wird nur Widerwillen oder herablassende Besorgnis ernten wie alles, was ich seit meiner Rückkehr aus Kiw-Aza den Ärzten gegenüber geäußert habe. Es wird nicht leicht sein, noch einmal einzutauchen in die so schmerzlichen und verwirrenden Geschehnisse, mich noch einmal dem Schrecken auszusetzen, der mich damals fast um den Verstand brachte. »Hier sind Sie in Sicherheit«, wurde gesagt, als ich zurückkehrte. Man gab mir ein Zimmer, ein kahles, zellenartiges Zimmerchen in diesem großen stillen Krankenhaus am Stadtrand, verschrieb Tabletten, das Übliche. Sicherheit? All diese langweiligen und lächerlichen Therapien können die Erinnerung nicht löschen. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Ich müsse erkennen, dass ich keine Schuld trage, sagen sie. Doch wie können sie sich anmaßen, über diese Dinge zu urteilen? Je länger ich gezwungen bin, mir ihr beschwichtigendes Geschwätz anzuhören, desto klarer wird mir, dass ihnen die Fähigkeit fehlt, sich das, was dort geschehen ist, auch nur annähernd vorzustellen. Ihrer Arglosigkeit zum Trotz halte ich an dem fest, was meine Albträume zuverlässig überliefern. Ich kann nicht behaupten, dass ich über alles, wovon hier die Rede sein soll, präzises Wissen besitze. Vieles wird in der Schwebe bleiben, weil es mir im Strudel von Ereignissen, die mich mit teuflischer Macht in ihrem Bann hielten, nicht immer gelang, kaltes Blut zu bewahren; und die papiernen Begriffe, die eine auf Lehrstühlen thronende »Wissenschaft vom Menschen« für haarsträubende barbarische Gebräuche geprägt hat, wollen zu dem, was ich erlebte, nicht passen. Die Ärzte mögen glauben, was sie wollen, aber wenigstens sollen mein Bruder und meine Schwester – die Einzigen, die noch an meinem Leben Anteil nehmen – erfahren, wie es wirklich war. Ich passe mich den Regeln an, die hier herrschen, und tue, was von mir erwartet wird. Ob allerdings jener Thedor Weyde, der von hier aufbrach, noch derselbe ist, der ein paar Monate später zurückkehrte, bezweifle ich, und ob dieser Thedor Weyde – also ich – je wieder das werden kann, was man unter einem selbstgewissen Mitglied der Gesellschaft versteht, ist mehr als fraglich. Bin ich deshalb krank, wie sie behaupten? Die Antwort muss ich anderen überlassen, ebenso wie die Folgerungen aus dem, was ich – immer in den frühen Morgenstunden, wenn die Wirkung der Tabletten nachlässt und der leere, kalte europäische Himmel in meinem Fenster sichtbar wird – hier aufschreibe.
Aus diesem Himmel schwebt eine weiße Feder zu mir herab. Schaudernd lege ich sie auf mein Blatt.
Ich war ein schwaches, unentschlossenes Kind, das jüngste von drei Geschwistern, und wurde, vielleicht zu meinem Unglück, von meinen keineswegs besonders vermögenden Eltern stets mit besonderer Großzügigkeit behandelt. Über meine Geschwister pflegte mein Vater, Lehrer und Ornithologe, regelmäßig zu Gericht zu sitzen (meine Mutter fungierte als stumme Beisitzerin), wegen mangelnder Leistungen, irriger Meinungen, unüblicher Wünsche und sonstiger Verfehlungen, die stets reichlich vorhanden waren. Dabei kam es zwischen ihm und meinem Bruder Lorenz zu hitzigen Auseinandersetzungen. Lorenz war klug und aufgeweckt, eloquent; er mühte sich ab und ließ sich in Machtkämpfe verwickeln, ohne die dunkle Angst des Vaters zu spüren, die seiner Strenge, seinem Ehrgeiz zugrunde lag. Für Lorenz fielen die Strafen stets am härtesten aus. Auch mit Dora suchte der Vater den Kampf und machte ihr die Jugendjahre schwer. Doch der Streit mit seinen beiden älteren Kindern schien ihn immer mehr Mühe zu kosten und Kraft zu rauben. Ich jedenfalls, der kleine, bebrillte, ungewandte Thedor, war von alldem ausgenommen, mir fiel die Milde, die väterliche Güte und Nachsicht zu, die den anderen vorenthalten war, für mich fand er stets Entschuldigungen und versöhnliche Worte – was der bedrückenden Wirkung jener Zusammenkünfte auf mich keinen Abbruch tat.
»Was habt ihr heute gelernt?«