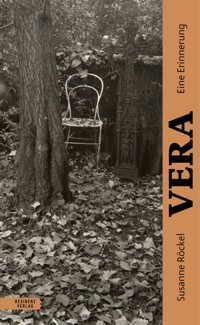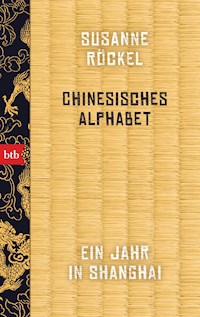
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jetzt wiederveröffentlicht, mit einem aktuellen Nachwort der Autorin.
»Überwältigt von dem, was zu hören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken war, begann ich zu schreiben.« Ein Jahr verbrachte Susanne Röckel in Shanghai – wie lebt es sich in der Metropole als »Langnase«, als »blutiger China-Anfänger«? Aus dem Impuls, die Fremde fassen und begreifen zu wollen, entstanden Aufzeichnungen und Geschichten von spielerischer Leichtigkeit und großer evokativer Kraft. Auch heute noch, zwanzig Jahre später, überzeugt dieses Mosaik aus Erlebtem und Gedachtem, ob es um Hühnerfüße geht oder Grillenverkäufer, Verkehrspolizisten oder Tempel, Kalligraphie oder Friseursalons.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum BuchEin Jahr verbrachte Susanne Röckel in Shanghai – 1997/98 unterrichtete sie Deutsch an einer Universität. Überwältigt von den Eindrücken in der so ganz anderen und unbekannten Metropole, begann sie zu schreiben. Aus dem Impuls, die Fremde fassen und begreifen zu wollen, entstanden Aufzeichnungen und Geschichten von spielerischer Leichtigkeit und großer evokativer Kraft. Auch heute noch, gut zwanzig Jahre später, überzeugt dieses Mosaik aus Erlebtem und Gedachtem, ob es um Hühnerfüße geht oder Grillenverkäufer, Verkehrspolizisten oder Tempel, Kalligraphie oder Friseursalons.
Zur AutorinSUSANNE RÖCKEL wurde 1953 in Darmstadt geboren. Sie ist Schriftstellerin, literarische Übersetzerin und Sprachlehrerin. Susanne Röckel lebt in München. Ihre Texte wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Tukan-Preis und dem Franz-Hessel-Preis. Ihr Roman »Der Vogelgott« stand 2018 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.
SUSANNE RÖCKEL BEI BTB
Der Vogelgott. Roman
Susanne Röckel
Chinesisches Alphabet
Ein Jahr in Shanghai
Die Erstausgabe erschien 1999 in der Luchterhand Literaturverlag GmbH, München.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Genehmigte Neuauflage Oktober 2021
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 1999, 2021 Susanne Röckel
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Shutterstock/sukiyaki; Kevin 5017
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
CP · Herstellung: sc
ISBN: 978-3-641-25800-9V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
INHALT
Ausländer
Bambus
Bauarbeiter
Baustellen
Bronzegefässe
Busse
Chinesen
Coca-Cola
Deutschland
Diebe
Drachen
Dunkelheit
Empfangshallen
Enkel
Fahnen
Fotos
Friseursalons
Frühlingsfest
Fussgängerbrücken
Gedränge
Gitter
Gräber
Grillenverkäufer
Heping-Park
Hitze
Hochhäuser
Hochstrasse
Huangpu-Fahrt
Hühnerfüsse
Innehalten
Jing’an-Tempel
Kähne
Kalligraphie
Karaoke
Kommunisten
Kopfstimme
Laster
Lautsprecher
Longhua-Märtyrerfriedhof
Märkte (1)
Märkte (2)
Menschenfresser
Mondfest
Nachtwächter
Nescafé
Ordnung
Pfusch (1)
Pfusch (2)
Pudong
Putzfrauen
Qiuxia-Garten
Regen
Restaurants
Rost
Schaukästen
Shanghai Lily
Shanghai Star
Söckchen
Stempel
Strassenhändler
Strassenmusik
Sun-Yat-Sen-Haus
Tänzer
Taxifahrer
Torso
Trader’s Bar
Traum
Unterhosen
Vergänglichkeit
Verkehrspolizisten
Vogelgezwitscher
Westen
Windräder
Xujiahui-Kathedrale
Yangpu-Brücke
Zeichen (1)
Zeichen (2)
Ziehnudeln
Nachwort Zur Neuauflage
Danksagung
»Wir besitzen alle Dinge.«
Kaiser Qianlong an König Georg III.
AUSLÄNDER
Als europäische Kriegsschiffe in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Öffnung des riesigen Marktes und Arbeitskräftereservoirs China erzwangen, war es mit der stolzen Selbstgenügsamkeit der Qing-Kaiser ausländischen Handeltreibenden gegenüber endgültig vorbei. Die Kolonisten, die sich des sumpfigen Fleckens am Huangpu bemächtigten, dachten und handelten, wie es dem Geist der Zeit entsprach: Auch sie verachteten das Fremde – ohne den Nutzen zu verachten, der aus Fremdem und Fremden zu ziehen war. Bald blühte Shanghai, doch von der Ernte bekamen Chinesen kaum etwas ab.
Nachdem es den Kommunisten gelungen war, die De-facto-Kolonialherren mit ihren Verbündeten aus dem Land zu werfen, folgte eine neue Periode der Abschließung, die zwanzig Jahre dauerte. Die Weltstadt Shanghai wurde zu einem Dorf gemacht. Mao, der Bauernsohn, stellte sich vor, dass man aus eigener Kraft mit Schwierigkeiten fertigwerden könne, deren Gründe weit in die Jahrhunderte zurückreichten; das Scheitern dieser Politik hatte das Volk mit unermesslichen Opfern zu bezahlen.
Heute scheint die Zeit, da man Ausländern wie Hausierern die Tür wies, tausend Jahre weit weg.
Schon der oberflächlichste Eindruck zeigt den Einfluss des Westens auf die Stadt. Nicht nur dort, wo die Repräsentationsgebäude der ersten Besatzer stehen (die zum Teil wieder von ausländischen Banken und Versicherungen genutzt werden), auf dem Gebiet der Internationalen Konzession, oder in jenen ehemals französischen Vierteln westlich der Yan’an Lu, wo Kaufleute, Schiffseigner, Opiummagnaten, umgeben von Gärten und Dienstbotenheeren, ihre Mußestunden verbrachten, sondern überall in der inneren Stadt ist der Wohnungsbau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mehr als anderswo in China von westlicher Architektur geprägt. Die völlig heruntergekommenen Häuser und Siedlungen, in denen europäische Fassadengliederung, Fensterformen, Ornamentik mit chinesischen Wohnbedürfnissen harmonierten, werden nach und nach abgerissen, um Hochhäusern Platz zu machen, deren Architektur einen wichtigeren Zweck zu erfüllen scheint als den des Wohnens: Im Zeitalter der globalen Sachzwänge muss vor allem das Gefühl hervorgerufen werden, dass die Stadt in der Lage ist, sich im Wirtschaftswettlauf auf einem der vorderen Plätze zu behaupten.
Deshalb sind Ausländer, besonders Ausländer aus dem Westen, und nicht nur Investoren und Fußballtrainer, willkommener denn je.
Überall wird der westliche Ausländer von Leuten angesprochen, die sich mit ihm unterhalten wollen, um Englisch zu trainieren. Im Radio wird täglich eine halbe Stunde Dickens im Original vorgelesen. Im Fernsehen gibt es Benimmkurse, die in westliche Sitten und Gebräuche einführen. Reiche Leute suchen Ausländer als Klavierlehrer für ihre Töchter. Arme Leute suchen, wenn sie etwas zu verkaufen haben, Ausländer als Kunden, denn Ausländer lassen sich leicht übers Ohr hauen. Ausländer genießen Sonderrechte. Mehrmals habe ich es erlebt, dass man mir in vollgestopften Bussen einen Sitzplatz anbot oder mir in einer Schlange den Vortritt ließ – nicht um meiner grauen Haare, sondern einzig um meiner langen Nase willen. Einmal saß ich irgendwo auf einer Bank, da trat mit strahlendem Lächeln ein Mann auf mich zu und ergriff meine Hand, um sie ausgiebig zu schütteln. »Hello! Hello! Goodbye!« Dann ging er weiter, nicht ohne mir aus der Ferne noch einmal herzlich zuzuwinken. Warum das alles? Offenbar vermutet man im Ausländer Qualitäten, die sonst nur Märchenfiguren besitzen.
Von Seiten der Behörden hat man als Ausländer weniger Freundlichkeiten zu erwarten. Bürokratische Schikanen sind an der Tagesordnung. Der private Briefverkehr wird vielerorts überwacht. Bis vor kurzem waren private Kontakte zwischen ausländischen Dozenten und chinesischen Studenten noch kaum möglich. Es liegt im Interesse der Behörden, dass Ausländer dort wohnen, wo sie unter sich bleiben. Das kommt den Wünschen vieler Ausländer entgegen.
Westliche Ausländer sind, unabhängig vom wirklichen Grad ihrer Kennerschaft, als »foreign experts« meist für chinesisch-ausländische Gemeinschaftsunternehmen tätig. Sie empfinden die Stadt als Erschwernis ihres Lebens, die ihnen neben der Arbeit zugemutet wird und für die sie von ihren Firmen entschädigt werden müssen. Oft leben sie jahrelang in luxuriösen Hotelghettos, ohne mit den alltäglichen Schwierigkeiten ihrer Umgebung, der Not, dem Dreck, der Enge je in nähere Berührung zu kommen. In dieser Hinsicht spart man chinesischerseits nicht an Aufwand, um es den Ausländern recht zu machen, das heißt, die Wirklichkeit von ihnen fernzuhalten. Ein schönes Bild dafür ist die lange Haube aus undurchsichtigem blauem Plastik, die man am seitlichen Eingang des Jinjiang-Towers den dort abgestellten Fahrrädern der Angestellten überstülpt, um den Hotelgästen den Anblick von rostigem chinesischem Blech zu ersparen.
»Auch Singapur war früher ein Sumpf«, sagt ein durchreisender deutscher Professor, die neue Politik der Chinesen lobend, »und jetzt können Sie da von der Straße essen.«
Die Welt, von der er träumt, ist eine Welt, die es nicht mehr nötig hat, das Fremde zu verachten – das Fremde ist eingeebnet und verschluckt, auf dass nichts mehr davon uns erschrecke. Es wird eine kleine Welt sein! Was aber würde passieren, wenn es ihn einmal in eines der ganz anderen Viertel der Stadt verschlüge, wo vom Bann der boomenden City nichts mehr zu spüren ist, wo man ihn auf durchaus friedliche Weise begafft und seine außerirdische Erscheinung mit einem selbstvergessen gemurmelten »Lao wai, lao wai« (Ausländer) staunend zur Kenntnis nimmt? Könnte es geschehen, dass ihn eine Ahnung der unüberwindlichen Entfernung beschliche, die unseren Teil der Erde noch immer von dem großen China trennt? Stiege das ferne Bild einer Welt in ihm auf, die unseren gönnerhaften Erklärungen unweigerlich entgleitet? Dämmerte dem Ausländer das Bewusstsein der eigenen Fremdheit?
BAMBUS
Ich wähle den Bambus als Wappen.
Bambus ist stark. Sein Holz ist biegsam, Stürme können ihm nichts anhaben. Bambus ist nützlich. Bambus schmeckt, Bambus heilt. Bambus ist angenehm dem Auge und dem Ohr.
Bambus steht für Beharrlichkeit, Bescheidenheit, Langlebigkeit, freien und edlen Sinn. Doch das Symbol bliebe blass ohne das Spiel der Gestaltungen, denen der Bambus sein langes und reiches Leben verdankt.
Bambus wird geschrieben wie eine Kalligraphie, gelesen wie ein Gedicht. Bambusmalen kann jeder. Die Besten zeichnen sich aus durch höchste Subtilität der Pinselführung, der Aufteilung der Fläche. Aus den Kontrasten von Schwarz und Grau entsteht der Eindruck von Nähe und Ferne, Schatten und Licht. Sparsame Striche rufen Stimmungen von schneelastendem Winter oder windraschelndem Sommer hervor, Bilder von heilloser Verwirrung und dumpfer Qual, die sich in klare Ruhe wandelt.
Von der Malerei stammen die Bambusmuster ab, mit denen unzählige Gegenstände des täglichen Gebrauchs verziert sind, Stein und Glas, Porzellan und Seide, Baumwolle und Plastik. Der Pinsel, mit dem man malte und schrieb, hatte einen Bambusstiel. Das erste leichte und leicht handhabbare Material, das Schrift trug, waren Täfelchen aus Bambus. Auch Papier wurde aus Bambus hergestellt, Musikinstrumente und Gegenstände des hochentwickelten Kunsthandwerks waren und sind aus Bambus, ebenso Tische, Stühle, Schränke. Die besten Kunstschreiner früherer Zeiten fertigten Möbel aus kostbaren Hölzern, deren Oberflächen Bambus imitierten, wie Porzellanmacher Schalen formten, die Gefäße aus Bambus nachahmten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Aus Bambus macht man Besen und Bürsten, Körbe und Matten, Jalousien und Zäune und Küchengerät. Bambushäuser und Bambusbrücken werden kaum noch gebaut; Betonpavillons und Betonbrücken in den Shanghaier Parks imitieren das frühere Material. Die wichtigste Branche der Stadt kommt weiterhin nicht ohne Bambus aus: Die Baugerüste bestehen aus Bambusstangen unterschiedlicher Länge, die von Arbeitern mit Draht und Schnur zusammengefügt und hochgezogen werden. Und die Bank of China wirbt im Fernsehen mit einem stillen Bambushain.
In Wolfgang Bauers großem Buch über die Glücksvorstellungen der Chinesen lese ich von den »fast rührend hausbackenen chinesischen Paradiesen« (im Gegensatz zu den ausschweifenden und schwülstigen frühen utopischen Phantasien Indiens). Diese Hausbackenheit zeigt sich auch in der Verehrung, die Chinesen von jeher dem Bambus entgegenbrachten, jener von Gestalt einfachen, bezüglich Boden und Klima anspruchslosen, schnellwachsenden, immergrünen tropischen Grasart. Ich nehme den Stift zur Hand, der auf dunkelgrünem Grund ein Muster aus hellgrünen Bambuszweigen zeigt, und hoffe, dass der schlichte und tiefe Geist des anmutigen Grases auch auf mich übergeht.
Ich wähle den Bambus als Wappen.
BAUARBEITER
»Yi-er-san, yi-er-san«, höre ich sie stundenlang vor dem Fenster. Ein langes Plastikrohr wird von einer riesigen hölzernen Kabelrolle abgezogen und in einem Graben verlegt. Stricke um die Brust gebunden wie Ochsen, mühen sie sich ab, kleine, grazile Männer mit dunkelfarbigen Gesichtern, ermuntern sich mit lautem »Eins-zwei-drei« im Chor zu immer neuer Anstrengung. Den Graben haben sie mit der Schaufel ausgehoben, es hat Tage gedauert, denn die Erde ist hart und steinig, und die Sonne brennt. Bagger gibt es nicht, nur einmal haben sie auf einem Handkarren einen vorsintflutlichen Pressluftbohrer dabeigehabt, um die Asphaltdecke der Zufahrt zu zertrümmern. Sie arbeiten von Sonnenaufgang bis spätabends, nach dem Dunkelwerden. Manchmal sehe ich sie auf dem Dach des Hotels gegenüber. Solange es im Umbau ist, gehört es ihnen. Vor dem grauen Himmel gleichen sie müden Wanderern, die von ihrem Gipfel aus die Welt betrachten, eine fremde Welt, der sie nichts hinzuzufügen, nichts wegzunehmen haben.
Den wandernden Arbeitern in der Stadt eignet eine seltsame Vagheit, Schattenhaftigkeit. Wie streunende Tiere bevölkern sie die Rohbauten, ihre geheimen Burgen und Festungen, zu denen Sesshafte keinen Zutritt haben. Manchmal sieht man sie auf der Ladefläche von Lastwagen sitzen, stumpf und erschöpft lehnen sie aneinander und lassen sich durchschütteln. Ein andermal sieht man sie irgendwo auf einem Haufen Bauschutt hocken und essen, schnell und gierig, mit krummem Rücken, als hätten sie Angst, dass man ihnen das bisschen Reis noch nimmt. An bestimmten Straßen stehen sie mit Pappschildern in Händen, auf denen steht, zu was sie taugen, Maurer-, Holz-, Zementarbeiten, in einem Beutel tragen sie ihr Werkzeug bei sich, Kellen und Sägen, alt und abgenutzt. Oft sind es junge Burschen, scheu, mit dickem, staubigem, grob geschnittenem Haar. Sie tragen Armeeturnschuhe und übergroße Jacketts, denen man ansieht, dass sie auch zum Schlafen nicht ausgezogen werden. Sie leben jahrelang in Behelfsunterkünften, grauen Waben mit dünnen Wänden, an den Rand des Baustellengeländes geklebt. Ab und zu erhascht man einen Blick in die winzigen, stickigen, mit Stockbetten und Hausrat vollgepfropften Räume, die an Ställe erinnern. Auf den Galerien hängt zerschlissene Kleidung, große Schilder fordern zur Umsicht auf den Gerüsten auf. Es wird im Schichtbetrieb gearbeitet, Ruhetage sind selten.
Einmal im Jahr, zum Frühlingsfest, fahren sie heim. Auf Züge wartend, die sie nach Anhui, Jiangxi, Hunan und in noch weiter entfernte Provinzen bringen, sieht man sie tagelang mit Kind und Kegel auf dem großen Platz vor dem Bahnhof. In Gruppen lagern sie zwischen Säcken und Kisten, Karten spielend, rauchend, schlafend, bei jedem Wetter. Plötzlich entsteht Bewegung unter ihnen, ein Zug ist aufgerufen worden, alles drängt zu den Eingängen. Doch so viele auch hinter den eisernen Absperrgittern verschwinden, so wenig scheint die Zahl der Lagernden und Wartenden je abzunehmen.
Wer weiß etwas von ihnen? Wer vertritt ihre Interessen? Wen gehen sie etwas an? Man scheint sich daran gewöhnt zu haben, die zu Hunderten entstehenden Hochhäuser als Hervorbringungen einer unerschöpflichen, quasi organischen Energie zu betrachten. Die Wanderarbeiter sind anderswo. Ihre Lebensgewohnheiten, die Modalitäten der Verträge, die sie binden, ihre Streitigkeiten, Unfälle, die Einzelheiten ihres Schicksals sind nirgends öffentlich verzeichnet und dringen nicht ins Bewusstsein. Mangelhafte medizinische Versorgung, Beschränkungen und Verbote, Schwierigkeiten bei der schulischen Eingliederung der Kinder – davon hört man gelegentlich, doch selten wird ein genaues Bild daraus. Scharenweise kommen sie, Millionen jedes Jahr, und die Stadt verleibt sich ihre Jugend ein, ihre Ausdauer, ihre Körperkraft, gibt ihnen Arbeit und wirft ihnen Pfennige dafür hin, und wenn sie genug von ihnen hat, spuckt sie sie aus wie bittere Kerne. Sie schaden dem Image, heißt es. Wie leicht fällt es, diese Ohnmächtigen und Hoffenden zu verleugnen, wie wenig scheint es zu gelingen, ihrer bedrohlichen Ströme Herr zu werden. Denn die Stadt selbst lebt ja von der Kraft jener Hoffnungen. Und die armen Bauern erkennen im täuschenden Glanz dieser falschen Perle, in ihrem Pomp und ihrer Hässlichkeit die eigenen rohen und naiven Träume wieder, die sie stets von neuem dazu treiben, das Land im Stich zu lassen, das karge Feld, die leere Kammer, das Dorf, das die Welt vergessen hat, und sich aufzumachen, um in der Stadt das Glück zu suchen.
BAUSTELLEN
Hohe Wände, mit Reklamebildern bemalt, umschließen das Gelände. Lastwagen stauen sich in der Einfahrt, beflaggte Maschinen bohren sich in den Boden, rostige Stangen ragen wie Stachelmähnen aus der befestigten Grube. Majestätisch schwenken Kräne ihre Gigantenarme, beflissen kriechen Außenaufzüge von Stockwerk zu Stockwerk, hektisch flappen zerrissene Planen über gähnenden Löchern. Wie wertvolles Pflanzgut von dichten Bambusmatten umhüllt, wie ein kostbarer Edelpilz von Scheinwerfern bestrahlt und von unermesslichen Mengen Beton begossen, wächst das Hochhaus Meter um Meter aus der Erde. Hinter verhängten Gerüsten hämmert und rattert es Tag und Nacht, blaue Schweißblitze erleuchten die trübe Luft. Und die Mauern dehnen sich und breiten sich aus und bilden schiefe Verwachsungen und strähnige Verschlingungen, bizarre Warzen, düstere Stümpfe. Und nach zwei, drei Jahren ist das pflanzliche Stadium überwunden, und der rohe Bau mit seinen tausend Augen steht linkisch da wie ein nackter Wilder unter lauter angezogenen Zaungästen. Zu diesem Zeitpunkt übt er, schattenhaft, phantastisch wie die unbewohnbaren Monumente der Träume in ihrer großartigen Vermessenheit, am meisten Faszination aus. Doch bald wird ihm das enge Kleid aus Glas und Marmor übergestreift, das ihn als zur Zivilisation gehörend ausweist. Von Investoren und Offiziellen gehätschelt, bildet er noch eine Zeitlang den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, bis die Gewohnheit ihn seiner traumhaften Eigenschaften beraubt und das kritische Urteil nur noch Prunk und Hässlichkeit übriglässt.
BRONZEGEFÄSSE
Von Tierfüßen, Tierbeinen, Tiernacken, hin und wieder auch knienden menschlichen Figuren getragen, von Vögeln, Schlangen, Fischen und abstrahierten Tiergesichtern umfangen, runden und wölben sich Vorratsgefäße, Dampftöpfe, Wein- und Wasserkessel. Aus Reliefs und Halbreliefs werden ganzkörperliche Figuren, die die Formen erweitern und aufbrechen, große Augen, starrende Brustwarzen, Ohren, Zungen, Hörner, Schwänze, Tatzen. Tierfiguren und Tierköpfe krönen Deckel, bilden Henkel, Knäufe, Griffe. Die Gefäße zeigen, was sie enthalten und wozu sie bestimmt sind. Das harte, kühle, einst dunkel glänzende Metall hat Wellen wie Wasser, spiralige Auswüchse wie Dampf, Dornen und Schlingen wie Pflanzen, Maserungen und Schuppen wie Tierpanzer und Tierhäute. Überall ist Verwandlung. Form ruft Formlosigkeit ins Gedächtnis, der Gegenstand sein Material, das fest war und verflüssigt wurde, um wieder fest zu werden, kalt war und erhitzt wurde, um wieder kalt zu werden. Aus dem wandlungsfähigen Metall wurden Gefäße hergestellt, die der Verwandlung tierischer und pflanzlicher Lebewesen in menschliche Nahrung dienten. Die verschlungenen Muster bewegen sich im Rhythmus der schwimmenden, kriechenden, springenden, fließenden Wesen, Tier-Götter, deren überwältigendem und rätselhaftem Dasein die Menschen ihr Leben verdanken und denen sie sich entgegensetzen. Auch Inschriften finden sich, Hinweise auf Feste und rituelle Bankette, bei denen die Gefäße benutzt wurden. Historikern sind sie eine Hilfe bei der Datierung von Kriegen und Grenzverschiebungen. Die kleinen geritzten Zeichen scheinen Echos jener Muster und Figuren, skizzenhafte Versuche, in der Überfülle des Kosmos eine eigene, menschliche Ordnung festzuhalten.
Die Gewinnung der Nahrung ist prekär. Wer sagt, dass man morgen noch genug zu essen hat? Auf drei oder vier Beinen ruhend, wirken die wuchtigen Kessel, als verweilten sie nur vorläufig an ihrem Platz, erfüllten nur vorläufig ihren Zweck. Im Boden eines großen, pfannenartigen Topfes sind Bronzepüppchen jener Tiere versammelt, die hier gekocht und gebraten wurden, Fisch, Wild, Geflügel. Raubt man den Familien jener Tiere immer wieder Angehörige, um sie zu verzehren, so scheint man sie nun zu beschwören, sich davon in ihrem Dasein und Wachstum nicht beeinträchtigen zu lassen und Menschen weiterhin als lebensspendende Nahrung zu dienen. So wären die Tierbilder und Tiermasken Ausdruck eines Bewusstseins, dem ständig die Möglichkeit des Verlusts vor Augen steht, der überbordende Reichtum der Gestaltung entstammte der Erfahrung des Entblößtseins und des Mangels; dem Tod der gejagten, geschlachteten, geopferten Tiere entspränge die große Feier des Lebens, der man hier staunend beiwohnt.
Touristen mit Kopfhörern über den Ohren gehen zwischen den erleuchteten Vitrinen umher. Videorecorder zeigen Bilder und geben Erklärungen. Bronzeglocken klingen aus versteckten Lautsprechern. Die Bronzegefäße schimmern in allen Schattierungen von Grün. Wie jene Menschen den Stoff, dem sie ihre eigene, unvergleichliche Form gaben, haben wir sie aus der dunklen Erde ausgegraben, die sie dreitausend Jahre in sich barg, um sie durch unseren Blick erneut zu verwandeln.
BUSSE
Alles wird besser. Von diesem goldenen Versprechen eines unerforschlichen Gottes lebt die Stadt, leben wir alle. Eines Tages wird es den ganzen Dreck und Krach und Smog und das ganze fürchterliche Gewühl und Durcheinander nicht mehr geben, alle werden in stillen Villen mit Klimaanlage und elektronischem Whirlpool leben und auf Wolkenkratzer und Bambushaine mit herrlichen Steinen und Pavillons und Teiche mit ewig blühendem Lotus und melodisch quakenden schmackhaften Ochsenfröschen blicken und Fernseher mit Fernbedienung und Autos mit schwarzen Scheiben und nichtrostende Wasserkessel haben und jeden Tag Schildkröten und Schlangen und die Pfirsiche der Unsterblichkeit essen und tausendjährigen französischen Joint-Venture-Rotwein trinken und auf jadegrünem englischem Rasen mit Federbällen aus Kranichfedern Federball spielen und Handtaschen und Lederschuhe tragen, und nachts wird von Westen her ein Heer von Feen kommen, das den ganzen Abfall in fruchtbaren Boden verwandelt, auf dem duftender, total insektenresistenter Reis wächst. Auch Busse wird es dann nicht mehr geben. Natürlich wird es immer Fahrzeuge geben, die von fern irgendwie busähnlich aussehen, geheizte bzw. gekühlte Säle auf Rädern, in denen man, auf weichen Sesseln vor kristallenen Scheiben sitzend, die schöne Welt an sich vorüberziehen lässt, doch dass diese Fahrzeuge von den heutigen Bussen abstammen, werden nur noch die Historiker wissen. Geräuschlos und wohlgefedert bewegen sie sich vorwärts, geräuschlos halten sie an, wenn das gemütliche Häuschen erreicht ist, das dann Haltestelle genannt werden wird, und wie von Geisterhand öffnen sich die Türen. Niemand schiebt von hinten, drängelt von der Seite, stößt einem Ellbogen in den Magen, niemand tritt einem auf die Füße, und man selbst wird all das auch nicht tun, es besteht nämlich gar keine Notwendigkeit dazu! Fast ohne das Bein zu heben, steigt man mit einem einzigen leichten und tänzerischen Schritt ein, und wenn man drin ist, kann man seinen Körper mühelos in alle Himmelsrichtungen bewegen. Stabile, silbrig glänzende Haltestangen laden dazu ein, sich festzuhalten, obwohl man sich eigentlich überhaupt nicht festzuhalten braucht, und es gibt sogar manchmal Sitzplätze mit einem gänzlich unabgewetzten, unausgefransten, unekelhaften Polyesterbezug, und wenn man auf so einem Sitz sitzt, denkt man wegen der gänzlich ruck- und rumpellosen Fahrweise dieses Zukunftsgefährts oft, man sitze unbeweglich auf einem Kinosessel und ein Film rolle vor einem ab. Das Personal hat nur ein einziges Bestreben, nämlich den Fahrgast so wenig wie möglich zu belästigen und ihm die Fahrt so angenehm wie möglich zu machen. Keine Schaffnerin, die mit gellender Stimme die Stationen ausruft und saumseligen Passagieren rüde Befehle gibt! Kein Lautsprechergequäke! Keinerlei Ärger und Unbequemlichkeit, wenn die Schaffnerin die Mauer der zusammengepressten Menschen mit Hilfe ihrer eisernen Arme aufbricht, um die Zugestiegenen, die ja kaum noch so viel Platz haben, dass sie die Hand in die Tasche stecken könnten, im Kasernenton aufzufordern, den Fahrpreis zu entrichten! Überhaupt keine Schaffnerin! Nur das leise Knacken und Klingeln einer stets funktionierenden Entwertungsmaschine, die eifrig und zuverlässig ihren Dienst versieht.
Und nun die Passagiere: Es wird keine von diesen ungekämmten und ungehobelten und gar nicht ins Stadtbild passenden Landleuten mit schmutzigen Hemdkrägen geben, die den ganzen Bus mit ihren Säcken und Bündeln und ihrer ganzen elenden Habe vollpfropfen, statt sich ein Taxi zu nehmen wie anständige Leute. Keine von diesen Ausflugsgesellschaften, deren Mitglieder sich laut schreiend um die Ehre des Bezahlendürfens streiten. Keine Arbeiter, die von der Schicht nach Hause fahren und die besten Sitzplätze besetzen, um mit wackelnden Köpfen auf ihnen zu schlafen. Es wird nicht einmal mehr solche Schnösel geben, in deren Jacken es plötzlich pfeift und die dann das Handy herausziehen und irgendwas hineinbrüllen, was keiner wissen will. Es wird nur noch diskret parfümierte weise Seniorinnen mit schön gelegten Locken und vielen Zähnen geben, die ganz leise sprechen oder einfach nur schweigend aus dem Fenster schauen, während ab und zu Erinnerungen an interessante Begebenheiten ihres Lebens in ihnen aufsteigen, und vielleicht zur Auflockerung der Atmosphäre hie und da ein paar fröhliche Schulkinder. Mehr nicht! Wer zweifelt noch daran, dass jede noch so kurze Fahrt in einem dieser Wundervehikel ein herrliches Erlebnis, ein wahrer und tiefer Genuss sein wird?