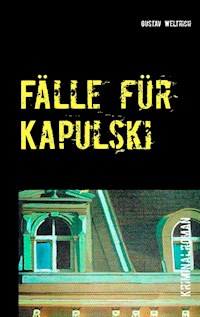Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der historische Roman "Der Wartenberg" schildert in vier Kapiteln die Geschichte dieses Berges. Er trug einst eine Burg der Wittelsbacher, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde und den ersten Bayerischen Herzögen Otto I. und Ludwig I. als Wohn- und Regierungssitz diente. Nach Verlegen der Hofhaltung in die neue Burg Landshut wurde die Wartenberger abgetragen und zu Füßen des Berges ein Jagdhaus für die Herzöge errichtet. An die Bewohner der Burg erinnert ein Gedenkstein auf dem Berg, dessen Inschriften über den vier Kapiteln des Romans stehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Kapitel I:
Hier stand die Burg Wartenberg
Kapitel II:
Otto der Größere, Stammvater des bayerischen Regentenhauses, wohnte auf der Burg Wartenberg laut Urkunde von 1171
Kapitel III:
Ludwig, der Kelheimer, lebte in seiner Jugend auf dem Schlosse Wartenberg 1183-1192
Kapitel IV:
Herzog Ferdinand von Bayern, vermählt mit Maria Pettenbeck, gründete unter Wilhelm dem V. aufs Neue das Haus Wartenberg, dessen Nachkommen blühten als Grafen von Wartenberg 1588 – 1736
Hier stand die Burg Wartenberg
(Aufschrift auf der Westseite des Gedenksteines auf dem Wartenberg)
I
Von der alten, bescheidenen und beschaulichen Burg Scheyern war Vitilo, der junge Ministeriale und Vertraute von Graf Otto V., kurz vor Sonnenaufgang aufgebrochen. Noch bevor der Tag endet, möchte er sein Ziel, das Gebiet zwischen den Flüssen Sempt und Strogen östlich des nahen Stifts Freising, erreicht haben.
Vor nicht langer Zeit war er schon einmal auf dieser Strecke unterwegs gewesen: heuer im Frühjahr 1117, als er mit seinem gnädigen Herrn und dessen gewaltigem Tross zum fernen Kloster Ebersberg reiten musste. So war ihm die Route wohl vertraut.
Vitilo war als Sohn eines unfreien Dienstmannes auf einem Gutshof des Grafen in der Nähe von Scheyern geboren und aufgewachsen.
Er war wie sein Vater ein „Höriger“, das heißt, die ganze Familie befand sich in absoluter Abhängigkeit von ihrem Grundherrn.
Dem Grund und Boden, der ihnen nicht gehörte, sondern nur anvertraut, geliehen war, waren sie absolut verpflichtet. Sie durften ihn nicht verlassen, mussten ihn nach Vorschrift bearbeiten und entsprechend hohe, ja häufig knebelnde Abgaben an ihren Herrn leisten.
Nicht nur das.
Selbst zu Frondiensten waren sie verpflichtet, zu schweren Arbeiten ohne jegliche Bezahlung, sie und die ganze Familie.
Als Vitilo etwa acht Jahre alt war und in der Nähe der Scheyerner Burg die Schafe hütete, büxte eines der Lämmer aus. Vitilo folgte ihm, um es vor Schaden zu retten, vor allem vor den Wölfen, die überall in großer Zahl durch die Gegend strichen und nach leichter Beute aus waren. In die Herde trauten sie sich nicht. Dort waren gut dressierte Hunde. Und nachts wurden die Schafe eingepfercht und bewacht.
Aber Tiere, die sich von der Herde entfernten, waren ihnen ausgeliefert. Sie hatten keine Chance, den heulenden Wolfsrudeln zu entkommen.
Auf der Suche nach dem entlaufenen Lamm näherte sich Vitilo der Burg mehr als ihm erlaubt war.
Einer der kräftigen Knechte fasste ihn und schleppte ihn hinter die Burgmauer.
Vitilo wehrte sich so gut er konnte. Aber es war umsonst. Erst als er klar machen konnte, dass er die Herde nur kurz lediglich deshalb verlassen hatte, um das Lamm zu suchen, ließ man ihn laufen unter der Auflage, sich am nächsten Tag beim Burghauptmann zu melden.
Dies tat er.
So stand er nun zitternd vor dem autoritären Mann, der ihm die beiden Ohren lang zog und ihm vorwarf, die Herde seines Herrn verlassen und preisgegeben zu haben.
Hatte sich Vitilo gestern noch körperlich zu wehren versucht, so musste er nun in Wort und Rede seinen „Mann“ stehen.
Schnell zeigte sich des kleinen Vitilos überdurchschnittliche Intelligenz.
In einer durchwachsenen Mischung aus Frechheit, Schüchternheit, Unterwürfigkeit und Angriffslust verteidigte er sein gestriges Verhalten.
Nicht er habe die Herde fahrlässig verlassen, sondern die Knechte der Burg haben gewissenlos gehandelt, wenn sie durch seine Festnahme in Kauf genommen haben, dass die Tiere für längere Zeit ohne Hüter und deshalb großer Gefahr ausgesetzt waren.
Und: er habe das entlaufene Lämmchen gesucht, damit es der Herde nicht verloren ginge. Die Hunde seien auf ihn geeicht und deshalb während seiner Abwesenheit doppelt aufmerksam gewesen, bis …, ja, bis die Knechte ihn geschnappt und hierher verschleppt haben.
Als die Hunde das merkten, seien sie ihm gefolgt und hätten die Herde verlassen. Welch ein Glück, dass keine Wölfe in der Nähe waren, oder Greifvögel.
Der Burghauptmann war zunächst sichtlich erstaunt und auch verärgert über den ungebührlichen Ton, dessen sich dieser Knabe erdreistete. Sehr bald wechselte aber sein Erstaunen in Bewunderung.
Es machte ihm schließlich sichtbar Spaß, ihn in eine Diskussion auf weitere Gebiete zu locken und seine erstaunliche Gewandtheit in Rede und Gegenrede zu prüfen.
Der Burghauptmann empfahl schließlich seinem Herrn, den Jungen, von dem er sich den Fronhof, auf dem er zuhause war, genau hat schildern lassen, auf den gräflichen Ansitz zu holen, seine gründliche Erziehung zu übernehmen und aus ihm einen brauchbaren, zuverlässigen, treuen Gefolgsmann und vielleicht sogar Ministerialen zu formen.
Zuerst mussten aber Vitilos Herkunft und die Stellung und Haltung seiner Eltern und deren Vorfahren gegenüber ihren verschiedenen Fronherrn geprüft werden.
Das Ergebnis dieser Untersuchung ergab, dass sie seit Generationen loyale Diener ihres jeweiligen Herrn gewesen sind.
Der Herr der Burg, Graf Otto von Scheyern, genehmigte schließlich, dass der kleine Vitilo in die Burg aufgenommen und seine Ausbildung übernommen wurde.
Der Burghauptmann, die zur Verteidigung auf der Burg befindlichen Ritter, aber ganz besonders der Burgkaplan nahmen sich seiner an und verhalfen ihm zu einer gründlichen Ausbildung nicht nur im Lesen, Schreiben und in Zahlen, sondern auch militärisch im Umgang mit Waffen und Pferden.
Graf Otto kümmerte sich auch persönlich um den Jungen, soweit es ihm seine Zeit erlaubte.
Jahre vergingen. Vitilo hielt, was alle auf der Burg an Vertrauen in ihn gesetzt hatten.
So reüssierte er bald zum Vertrauten seines Herrn in vielerlei Bereichen.
Beim Besuch des Klosters Ebersberg im heurigen Frühjahr fungierte Vitilo bereits als eine Art Anwalt seines Herrn.
Es galt, die Urkunde zu lesen und verständlich zu machen, die einen Grundstückstausch dokumentierte, der zwischen dem Kloster und dem Grafen ausgehandelt worden war. Denn der Graf beherrschte die Schrift nicht einwandfrei – und wenn sie in Latein war, schon gar nicht.
Feierlich über dem steinernen Altar des Klosterheiligen Sebastian wurde dieser folgenreiche Tausch vollzogen: Zwei Joch, „in der Villa Aufham gelegen“, im Eigentum des Scheyerner Grafen, sollen in das Eigentum des Klosters, vertreten durch den damaligen Vogt Ekkehard, kommen, gegen die gleiche Fläche auf dem Wartenberg für Graf Otto. Dieser Ekkehard, der Vogt des Klosters, war ein jüngerer Bruder des Grafen. Das dürfte die Verhandlungen sicher erleichtert haben.
Der Vater von Otto und von Ekkehard, der ebenfalls wieder Ekkehard hieß, war Gaugraf an der Ilm und Hauptschirmvogt über das Stift Freising und das Kloster Weihenstephan. Er war bereits seit sechs Jahren tot. Die Vogtei hatte Otto V., der Scheyerner, geerbt.
Nun ist Vitilo auf demselben Weg nach Osten zu jenen zwei Joch.
Graf Otto hatte angeordnet, dort eine weitere Burg zu errichten.
Durch eine umfangreiche Erbschaft, die auf Otto fiel, nachdem die Grafen von Ebersberg ausgestorben waren, hatte er riesige Ländereien mit einer großen Anzahl von Fronhöfen im Sempt-Strogen-Gebiet in sein Eigentum gebracht.
Diese neu hinzu gekommenen Ländereien zu den bestehenden zwischen Lech und Isar bedeuteten für ihn nicht nur einen gewaltigen Reichtums- sondern auch Machtzuwachs.
In den Augen des Kaisers war der Landbesitz ein wichtiger Gradmesser für die Einschätzung des örtlichen Adels und der Vergabe von Posten auf kaiserlicher Ebene.
Die in ihrem Ansehen so hoch gestiegenen Herren von Scheyern hielt es in ihrer kleinen Burg bald nicht mehr.
Außerdem suchten sie geeignete Orte zur Errichtung von befestigten Ansitzen innerhalb ihrer Ländereien.
Die Zeiten waren unruhig. Es gab ewige Kämpfe.
Zwischen Kaiser und Papst herrschte der „Investiturstreit“.
Die Kirche wollte die Privilegien des Kaisers, die Bischöfe und Würdenträger zu ernennen, nicht weiter anerkennen.
Die römisch-deutschen Kaiser sahen sich jedoch als Eigentümer aller Kirchen und Klöster in ihrem Herrschaftsgebiet und beeinflussten die Wahlen von Bischöfen, Erzbischöfen und Äbten in ihrem Sinne.
Dagegen wehrte sich der Papst.
Er führte an, dass die Ernennungen wohl lediglich gegen Loyalitätsbekundungen erfolgten und nicht nach Bildung, religiösen Glauben und Gehorsam der Kirche gegenüber.
Graf Otto V. stand auf der Seite von Kaiser Heinrich. Er war viel mit ihm unterwegs.
Der Kaiser wusste das zu schätzen und erteilte ihm etliche Privilegien. Als die Kastler Linie des Geschlechts der Sulzbacher um 1108 ausstarb, erhielt der Kaiser durch Testament einen Teil dieses Erbes.
Da zeigte Heinrich V. seine Dankbarkeit dem treuen Vasallen gegenüber und gab einige der ererbten Besitzungen an Graf Otto weiter.
Auch später bei der Gründung des Klosters Ensdorf war der Kaiser behilflich. Er schenkte Otto die Villa, auf der das Kloster errichtet wurde. Der Abt kam vom Kloster Michelsberg in Bamberg, ein Priester der dem Grafen voll ergeben war.
Diese absolute Loyalität Ottos dem Kaiser gegenüber wurde von allen Insassen seiner jetzigen und späteren Burgen ohne Hinterfragen mitgetragen.
Eine Burgbesatzung war eine „eingeschworene Gesellschaft“, Familie oder lateinisch „familia“ genannt, vom Grafen bis zur letzten Magd.
Schon von Jugend her war der Graf von Scheyern, wie er sich damals noch nannte, ein Verehrer von Kaiser Heinrich V., wie er es auch schon von dessen Vorgänger Heinrich IV. gewesen war.
Im Investiturstreit waren die meisten kirchlichen Würdenträger in Bayern auf Seiten des Kaisers und nicht des Papstes, verständlicher Weise, sie waren ja nicht vom Vatikan berufen, sondern vom Kaiser. Aus Angst vor Restriktionen durch den Vatikan wagte aber kaum einer, dies öffentlich zu bekennen.
Oft sind es nachgeborene Grafen, die berücksichtigt wurden und nicht bestens theologisch Ausgebildete. Die Kirche beäugte die Investitur deshalb mit großer Sorge.
Manche Kleinadeligen, von bigotten Pfarrern und Mönchen ge- und verführt, konnten oder wollten den Krieg gegen den Papst und die Heilige Kirche in Rom nicht billigen.
So spaltete die Sache die Gesellschaft.
Otto ist jetzt 37 Jahre alt. Von männlicher Schönheit ist er nicht gerade. Ein wirrer, meist ungepflegter Oberlippen- und überlanger Spitzbart fällt auf seine Brust. Dichtes brünettes Haupthaar, schulterlang, umrahmt aber ein entschlossenes Gesicht. Die gerade, starke Nase zeugt von Stärke und Überzeugungskraft.
Er ist schlank, aber nicht dünn, ist muskulös und von kräftiger Gestalt, ein Haudegen, der sich nicht nur bei vielen Turnierkämpfen bewährt hat, sondern auch bei Kriegskämpfen seinen Mann steht. Kein Wunder, dass ihn Kaiser Heinrich IV zu seinem dritten Romzug rief.
Wie dem Kaiser-Vater, folgte Otto auch dem Sohn in Allem, auch als sich der mit seinem Vater überworfen hatte.
Schon als Knabe zeichnete sich Otto durch einen strikten Gerechtigkeitssinn aus, den der Heranwachsende immer mehr kultivierte und schließlich gar absolutierte.
Aber er konnte und kann zum Bedauern seiner Freunde auch wankelmütig sein. Sein absoluter Gerechtigkeitssinn kann mit seiner Treue und Loyalität leicht in Konflikt geraten.
In der Knechtschaft dieser Eigenschaften kann er bisherige treue Gefolgschaften abrupt und über Nacht verlassen.
Als eine Reihe junger Bayerischer Adeliger gegen Kaiser Heinrich IV rebellierten und wegen dessen reformreligiöser Einlassungen seiner Absicht, dem Papst zu willfahren, an seiner Entmachtung arbeiteten, schloss sich ihnen Otto erst an, nachdem er durch Gelage und Jagdvergnügen geködert worden war.
Sie allesamt wollten nicht dulden, dass an der Investitur gerüttelt würde. Auch weiterhin soll der Kaiser Bischöfe und Äbte in ihre Ämter berufen.
Das führte zum Streit.
Der Sohn Heinrich begab sich im Heer seines Vaters, mit dabei Otto, auf eine Strafexpedition gegen sächsische Reformadelige, die die Berufung des Erzbischofs von Magdeburg bekämpft hatten.
Auf diesem Marsch kam es zum Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn.
Der Sohn hatte vor Jahren den Eid geschworen, niemals gegen den Vater in der Nachfolge anzutreten. Nun war er daran, diesen Eid zu brechen und sich mit dessen Gegnern zu verbünden.
Otto hielt zum Sohn.
Heinrichs V. Stellung war nicht von allen Herzögen toleriert. Aber er hatte Stehvermögen und konnte kompromisslos handeln. Nur so konnte er seine Stellung gegenüber den Herrschaftsansprüchen der Herzöge bewahren.
Beim letzten Italienzug, im Jahr 1111 hatte Heinrich in der Auseinandersetzung mit Papst Paschalis diesen und weitere 16 Kardinäle zeitweise gefangen genommen – unter tätiger Unterstützung von Otto. So wurde vom Vatikan über beide der Bann gelegt.
Erst nachdem Otto das Kloster Ensdorf, wie er seinem künftigen Schwiegervater versprechen wird, gegründet hatte, wurde der Bannspruch von Papst Paschalis wieder aufgehoben.
1116 wird Otto Pfalzgraf in Bayern. Und damit noch mehr mit dem Kaiser verbunden. Er war in Allem seinem Kaiser strikt gefolgt aus der Überzeugung, dass dessen Wirken für seinen ganzen Herrschaftsbereich und damit für Bayern segensreich ist.
Die großen Auseinandersetzungen und die Ursache für die Unruhen im Land können auf einen kurzen Nenner gebracht werden: Es geht um die Vorherrschaft im Römischen Reich Deutscher Nation.
Kaiser oder Papst. Und die wurde vielfach mit dem Schwert ausgetragen.
Da war es wichtig, gut geschützte Ansitze zu haben.
Schon vor zwei Jahren hatte Otto den Bau einer neuen, repräsentativeren und trutzigeren Burg auf dem Berg nahe Aichach begonnen. Ihre abgelebte Stammburg Scheyern sollte den Benediktiner Mönchen übergeben werden zur Errichtung eines Hausklosters als Grablege für die gräfliche Familie.
Damit war die Bezeichnung „Grafen von Scheyern“ nicht mehr angebracht.
Otto wollte sich nach der neuen Burg nennen.
Aber sie hatte noch keinen Namen.
Vitilo, der neue Ministeriale Ottos, hatte sich beim Bau der neuen Anlage so mit ihr identifiziert, war sozusagen der „Vater“ des Bauwerks, dass die Scheyerner sie nur noch nach ihm die Vitiloburg bzw. Witilisburg oder Witelinspach nannten.
Im Laufe der Bauzeit hat sich dieser Name zur „Wittelsbacher“ Burg abgeschliffen.
Es dürfte einmalig sein, dass ein Potentat sein Herrschaftszentrum nach einem Untergebenen, wenn auch Burghauptmann, genannt hat.
Dieses Namensproblem gab es bei der nun neu zu errichtenden Burganlage nicht.
Der „Wartenberg“ stand von Anfang an als Name fest.
Eine „Warte“ war dort wohl schon zur Römerzeit zu finden.
Hier wird der älteste Sohn, Otto Major, wie man ihn später nannte, geboren werden. Otto Major deshalb, weil später ein Bruder geboren wurde, den man erstaunlicher Weise ebenfalls „Otto“ taufte und den man offiziell zur Unterscheidung „Otto Minor“ nannte.
Angesichts der hohen Säuglingssterblichkeit hatte man wohl versucht, den Namen Otto auf jeden Fall zu erhalten, auch wenn der Erstgeborene nicht überleben sollte.
Otto Major, der auch Otto VI. nummeriert war, verbrachte seine Kindheit hier und hielt sich auch später vorwiegend auf der Wartenberger Burg auf, wenn er sich nicht gerade mit dem Kaiser auf Kriegszügen befand. Er nannte sich deshalb später auf einer Urkunde auch „Pfalzgraf von Wardenberg“. Die ehemals in Ebersberger Besitz und nun geerbten Fluren mussten verlässlich verwaltet werden. Das ging nur von Ort und Stelle aus.
Das war der begreifliche Grund, warum Vater Otto jene zwei Joch auf dem Wartenberg erworben hatte, um dort zu diesem Zweck eine weitere Burg neben der Wittelsbacher zu errichten.
Er schickte also Vitilo aus, seinen vertrauten Ministerialen, der schon die andere neue Burg betreut hatte, um den Bau der Burg auf dem Wartenberg zu überwachen, die auf dem auffälligen Hügelsporn im Entstehen begriffen war.
Vitilo saß nun schon mehrere Stunden auf seinem Apfelschimmel, gefolgt vom Pferd seines Pferdeknechts, der ein weiteres Pferd mit Gepäck an der Leine führte und einer Zahl schwer bewaffneter Dienstmannen als Schutztruppe.
Vitilo führte die Kasse mit. Sie enthielt Bargeld für die am Bau der Burg beteiligten Handwerker, die wöchentlich ausgezahlt werden mussten.
So eine Reitergruppe ist sehr schnell Ziel von marodierenden Banden, die in großer Zahl den arglos Reisenden auflauern, um sie zu berauben und ihn womöglich auch noch ums Leben bringen, um die Spuren der Tat zu verwischen. Deshalb die Schutztruppe.
Die Frondienst leistenden Bauern erhielten keine Entschädigung. Sie mussten darüber hinaus auch noch Gerätschaften, Zugtiere und Fahrzeuge kostenlos stellen.
Bald sah Vitilo im Osten schon den ersten Lichtsaum der aufgehenden Sonne.
Es ist Frühsommer.
Das Wetter ist zwar noch kühl, aber die ersehnte Sonne hinter den Wolken wird die Wärme der letzten Tage wiederbringen.
Der Weg ist für die Pferde schwierig. Über Wiesen und Trampelpfade mühen sie sich beschwerlich vorwärts. In der Nacht hatte es geregnet, die Wege sind nass, tief und morastig.
Mittlerweile sind die Wolken aber verschwunden. Die tiefe Bläue des Himmels verspricht einen schönen Tag.
Es ist die Kunst des Reiters, die Pferde so zu führen, dass sie die lästigen Unregelmäßigkeiten der Fährte klug umschiffen. Deshalb kommen sie aber auch nur langsam voran. Dies wird sich bessern, wenn sie auf die alte Römerstraße treffen, die sie nach dem Stift Freising und bis zum Zielgebiet bringen wird.
Erst aber müssen sie die Ilm überwinden.
Brücken gibt es weit und breit nicht. Also sind sie auf der Suche nach einer Furt. Nach einiger Mühe und vielen Stunden Rittes werden sie fündig.
Hier ist der Fluss in viele Rinnsale aufgespalten und die Wassertiefe entsprechend gering. Aber die großen Steine des Geschiebes machen das Durchkommen für die Pferde unbequem und gefährlich. Denn die schlanken Fesseln der Pferde sind sehr empfindlich und bei einem eventuellen Bruch nicht mehr heilbar.
Nun kommen sie endlich auf die Römerstraße.
Sie ist zwar seit vielen Jahrhunderten nicht mehr gewartet worden, ihr Vorteil ist aber, dass sie einen soliden Unterbau aufweist, der bis zu einem Meter Tiefe ausgekoffert, mit groben Steinen, dann mit Kies und schließlich mit Sand in Schichten aufgebaut, die Straßendecke gepflastert ist. Auch wenn sie nun nach dem lange zurückliegenden Abzug der Römer nicht mehr gewartet wurde und viele Pflastersteine zum Häuserbau der Anlieger verschwunden sind, ist ihre Nutzung doch bedeutend bequemer als die der Naturwege, die sonst üblich sind und nichts anderes darstellen als pfützenreiche, unebene, löcherige und schlammige Pfade.
Auf der Via Vicinalis, der „Provinzstraße“, wie sie die Römer nannten, näherten sie sich dem Stift Freising, über das, wie auch über Weihenstephan Otto die Vogteirechte ausübte.
Kirchen- und Klostervogteien waren wichtig für die Herzöge und Pfalzgrafen, weil sie damit die politische Herrschaft über deren große Landschaftsflächen sicherten.
Kirchen und Klöster wuchsen mit den Schenkungen, die manches Testament eines Grundbesitzers zierten, der dies in der Hoffnung tat, leichter das Paradies zu erreichen.
Mit den Vogteien wurden Grundbesitz und Hoheitsrechte voneinander getrennt.
So wurden die Kirchen- und Klostervogteien zu einem wesentlichen Mittel für den staatlich-juristischen Aufbau des Landes.
Otto hatte wie die anderen Vögte auch, den Kirchen und Klöstern, über die er die Vogteirechte ausübte, also vor allen Dingen das Stift Freising, Neustift bei Freising und Weihenstephan, den notwendigen Schutz zu sichern, den militärischen wie auch den juristischen, etwa vor Gericht. Er hatte als Vogt auch das Kirchengut zu verwalten.
Den Kirchen, Stiften und Klöstern war es aus religiös-theologischen Gründen versagt, Gewalt anwenden zu dürfen. So konnten sie sich nicht gegen Feinde wehren und waren auf den Schutz durch ihre Vögte angewiesen. Der Schutz wurde im Laufe der Jahre auf alle weltlichen Dinge ausgedehnt.
Graf Otto hatte mit Bischof Heinrich von Freising ein gutes persönliches Verhältnis. Die Aussicht, dass in der Nähe eine neue Burg entstehen soll, war für den Bischof von nicht geringer Bedeutung, konnte er damit doch die Hoffnung verknüpfen, dass sich der juristische, militärische und gesellschaftliche Schutz für sein Stift und seine Diözese damit noch enger gestalten dürfte.
Als Bischof Heinrich am 9. Oktober 1137 starb und Otto I. von Österreich 1138 die Nachfolge antrat, sah das Verhältnis zwischen Vogt und Bischof etwas anders aus. Bischof Otto war innerhalb des Bayerischen und Deutschen Adels stark vernetzt. So waren der spätere König Konrad III. sein Halbbruder, Herzog Leopold IV. von Bayern, Herzog Heinrich II. von Österreich und Erzbischof Konrad II. von Salzburg seine Brüder.
Bischof Otto wird diese politischen Verflechtungen und Beziehungen weidlich nutzen, nicht nur für seine weithin berühmten, nachhaltigen geschichtlichen Arbeiten, sondern auch für sein umfangreiches politisches Wirken. Graf Otto wird mit dem um etwa 25 Jahre jüngeren Bischof noch seine Schwierigkeiten bekommen.
Während des Rittes, auf dem Vitilo die Landschaft des Frühsommers genießen konnte, schweiften seine Gedanken vielfach ab und er erinnerte sich seiner Kindheit und Jugend, des Lebens auf dem Fronhof mit seinen Eltern und Geschwistern, der schweren Arbeit auf den Feldern.
Die Kinder – und so auch Vitilo – waren fest in die Arbeit eingebunden. Und nicht nur zum Hüten von Gänsen, Schafen und Kühen. Auch schwere Handarbeit wurde ihnen abverlangt. Besonders bei der Ernte.
Es war ihre Aufgabe, die gemähten Getreidehalme zu sammeln und für die Garbenbinder vorzubereiten – hernach auch beim Aufstellen der „Troatmandln“ Hand anzulegen und beim Transport der so getrockneten Ähren zu den Dreschplätzen zu helfen. Dabei mussten sie die Zugtiere - sie hatten als Arbeitstiere nur Kühe und Ochsen – dirigieren. Pferde hatten die Fronbauern nicht. Sie waren den hohen Herrschaften vorbehalten.
Die Drescharbeit war für die Kinder zu schwer – aber später, als Heranwachsende wurden auch sie dafür eingeteilt. Die schweren Dreschflegel auf die Getreideähren niedersausen zu lassen, verlangte viel Kraft, nicht weniger, die gedroschenen Fruchtstände in den Wind zu werfen und so die schwereren Körner von den leichteren Spelzen zu trennen.
Vitilo erinnert sich, dass es für ihn und seine Geschwister eine Selbstverständlichkeit war, den ganzen Tag im Freien bei der Arbeit zu verbringen. Außer im Winter, wenn die Tiere im Stall waren. Dann waren auch Vitilo und die Geschwister am liebsten dort. Denn hier war es warm und die Verbundenheit zu den Tieren war stark.
Aber auch hierfür war wenig Zeit.
Denn im Winter galt es, die Waldarbeit zu verrichten, Bäume zu fällen, zu entasten und in etwa zwei Meter lange Stücke zu schneiden, oder – fürs Brennholz – noch weiter zu verkleinern und mit dem Beil zu spalten, damit es als Brennholz dienen konnte. Das Fällen selber war für die Kinder viel zu schwer und gefahrvoll. Aber die Zugtiere zu dirigieren und das Holz nach Hause, oder, wenn es sich um besonders schön und gerade gewachsene Stämme handelte, zur Sägemühle zu bringen, damit Bretter und Balken gesägt werden konnten, war sehr wohl ihre Aufgabe.
Das Holz brauchten sie außer zum Heizen vorwiegend für Ausbesserungsarbeiten am Wohnhaus und den Ställen.
Die Stube im kleinen Haus wurde nur nach Sonnenuntergang aufgesucht. Da saßen sie dann um das Herdfeuer herum, das sich in der Mitte der Kate befindet, das den Raum nur mäßig wärmte und dessen Rauch über eine Öffnung im Dach abziehen musste, aber vorher den ganzen Raum einhüllte und zu Hustenreizen führte.
Einen Kamin gab es nicht.
Zur Beleuchtung dienten Fackeln, so sie welche hatten, denn sie waren sehr teuer. Sonst mussten auch Binsen, die in Fett getaucht waren, herhalten. Ihr Ruß und Gestank war zuweilen aber unerträglich.
Vitilos Gedanken schweiften weiter, denn in späteren Jahren tauchten bei ihm auch Fragen auf zu den Dingen des Lebens, zur Bedeutung des Seins. Auf die Fragen fand er selber keine Antworten. Sein Vater war wortkarg und verschlossen, seine Mutter immer stumm im Hintergrund.
Nur seine Großmutter konnte er in seine Überlegungen einbeziehen. Sie war eine lebenskluge Frau.
Wenn sie alle in der Winterszeit um das Feuer saßen und das häusliche Licht so dämmrig war, dass keine Arbeiten, selbst Handarbeiten nicht möglich waren, erzählte sie gerne von ihrer frühen Kindheit, von der harten Arbeit und den Umständen des so einfachen Lebens.
„Der liebe Gott sorgt für uns. Er hat uns in die Hand des gnädigen Herrn Grafen gegeben, der uns das Dach über dem Kopf und das tägliche Brot gibt und der uns beschützt vor Wegelagerern, Gaunern und Dieben.
„Aber warum hat Gott die einen reich und die anderen arm gemacht?“ war eine meiner Fragen, die mich beschäftigten.
„Wer ist arm?“ fragte die Großmutter zurück und beantwortete ihre eigene Frage gleich selber: „Arm ist nur, wer sich der Ordnung widersetzt, die Gott geschaffen hat. Alle, die Armen und die Reichen sind Teile der Schöpfung Gottes, weil sie die Menschen, die Tiere, die Natur, die ganze Welt umfasst.“
Das konnte Vitilo nicht begreifen.
„Was fragst du nach solchen Dingen. Der Herr sorgt für uns. Sind wir dann arm?“, war die Meinung des Vaters, die eine weitere Diskussion um diese Frage nicht zuließ.
Vitilo und seine Leute reiten weiter.
Als er etwa 12 Jahre alt und längst auf der Burg zur Erziehung war, plagten ihn diese Fragen noch immer.
„Arm und reich“, antwortete der Burgkaplan, „und die Ungleichheit der Menschen auf der Welt sind von Gott gegeben. Wir haben daran nicht zu zweifeln. Wer arm ist, kann für die Reichen arbeiten und beten, die Reichen geben den Armen Brot, Dach und Schutz. Diese Beziehung untereinander ist ein geordnetes Ganzes, die Ungleichheit wird erst im Himmel aufgehoben in einer höheren Harmonie.“ Vitilo muss lange darüber nachdenken. Schließlich scheint ihm des Kaplans Antwort nicht schlüssig zu sein und eine Lücke zu haben.
„Gott hätte doch von Anfang an die Ungleichheit gar nicht erst zulassen dürfen. Alle wären gleich arm und gleich reich! Das wäre gerecht!“
Solche und ähnliche Fragen waren dem Kaplan geläufig. Sie wurden immer wieder gestellt.
„Diese Lösung würde nicht aufgehen“, hatte der Kaplan geantwortet, „Arme und Reiche, oder eigentlich ist es ja eine Dreiteilung: Klerus, Adel und Bauern kann man nicht einfach in arm und reich aufteilen. Jeder dieser Teile hat eine andere, eine sehr spezielle, ihm zugeordnete Aufgabe. Die Adeligen geben uns Schutz, sie verteidigen die Heimat, die Bauern sorgen für unsere Ernährung und der Klerus betet für das Seelenheil aller. Ob reich oder arm, zählt nicht. Nur wer die Aufgaben, die seinem Stand aufgegeben sind, richtig und aufopferungsvoll erfüllt und wer nicht versucht, aus Unzufriedenheit oder Besserwisserei Gott wegen seines Standes zu erzürnen, erfüllt auch den Auftrag Gottes und seiner Heiligen Kirche und kann auf das Paradies nach seinem Tod hoffen. Das tägliche Gebet, der sonntägliche Besuch der Heiligen Messe, die Erfüllung der Heiligen Sakramente können auch den Armen reich machen.“
Dieser Logik konnte Vitilo für den Augenblick nichts entgegen setzen. Obwohl er fühlte, dass an der Schlussfolgerung irgendetwas nicht stimmen konnte.
Er dachte an seine eigene Vergangenheit. Als Achtjähriger kam er auf die Scheyerner Burg. Hier, in Wittelsbach und Wartenberg darf er nun sein, obwohl er unfrei geboren ist, unfrei wie seine Eltern, Geschwister und Vorfahren. Er hat das Wohlwollen seines Herrn, des Herrn Grafen, erfahren und soll eines Tages als freier Mann sogar zum Ritter geschlagen werden.
„Ich habe in der Dreiteilung der Gesellschaft, die Ihr mir erläutert habt, wohl eine Stufe übersprungen. Eigentlich gehöre ich ja den Bauern an, den unfreien.“
„Das hast du der Gnade unseres Herrn Grafen zu verdanken, der dich aus der Unfreiheit nach oben geholt hat.
Vitilo musste, während er auf seinem Apfelschimmel weiter Richtung Wartenberg reitet, lange über diese Unterredung nachdenken.
Als er mit seiner kleinen Gruppe das Stift Freising erreichte, konnte er in die weite Ebene und über die schier endlosen Auwälder der Isar blicken. Er sah, dass der Fluss in seinem Hauptarm mit großer Wucht und Kraft vorbeipflügte, ein richtiger wilder Gebirgsfluss eben, sich aber auch in eine Vielzahl von Nebenarmen aufspaltete. Und wenn Vitilo die Augen zukniff, meinte er, in der Ferne sogar den Hügelsporn erkennen zu können, auf dem die neue Burg entstehen soll.
Dieser Hügelsporn ragt aus der Hügelfront heraus, die durch den Gletscher und als Hochufer der Isar entstanden ist und sich von dort weit, bis hinauf zur Donau im Norden, bis in die Gegend von Regensburg zieht.
Südwestlich vom Wartenberg sieht er die weite flache Ebene, eine Schotterebene und angrenzende Moosgegend als krassen Gegensatz zur bewaldeten Hügelkette.
Er reitet in das Freisinger Stift ein und muss einen steilen Pfad nach unten nehmen. Dann kommt er in die Stadt und gleich wieder auf den Berg, auf dem Kloster und Kirche ihm eine kurze Rast bieten.
Lange hält es ihn nicht. Nach einer köstlichen Jause im Empfangsraum des Klosters und einem kurzen Gebet in der großen, dreischiffigen Bischofskirche, der Tausendjährigen, die vor gut 200 Jahren nach einem Brand erneuert worden ist, verabschiedet er sich nicht ohne den Hinweis, dass sein Herr als Vogt über Kirche und Kloster Freising herrscht.
Mit tiefer Verbeugung bestätigt dies der Probst, der die Rolle des Gastgebers übernommen hatte, nachdem der Bischof nicht anwesend war.
Nun mussten die Reiter mit ihrem Tross vorsichtig den steilen Berg hinunter zur Isar schaffen und gelangten über die Brücke in den dichten Auwald.
Sie hatten sich vorzusehen, weil die Isar ständig ein neues Bett sucht und so die Morphologie des Ufers verändert. Da können die Pfade schon einmal überraschend in Altwässern oder abgeschnittenen Mäandern und Seitenarmen der Isar münden, deren Tiefe kaum kalkuliert werden kann.
Nach einer weiteren Stunde, nachdem er die Isarbrücke hinter sich gebracht hatte, näherte er sich dem Moos bei Eitting. Er muss sehr darauf achten, dass er mit seiner Gruppe keine Wege verfehlt, denn die Landschaft ist moorig und tief. Jeder Schritt der Pferde muss sorgsam gesetzt werden. Alle sind froh, wenn sie wieder die Römerstraße erreichen, die Richtung Preising führt. Bei Lern müssen sie die Sempt überqueren. Wie sie wissen, gibt es keine Brücke. Aber eine Furt finden sie nach längerem Suchen.
Nun ist es nicht mehr weit bis Aufham.
Dort befindet sich die „Villa“, ein Herrensitz, der „Villa Rustica“ aus der Römerzeit vergleichbar. Vielleicht sogar ein Überbleibsel aus jener Zeit.
Das Herrenhaus beherbergt eine Flucht von herrschaftlich ausgestatteten Zimmern mit allen nötigen Nebenräumen, darunter ein heizbares Bad, so wie es die Römer liebten. Die Villa dient dem Grafen als Etappenziel, wenn er in seinen Ländern und Feldern unterwegs ist.
Neben dem Herrenhaus liegen in einem weitläufig umzäunten Bereich die Wirtschaftsgebäude und Stallungen. Denn zur Villa gehört eine große Landwirtschaft, die von Unfreien, von Leibeigenen des Grafen betrieben werden muss, von Unfreien, die früher dem Grafen von Ebersberg unterstellt waren und nach dem Erbfall nun Pfalzgraf Otto dienen müssen.
Diese Villa hatte sich Vitilo als Domizil erwählt für die Zeit, in der er sich in der Gegend aufzuhalten hatte.
Graf Otto hatte ihn hierher geschickt, um den Bau der Burg auf dem Wartenberg zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass sie möglichst bald für ihn und seine Familie bewohnbar wird.
Die Pferdeknechte bringen nun Vitilos Apfelschimmel und die anderen Pferde in den Stall. Dort werden sie abgerieben und erhalten Futter und Eimer voll Wasser. Die Pferdeknechte und die begleitende Schutzmannschaft erhalten ebenfalls eine Erquickung. Sie schlafen im Pferdestall.
Vitilo begibt sich ins Herrenhaus. Er ist verschwitzt und müde. Die Mägde haben ihm ein Bad bereitet.
Wieder hergestellt und erfrischt begibt er sich auf das Zimmer, das ihm zugewiesen ist und dann zum Hauptmann, der den Hof leitet.
Er überbringt die Grüße des Herrn Grafen und erkundigt sich, wie weit die Fortschritte in den Vorarbeiten für die Burg gediehen sind. Der Hauptmann berichtet, dass die Bauern im ganzen Land, die zu Frondiensten verpflichtet sind, seit Wochen auf dem Wartenberg beschäftigt sind. Sie haben Bäume gefällt, um die Sicht vom Hügel über die Umgebung zu verbessern, haben den ganzen Hügel entbuscht und mit Hacken und Schaufeln die Baustelle eingeebnet, die Hänge auf drei Seiten steiler gemacht und sind im Nordosten dabei, einen mächtigen Graben auszuschaufeln. Hunderte von Bauern müssen hier mit ihren Ochsen und Fuhrwerken kostenlose Fron leisten.
Dort nämlich entsteht der „Flaschenhals“, die engste Stelle des Bergsporns, die Stelle, an der die Burg vom Feind hätte eingenommen werden können. Jetzt kann er nur über eine Brücke, wohl eine Zugbrücke, überwunden werden. Eine solche sehen die Pläne für die Burg auf dem Wartenberg auch vor.
Ehe diese Arbeiten begonnen werden konnten, waren alte Anlagen auf dem Berg zu entfernen gewesen. Es waren dies Beobachtungseinrichtungen, so genannte „Warten“, die dem Berg und der Ortschaft, die sich am Fuße des Hügels gebildet hatte, den Namen gaben.
Vitilo reitet zum Berg, begrüßt den Baumeister. Er war aus Freising gekommen und trug die Verantwortung über die Technik des ganzen Bauwerks, hatte sich um alle architektonischen Fragen zu kümmern wie Konstruktion, Statik und Bautechniken, aber auch um die Koordination der Handwerker und Hilfskräfte, die Beschaffung des Materials, also die gesamte Bauleitung.
Daneben arbeiten die Bauhandwerker.
Es werden Leute gebraucht für alle Gewerke, Schreiner und Steinmetzen, Tischler und Gerüstbauer, Maurer und Ziegelbrenner.
Viele von ihnen hat der Baumeister mitgebracht, andere wurden aus den Reihen der Handwerksburschen gewonnen, die mit ihrer Handwerksausbildung über die Lande zogen, um Erfahrung zu sammeln zur Abschließung ihrer Ausbildung.
Die Wanderjahre nach Abschluss der Lehrzeit waren eine Voraussetzung für die Handwerksgesellen, dass sie Meister werden und sich niederlassen konnten. Sie lernten so neue Arbeitspraktiken kennen und fremde Regionen und Länder, besonders aber Lebenserfahrung.
Oft kamen täglich Wandergesellen und fragten nach Arbeit.
Wenn der Baumeister feststellte, dass das Gewerk benötigt wurde, konnten sie bleiben. Aber nur, wenn sie sich für mindestens ein halbes Jahr, oder bis Fertigstellung der Burg verpflichteten.
Pfalzgraf Otto hatte Weisung gegeben, wie er sich die Burg vorstellte. Einen gezeichneten Bauplan gibt es nicht, den hatte sich der Baumeister bei den Vorgesprächen ins Gedächtnis geprägt.
Er erläutert Vitilo die Planung.
An der Süd-West-Ecke soll der Turm erstehen, der dazu dienen soll, die ganze Ebene im Süden, Westen und Osten zu überblicken und zu überwachen. Daran anschließend der wichtigste Bau, das Herrenhaus mit dem Saal und der anschließenden Küche, den Woh- und Repräsentationsräumen des Grafen. Gegenüber die Kemenate und die Kapelle. Dazu Gebäude für das Wachpersonal, für die Vorräte. Das Ganze umgeben von einer mannshohen Steinmauer. Jenseits der Zugbrücke, in der Vorburg, sieht er die Wirtschaftsgebäude und Ställe vor, geschützt durch dreifache Wälle.
Vitilo stellt fest, dass die Wünsche des Grafen erfüllt werden und gibt sein Plazet.
Schon vor Wochen waren die Bauern mit ihren Fuhrwerken in den Wäldern unterwegs, um Eichen und Buchen zu fällen und zur Baustelle zu transportieren. Diese harten Hölzer waren nötig für die Tragwände und Deckenkonstruktionen. Und für die Zugbrücke als Belag.
Die Zimmerleute fertigten daraus „gehauene“ Balken und Bretter. Aber auch Fichten und Tannen mussten herbeigeschafft werden für die Gerüste und für Bauverkleidungen, für Stallungen und Vorratsschuppen, ebenso für die Dachstühle.
Schon seit über einem Jahr hatten die Ziegelbrenner Ton und Sand ins Zieglertal hinter der Baustelle gebracht, ihn gewässert und wieder bis zur „Lederhärte“ getrocknet, damit er in Formen gebracht werden konnte.
Vitilo besichtigt die Baustelle. Für den Turm waren bereits die Fundamente gelegt. Mit Ochsenfuhrwerken wurden dazu Flusskieselsteine verschiedener Größe von der Isar hierher geholt und mit Bruchsteinen und Mörtel vermischt in die ausgehobenen Gräben eingebracht. Daneben waren große Mengen Backsteine aufgeschichtet, die darauf warteten, auf die Fundamente gemauert zu werden.
Vitilo wendet sich mit seinem Apfelschimmel vom Burgberg nach Osten ins Zieglertal, so nannten die Arbeiter den Weg, der zum Brennofen führt. Dort sieht er die große Grube, in der sich der Ton als Ausgangsmaterial für die Ziegel befindet. Er muss trocknen, bis er krümelig ist und wird dann erneut bewässert und gegebenenfalls mit Sand vermischt und dann in die Ziegelmodel, die hölzernen Formen gestrichen. Rechts von der Grube sieht Vitilo unzählige Steine, die zum Trocknen aufgeschichtet sind, damit sie gebrannt werden können, sobald sie den richtigen Trocknungsgrad erreicht haben.
Auf der anderen Seite der Grube sind die schon fertig gebrannten. Der Brandmeister Otomar, kurz „Oto“ genannt, ist gerade damit beschäftigt, den Brennofen aufzurichten. Er und seine Tochter Ada verrichten dieses verantwortungsvolle Geschäft gemeinsam.
Vitilo kann das Auge nicht von Ada wenden. Er beobachtet aufmerksam, wie das junge Mädchen – später erfuhr er, dass sie sechzehn war - mit großer Umsicht die getrockneten Tonziegel, die ihr der Vater reicht, Stück um Stück, immer eine Reihe horizontal und eine hochkant aufeinanderreiht und die Hohlräume, die dabei entstehen, mit Holzkohle auffüllt. Es ist dies eine sehr diffizile Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Dafür sind die großen rauen Hände des Vaters nicht so geeignet. Umso wichtiger ist für ihn deshalb, dass sie ihn bei der Arbeit unterstützt.
Als sie Vitilo auf seinem Pferd gewahr wird, dreht sie sich zu ihm um und begrüßt ihn mit einem zierlichen und charmanten Knicks.
Vitilo blickt sie an und malt sich ihre Schönheit aus, die sie unter einer klobigen, schmutzigen Jacke versteckt. Er vermutet eine schlanke, grazile Gestalt, das sonnengebrannte Gesicht zeigt unter der Haube helles, blondes Haar. Mehr kann er von ihr nicht erblicken. Auch ihre Stimme bleibt ihm stumm. So sind es allein die Bewegungen ihres jungen Körpers, die seinen Blick unwiderstehlich anziehen.
Ihre blonden Haare löst sie jetzt und sofort fließt eine Haarflut freie über ihre Schultern.
Vitilo ist jetzt vierundzwanzig Jahre alt.
Seit er an den Hof des Pfalzgrafen geholt worden war, hatte er nur Interesse, den Anforderungen, die man an ihn gestellt hatte, gerecht zu werden. Nichts darüber hinaus.
Zwar hatte er in den Jahren seiner Pubertät schon öfter ein Auge auf die eine oder andere Magd geworfen, die auf der Scheyerner Burg diente. Aber nie sah er eine solche Schönheit wie heute. Nie hatte der Blitz der Liebe ihn getroffen.
Er fragt nach ihrem Namen.
Unter Erröten hauchte sie ihn.
Vitilo springt vom Pferd.
Wo sie denn wohne.
„Bei meinen Eltern in einem Ort in der Nähe von Freising“, aber derzeit, so lange an der Burg gebaut werde, wohne sie hier am Bauplatz in einer Hütte.
Den ganzen Sommer über.
Im Winter kehre sie mit ihren Eltern zurück in ihre Kate, nachdem hier der Ton für die Steine in die Grube gebracht worden sei, der dort den Winter über bleiben müsse, damit er richtig ausfriere.
Vitilo ergreift ihre Hand, die sie sofort zurückzuziehen versucht.
Ob sie ihn nicht besuchen wolle, in der Villa Aufham, in der er Quartier habe? Wieder errötete sie und meinte, das schicke sich nicht. Aber wenn sie mit ihrem Vater kommen dürfe, dann gerne.
So kam es, dass sich Ada und ihr Vater an einem Sonntag-Mittag, nachdem die Arbeiten, die auch an diesem Tag sein mussten, verrichtet waren, zu Fuß auf den Weg nach Aufham zur Villa machten.
Der Weg war nicht weit. Nur durch die Furt der Strogen und dann höchstens eine halbe Stunde. Dort angekommen, sah Vitilo nun die ganze Schönheit des Mädchens. Denn sie hatte sich hübsch herausgeputzt.
Aber was ihn noch mehr reizte als die wohlgeformte Gestalt, die langen und frisch gewaschenen blonden Haare, die sie kokett aufgesteckt hatte und das spitzbübische Gesicht mit der hübschen Stupsnase, das waren ihre zarten, feinen Bewegungen, die bescheidene Art ihres Verhaltens, wie sie die Hände, denen man die harte Arbeit am Brennofen nicht ansieht, ineinander faltet und wie sie ganz so wie bei ihrer ersten Begegnung einen kleinen, zurückhaltenden Knicks andeutet.
Vitilo war entzückt. Noch nie hatte er beim Anblick eines Mädchens gespürt, dass es ihn so unwiderstehlich zu ihm hinzog .
In seinem Innersten entbrannte ein Gefühl, das er bisher nicht kannte, ein Gefühl, das ihn mit einer solchen Kraft erfasste, dass er ihm nicht widerstehen konnte. Mit diesem Mädchen wollte er alleine sein, um mit ihm zu plaudern und den Geruch ihrer Person einzuatmen.
Nur zu schade, dass stets der Vater um sie war.
Aber nach dem Mittagstisch, als der Vater kurz eingenickt war, konnte Vitilo die kleine Ada in den Garten führen und mit ihr einige Worte ohne Aufsicht wechseln.
Auf die Frage, ob sie einen Freund habe, antwortete sie mit ja. Es sei Trindo, ein Zimmerergeselle, der auch beim Bau der Burg Arbeit gefunden habe. Sie liebe ihn sehr und auch er versichere sie stets seiner Liebe. Sobald er entsprechend verdiene, wollen sie heiraten.
„Aber du bist doch erst sechzehn!“ wollte Vitilo einwenden.
„Es wird ja auch noch etwas dauern“, ihre kurze Antwort.
Vitilo spürte, dass trotz ihrer Versicherung die Verbindung zwischen ihr und Trindo noch nicht allzu gefestigt war. Andererseits musste er feststellen, dass seine Person sie nicht oder noch nicht entflammt hatte.
Da kam ihm eine Idee. Er wollte erreichen, dass sie von hier gelöst würde und er möglichst häufig in ihrer Nähe sein konnte.
„Ich könnte behilflich sein. Am Hof meines Herrn, des Herrn Grafen, könnte ich dich möglicherweise unterbringen. Du hättest leichte Arbeit, volle Verpflegung, stets ein Dach über dem Kopf.“ Dieser Vorschlag hatte einen unschönen Hintergedanken: er könnte so das Mädchen von ihrem Freund trennen.
Ada überlegt.
Ein verlockendes Angebot.
Immer schon hatte sie den Wunsch verspürt, aus dem schweren Alltag in der Brennerei auszubrechen, andere Leute, andere Landstriche kennenzulernen, eine echte Perspektive für ihr weiteres Leben zu gewinnen.
Schon die Villa in Aufham mit der Großzügigkeit der Räume, der Einrichtung, der Bequemlichkeit bewundert sie – und sieht dagegen ihre Hütte mit den nicht verglasten kleinen Fensterchen, die stets auch tagsüber nur dämmrige Düsternis verbreiten, zu beleuchten nur mit entzündeten Binsen, die in Fett getaucht waren und entsetzlich stanken, mit der rußigen Feuerstelle in der Mitte und der Öffnung im Dach, durch die der Rauch abziehen sollte, nachdem er den ganzen Raum verpestet hatte.
Sie konnte sich gar nicht ausmalen, wie das Leben am Hof des Herrn Grafen aussehen könnte.
Aber, was würde Trindo sagen?
„Hätten Sie denn auch für Trindo eine Stelle am Hof?“ Sie liebte ihn – aber sie fühlte auch den inneren Vorbehalt, dass eine Vereinigung mit ihm das Leben hier in dieser Umgebung auch nicht lichter gestalten würde.
„Ich müsste mal sehen“, war Vitilos ausweichende Antwort.
In Wahrheit will er Trindo nicht dabei haben, wenn er Ada an den Hof vermittelt. Er will sie ja für sich haben. Sie würde im Laufe der Zeit ihren Freund vergessen und er hätte leichtes Spiel, so waren seine Überlegungen.
Der Vater hat sein Mittags-Nickerchen überwunden und tritt zu den Beiden. Den letzten Satz hatte er mitgehört.
„Das kommt nicht in Frage!“ seine kurze, schroffe Antwort. „Ich brauche Ada für mein Geschäft.“
Oto war aufgebracht, dass der Burghauptmann ihm seine Tochter, die er nicht nur brauchte, sondern die er auch liebte und ohne die er seine Arbeit nicht bewältigen zu können überzeugt war, wegnehmen wollte.
„Ada soll ihren Trindo heiraten. Ich würde ihr dafür jederzeit den Segen geben. Er ist ein Partner, der zu ihr passt. Ein lieber, arbeitssamer junger Arbeiter, ein tüchtiger Zimmerer, der entschieden und zukunftssicher an seiner Ausbildung arbeitet und schließlich als Zimmerermeister sein eigenes Leben in die Hand nehmen wird. Mit ihm kann Ada glücklich werden. Das ist die gesellschaftliche Ebene, in die unsereiner hingehört. Über die eigene soziale Ebene hinauszublicken, bringt keinen Segen.“
„Sie könnten Ihrer Tochter eine neue, eine bessere Zukunft geben. Und ich wäre dabei behilflich. Ich liebe sie nämlich und würde sie, wenn sie zustimmt, zur Frau nehmen.“
„So eins, zwei, drei? - Komm, mein Kind, wir haben hier nichts mehr zu schaffen!“
Er nimmt Ada bei der Hand und entfernt sich mit ihr ohne Gruß.
Vitilo bleibt ratlos zurück.
Er sieht sehr wohl, dass Ada kurz und von ihrem Vater unbemerkt zu ihm zurück blickt.
„Vielleicht bin ich ihr doch nicht gleichgültig geblieben“. Er hofft es und will deshalb am Ball bleiben.
Am nächsten Tag ist Vitilo an der Baustelle.
Die Fundamente für den Turm sind erstellt. Die Hilfsarbeiter bringen mit Schubkarren die Backsteine, die im vergangenen Winter gebrannt worden waren und so lange zum Trocknen aufgeschichtet waren.
Nun sind die Maurer an der Arbeit. Stein um Stein, zweimal längs, zweimal quer wird Zeile um Zeile aufgeführt.
Weiter reitet Vitilo ins Zieglertal.
Er sieht Ada am Brennofen arbeiten. Geschickt hat sie die lederharten Steine aus den Modeln genommen und aufgeschichtet – immer mit einer Schicht Holzkohle dazwischen. Sie blickt kurz auf, als Vitilo vom Pferd springt und er kann sehen, wie sie ihm ein schüchternes Lächeln schenkt. Der Vater nimmt von Vitilos Anwesenheit Kenntnis, wagt aber keine Reaktion. Er weiß um des Aufsehers Macht über alle, die hier arbeiten.
Trindo war bislang ahnungslos. Als Zimmerer ist er am Bau mit der Herstellung des Dachgestühls für den Wehrturm beschäftigt. Der Brennofen ist außerhalb seines Blickfeldes. So konnte er nicht beobachten, dass der Burghauptmann auffällig häufig dort zu sehen war, häufiger als es die Bauaufsicht erfordert hätte.
Trindo vertraute fest auf die Treue seiner Ada. So fest, dass er immer wieder ins Fadenkreuz seiner über ihn spottenden Arbeitskollegen gelangte.
Sie haben schnell bemerkt, dass Vitilo offensichtlich die kleine Ada umschwärmte.
Besonders der schiefe Bernar, der nicht nur schief war wegen eines kürzeren Beines, sondern der auch stotterte.
„Vit.., Vit.., ..tilo war scho wieder bei A.., A.., Ada!“
„Halts Maul!“ Trindo war sich der Ada sicher.
„A.., A.., da hat …“
„Sei still! Was geht dich Ada an. Mach deine Arbeit! Halt lieber den Balken fest, dass ich ihn mit dem Beil zuschlagen kann!“
Die anderen Zimmerer haben neugierig zugehört.
Sie alle mögen Ada und mancher hätte sie gerne als Freundin gehabt. Sie aber war stets abweisend allen gegenüber. Trindo war die Ausnahme.
Durch die andauernden Sticheleien wurde Trindo allerdings im Laufe der Tage mürbe. Auch wenn er es niemals zugegeben hätte, begann in seinem Innern der Zweifel zu nagen.
Der Burghauptmann war eine angesehene Respektsperson, sein attraktives Äußeres, seine beachtliche Karriere, sein großer Einfluss auf den Herrn Grafen und die Tatsache, dass er noch unverheiratet war, machte ihn für alle Mädchen interessant.
„D.., d.., der Herr B.., B.., Burg…, Burghauptmann war wie.., wie.., wieder bei A.., Ada! – Er hahat Aa.., Aa.., …“
„Dein Aa interessiert uns nicht!“ unterbrach ihn ein Arbeitskollege.
„Lass den Trindo in Ruhe!“ ein anderer.
Trindo äußert sich nicht. Er kann es sich nicht vorstellen, dass seine Ada ihm untreu werden könnte.
Nächste Station in Vitilos Umritt ist der Halsgraben.
30 bis 40 Mann schaufeln sich vorwärts. Der Aushub wird auf Ochsenkarren nach oben gebracht. Er wird für die Wälle benötigt, die im Norden die Vorburg schützen sollen.
Inzwischen werden die Grundfesten für das mächtige Herrenhaus, das Ritterhaus, erstellt und für die Mauer, die einmal die ganze Burganlage umgeben soll.
Vitilo muss zurück nach Scheyern, an den Hof, um Bericht über den Fortschritt der Bauarbeiten auf dem Wartenberg zu bringen und neue Anweisungen einzuholen – und Geld. Denn er hat die Kasse zu überwachen und die Auszahlungen an die Handwerker anzuordnen.
Die Burg in Wittelsbach ist inzwischen fertiggestellt und die Hofhaltung bereits hierher umgesiedelt.
Als er in Scheyern ankommt, findet er nur noch einige Hofbedienstete vor, die Restarbeiten verrichten.
Die Scheyerner Burg soll umgebaut und den Benediktinern übergeben werden. Graf Otto möchte hier sein Hauskloster errichten. Es soll die Grablege für seine Familie aufnehmen.
Also wendet sich Vitilo mit seinem Pferdeknecht und dem Tross weiter nach der neuen Burg.
Schon von weitem sieht er sie auf dem Hügelsporn.
Ganz ähnlich wie auf dem Wartenberg fällt das Burg-Plateau steil ab. Der Turm ragt hoch auf. Über die Brücke, die den Halsgraben im Norden überspannt, gelangt er in den Burghof. Dort wird er empfangen. Die Knechte versorgen die Pferde. Vitilo selbst wird ins Herrenhaus geleitet. Dort wird er dem Herrn Grafen gemeldet, der ihn nach kurzer Wartezeit in seinen Saal bittet.
Der Finanzchef ist anwesend. Ihm übergibt Vitilo die vorläufigen Abrechnungen. Die Geldkassette wird überprüft und weitere Beträge werden hinzugefügt.
Den Grafen interessieren aber vor allem die Aufzeichnungen des Bauleiters mit den Skizzen des bisherigen Baufortschrittes.
Vitilo legt sie ihm vor mit den nötigen Erläuterungen.
Der Graf ist voll des Lobes für seinen Vitilo, den er ja selbst aus dem unfreien Bauernstand auf die Burg geholt hat und ruft den Notar in den Saal. Dieser erscheint mit einem Bündel Urkunden unter dem Arm.
Der Graf übernimmt die Urkunden und setzt zu einer kurzen Rede an: „Ich habe nun über längere Zeit Deinen Einsatz und Deine Arbeit beobachtet, vor allem um die Errichtung der beiden neuen Burgen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Du eine treue Stütze meines Wirkens bist. Ich wüsste keinen Besseren am Hof als Dich für den Posten des Burghauptmanns meiner Burg hier, wie auch der künftigen auf dem Wartenberg. Deine Arbeit hat alles hier geprägt und meine Mitarbeiter nennen diese Burg hier nur noch 'Vitilos Burg'.“
Er überreicht Vitilo die Ernennungsurkunde und fährt fort: „Ich erwarte von Dir absoluten Gehorsam, Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit und Solidarität.“
Vitilo ist zunächst wie gelähmt. Niemals hatte er mit dieser Ehrung und mit ihr die Übertragung eines so wichtigen Amtes gerechnet. So dauert es eine Weile, bis er in der Lage ist, zu erwidern:
„Ich danke untertänigst für diese nicht erwartete Ehre und schwöre in Gegenwart des Herrn Notars lebenslange Treue und Fürsorge für die Burgen des Herrn Grafen.“
Der Notar übergibt Vitilo eine Reihe von Abschriften der Urkunde, die dieser benötigt, um sich vor anderen als Burghauptmann zu legitimieren.
Damit hatte die Burg ihren Namen offiziell: Vitilos Burg – daraus entstanden: „Wittelsbacher Burg“. Und Otto nannte sich fürderhin „Otto von Wittelsbach“ – wie sein Sohn, der sich zusätzlich auch noch „Otto von Wartenberg“ nennen wird.
Damit war etwas geschehen, was noch nie jemals bekannt geworden war: dass ein Herr seine Familie nach dem Namen eines zunächst Unfreien benannte.
„Darf ich dem Herrn Grafen eine Bitte äußern?“
„Du hast eine Bitte frei.“