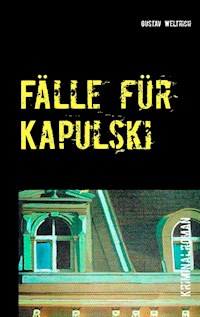
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kriminalhauptkommissar Paul Kapulski hat im Krimi "Das Biedermeier Haus" einen tödlich geendeten Autounfall zu untersuchen. Dabei taucht er tief ein in die Wirrnisse, Verschlagenheiten, Täuschungen und Ränke der Kommunalpolitik. Und das alles in einer kleinen oberbayerischen Gemeinde mit ihren politischen Repräsentanten. Im "Lohengrin Konstrukt" hat er es mit einer Möbelfabrik zu tun mit einer genialischen, aber leider nicht gesetzeskonformen Firmenphilosophie, mit einem Autoschieber mit Charisma und einer Toten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
I
II
III
IV
Das Lohengrin Konstrukt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I
Kriminalhauptkommissar Paul Kapulski parkt seinen VW-Golf auf einen der wenigen ausgewiesenen Stellplätze des Rathauses von Obertieming. Er dehnt sich nach dem Aussteigen und atmet genussvoll die angenehme Luft des frühen Herbsttages.
Wir schreiben den 10. September 2002.
Er und seine Frau haben auf ihrem Balkon in der milden Sonne gefrühstückt.
Gegen neun Uhr war er im Büro und fand auf seinem Schreibtisch den Akt vor, den er nun zu bearbeiten hat.
Ein Verkehrsunfall. Routine.
Die Kollegen von der Polizeiinspektion Torstadt haben den Unfall aufgenommen. Und nun soll Kapulski untersuchen, ob Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.
Die Versicherungen wollen das.
Hans Drescher, Schriftsetzer in der Buch- und Offset-Druckerei Alois Ganzer in Obertieming war in seinem Porsche-Carrera GT 911 Cabrio mit seinen 325 PS und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Fahrt nach München vor zwei Tagen in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern geraten und mit der linken Längsseite seines Fahrzeuges, der Fahrerseite, an einen Alleebaum geknallt. Unzählige Male war er die Strecke schon gefahren. Er kannte jede Stelle, jede Kurve, jede Einzelheit. Und doch konnte er das schnelle Fahrzeug nicht mehr beherrschen, so dass es zu diesem folgenschweren Unfall gekommen ist. Der Aufprall war so gewaltig, dass sich der Sportwagen förmlich um den Baum gewickelt hatte.
Der Motorblock war aus seiner Verankerung gerissen und lag einige Meter neben dem Auto.
Ein anderes Fahrzeug war offenbar nicht beteiligt.
Hans Drescher dürfte sofort tot gewesen sein.
Die Polizeibeamten, die den Unfall aufgenommen hatten, veranlassten, dass das Autowrack im kriminaltechnischen Institut untersucht wurde, um festzustellen, ob etwa ein technischer Defekt als Unfallursache in Frage käme.
Bei dem heftigen Aufprall war ein Rad, das linke Vorderrad, abgerissen worden. Es war weggerollt und etwa 30 Meter weiter im Straßengraben gefunden worden.
Kapulski sieht sich um. Er war nur einmal vorher in Obertieming gewesen und das ist lange her.
Das Rathaus steht auf dem Marktplatz und ist dort das einzige Gebäude mit zwei Obergeschossen.
Es dürfte in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts als Ersatz für ein früheres gebaut worden sein. Es wirkt schmucklos, ist in einem Einheits-Beige gestrichen, mit helleren Lisenen. Nur an der Ecke zwischen dem ersten und zweiten Stock reckt sich ein schmiedeeiserner, schwarz bepinselter Adler in die Diagonale. In seinen Krallen hält er ein goldenes Schild mit der Aufschrift „Rathaus“, wie wenn er es soeben gefasst hätte und nun zum Horst schaffen möchte. Die anderen Häuser am ausgewogen geformten, leicht nach Westen geneigten Marktplatz sind in der Regel zweigeschossig: Eine Bäckerei, eine Apotheke, eine Metzgerei, die Obertieminger Volksbank, die Post und das Gasthaus zum Schwarzen Adler. Sie wirken zwar gepflegt, aber nur zwei oder drei weisen ältere Bausubstanz auf und lassen das Alter des Ortes erahnen.
Der Platz ist gepflastert mit Kleinstein aus Granit, unterbrochen durch Reihen aus Großsteinpflaster.
In der Mitte des Platzes ein mächtiger Maibaum mit Motiven aus der örtlichen Geschäftswelt und Handwerkerschaft.
Es ist ruhig im Ort. Mittagszeit.
Kapulski betritt das Rathaus.
Es macht einen städtischen, modernen Eindruck. Der Empfangsschalter ist zwar derzeit nicht besetzt. Aber dem “Wegweiser” ist zu entnehmen, dass sich das Büro von Bürgermeister Mark Zauser im Zimmer 11 im ersten Obergeschoss befindet. Erstaunlicher Weise kann man gar mit einem Lift nach oben schweben.
Im Zimmer 10, dem Vorzimmer, begrüßt ihn Franziska Lehr, die Sekretärin sowohl des Bürgermeisters als auch des Geschäftsleiters Hermann Dachs.
Sie ist im Dienst ergraut, macht aber einen kompetenten, sehr beweglichen, freundlichen Eindruck.
Kapulski weist sich mit der Kennmarke aus und wird in das Amtszimmer des Bürgermeisters eingelassen.
Bürgermeister Mark Zauser erhebt sich hinter dem Schreibtisch, reicht dem Kommissar die Hand und bietet ihm den Stuhl gegenüber an.
Er ist adrett gekleidet. Der dunkelblaue Anzug mit der dezenten Krawatte auf weißem Hemd scheint der „Dienstanzug“ aller Bürgermeister zu sein.
Das Büro ist einfach, aber geschmackvoll eingerichtet. Die hellen Möbel stammen aus dem Katalog für kommunale Diensträume. Was den Raum aufwertet, ja attraktiv und unverwechselbar macht, das sind die vielen und in gedrängter Fülle die Wände zierenden Bilder, alles Ölgemälde, wie Kapulski meint, in passenden dekorativen Rahmen. Und mit Qualität. Das weist Kapulski, den an Bildender Kunst Interessierten darauf hin, dass der Bürgermeister einigen Kunstsinn haben dürfte.
Der Schreibtisch ist so gestellt, dass er Licht aus dem Fenster zur Linken erhält, aus dem Fenster, das nach Osten zeigt, mit der Morgensonne, die aber jetzt zu Mittag weitergewandert ist, so dass keine Blendwirkung auftritt und das Fenster deshalb auch nicht verhängt oder abgedunkelt werden muss.
Auf dem Tisch liegen Akten, Bücher, Prospekte, alles etwas genialisch durcheinander, um nicht zu sagen unordentlich. Was fehlt, ist ein Computerbildschirm, sonst “Schmuckstück” eines jeden Schreibtisches in der Verwaltung.
“Ich bin über diesen schrecklichen Unfall zu tiefst erschüttert.” beginnt der Bürgermeister, nachdem ihm der Kommissar den Grund seines Kommens erläutert hatte.
Mark Zauser ist seit Mai dieses Jahres hauptamtlicher Erster Bürgermeister der Gemeinde Obertieming.
Er ist Mitte 50, mittelgroß, etwas untersetzt, mit kurzen Armen und fleischigen, aber gepflegten Händen. Seine dunklen, im vorderen Teil schon etwas schütteren Haare gehen ins Graue. Die graublauen Augen können sich zu einem schmalen Schlitz verengen, wenn sie ein gegenüber mustern, seine Bewegungen sind geschmeidig, er macht insgesamt einen souveränen, ja man kann sagen, fast staatsmännischen Eindruck.
“Ich habe Herrn Drescher sehr gut gekannt. Er war viele Jahre Mitglied des Gemeinderates und zuletzt des Bau- und Planungsausschusses. Dadurch ergaben sich häufige Kontakte. Auch außerhalb der Sitzungen.
“Hatten Sie neben der gemeindlichen Arbeit zudem private Beziehungen oder Verbindungen mit ihm?”
“Nein, er lebte sehr zurückgezogen. Über sein Privatleben weiß ich eigentlich gar nichts.”
“Er fuhr einen Porsche Carrera GT 911, ein sehr teures Fahrzeug. Glauben Sie, dass er sich ein so luxuriöses Auto überhaupt leisten konnte?”
“Offensichtlich. Solch extrem teure Fahrzeuge gibt es oft unglaublich preiswert im Gebrauchtwagenhandel, weil der Käuferkreis für gebrauchte Luxusfahrzeuge dieser Klasse nicht sehr groß sein dürfte. Allerdings die Treibstoffkosten sind beachtlich.”
Die Sekretärin und der Geschäftsleiter wissen auch nicht mehr. Sie bestätigten nur, dass sie mit ihm, dem Angestellten der Buch- und Offsetdruckerei Alois Ganzer GmbH, häufig zu tun hatten, wenn sie Druckwerke für die Gemeinde bestellten. Und dass er ein sehr engagierter Gemeinderat war, der viel Zeit und Energie in sein Wirken als Mitglied des Bau- und Planungsausschusses investierte.
Ihm war die Entwicklung des Ortes ein auffallend großes Anliegen und er glaubte, dass hierfür das Anwachsen der Einwohnerzahl die erste Voraussetzung sei. Deshalb war er darauf bedacht, dass immer wieder neue Baugebiete ausgewiesen wurden.
Nicht sehr viel, was Kapulski nach diesen Auskünften mit nach Hause nehmen konnte.
Sein nächster Weg führt ihn zur Druckerei, besser gesagt zu deren Eigentümer und Dreschers Arbeitgeber, Alois Ganzer.
“Hans Drescher war ein zuverlässiger Angestellter, meine rechte Hand im Betrieb sozusagen. Er war über zehn Jahre bei mir beschäftigt, zunächst als gelernter Schriftsetzer, ein Beruf, den es heute im früheren Sinn nicht mehr gibt. Heute würde man sagen “Mediengestalter für Digital- und Printmedien”. Dann auch als eine Art Geschäftsführer.
Sein Tod schmerzt mich nicht nur menschlich. Betrieblich gesehen ist er eine Katastrophe. Hans Drescher hinterlässt in meiner Druckerei eine Lücke; die kaum zu schließen sein wird.”
“Sind Sie auch über seine persönliche Situation im Bilde?”
“Ich weiß nur, was in seinen Personalakten steht:
Er ist in München geboren. Dort hat er auch seine Ausbildung erfahren. Er war Jahrgang 1970, ist also 32 Jahre alt geworden, war unverheiratet und ohne familiären Anhang. In Obertieming hatte er keine Freunde, soviel ich weiß. Seine freie Zeit verbrachte er vorwiegend in München”.
“Aber er war Gemeinderat”
“Ja, und diese Aufgabe hat er sehr ernst genommen”
“Können Sie mir Hinweise geben, die mit dem Unfall zu tun haben?”
“Nein - davon weiß ich nur, was ich in der Zeitung gelesen habe.”
“Hans Dreschers Auto, mit dem er verunglückte, war ein Porsche Carrera GT 911. Ein sehr teures Auto. Konnte er sich so einen Luxusschlitten denn leisten?”
“Schnelle Autos waren sein Ein und Alles. Vielleicht hielt er seinen Lebensstandard sonst sehr bescheiden. Ich weiß es nicht.”
Ein Routinefall.
Kapulski hat seine Pflicht erfüllt.
Es handelte sich um einen Verkehrsunfall, wie sie zu Tausenden vorkommen: Überhöhte Geschwindigkeit, Überforderung des Fahrers.
Ein Fremdverschulden kommt offensichtlich nicht in Frage. Er wird zu Hause ein Protokoll diktieren, dann ist die Sache für ihn erledigt.
Paul Kapulski setzt sich in sein Auto und fährt kreuz und quer durch Obertieming.
Er sieht sich die Pfarrkirche an, eine große Hallenkirche, ursprünglich wohl gotisch mit schlanken Säulen und später, als sie barockisiert wurde, mit Pilastern zwischen den vergrößerten Fenstern und heller und freundlicher Ausstattung. Die Figuren am Hoch- und den Seitenaltären, ein St. Georg, dem die Kirche geweiht ist, sowie St. Petrus und Paulus und die Hl. Barbara sind von hoher Qualität. Ein “Kirchenführer” ist nicht vorhanden, so dass er nichts über die Künstler erfahren kann.
Kapulski kennt sich in Kunstgeschichte einigermaßen aus. Gerade die Epoche von Barock und Rokoko, insbesondere der “Bayerische Barock”, gehört zu seinen Lieblingsgebieten.
Erst an den beiden letzten Wochenenden haben er und seine Frau kleine Exkursionen zu den wichtigsten Künstlern dieser Epoche, Johann Baptist Straub und Ignaz Günther unternommen nach Berg am Laim, Dießen, Gauting, Kloster Andechs, Kloster Schäftlarn und Kloster Ettal, um Straubs Werke zu besichtigen. Ignaz Günther besuchten sie in Freising-Neustift, Rott am Inn, Weyarn und Mallersdorf. Nachdem gerade von Ignaz Günther viele Entwürfe nicht von ihm selber, sondern von Schülern oder anderen Künstlern ausgearbeitet worden sind, nimmt Kapulski an, dass die Figuren in der Obertieminger Kirche dazu gehören. Denn die Bewegung der Skulpturen, der Augenschnitt und der Ausdruck der Gesichter, sowie die umeinander purzelnden Putti weisen auf diesen genialen Künstler hin.
Neben der Kirche der Pfarrhof, wohl auch aus der Barockzeit mit quadratischem Grundriss und großem Walmdach. Im Lauf der Jahrhunderte unzählige Male um- und angebaut, die Fenster vergrößert, so dass das ästhetische Gleichgewicht des Baues, das es ursprünglich sicher gegeben hat, verloren gegangen und außer der Grundkonzeption vom Barock nichts übriggeblieben ist.
Ein Gebäude fällt ihm im Ort noch besonders auf:
Im Biedermeier- oder klassizistischen Stil. Es liegt in einem großen, etwas verwilderten Park. Soweit er es feststellen kann, ist es unbewohnt. Die Fensterhöhlen sind tot, etliche Scheiben eingeschlagen, der Putz löst sich an vielen Stellen. Aber in dem sonst eher schmucklosen Ort fällt es als ein überraschendes Bauwerk, um nicht zu sagen, ein Juwel, ins Auge.
Im Rathaus hatte er sich einen bunten Prospekt des Ortes mitgenommen. Aber aus ihm geht nicht hervor, welche Bewandtnis es mit diesem Gebäude hatte bzw. hat.
Die anderen Einträge liest er sich durch.
Dabei erfährt er, dass Obertieming rund 6000 Einwohner zählt, dass der Ort eine Reihe von Traditionsvereinen aufweist: den Schützenverein “Wilhelm Tell”, einen “Kriegerund Veteranenverein”, einen “Verschönerungsverein”, einen Sportverein, den “TSV Obertieming”.
Mit dem Trachtenverein in Oberlandtracht, dem Kirchenchor und dem Männergesangsverein “Harmonie” ist die Kultur “abgedeckt”.
Dann gibt es noch drei Allgemeinmediziner, zwei Zahnärzte, einen Tierarzt, zwei Apotheken, eine Filiale einer Drogeriemarktkette, einen “EDEKA- und einen “REWE”-Markt”, zwei Tankstellen, drei Wirtshäuser, eines davon ein Italiener, ein Café und eine Kneipe mit dem originellen Namen “Ums Eck”.
Im ganzen Ort wild und rücksichtslos geparkte Autos, wie heute überall. Vor allem vor den Geschäften. In der Hauptgeschäftsstraße und am Hauptplatz deshalb häufig ein Verkehrschaos. Die Straßenverkehrsordnung scheint sich bis Obertieming nicht so recht herumgesprochen zu haben.
Industrie gibt es offensichtlich nicht.
Es gibt aber ein Gewerbegebiet. Dorthin haben etliche größere Handwerksbetriebe ausgesiedelt. Aber viele Parzellen sind leer und harren der eklatant fehlenden Arbeitsplätze, eine der Hauptsorgen der Gemeinde und ihrer Verantwortlichen.
Am Rande des Ortes in allen Richtungen so einfallslose wie traurige und abscheuliche Siedlungen, ohne jedes Gesicht, mit ebensolchen Straßennamen: Blumen-, Margariten-, Erlen-, Birkenstraße, Am Waldrand, Im Großfeld und so weiter. Ein Haus gleicht dem anderen. Man hat das Gefühl, sie stammten alle vom gleichen Bauplan des immer gleichen Bauträgers oder –unternehmers.
Mit diesen Eindrücken macht sich der Kriminalhauptkommissar auf den Rückweg nach Torstadt, der Kreisstadt. Auf der Fahrt sieht er sich den Baum an, an dem Hans Drescher vor zwei Tagen sein Leben verlor. Die Rinde wurde bei dem Aufprall des Porsche fast rundherum abgeschält.
Die leichte Rechtskurve, in der der Wagen ins Schleudern gekommen war, sieht nicht so aus, als dass ein geübter Fahrer sie auch bei überhöhter Geschwindigkeit nicht hätte bewältigen können. Etwa 150 km/h haben die Sachverständigen aus der Bremsspur ermittelt. Diese Geschwindigkeit schafft ein Porsche-Carrera GT 911 im zweiten Gang!
Es ist vier Uhr am Nachmittag geworden, als Paul Kapulski wieder an seinem Schreibtisch in der Kriminalpolizei-Inspektion sitzt.
Jetzt erst merkt er, dass er zu Mittag nichts gegessen hat.
Sein Magen meldet sich.
Er ruft seine Frau an und macht ihr den Vorschlag, nach 18 Uhr, wenn er seine Arbeit hier beendet hat, essen zu gehen.
“Zum Griechen?”
“Einverstanden, zum Griechen.”
Er freut sich auf das Gespräch mit seiner Frau.
Kapulski ist ein Einzelgänger - und ein Einzelarbeiter.
Er steigert sich in seine Ermittlungen meist ohne Partner.
Da häufen sich die Eindrücke, die Probleme und auch die Sorgen an.
So ist es ihm wichtig, mit seiner Frau nach einem gefüllten Arbeitstag über alles zu sprechen, den Berg von Eindrücken, von unausgegorenen Ideen, von Einfällen und Rückschlüssen, von Argumenten zu sondieren und auf eine Reihe zu bringen.
Monika Kapulski ist eine kluge Frau.
Bevor Tochter Silvia zur Welt kam, war sie Verkäuferin im “Oberpollinger” in München in der Abteilung ‘Damen-Oberbekleidung‘. Sie brachte es dort bis zur Abteilungsleiterin.
Dann kam die Babypause und auch danach widmete sie sich ausschließlich der Tochter und dem Haushalt.
Sie ist zwei Jahre jünger als ihr Mann, derzeit also 51.
Kennen gelernt haben sich die beiden, als Paul in der Ausbildung bei der Kripo in München in der Ettstraße und Monika beim “Oberpollinger” lernte.
Aber es dauerte noch, bis sie sich das Ja-Wort geben konnten.
1977 kam Silvia zur Welt. Sie hat sich längst selbständig gemacht, ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie in München.
Paul und Monika freuen sich, wenn die Enkelkinder zu Besuch kommen und wenn sie mit Tochter und Schwiegersohn Unternehmungen planen können.
Nachdem die Tochter versorgt und außer Haus ist, kann Monika Kapulski wieder zum “Oberpollinger”, ist dort wieder Abteilungsleiterin, wenn sie auch nur noch 30 Stunden in der Woche arbeitet.
Nach seiner Ausbildung wurde Paul Kapulski in verschiedene Kriminalämter in ganz Bayern geschickt.
1983 kam die Versetzung nach Torstadt, was ihm sehr recht war, denn es war das Jahr der Einschulung seiner Tochter und brachte endlich eine örtliche Stabilität in sein Leben. Hier würde er nun bis zu seiner Pensionierung und darüber hinaus bleiben wollen.
Sie hatten sich eine hübsche Eigentumswohnung im ersten Stock eines Neubaus mit unverbaubarem Blick auf den Stadtpark und mit einem geräumigen Balkon geleistet.
Seit Silvia ausgezogen ist, kann Paul das ehemalige Kinderzimmer als Arbeitszimmer nutzen.
Immer wieder holt er sich Akten nach Hause, und zwar dann, wenn er vorhat, sich in Ruhe in sie zu versenken, ohne Ablenkung vom Parteiverkehr, von der Sekretärin und vom Telefon. Zuhause kann er den Telefonstöpsel aus der Dose ziehen. Früher, als das Kinderzimmer noch Kinderzimmer war, musste er diese Arbeiten im Wohnzimmer erledigen und stets sein Arbeitsgerät wieder wegräumen, wenn die Familie Ansprüche stellte.
Der Unfall von Hans Drescher scheint tatsächlich ein Unfall gewesen zu sein.
Ein anderes Fahrzeug war nicht beteiligt. Der Fahrer war angeschnallt. Dass das Vorderrad beim Aufprall abgerissen wurde, verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass sogar der gesamte Motorblock aus seiner Verankerung gehebelt worden ist.
Paul Kapulski diktiert ein kurzes Protokoll über seine Ermittlungen am heutigen Tag.
Das Fahrzeugwrack wird er freigeben, die Beerdigung von Hans Drescher genehmigen und den Akt schließen.
Es war 18 Uhr geworden.
Er wollte das Versprechen, mit seiner Frau essen zu gehen, nicht vergessen und machte sich auf.
Aber ehe er die Klinke der Tür ergreifen konnte, läutet das Telefon.
Kapulski überlegt kurz, ob er es ignorieren solle.
Dann griff er doch zum Hörer.
“Hallo Paul, hier Günter”
Es ist Dr. Günter Specht vom kriminaltechnischen Institut München.
“Wir haben das Autowrack noch einmal genau untersucht.
Die Befestigung des linken Vorderrades war manipuliert.
Alle vier Radmuttern waren zum Zeitpunkt des Unfalls gelockert. Wir konnten eindeutig feststellen, dass die Gewinde durch den Abriss des Rades beschädigt worden sind, aber erst ab etwa einem Zentimeter vor deren Ende. Sonst sind die Gewinde unversehrt geblieben. - Hast du mich verstanden?”
“Ja, aber was heißt das?”
“Das heißt, dass die Radmuttern ungefähr nur einen Zentimeter angeschraubt, oder, anders gesagt, bis hierher abgeschraubt waren. Diese Befestigung reichte bei niedriger oder auch bei Normalgeschwindigkeit aus, das Fahrzeug stabil zu halten.
Bei Erhöhung der gefahrenen Geschwindigkeit auf 150 Stundenkilometer reichte die Schwerkraft, die in der leichten Rechtskurve auftrat, aus, um das Rad aus der Verankerung zu reißen. So kam es zum Schleudern und schließlich zum Crash.”
“Das heißt also: Das Rad war vor dem Unfall abgegangen.”
“Ja, wir haben darauf die Unfallstelle noch einmal inspiziert und scharfkantige Rillen im Asphalt gefunden. Diese Rillen rühren vom Schlittern des vom Rad befreiten Radträgers auf dem Asphalt her.”
“Es ist der Beweis dafür, dass das Rad schon vor dem Zusammenstoß mit dem Baum abgetrennt war?”
“So ist es. Das abgetrennte Rad war die Unfallursache.”
“Kann sich ein Rad während der Fahrt “verabschieden”, wenn es ordentlich mit dem Radträger verschraubt ist?”
“Auf keinen Fall!”
“Ich danke dir, Günter“
“Gern geschehen. Servus, Paul!”
Damit war die Akte wieder geöffnet.
Paul verlässt sein Büro.
Seine Frau Monika interessiert sich für die Sache.
Nachdem sie ihre “Athener Platte” bzw. den “Griechischen Hirtenspieß” verspeist hatten und nun vor ihrem roten “Demestica” saßen und überlegten, ob sie sich noch eine der zuckertriefenden Süßspeisen gönnen sollten, fragt Monika, ob er schon eine Ahnung habe, wer diesen Anschlag ausgeübt haben könnte.
Nein. Er ist völlig überfragt und muss gestehen, dass er den Fall schon für abgeschlossen hielt. Selten war er so leichtsinnig mit einer Sache verfahren.
Der Anruf von Günter Specht ließ nun alles wieder offen erscheinen.
Kapulski ärgert sich über sich. Es ist eigentlich nicht seine Art, so schnell aufzugeben.
Er liebt seinen Beruf. Er liebt ihn deshalb, weil er ihm die Möglichkeit gibt, theoretische Konstrukte zu bilden aus winzigsten Hinweisen. Und diese Konstruktionen wieder aufzulösen, in Einzelteile zu zerlegen und deren Beziehungen zueinander zu analysieren. Aus dieser Analyse kann sich der Hergang auch der kompliziertesten Art erschließen. In dem Fall, der ihm vorgelegen hat, wollte diese Vorgehensweise nicht aufgehen. Allzu schnell hat er dem ersten Schein nachgegeben.
Kapulskis Kunst und sein Markenzeichen sind sein Vermögen, bei Verhören sein Gegenüber mit einfachen, leicht zu beantworteten Fragen zu konfrontieren. Dadurch wiegt er sie in Sicherheit und sie werden leichtsinnig.
An der Art von Formulierungen, bisweilen nur an der Färbung der Stimme konnte er wichtige Details ablesen.
Dieses Vermögen macht ihn zu einem erfolgreichen Kriminaler und zur Stütze der Kriminalpolizeilichen Inspektion. Seine Vorgesetzten, vor allem sein unmittelbarer Chef, Kriminaldirektor Ferdinand Hohenstein wussten das zu schätzen.
Paul Kapulski war 1949 in München geboren. Nach Volksschule und Realschule und der 11. und 12. Klasse der Fachoberschule machte er Abitur in München.
Es folgte die Ausbildung zum Polizeibeamten im gehobenen Dienst und schließlich die einjährige Ausbildung zum Kriminalbeamten.
Von einem solchen, der selbst Schwerverbrechen wie Mord, Totschlag, Sexualdelikte selbständig aufzuklären hat, werden hohe Voraussetzungen erwartet.
Paul Kapulski kann damit aufwarten: Geistige Beweglichkeit, logisch-analytisches Denken, Interesse für Psychologie, Einsatzbereitschaft und intuitives Gespür für Antworten in Befragungen, auch zwischen den Zeilen, sind Eigenschaften, die er jederzeit vorzeigen kann.
Paul Kapulski wirkt im ersten Ansehen zwar nicht besonders intellektuell, eher etwas schwerfällig mit seinem ausladenden Schnauzbart, der Glatze, der Fülle um die Körpermitte und seiner im Bayerischen stark dialektgefärbten Sprache.
Da können sich so manche Gesprächspartner leicht überlegen fühlen und werden so gesprächiger. Spätestens nach Beendigung des Gesprächs merkt er jedoch, dass Kapulski aus ihm Aussagen hervorgeholt hat, die er bei ruhigem Überlegen lieber doch nicht von sich gegeben hätte.
Paul Kapulski liebt seinen Beruf. Er kann selbständig arbeiten, erhält Einblick in die verschiedensten Berufe, Situationen und Geschäfte und kann mit der Arbeit reifen.
Nach der Untersuchung von Specht ist also klar: Hans Drescher ist ermordet worden. Der Mörder hat Dreschers Leidenschaft für schnelle Autos und für riskant hohe Geschwindigkeit für seine Tat genutzt.
Am nächsten Morgen fährt Kapulski erneut nach Obertieming. Er wendet sich zur Buch- und Offsetdruckerei Alois Ganzer.
Ob er wisse, wo Hans Drescher den Kundendienst für seinen Porsche besorgen ließe, wo er zum Beispiel die Winterund die Sommerreifen auswechseln ließe. Wer das denn mache.
Alois Ganzer wusste nur, dass Hans Drescher das Auto beim “Porsche-Zentrum” in Torstadt erworben hatte. Ob er dort auch den Kundendienst und den Reifen- oder Radwechsel machen lasse, entziehe sich seiner Kenntnis.
Kapulski sucht im Telefonbuch die Nummer des Porsche-Zentrums und wählt sie auf seinem Handy.
“Nein”, ist die Antwort, “ das lasse Herr Drescher wohl wo anders machen, oder er mache es selber. Er habe sich seit dem Kauf des Wagens nie wieder sehen lassen.”
Weiter in der Druckerei.
Aber auch Dreschers Kollegen können keine Auskunft geben.
Lediglich einer sagt hinter vorgehaltener Hand: “Vielleicht macht es ihm einer seiner schwulen Freunde?!”
Paul Kapulski wird hellhörig.
Einer seiner schwulen Freunde?
“Ja, ja, das ist bekannt, dass Hans Drescher homosexuelle Beziehungen hatte”, so ein andrer.
„Das haben Sie mir bei unserem gestrigen Gespräch verschwiegen“, wendet sich Kapulski an Ganzer.
Chef Ganzer bestätigt schließlich, dass Drescher homophil war. Aber, das habe ihn nie gestört. Das sei dessen persönliche Sache gewesen.
Auch, mit wem er „in Beziehung” stand, bzw. wo Drescher seine sexuellen Neigungen auslebte, weiß niemand zu beantworten.
Weder Ganzer, noch Bürgermeister Zauser noch Geschäftsleiter Hermann Dachs.
Kapulski erinnert sich: Ganzer hatte ihm geschildert, dass Drescher seine Freizeit hauptsächlich in München verbringe und dass er deshalb in Obertieming kaum Freunde oder Bekannte habe.
Er muss also im Münchner Schwulenmilieu ermitteln.
In seinem Büro angekommen, bittet er seine Sekretärin, die wichtigsten Schwulentreffs in München zusammen zu stellen.
Sie findet im Internet eine ganze Reihe von einschlägigen Lokalen.
Sie telefoniert alle durch. Ohne Erfolg. Sie hat den Eindruck, mit einer Frau spricht man nicht.
Sie war einmal vor Jahren per Zufall in eine solche Gaststätte gekommen. Erst nach und nach hat sie bemerkt, dass sich hier nicht alles “normal” abspielt. Sie konnte aber feststellen, dass alle Anwesenden ihr gegenüber äußerst liebenswürdig und freundlich waren. Trotzdem war sie erleichtert, als sie wieder im Freien war.
Im “Blauen Löwen” in der Münchner Demianstraße, im Gärtnerplatz-Viertel, wird sie schließlich fündig.
Es ist früher Nachmittag.
Im Lokal dösen einige Gestalten.
Zum Teil skurril gekleidete, geschminkte Kerle. Sie sitzen an den Tischen oder lehnen an der Bar.
Meist haben sie ein Glas Wasser vor sich, oder einen Espresso, die aber schon lange Zeit dort unberührt zu stehen scheinen.
Auch der Wirt gehört zum “Milieu”.
Zunächst ist er nicht bereit zu sprechen, auch nachdem Kapulski seine Dienstmarke vorgezeigt hatte.
Erst, als ihm gesagt wird, Hans Drescher sei tot, wird er sprechbereit.
Hans Drescher sei regelmäßig hier gewesen.
Er habe viele Kontakte gepflegt.
Zuletzt aber nur noch mit Fred.
“Wer ist Fred?”
“Fred ist ein Strichjunge, der sich für Geld zur Verfügung stellt.”
“Ist Fred hier?”
“Nein, ich habe ihn mindestens eine Woche nicht mehr gesehen”.
“Wie kann ich ihn erreichen?”
“Am besten hier im Lokal. Normalerweise ist - oder war - er regelmäßig ab 20 Uhr an der Bar und wartet auf Hansi.” Hansi ist niemand anderer als Hans Drescher.
Am Abend, nach 20 Uhr, ist Paul Kapulski wieder im “Blauen Löwen”.
Drei oder vier Männer hängen an der Bar.
An ihrem Äußeren und ihrer soften Kostümierung sind sie unschwer als “Schwule” zu erkennen. So oder so ähnlich hatte er sie sich auch vorher schon immer vorgestellt.
Einer davon, ein hübscher Junge, oder wie es im Jargon heißt, ein “süßer Boy” mit einem Engelsgesicht und passenden langen, blonden Locken, sowie langen, oder verlängerten Wimpern, Rouge im Gesicht, wendet sich an Kapulski:
“Bist du auch so einsam? Wollen wir uns nicht etwas unterhalten? - Aber nicht hier.”
“Nein, ich warte auf Fred”
“Er kommt nicht”, weiß der Boy.
“Er hatte eine Auseinandersetzung mit seinem Lover. Dabei ging es ziemlich heftig zu, musst du wissen. Und seitdem habe ich die Beiden nicht mehr gesehen.”
“Wie heißt Fred mit Familiennamen und wo wohnt er?”
“Das weiß ich beim besten Willen nicht.”
Auch der Wirt will damit nicht heraus rücken.
Erst als Kapulski droht, ihm die Konzession entziehen zu lassen, nennt er den vollen Namen: Alfred Dommert.
“Wo er wohnt, weiß ich nicht.”
Am nächsten Morgen spuckt in der Kriminalinspektion der Computer die erforderlichen Daten aus.
Alfred Dommert wohnt nur um die Ecke vom “Blauen Löwen”.
Kapulski läutet an der Tür.
Ein etwa 20 Jahre alter Mann öffnet.
Er hat, wie der Mann an der Bar, lange blonde, aber jetzt unfrisierte wirre Locken. Die Schminke in seinem Gesicht ist verwischt. Er trägt einen windigen Bademantel über schmuddeliger Unterwäsche.
Offensichtlich hat ihn Kapulski aus dem Bett geholt.
“Kriminalpolizei”. Er zeigt seine Marke.
Dem Kommissar entgeht nicht, dass der junge Mann heftig erschrickt, sich aber sehr schnell wieder fängt.
“Sie wünschen?”
“Sind sie Herr Dommert?”
“Ja”
“Kennen Sie einen Herrn Hans Drescher?”
Fred zuckt.
Die Frage kommt so unerwartet, dass er wie automatisch antwortet:
“Ja”.
Kapulski drängt Fred ins Innere der Wohnung, schließt die Tür.
Es ist ein Einzimmer-Appartement, sinnvoll geschnitten: Eine kleine Diele, ein relativ großes Zimmer, das im Augenblick zum Schlafen hergerichtet ist mit einem breiten Bett mit roter Bettwäsche, das zusammengeklappt werden kann, um den Raum zum Wohnen nutzen zu können mit kleiner Kochnische.
Anschließend ein sehr kleines Bad mit WC und Dusche.
“Wann haben Sie Hans Drescher zuletzt gesehen?”
“Ich weiß nicht - gestern - oder vorgestern.”
“Sie lügen!”
“Warum sollte ich ..?”
“Sie hatten mit ihm ein Verhältnis … Ein Liebesverhältnis?”
“Ja” stammelt Fred, “aber was soll das?”
“Sie hatten Streit?” -
“Ja”
“Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? - Jetzt aber die Wahrheit!”
“Vor etwa 14 Tagen.
“Wo war das?”
“Hier in meinem Zimmer”.
“Worum ging der Streit?”
“Das möchte ich nicht sagen”
“War es Eifersucht? Hatte Hans Drescher einen anderen Lover?”
“Darüber spreche ich nicht”
“Dann muss ich Sie in Untersuchungshaft nehmen.
Hans Drescher ist mit seinem Auto tödlich verunglückt. Es war manipuliert.
Sie stehen im Verdacht, dass Sie ihn haben beseitigen wollen. - Ich muss Sie wegen Mordverdachts vorläufig festnehmen.”
Paul Kapulski ließ die Handschellen um die Handgelenke Freds zuschnappen, nachdem dieser die wichtigsten Dinge für einen Aufenthalt im Untersuchungsgefängnis zusammengepackt hatte.
Während der Verhöre leugnet Fred stets, sich am Auto Dreschers betätigt zu haben.
Auch weist er entschieden zurück, dass er und Drescher in höchster Erregung handgreiflich geworden seien und dass Drescher ihn geohrfeigt habe.
Als der Kommissar ihm vorhielt, Drescher habe ihm eröffnet, dass er sich von ihm abwenden wolle, dass er künftig seine Wohnung nicht mehr bezahlen und auch die regelmäßigen Bargeldleistungen einstellen werde, dass er ihn im Übrigen bei der Polizei zur Anzeige bringen werde wegen ungenehmigter Prostitution, leugnet er empört.
Kein Wort davon sei wahr.
Nach tagelangem Verhör gibt Fred immerhin zu, dass er von Drescher regelmäßig Geld erhalten habe.
II
Der Schlüssel für die ganze Geschichte liegt in dem Geschehen etwa zwei Jahre früher, im Jahr 2000.
Ewald Meier ist noch Bürgermeister von Obertieming. Kommunalwahlen sind erst im März 2002.
Seit zwei Jahren steht das ehemalige Krankenhaus leer. Es ist jenes Gebäude, das Paul Kapulski bei seinem Besuch in Obertieming später besonders aufgefallen ist. Es war das frühere Gemeindekrankenhaus, das nach der Krankenhausreform aufgelassen worden ist.
Bevölkerung und Gemeinderat sind in der Einschätzung, was mit ihm geschehen soll, gespalten.
Die einen möchten das “alte Gemäuer” am liebsten beseitigen und das Areal zu höchst möglichem Preis verkaufen. Die anderen plädieren für den Erhalt.
Immerhin ist dieses Biedermeierhaus das einzige historische Gebäude neben der Kirche und dem Pfarrhof in der Gemeinde.
Etliche Bauträger haben schon vorgesprochen. Und auch schon Angebote unterbreitet.
Bürgermeister Ewald Meier und die meisten Gemeinderäte plädieren für den Verkauf.
Den unterstützt auch der Geschäftsleiter der Gemeinde, Hermann Dachs.
Die Einnahmen würden der Gemeindekasse gut tun, die ohnehin stets Ebbe zeigt.
Der Gemeinderat solle einen Bebauungsplan für das Areal erarbeiten, dort eine Wohnbebauung vorsehen und das Baugebiet von einem Bauträger erschließen lassen.
Noch besser, die Gemeinde solle das erschlossene, parzellierte Gebiet einem Bauträger verkaufen.
Die zentrale, attraktive Lage könnte einen beachtlichen Erlös erwarten lassen.
Anders die Argumentation von Gemeinderat Franz Adam, Biobauer in Obertieming und von Gemeinderat und Druckereibesitzer Alois Ganzer.
Sie sprechen sich dafür aus, das Gebäude zu erhalten. Es stelle weit und breit das einzige im Biedermeierstil errichtete und in der Fassade original erhaltene Gebäude dar.
Zu Recht stehe es unter Denkmalschutz. Es wäre eine Schande, so ein wichtiges Zeugnis der Geschichte des sonst so geschichts- und gesichtslosen Obertieming dem “öden Mammon” zu opfern.
Das Gebäude gehöre sach- und fachgerecht saniert, der Park wieder hergerichtet und das Haus der Öffentlichkeit gewidmet.
Unversöhnlich stehen sich die Meinungen im Gemeinderat gegenüber.
Und derselbe Riss geht durch die Bevölkerung.
Dieses ehemalige Krankenhaus ist das wichtigste Gesprächsthema an den Stammtischen der Wirtshäuser.
Das Gebäude ist mächtig. Die etwa 40 Meter lange Hauptfassade ist im Stil der klassizistischen Biedermeier-Architektur gegliedert.
Etwa in der Mitte befindet sich der Eingang, ein Portal mit Säulen, darüber ein Balkon mit Balustrade aus Gusseisen, verspielt in den Formen, aber klar, weiß lackiert.
Die Fenster in den drei Etagen sind alle eineinhalb mal so hoch wie breit, im zweiten Stock etwas niedriger als im ersten, unterteilt mit einer Sprosse vertikal und zwei Sprossen horizontal. Sie sind im ersten Obergeschoss, der “Belle Etage” mit einem Stuckrundbogen gekrönt, in dem klassizistische florale Darstellungen eingearbeitet sind. Seitlich und zum zweiten Stockwerk hin ist das Bauwerk mit Lisenen gegliedert. An den Ecken und immer nach zwei Fenstern befinden sich Pilaster, geriffelt und stuckiert.
Das Dach ist ein so genanntes “Mansarddach” oder “Doppelwalmdach”, ein “geknicktes” Dach, wobei der untere Teil steiler ist als der obere. Dadurch entstehen zwei Zonen. Der untere Teil ist mit “Mansardfenstern” versehen und diente zu Wohnzwecken, ursprünglich wohl dem Personal. Der obere ist Speicher.
Das Ganze macht einen herrschaftlichen Eindruck. Unverkennbar wirkt der Barock noch nach. Doch ist der Gesamteindruck nicht eher repräsentativ, sondern bürgerlich privat, nicht protzig, sondern individual.
Wenn das Gebäude auch schwer sanierungsbedürftig ist, hat sich sein Erscheinungsbild doch kaum verändert.
Erbaut wurde es 1830 von dem damals sehr erfolgreichen Schriftsteller Karl Philipp Ringelstein, der eine ganze Reihe historischer Romane geschrieben hatte, dadurch reich wurde und sich im Alter von 40 Jahren in diesem “Landhaus”, wie er es nannte, niederließ.
Ringelstein war viele Jahre befreundet mit dem berühmten Wiener Architekten Joseph Georg Kornhäusel. Ringelstein und Kornhäusel waren etwa gleich alt. Sie hatten sich in Wien kennen gelernt, machten gemeinsame Reisen und blieben ein Leben lang befreundet.
Joseph Georg Kornhäusel war der herausragende Architekt des Wiener Klassizismus, sozusagen der “Wiener Schinkel” und einer der wichtigsten Architekten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er wirkte vor allem in Wien und in Baden bei Wien. Zu seinen bekanntesten Bauwerken gehören das Theater in der Josefstadt in Wien, der Ausbau des Stiftes Klosterneuburg und das Theater in Baden bei Wien, das aber leider im 20. Jahrhundert der Spitzhacke zum Opfer fiel.
Joseph Georg Kornhäusel war Mitglied der KK Akademie der bildenden Künste in Wien, dessen Mitgliedschaft eine große Ehre darstellte.
Aus alter Verbundenheit hat er seinem Freund dieses Haus für Obertieming entworfen.
Ringelstein starb im selben Jahr wie der Architekt 1860. Er war alleinstehend und kinderlos und vermachte das Haus mit Park der Gemeinde Obertieming mit der Maßgabe, es als Gemeinde-Krankenhaus zu nutzen.
So geschah es.
Ringelstein wurde posthum zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Eine Straße trägt seinen Namen.
Bis Mitte der 60er Jahre beherbergte das Krankenhaus 50 Betten.
Betreut wurden die Patienten von Mallersdorfer Schwestern. Letzter Belegarzt war der damals einzige niedergelassene Arzt am Ort, der noch junge Dr. Bader.
Dann griff das Gesundheitsgesetz und das Haus musste geschlossen werden, da es wegen seiner geringen Kapazität und seiner primitiven Ausstattung nicht mehr in die moderne Krankenversorgung passte.
Die Schließung wurde von der Bevölkerung sehr bedauert. Immerhin hatte das Haus über 80 Jahre den Obertiemingern bestens gedient.
Zahllose Kinder wurden dort geboren und vielen Alten war es das Sterbehaus.
Dr. Bader war zwar “Allgemeinpraktiker”, war aber auch in chirurgischen, kinder- und frauenheilkundigen Aufgaben sehr versiert. So dass er in vielen Fällen Hilfe gewähren konnte und die Leute so in ihrem Heimatort bleiben durften. Sie mussten nicht ins Kreiskrankenhaus nach Torstadt gebracht werden.
Nach Schließung des Hauses wanderten die Schwestern ab, die Krankenhauseinrichtung wurde entfernt und das Haus samt Park an die Firma Mirza & Co in Torstadt verpachtet, die hier eine Filiale ihrer Fabrik für Brillengestelle einrichtete.
Im Jahr 2000 musste die Firma Mirza & Co, Torstadt, und mit ihr die Filiale in Obertieming wegen Zahlungsunfähigkeit schließen.
25 Mitarbeiter der Filiale, überwiegend Frauen, wurden entlassen und arbeitslos.
Der damalige Bürgermeister Ewald Meier erwirkte beim Konkursverwalter eine Abfindungszahlung an die Mitarbeiter.
Seit dem steht das Haus leer und zur Disposition.
Der Gemeinderat fasst nun mit 1 Stimme Mehrheit den Beschluss, das Areal höchstbietend zu verkaufen.
Eine ganze Reihe von Bauträgern stürzt sich auf den Ort. Jeder will die begehrte Immobilie nutzen.
Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan “Wohnpark Ringelstein”.
Das lässt eine Reihe von Gemeinderäten nicht ruhen.
Alois Ganzer macht sich zum Sprecher der Einwohner, die das Haus erhalten wollen.
Er beruft eine Versammlung ins Gasthaus zum Schwarzen Adler ein mit dem Ziel, eine Bürgerinitiative zur Erhaltung des Hauses zu gründen.
Das Gasthaus ist überfüllt.
Emotionen werden geweckt.
“Was sind das für vaterlandslose Gesellen, die dieses wichtige, dieses einzige profane historische Gebäude von Obertieming einfach versilbern wollen.”
“Wir wollen dieses Haus, das der Erbauer an die Gemeinde für einen sozialen Zweck vermacht hat, behalten.”
“Er hat es für ein Krankenhaus geschenkt. Nachdem ein solches in dieser Zeit nicht mehr möglich ist, sollte es anderen sozialen Zwecken dienen”.
“Ja, wir wollen ein Altenheim, ein Seniorenzentrum. Ein solches ist für unsere Gemeinde wichtig, damit die Alten, die nicht mehr ihren Haushalt selber führen können, in Obertieming bleiben können und nicht wegziehen müssen”.
“Und es sollten ein paar kleine Ein- oder Zweizimmerwohnungen für ‘Betreutes Wohnen’ entstehen für Leute, die nicht mehr alleine ihre Wohnungen betreuen können, aber nicht in ein Heim wollen.”
Es war kein Problem, die nötigen Unterschriften beizubringen, die zur Beantragung eines Bürgerbegehrens notwendig sind.
Alois Ganzer, unterstützt von Biobauern Franz Adam, war über das Prozedere eines Bürgerbegehrens mit dem Ziel eines Bürgerentscheids bestens informiert.
Bürgermeister Ewald Meier aber hatte bereits mit Bauträgern, an der Spitze mit Wilfried Brauer, dem Geschäftsführer der W.B.Immo-GmbH & Co.KG in Torstadt Gespräche aufgenommen.
Brauer hatte zunächst weniger geboten als der nächste Bewerber, schließlich aber, noch während der Bieterfrist, aufgestockt. Sein Angebot war nun das günstigste und ihm sollte in der nächsten Sitzung des Gemeinderats der Zuschlag erteilt werden.
Das Ganze war nun wegen des Bürgerbegehrens gestoppt. Alois Ganzer musste dafür büßen.
Seine Druckerei bekam fortan bis auf Weiteres keine Aufträge mehr von der Gemeinde.
Bei der Bürgermeisterwahl 2002 kann Bürgermeister Ewald Meier aus Altersgründen nicht mehr antreten. Er wird im Januar 65 Jahre alt und muss am 30. April gemäß Beamtenrecht als Bürgermeister ausscheiden.
Damit werden “die Karten neu gemischt“, der Bürgermeisterposten wird frei.
Mark Zauser war immer schon politisch - und besonders kommunalpolitisch - interessiert.
Er ist Mitglied des Gemeinderats und dort auch im Bau- und Planungsausschuss tätig. Er gehört der Partei an, die “den weiß-blauen Himmel über Bayern” erfunden hat und deren Vertreter schon bei der Nominierung mit einem Ausgangswert von nahe 50% gewählt sind.
Die dann noch notwendigen paar Prozente wird er ohne Problem einfahren.
Er hat eine Naturbegabung in freier Rede und verfügt über eine hohe Überzeugungskraft, auch wenn seine Ziele und Pläne oft diffus sind.
Seine Partei hat keinen besseren Kandidaten und so nominiert sie ihn als Bürgermeister- und als Spitzenkandidat für den Gemeinderat.
Und nicht nur das: auch für den Kreistag in Torstadt wird er auf den Wahlzettel gesetzt, hier allerdings nicht auf einen der vorderen Plätze.
Für Mark Zauser ist der Erfolg als künftiger Bürgermeister also nicht nur in greifbarer Nähe, sondern eigentlich schon perfekt.
Er muss ihn haben, nicht nur, weil er den entsprechenden Ehrgeiz spürt, sondern auch, weil er beruflich nicht so erfolgreich war, wie er sich das gewünscht hatte.
Er ist in Frankfurt am Main geboren.
Seine Eltern sind beide früh gestorben. So wuchs er bei einer Tante, der Schwester seines Vaters, in Frankfurt auf. Dort besuchte er das Gymnasium und machte das Abitur im humanistischen Zweig mit gutem Notendurchschnitt.
Da er schon seit Jahren eine künstlerische Ader in sich verspürte und er viele für einen Unausgebildeten beachtliche Zeichnungen und Bilder produziert hatte, wählte er als Studium die Kunstgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Er beginnt das Grundstudium, in dessen Verlauf er “Scheine” erwirbt in allen großen Kunstzeitabschnitten.
Nach vier Semestern gilt es, die Zwischenprüfung zu bestehen, die zum Hauptstudium führt. Diese Prüfung ist mündlich. Mark Zauser besteht sie nicht.
Er könnte sie wiederholen, aber er unterlässt es.
Warum?
Seiner späteren Frau wird er gestehen, er habe unüberwindbare Schwierigkeiten mit seinen Professoren gehabt.
Zauser geht nach München.
Er schreibt sich in der Kunstakademie ein, “Freie Malerei und Bildhauerei” bei Prof. Anastasius Hahn.
Eine Mappe mit Zeichnungen, Entwürfen, Skizzen und Ölbildern musste er einreichen. Sie wurden akzeptiert, obwohl die Arbeiten nicht ganz den Vorstellungen der Jury entsprachen.
Mark wurde zur Eignungsprüfung zugelassen.
Diese teilt sich in eine praktische und eine theoretische.
In der praktischen muss er in Klausur das Thema bearbeiten: “Verkehr in der Großstadt“.
Acht Stunden hat er dafür Zeit.
Das Ergebnis findet die Zustimmung der Eignungsjury. Auch die theoretische Prüfung kann er bestehen. Seine angeborene Beredsamkeit hilft ihm dabei entscheidend.
Die Aufnahme erfolgt auf Probe. Nach Ablauf der Probezeit, das sind zwei Semester, muss er sich der Probezeitprüfung stellen.
Er ist nun Student in München. Aber wie soll er seine Studien und sein Leben in dieser Zeit finanzieren?
Die Studiengebühren sind zu bezahlen, der Studentenwerksbeitrag und das möblierte Zimmer, das er unweit der Akademie gefunden hat. Und leben muss er auch.
Bafög erhält er. Diese reicht aber nicht. Auch Mittel aus der “Karl-Forster-Stiftung” bekommt er. Damit kann er wenigstens das benötigte Material, Pinsel, Farben, Zeichenblöcke, Stifte usw. finanzieren.
Um seine Finanzsituation zu fundieren, verdingt er sich im “Unionsbräu” in der Türkenstraße.
Dort arbeitet er täglich als Kellner von 18 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zusätzlich von 12 bis 15 Uhr.
Gerade an Sonntag-Mittagen ist viel zu tun. Unzählige Schweinsbraten schleppt er durchs Lokal und ungezählte Halbe Bier.
Er ist ein beliebter Kellner und kassiert gutes “Trinkgeld”.
Doch das wandert in einen großen Topf, aus dem auch die Bediensteten hinter den Kulissen, Schankkellner und Küchenpersonal davon abkriegen. Am Monatsende wird abgerechnet und christlich geteilt.
Diese Solidarität macht ihn auch für die Kollegen und vor allem Kolleginnen angenehm.
Aber ein Gast, ein junges Mädchen, hat ein besonderes Auge auf ihn geworfen.
Mark blieb es nicht verborgen.
Täglich kam es ins Lokal, suchte sich einen Tisch, den er bediente und machte ihm “schöne Augen”.
Sie kamen ins Gespräch und vereinbarten ein Treffen am nächsten Sonntag, wenn er seinen Dienst um 15 Uhr beendet hatte.
Sie holte ihn ab.
Es war ein schöner Tag.
Sommer.
Heiß.
Sie gingen Richtung Englischer Garten. Beim Chinesischen Turm suchten sie sich einen schattigen Platz unter einem Kastanienbaum.
Am Buffet holte er für sich und sie einen Kaffee.
Sie sitzen an Biertischgarnituren.
Viele Familien sind hier mit kleinen Kindern.
Es macht den Kleinen Spaß, in einem Boot zu sitzen und auf dem Kleinhesseloher See zu paddeln, auf den Wiesen Ball zu spielen.
Umso größer wird der Hunger und dann packt Mama die Brotzeit aus. Papa bekommt ein Bier, Mama und die Kinder ein Limo.
Die Sympathie zwischen unseren beiden ist nicht einseitig. Auch Mark hatte Amors Pfeil verspürt.
Zur Feier des Tages und um sich das “Du” zu gestatten, spendiert Mark einen Prosecco.
So dauert es nicht lange, bis sie Hand in Hand gehen.
Schnell sind die Namen ausgetauscht. Hilde heißt sie, Hilde Kauter.
Auch er stellt sich vor: Mark Zauser.
Marks Hand tastet sich an ihre Taille.
Sie hat eine hübsche Figur, die ein „Münchner Dirndl“ deutlich zur Geltung bringt, ein ebenmäßiges, schmales Gesicht mit großen dunklen Augen.
Gestört wird die Harmonie nur durch eine etwas kräftige Nase, die aber angeblich für einen starken Charakter steht.
Es dauert nicht lange, da ist die Frage zu klären: “Zu Dir oder zu mir?
Bei Mark: unmöglich!
Seine Zimmerwirtin ist konservativ. Sie duldet keinen Damenbesuch.
Bei Hilde geht es.
Erst muss er aber noch Dienst im “Unionsbäu” machen. Um 23 Uhr holt sie ihn ab.
So wird das Zusammensein immer intimer.
Für beide wird es klar: Sie wollen zusammen bleiben.
Hilde studiert das Lehramt und möchte Grundschullehrerin werden.
Derzeit ist sie im Endsemester und hat noch einige Praktika zu absolvieren. Dann folgt die zweite Lehramtsprüfung.
Sie stammt aus Obertieming, einem Ort im Oberland im Landkreis Torstadt, mit ungefähr 6000 Einwohnern.
Dort hat die Mutter ein Haus.
Hilde möchte nach Abschluss des Studiums an der Grundschule Obertieming arbeiten.
Diesen Ort und diesen Namen hat Mark noch nie gehört.
Er erzählt ihr von seinem Studium auf der Kunstakademie und von seinem Traum, die Malerei und Bildhauerei zu seinem Beruf zu machen.
Aber noch ist es nicht so weit.
Eine Zwischenprüfung ist fällig.
Hier versagt er total. Zumindest in den Augen des Professors.
Professor Hahn und Mark kommen in der Kunstauffassung nicht zusammen.





























