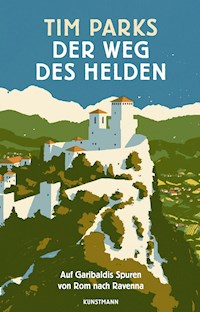
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Marsch Garibaldis und seiner Garibaldini durch den Apennin von Rom nach Ravenna ist legendär und zentral für die Einigung Italiens. Im Sommer 2019 ist Tim Parks Garibaldis Spuren gefolgt und durch das Herz des Landes gewandert: eine großartige Erkundung von Italiens Vergangenheit und Gegenwart. Im Sommer 1849 musste Guiseppe Garibaldi, Italiens legendärer Revolutionär, die Verteidigung Roms endgültig aufgeben. Er und seine Männer hatten die Stadt vier Monate gehalten, aber nun war klar, dass nur die Kapitulation die Zerstörung durch die überlegene französische Armee verhindern würde. Es galt, die Niederlage in einen moralischen Sieg zu verwandeln, und so führte Garibaldi mit seiner schwangeren Frau Anita eine kleine, schnell aufgestellte Armee an, um den Kampf für die nationale Unabhängigkeit fortzusetzen. Von französischen und österreichischen Truppen verfolgt, marschierten die Garibaldini über den Apennin und kamen mit nur 250 Überlebenden in Ravenna an. Tim Parks hat sich auf die Spuren Garibaldis begeben und ist seinem Weg durch das Herz Italiens gefolgt: ein grandioser Reisebericht, der von Garibaldis Entschlossenheit, die keine Rücksichten kannte, seiner Kreativität, seinem Mut und seinem tiefen Glauben erzählt und ein faszinierendes Porträt Italiens zeichnet, damals und heute, mit unvergesslichen Beobachtungen italienischer Lebensart, der Landschaft, der Politik und der Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Der Marsch Garibaldis und seiner Garibaldini durch den Apennin von Rom nach Ravenna ist legendär und zentral für die Einigung Italiens. Im Sommer 2019 ist Tim Parks Garibaldis Spuren gefolgt und durch das Herz des Landes gewandert: eine großartige Erkundung von Italiens Vergangenheit und Gegenwart.
Im Sommer 1849 musste Guiseppe Garibaldi, Italiens legendärer Revolutionär, die Verteidigung Roms endgültig aufgeben. Er und seine Männer hatten die Stadt vier Monate gehalten, aber nun war klar, dass nur die Kapitulation die Zerstörung durch die überlegene französische Armee verhindern würde. Es galt, die Niederlage in einen moralischen Sieg zu verwandeln, und so führte Garibaldi mit seiner schwangeren Frau Anita eine kleine, schnell aufgestellte Armee an, um den Kampf für die nationale Unabhängigkeit fortzusetzen. Von französischen und österreichischen Truppen verfolgt, marschierten die Garibaldini über den Apennin und kamen mit nur 250 Überlebenden in Ravenna an.
Tim Parks hat sich auf die Spuren Garibaldis begeben und ist seinem Weg durch das Herz Italiens gefolgt: ein grandioser Reisebericht, der von Garibaldis Entschlossenheit, die keine Rücksichten kannte, seiner Kreativität, seinem Mut und seinem tiefen Glauben erzählt und ein faszinierendes Porträt Italiens zeichnet, damals und heute, mit unvergesslichen Beobachtungen italienischer Lebensart, der Landschaft, der Politik und der Menschen.
Über den Autor
Tim Parks, geboren in Manchester, wuchs in London auf und studierte in Cambridge und Harvard. Seit 1981 lebt er in Italien. Seine Romane, Sachbücher und Essays sind hochgelobt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Er schreibt für den Guardian, The New Yorker und The New York Review of Books und übersetzte u.a. die Werke von Moravia, Calvino, Calasso, Tabucchi und Machiavelli. Er lebt in Mailand.
Tim Parks
DER WEGDES HELDEN
Auf Garibaldis Spuren zu Fußvon Rom nach Ravenna
Aus dem Englischenvon Ulrike Becker
Verlag Antje Kunstmann
Für Eleonora, garibaldina
Inhalt
Vorbemerkung des Autors
Ein guter Rat an die Lesenden
ERSTER TEIL: FLUCHT
ZWEITER TEIL: HOFFNUNG
DRITTER TEIL: ÜBERLEBEN
ENDSPIEL
Danksagung
Literatur
Vorbemerkung des Autors
Eine Version meiner Lebensgeschichte könnte lauten, dass ich 1978 eine Italienerin kennenlernte, sie heiratete, nach Italien zog und seitdem hier lebe. Ohne mir das Land bewusst ausgesucht zu haben oder von ihm ausgesucht worden zu sein. Doch das Schöne an meinem »italienischen Schicksal« ist, dass es sich schon in meiner Jugend auf kuriose Weise abzeichnete. Als Schüler brauchte ich für meine A-Level-Prüfung im Fach Geschichte ein Schwerpunktthema und entschied mich für das Risorgimento, die Bewegung, in deren Verlauf die vielen italienischen Kleinstaaten sich von der Herrschaft ausländischer Mächte befreiten und sich 1861 schließlich zu einer vereinten Nation zusammenschlossen. Unter der Anleitung eines engagierten Lehrers lasen wir ein Buch mit Originaldokumenten aus der damaligen Zeit und erfuhren von den vier großen Architekten des modernen Italien: dem revolutionären Republikaner Giuseppe Mazzini, der sein Leben lang immer wieder bewaffnete Aufstände anzettelte, die ausnahmslos scheiterten; dem machiavellistischen Ministerpräsidenten von Sardinien-Piemont, Camillo Benso von Cavour, der Rivalitäten zwischen Frankreich und Österreich erfolgreich auszunutzen wusste und seinen Staat zum Zentrum der neu entstehenden Nation machte; dem ungeschickten, aber erstaunlich effektiven Viktor Emanuel II., König von Sardinien-Piemont, der zwischen seinem Ministerpräsidenten auf der einen und den revolutionären Patrioten auf der anderen Seite stand und ein doppeltes Spiel spielte; und schließlich Giuseppe Garibaldi, dem herausragenden Guerillakrieger mit südamerikanischer Vergangenheit, der 1860 die Welt verblüffte, als er mit seinen tausend Rebellen an der Westküste Siziliens an Land ging, die Insel einem zwanzigtausend Mann starken Bourbonen-Heer abnahm, nach Kalabrien übersetzte, um in Richtung Norden über Neapel gen Rom zu ziehen, unterwegs weitere Freiwillige einsammelte, bis er schließlich auf die piemontesischen Truppen traf, die nach Süden entsandt worden waren, um ihn aufzuhalten, und daraufhin alle eroberten Territorien Viktor Emanuel überließ, womit er vollendete Tatsachen schuf und das vereinte Italien erschaffen war.
Ein Jahr nach diesen Studien, im Jahr 1974, nutzte ich den neuen Interrail-Pass der Bahn, um zum ersten Mal nach Italien zu reisen. Dort stellte ich fest, dass ich bereits einen großen Teil der Straßennamen kannte. Viale Cavour, Via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi – die vier Patrioten sind allgegenwärtig, mit zahllosen Denkmälern, Statuen, Tafeln und Plaketten werden ihre Heldentaten gefeiert. Der bei Weitem attraktivste von ihnen, sowohl auf dem Papier als auch in Stein gemeißelt, ist Garibaldi: In den tief liegenden Augen, der bärtigen Ernsthaftigkeit, dem männlichen Gebaren unter der Soldatenkappe und dem Gaucho-Poncho ist seine starke Ausstrahlung immer noch spürbar; die Worte ROMA O MORTE! neben den vielen Balkonen im ganzen Land, von denen er einst den berühmten Schlachtruf verkündete, wirken auch heute noch mitreißend. Eine Schande, dass die Geschichtsbücher ihn in der Regel als einfältigen Kämpfer darstellen, als Werkzeug in den Händen anderer, als einen, der mehr Glück als Verstand hatte.
Die ersten Zweifel an dieser Darstellung kamen mir ein Jahrzehnt später, als ich den Auftrag erhielt, Biografien des Helden zu rezensieren. Garibaldi mag oft manipuliert worden sein, aber er war ganz sicher nicht einfältig. Er war gerissen, gut organisiert, kreativ. Und wenn er oft Glück hatte, was er zugab, dann hatte er sich dieses Glück hart erarbeitet. Dass man ihm derart unrecht tut, ist interessant. Die Italiener, leidenschaftliche Lokalpatrioten, unterteilt in Clans, Fraktionen, Interessengruppen und Gemeinschaften, sind kein Volk, das zu Einheit und Einigkeit neigt. Misstrauen, Verschwörungstheorien und Zynismus grassieren. Interne Machtkämpfe sind die Norm, der Defätismus ist weit verbreitet. Garibaldi hat, und das ist höchst ungewöhnlich, diese negativen Eigenschaften, und mit ihnen seine republikanischen Ideale, beiseitegeschoben, um ein klares Ziel ins Auge zu fassen: Einheit um jeden Preis. Er war überzeugt, dieses Ziel sei noch zu seinen Lebzeiten erreichbar, und indem er andere dazu ermahnte, ihre Streitigkeiten zu vergessen und gemeinsam zu kämpfen, gar gemeinsam zu sterben, hat er es tatsächlich erreicht. So ist er für all diejenigen, die gerne glauben möchten, alle Tapferkeit sei zwecklos und Fortschritt unmöglich, zur Herausforderung, ja zum Vorwurf geworden. Was noch schlimmer war: Er hat überlebt, lange genug, um seine Geschichte zu erzählen. Obwohl der Held sich im Laufe seines vierzigjährigen Kampfes ein Dutzend Kugeln einfing, ist er erst 1882 im Alter von vierundsiebzig Jahren in seinem Bett gestorben.
Verliebt allerdings habe ich mich in Garibaldi erst, als mir das Tagebuch aus Italien 1849 von Gustav von Hoffstetter in die Hände fiel. Hoffstetter war ein bayrischer Offizier, der als Freiwilliger für die kurzlebige Römische Republik gekämpft hat, die im Februar 1849 die päpstliche Herrschaft ablöste und sich nach zweimonatiger Belagerung Anfang Juli den französischen Truppen ergeben musste. Garibaldi gehörte zu den Kommandeuren in dieser Schlacht, einer Schlacht, von der er wusste, dass er sie nicht gewinnen konnte. Was mich so tief bewegte, war jedoch weniger der verlorene Belagerungskampf als vielmehr Hoffstetters Beschreibung des außergewöhnlichen Rückzugs des Helden aus Rom, seines Marsches durch Mittelitalien mit seiner brasilianischen Ehefrau Anita und viertausend Freiwilligen. Er hatte geschworen, sich auf italienischem Boden niemals einem ausländischen Heer zu ergeben. Womöglich hat das, was der Held dabei lernte, und das Beispiel, das er auf diesem verhängnisvollen, sechshundertfünfzig Kilometer langen Marsch setzte, die Grundlage für seinen späteren Triumph geschaffen. Hoffstetter war Garibaldis Aide-de-camp. Beim Lesen seines Berichts habe ich mir so sehr wie sonst nur selten gewünscht, in einer anderen Zeit zu leben und in der Haut eines anderen zu stecken. Oder seiner Uniform.
2019, hundertsiebzig Jahre nach den Ereignissen in Rom, kaufte ich mir ein Paar Trekkingschuhe, überredete meine Partnerin Eleonora, dasselbe zu tun, und brach im Juli auf, um den Weg der Freischärler nachzugehen.
Ein guter Rat an die Lesenden
Abgesehen von dieser Überblickskarte hätte man dieses Buch wunderbar mit Zeichnungen, Strecken- und Ortsplänen vollpacken können. Es erzählt von einer Reise durch eine grandiose, abwechslungsreiche Landschaft. Von Flucht und Verfolgung. Katz und Maus. Oder vielmehr, Katzen und Mäusen. An vielen Stellen sollte man eine Vorstellung davon haben, wo sich die handelnden Personen im Verhältnis zu diesem oder jenem geografischen Punkt, den Bergen, den Flüssen, dem Meer befinden. Doch Karten sind teuer, und man würde sehr viele brauchen. Und heutzutage haben die meisten von uns ausgezeichnete, vielseitige Landkarten direkt in der Hosentasche. Wann immer Sie sich also unterwegs ein bisschen verloren fühlen, so wie es uns auf dieser Wanderung oft genug erging, rate ich Ihnen, Ihr Smartphone aus der Tasche zu ziehen. Jedes Kapitel, jeder Tag, beginnt mit den Namen der zwei, drei oder vier Städte oder Dörfer, die wir durchquert haben. Tippen Sie die Namen bei Google Maps ein. Verwenden Sie die Satellitenansicht, die Geländeansicht, die Kartenansicht. Ich werde mir sprachlich die größte Mühe geben, doch meine Worte werden vielleicht lebendiger und anregender wirken, wenn Sie genau wissen, wo wir gerade sind.
ERSTER TEIL
FLUCHT
TAG 1
2. Juli 1849 | 25. Juli 2019
Rom, Tivoli –35 Kilometer
Ihm blieben achtundvierzig Stunden für die Vorbereitung. Wir haben mindestens ein Jahr über diese Reise nachgedacht. Viertausend Mann Infanterie mussten organisiert werden. Achthundert Mann Kavallerie. Maultiere, Wagen, Munition, medizinische Versorgung. Eine Kanone. Er war enttäuscht, denn er hatte gehofft, es würden ihm zehntausend folgen. Wir wussten von Anfang an, dass wir nur zu zweit sein würden, mit unseren Rucksäcken.
Aber wir brechen vom selben Ort aus auf, der Piazza San Giovanni in Laterano in Rom. Massiv ragt die weiße Basilika in der Dunkelheit empor, am Himmel die Silhouetten der riesigen steinernen Apostel. Er zog bei Sonnenuntergang aus, ließ seine Männer die Nacht durchmarschieren. Rauchen war verboten. Befehle wurden flüsternd nach hinten durchgegeben. Der Feind durfte auf keinen Fall Wind bekommen. Unsere Feinde, nehmen wir an, werden vor allem der Verkehr und die Hitze sein. 37 Grad sind vorhergesagt, deshalb ist die Kühle der Nacht durchaus verlockend. Doch im Dunkeln am Rand von Schnellstraßen entlangzulaufen wäre Selbstmord. Deshalb brechen wir morgens um 4.30 Uhr auf, in der Hoffnung, die ersten dreißig Kilometer hinter uns zu bringen, ehe die Sonne ihren Höchststand erreicht.
Der Platz ist um diese Zeit wie ausgestorben; San Giovanni wird nachts nicht angestrahlt. Unser Selfie auf den Stufen zeigt nur schemenhaftes Mauerwerk hinter aufgeregt lächelnden Gesichtern. Niemand ist gekommen, um uns zu verabschieden. Garibaldi und seine Männer wurden von einer jubelnden Menschenmenge auf den Weg geschickt. Die amerikanische Journalistin Margaret Fuller war da. ›Nie habe ich etwas so Schönes gesehen‹, berichtete sie, ›etwas so Romantisches und Trauriges … ich sah die Verletzten … auf den Karren … Ich sah viele junge Männer aus reichen Familien, die ihren ganzen weltlichen Besitz in einem Tuch bei sich trugen.‹
Garibaldi, so berichtet Fuller, hob sich durch einen weißen Waffenrock von der Menge ab. Andere Beobachter sprechen von dem roten Hemd, das er zum Emblem des Kampfes für die nationale Einheit Italiens gemacht hat, und einem Poncho, einem Relikt aus seiner Zeit in Südamerika. Anita, im sechsten Monat schwanger mit ihrem fünften Kind, ritt hinter ihm am Kopf der Kolonne. Ganz wie ›ein mittelalterlicher Held‹, schrieb Fuller, trat Garibaldi ›an das Parapett, schaute mit dem Fernglas die Straße hinunter, und da kein Hindernis in Sicht war, wandte er noch einmal kurz den Kopf zurück gen Rom und führte dann den Zug zum Tor hinaus‹.
Es war der 2. Juli 1849. Einhundertsiebzig Jahre später folgten ihm Eleonora und ich durch denselben, im 16. Jahrhundert erbauten Torbogen. Anders als Garibaldi und seine Männer wussten wir, dass ein einmonatiger Fußmarsch vor uns lag. Naiv wie wir waren, betrachteten wir ihn als Urlaub.
Genau genommen einhundertsiebzig Jahre und dreiundzwanzig Tage später. Wir verlassen Rom am 25. Juli 2019. Es ist ärgerlich; wir wären gern am gleichen Tag losgegangen, aber ich musste in Mailand bei einer Abschlussprüfung anwesend sein. Doch das war zugleich ein Grund zum Feiern, denn es war meine letzte Amtshandlung als Dozent. Ich hatte meine Stellung nach über zwanzig Jahren aufgegeben. Italienische Freunde hatten alles versucht, um mich davon abzubringen. Du gehst ein hohes Risiko ein, sagten sie, du verzichtest auf ein verlässliches Einkommen. Ich durfte unter keinen Umständen allein und schutzlos dastehen, außerhalb der gesellschaftlichen Institutionen.
Garibaldini lautete der Name, den die Italiener den Männern gaben, die freiwillig mit Garibaldi in den Kampf zogen. Man war sich einig, dass sie alle vom selben Schlag waren. Schon bald wurde der Begriff aus seinem spezifischen historischen Kontext herausgerissen und bezeichnete ganz allgemein Personen, die kühn und idealistisch sind, die Risiken eingehen, die vielleicht auch naiv, ja unüberlegt handeln. Auch heute noch kann man sagen: »Sie ist eine echte garibaldina! Weiß der Himmel, was aus ihr mal werden soll.«
Wollen Eleonora und ich uns als garibaldini betrachten? Ist das der Grund, warum wir zu dieser unmöglichen Uhrzeit mit sechs Kilo Gepäck auf dem Rücken auf diesem menschenleeren römischen Platz stehen? Eleonora hat ihren festen Job schon vor zwei Jahren aufgegeben. Sie wollte ein Leben voller stumpfsinniger Einschränkungen nicht akzeptieren. Jedenfalls nicht kampflos. Das Problem bei dieser Haltung besteht natürlich darin, dass ein Risiko tatsächlich ein Risiko ist. Und ein Kampf ein Kampf. Alles kann schlimm ausgehen. ›Die Blüte der italienischen Jugend fand sich an diesem ehrwürdigen Ort ein‹, schrieb Fuller über die garibaldini auf der Piazza San Giovanni an jenem Abend. ›Von all den anderen Orten, an denen sie ihre Herzen als Bollwerke der italienischen Unabhängigkeit dargeboten hatten, hatte es sie hierher getrieben; in dieser letzten Hochburg hatten sie Hekatomben ihrer besten und tapfersten Kämpfer für die Sache geopfert; jetzt mussten sie entweder gehen oder als Gefangene und Sklaven bleiben.‹
Die Männer, die Garibaldi folgten, waren also traumatisiert, verschlossen vielleicht die Augen vor der Wahrheit; sie hatten einen Krieg verloren, weigerten sich aber, aufzugeben. Andere, die sich an diesem schicksalhaften Abend womöglich auch dem Zug angeschlossen hätten, wurden von Kommandanten, die das Vorhaben töricht fanden, in ihren Kasernen eingesperrt. Wieder andere entschieden sich einfach dagegen. Die langobardischen Bersaglieri, die disziplinierteste Truppe unter den Verteidigern Roms, hatten versprochen dabei zu sein; tatsächlich erschien aber nur eine Handvoll Männer.
Garibaldi hatte das Treffen für sechs Uhr abends angesetzt; jetzt wartete er, im Vertrauen darauf, dass noch mehr kommen würden. Doch mit jeder Minute wuchs das Risiko. Um acht Uhr, gerade als er entschieden hatte, genug sei genug, traf eine Gruppe Bersaglieri ein, um zu verkünden, dass sie nach langem Nachdenken nun doch nicht mitkommen wollten. Wir sind nur hier, um uns von unseren Freunden zu verabschieden, sagten sie.
Waren diese Männer klüger als die garibaldini? Margaret Fuller erwähnt sie nicht. Sie sagt nicht, dass der Marsch mit einem Gefühl der Enttäuschung und des Verrats begann. Das passte nicht in das romantische Bild, das sie für die New York Tribune entwarf.
Nachdem das Selfie aufgenommen ist, machen wir uns im Licht der Straßenlaternen auf den Weg durch menschenleere Straßen, vorbei an ungepflegten Denkmälern und Cafés mit heruntergelassenen Rollläden, über ausgedörrte Grünflächen, wo obdachlose Männer und Frauen unruhig auf den Steinbänken schlafen. Die Nachtluft ist stickig und abgestanden, wie so oft in trockenen Sommern. Rechts von uns, am frisch renovierten Museum der Grenadiere, ist die italienische Trikolore gehisst. Unter päpstlicher Herrschaft wäre man dafür ins Gefängnis gesteckt worden. Nach einer langen Kurve kommen wir zur Aurelianischen Mauer, einer massigen römischen Ziegelkonstruktion, die mitten durch eine Stadtbrache mit rissigem Asphalt und verblichenen Straßenmarkierungen verläuft.
Was für ein Durcheinander aus Antike und Moderne in Rom herrscht! Innerhalb von wenigen Minuten gehen wir durch alte Steinbögen aus der Kaiserzeit und unterqueren ein trostloses Betonviadukt, auf dem die Gleise für den Hochgeschwindigkeitszug verlaufen, der uns vor zwei Tagen von Mailand in die Hauptstadt gebracht hat. Eisenzäune, Uringeruch und Natriumdampflampen. Der Bahnhof Roma Termini liegt zu unserer Linken. Der war 1849 natürlich noch nicht da; für Papst Gregor XVI. waren Eisenbahnen Teufelswerk; der Kirchenstaat gehörte zu den rückständigsten Gebieten Europas.
An einem frühen Bus steht in Leuchtschrift RISORGIMENTO. Gemeint ist die Piazza Risorgimento, nicht die historische Bewegung. Ob den heutigen Italienern beim Anblick des Wortes immer noch warm ums Herz wird? Die drei aussteigenden Fahrgäste sind alle Immigranten unterschiedlicher Herkunft, Leute, wie sie der rechte Innenminister Matteo Salvini gern für den Niedergang Italiens verantwortlich macht. Vor Beginn der Schlacht um Rom im April 1849 sorgte Garibaldi für Aufsehen, als er mit einem Schwarzen an seiner Seite in die Stadt einritt. Andrea Aguyar, Kind afrikanischer Sklaven aus Uruguay, wurde für seinen Mut im Kampf und vor allem für das Geschick, mit dem er die Feinde mit dem Lasso von ihren Pferden holte, sehr bewundert. Doch am 2. Juli erschien er nicht auf der Piazza, um sich Garibaldi anzuschließen; er war zwei Tage zuvor in Trastevere durch Kanonenfeuer ums Leben gekommen.
OMIO DANTE GARIBALDI verkündet ein mysteriöses Plakat, als wir in die Via Prenestina einbiegen. Wir gehen jetzt schneller; wir müssen vorankommen, solange es kühl ist. Was hat Dante mit Garibaldi zu tun? »Natürlich erfordert es Mut, Italien zu einen«, lautet der Plakattext unter Bildern von Zügen und Flugzeugen, »aber jetzt können Sie endlich Ihre Tickets für Zug, Bus und Flugzeug an einem Ort kaufen. OMIO.« Es folgt eine Webadresse. Mir ist noch immer nicht klar, was Dante damit zu tun hat, doch wir haben keine Zeit, stehen zu bleiben und darüber nachzudenken. Die Sonne geht langsam auf, und durch die chaotische postindustrielle Stadtlandschaft der östlichen römischen Vororte hindurch erblicken wir zum ersten Mal die flache Silhouette der fernen Berge, in einen Hauch von Rot getaucht. Garibaldi wusste, dass er diese Hänge bis zum Einbruch der Dämmerung erreichen musste.
Doch wie hat das alles angefangen? Um zu verstehen, wohin wir in den nächsten Wochen gehen werden, müssen wir zuerst wissen, woher die Leute, deren Weg wir folgen wollen, kamen.
Die Stadt Rom und das als Kirchenstaat bekannte Territorium, das sich im Norden bis nach Bologna und Ferrara, im Osten bis Ancona an der adriatischen Küste und im Süden bis nach Terracina erstreckte, riefen am 9. Februar 1849 die Republik aus. Diese Republik war der letzte der kurzlebigen revolutionären Staaten, die nach den Aufständen von 1848 in ganz Europa entstanden. Man hoffte, Rom zur Hauptstadt eines vereinten Italien machen zu können, denn das Land war damals stark zersplittert und wurde größtenteils von ausländischen oder despotischen Mächten regiert.
Bis zum Ausrufen der Republik war es ein komplizierter Weg gewesen. 1846 stand der frisch gewählte Papst Pius IX. der Einheitsbewegung zunächst wohlwollend gegenüber und bestärkte die Patrioten sogar darin, ihn als künftigen Monarchen anzusehen. Im März 1848 gestand er seinen Untertanen eine Verfassung zu. Diese sah die Wahl einer Abgeordnetenkammer vor und ließ Regierungsminister zu, die keine Priester, sondern kompetente Laien waren – eine Entscheidung, die die Bischöfe und Kardinäle in Rom erboste. Als Pius außerdem einem gemischten Heer aus päpstlichen Truppen und patriotischen Freiwilligen erlaubte, nach Norden zu ziehen, um die Piemontesen bei der Befreiung der Lombardei und Venetiens von den Österreichern zu unterstützen, brach im Volk ein Sturm der Begeisterung aus. Vierzigtausend Freiwillige meldeten sich. Viva Pio Nono! Viva l’Italia! Viva l’unione! Libertá! lautete ihr Schlachtruf.
Doch ein bisschen Freiheit weckt die Lust auf mehr. Erschrocken von den Rufen nach weitergehenden Reformen wurde Pius nervös und schließlich offen feindselig. Er entzog der Bewegung die Unterstützung im Krieg gegen Österreich und versuchte, die neue Abgeordnetenkammer unter Kontrolle zu halten, indem er den verschlagenen, konservativen Ex-Diplomaten Pellegrino Rossi zu seinem Ministerpräsidenten machte. Rossi, bei Reaktionären und Reformern gleichermaßen unbeliebt, wurde im November 1848 ermordet, und Pius floh daraufhin aus der Stadt, um Schutz beim König von Neapel zu suchen.
Niemand wusste, was zu tun sei. Nachdem der Papst seinen Exilsitz in der südlich der Grenze gelegenen Küstenstadt Gaeta errichtet hatte, erklärte er die römische Regierung für illegitim, unternahm aber nichts, um sie auszutauschen. Die Abgeordneten schickten Gesandte, die ihn anflehten, zurückzukehren und das Pontifikat wieder aufzunehmen. Sie gelobten Loyalität; doch er weigerte sich, und nach einmonatigem Stillstand verlangten die Abgeordneten die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung, die über die künftige Gestaltung der staatlichen Institutionen entscheiden sollte. Am 9. Februar verkündete die neue Versammlung das Ende der weltlichen Herrschaft des Papstes und die Gründung einer Republik. Pius reagierte, indem er vier katholische Mächte – Österreich, Frankreich, Spanien und Neapel – dazu aufrief, sein Herrschaftsgebiet für ihn zurückzuerobern.
Angesichts der Tatsache, dass die Österreicher erst im vorangegangenen Juni im Verbund mit Sardinien-Piemont gegen päpstliche Truppen hatten kämpfen müssen, war das eine drastische Kehrtwendung. Aber sie kam den Österreichern durchaus zupass. Sie hatten die Piemontesen bereits besiegt und die Lombardei sowie Venetien mit Ausnahme von Venedig zurückgewonnen. Diese Gebiete waren Teil ihres Reichs. Am 18. April, nur vier Tage nach dem Hilferuf des Papstes, überquerten österreichische Streitkräfte die Grenze zu Venetien und eroberten die päpstliche Stadt Ferrara. Anschließend belagerten sie zuerst Bologna, dann Ancona und bombardierten beide Städte tagelang, bis sie sich nach beträchtlichen Verlusten von Menschenleben schließlich ergaben. Inzwischen verließ Anfang März Giuseppe Mazzini, der große Ideologe der italienischen Einheit und des Republikanismus, sein Londoner Exil, kam nach Rom und erklärte der verfassungsgebenden Versammlung sogleich: »Auf das Rom der Kaiser, auf das Rom der Päpste, wird das Rom des Volkes folgen … Vielleicht müssen wir einen heiligen Krieg gegen den einzigen Feind führen, der uns bedroht – Österreich. Doch wir werden ihn führen, und wir werden ihn gewinnen.«
Mazzini lag damit gleich mehrfach falsch. Am 24. April gingen französische Truppen in Civitavecchia, dem Hafen von Rom achtzig Kilometer nordwestlich der Stadt, an Land. Am 29. April landete fünfundneunzig Kilometer weiter südlich ein spanisches Heer an. Auch die neapolitanische Armee machte mobil. So viel zum Thema ein einziger Feind. Die Republik reagierte mit der Bildung eines Not-Triumvirats mit Mazzini an der Spitze. Tausende Patrioten hatten sich eingefunden, um die Stadt zu verteidigen. Sie mussten organisiert werden, und der militärische Schutz, den sie bieten konnten, musste mit der Diplomatie des neuen Staates in Einklang gebracht werden. All das oblag Mazzini, der weder über militärische noch über diplomatische Erfahrung verfügte.
Der bei Weitem prominenteste unter den Neuankömmlingen war Giuseppe Garibaldi. Geboren 1807 und von Haus aus Seemann, war er 1834 von den piemontesischen Machthabern als Aufständischer zum Tode verurteilt worden und hatte etliche Jahre im brasilianischen und uruguayischen Exil verbracht, wo er sich als unerschrockener und effektiver Freiheitskämpfer hervortat. Er hatte sein Leben, so sagte er, der Befreiung der Menschen von Unterdrückung gewidmet. Doch die Sache, die ihm am meisten am Herzen lag, war ein vereintes Italien. Ermutigt durch die Nachrichten von den Revolutionen in Europa und eine piemontesische Amnestie für wegen politischer Vergehen Verurteilte, kehrte Garibaldi im Juni 1848 mit sechzig Kameraden nach Italien zurück. Sofort bot er dem König von Sardinien-Piemont, der in der Lombardei gegen die Österreicher kämpfte, seine Hilfe an, die dieser jedoch ablehnte. Dann beteiligte er sich für kurze Zeit am Kampf um die unabhängige Republik Mailand, die schon bald zusammenbrach.
Garibaldi zog durch Mittelitalien, um Mitstreiter anzuwerben, in der Hoffnung, bei der Befreiung seines Landes eine Rolle spielen zu können, und befand sich im November 1848 in Ravenna, als er von Pius’ Flucht aus Rom erfuhr. Er eilte nach Süden und verbrachte einige Monate in Rieti, sechzig Kilometer nordöstlich der Stadt, wo er tausendzweihundert Männer ausbildete, die er als 1a Legione Italiana, Erste Italienische Legion bezeichnete. Nicht als piemontesische, nicht als mailändische und auch nicht als venezianische, sondern als italienische Legion. Das war ein wichtiges Signal.
Pausieren wir kurz, um darüber nachzudenken. Ein Mann kehrt nach vierzehn Jahren in sein Heimatland zurück, ohne einen Zahlmeister oder eine politische Organisation hinter sich, die ihn unterstützt, zieht von Stadt zu Stadt und lädt in aller Öffentlichkeit die Menschen ein, sich seiner Privatarmee anzuschließen und für eine Sache zu kämpfen. Dann muss er diese Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen, sie bewaffnen, ihnen Uniformen und Schlafplätze geben, sie ausbilden und organisieren. Der Umstand, dass ein solcher Hitzkopf nicht umgehend verhaftet wird, verweist auf eine gewisse Anerkennung der Berechtigung seines Anliegens. Oder es bedeutet, dass das betreffende Land gerade in Anarchie versinkt.
Der weitere Umstand, dass dieser Mann, der an häufigen Malaria-anfällen und lähmenden Rheumaschüben leidet, diese illegalen Rekrutierungen beharrlich weiterbetreibt, selbst nachdem bestimmte Städte in der Toskana und der Emilia-Romagna ihn zum Weiterziehen gezwungen haben und päpstliche Truppen nach Bologna entsandt werden, um ihn aufzuhalten, verweist auf ein tiefes persönliches Bedürfnis, zu tun, was er tut. Garibaldi will sich ein Leben ohne vereintes Italien nicht vorstellen. Oder allgemeiner gesagt, ein Leben ohne Ziel. Immer unterwegs, überall seine Dienste anbietend, scheint er sich nach einer Heimat zu sehnen, einer Gemeinschaft, in der er sesshaft werden kann. Doch ehe er dort sesshaft werden kann, muss dieser Ort befreit werden.
Seine Besessenheit vom Freiheitsgedanken ist der Schlüssel zum Verständnis Garibaldis. Freiheit von ausländischen Mächten, die dem eigenen Land Gesetze aufzwingen, Freiheit von religiösen Institutionen, die das Verhalten diktieren, oder ganz einfach von gesellschaftlichen Konventionen, die bestimmen, welche Kleidung man trägt. Garibaldi hat sich immer genau so gekleidet, frisiert und seinen Bart getragen, wie er wollte, ohne Rücksicht auf Etikette oder die üblichen Sitten. Ponchos, Sombreros, rote Hemden, weiße Waffenröcke, Kopfbedeckungen aller Art: Er trug das, was ihm gefiel, oder das, was die Botschaft übermittelte, die er übermitteln wollte. Und als er im Alter von zweiunddreißig Jahren bei der Einfahrt in den brasilianischen Hafen Laguna vom Schiff aus sein Fernrohr auf ein siebzehnjähriges Mädchen richtete, das am Ufer stand, wusste er sofort, dass er sie haben wollte. Als sie sich kennenlernten, wollte sie ihn zum Glück auch. Anita. Dass sie verheiratet war, war kein Hindernis. Sie verließ ihre Familie und ging mit ihm weg, bekam seine Kinder, machte seine Kriege zu ihren eigenen, kämpfte auf dem Schlachtfeld an seiner Seite, wurde gefangen genommen und floh, ritt mit ihrem neugeborenen Sohn auf dem Arm durch tiefe Wälder. Wie hätten Eleonora und ich die Unerschrockenheit der beiden nicht bewundern sollen? Auch wir sind in gewisser Hinsicht ein unkonventionelles Paar; der Altersunterschied zwischen uns ist genau doppelt so groß wie der zwischen Garibaldi und Anita. Wir haben mit so manchem missbilligenden Blick zu tun.
Darin liegt das Geheimnis von Garibaldis Charisma. Er ermunterte die Menschen, für ein bestimmtes politisches Ziel, die Einheit Italiens, zu kämpfen, doch sein eigentliches Anliegen war die Freiheit. Eine Freiheit, die er selbst verkörperte. »Ich konnte ihm einfach nicht widerstehen«, lautete der typische Kommentar eines jungen Mannes, dessen Leben sich veränderte, als er Garibaldi reden hörte. Tausende empfanden so. »Wir haben ihn alle verehrt, wir konnten nicht anders.«
Doch die römische Republik wollte ihn anfangs nicht haben. Mazzini hatte die Organisation der Verteidigung Carlo Pisacane, einem ehemaligen Soldaten der neapolitanischen Armee, anvertraut. Garibaldis Männer waren in Pisacanes Augen ein Mob. Braun gebrannt, schmutzig, langhaarig, bärtig. Ihre sogenannten Uniformen ein Witz. Die Offiziere waren nach Mut und Leistung ausgewählt worden, ohne Ansehen der Bildung oder Herkunft. Die Kavalleristen sattelten und fütterten ihre Pferde selbst, so wie Banditen oder Cowboys. Sie sollten lieber außerhalb von Rom bleiben und die ländlichen Gebiete verteidigen, entschied Pisacane.
Doch als sich die französische Armee mit siebentausend Mann der Stadt näherte, wurde ein neuer Kriegsminister berufen. Giuseppe Avezzana hatte in den napoleonischen Kriegen und in Mexiko gekämpft. Er zitierte Garibaldi umgehend zu sich. Die Erste Italienische Legion marschierte am 27. April durch die Porta Maggiore in die Stadt ein. Garibaldi ritt auf einem weißen Pferd. »Davon hatte ich schon als Kind geträumt«, schrieb er später. An seiner Seite Andrea Aguyar. Hinter ihnen marschierten tausendfünfhundert Männer, die ein bizarres Sammelsurium aus ausrangierten Uniformen, extravaganten Kappen und Hüten sowie erstaunliche Waffen zur Schau trugen. Die Römer waren begeistert. Sofort war aller Etikette und Konvention zum Trotz klar, dass die Stadt ihre Hoffnung auf Garibaldi setzte.
Avezzana beauftragte die Neuankömmlinge mit der Verteidigung des Colle del Gianicolo oberhalb der Porta San Pancrazio, auf der Westseite der Stadt. Das war eine wichtige Stellung. Von dem Hügel aus konnte jeder die Stadt nach Belieben bombardieren. Garibaldi hatte nur zwei Tage, um das Terrain zu sichten. Ihm war sofort klar, dass die drei, vier großen Villen vor und oberhalb der Stadtmauern entscheidend sein würden, und er ließ sie besetzen. Er hatte jetzt zweitausendfünfhundert Männer und bekam noch eine Reserve von weiteren tausendachthundert zugeteilt. Insgesamt hatte Rom etwa neuntausend Soldaten, die es in die Schlacht schicken konnte, doch sie standen stark verstreut um die Stadtmauer und die vielen Tore herum.
Die Franzosen griffen am Morgen des 30. April an und rechneten mit einem Spaziergang. Sie hatten sich die Porta Pertusa ausgesucht, ein Tor etwas nördlich von Garibaldis Position, dabei jedoch übersehen, dass dieses Tor schon seit Jahren zugemauert war. Als sie gezwungenermaßen entlang und unterhalb der Stadtmauern zum nächsten Tor zogen, wurden sie von schwerem Musketenfeuer überrascht. Garibaldi wartete nicht, bis der Feind zu ihm kam; er benutzte die Männer, die er in den Villen vor der Stadt in Stellung gebracht hatte, um die Franzosen einzukreisen und anzugreifen. Für viele seiner Freiwilligen war es der erste Kampf. Die Franzosen waren erfahren und gut organisiert. Sie kämpften in Gärten und Weinbergen, drängten die Italiener zurück und nahmen zwei der wichtigsten Villen ein. Garibaldi rief seine Reserve zu Hilfe und führte persönlich einen Reiterangriff an. Die Villen wurden zurückerobert. Nach Stunden sporadischer Kämpfe fielen die Franzosen zurück. Sie hatten etwa fünfhundert Männer verloren, Tote und Verletzte. Die Italiener zweihundert. Dreihundertfünfundsechzig französische Gefangene wurden gemacht. Garibaldi selbst erlitt eine Kugelverletzung in der Seite, die ihm in den kommenden Monaten beträchtliche Schmerzen bereiten sollte.
Es war das erste Mal, dass italienische Freischärler ein professionelles Heer in der Schlacht besiegt hatten. Die Römer waren euphorisch. Die Unterstützung für die Republik wuchs. Politiker und Diplomaten in ganz Europa staunten. Doch Garibaldi sah eine verpasste Gelegenheit. Er glaubte, er hätte die Franzosen bis ganz hinunter an die Küste jagen können. Mazzini bremste ihn aus. Frankreich war eine Republik, erklärte er. Und jetzt, da die Franzosen gesehen hatten, dass die Römer kampfbereit waren, würden sie wohl kaum eine andere Republik zerstören, um einen despotischen Papst zurückzuholen. Die dreihundertfünfundsechzig Gefangenen wurden gut behandelt und auf freien Fuß gesetzt.
Doch schon näherte sich der Stadt ein zwölftausend Mann starkes neapolitanisches Heer von Südwesten. Am 5. Mai wurde Garibaldi losgeschickt, um sich der Sache anzunehmen. Er nahm seine eigene Legion und die Langobardischen Bersaglieri mit, eine Gruppe freiwilliger Studenten aus der mailändischen Mittelschicht, deren Anführer der charismatische dreiundzwanzigjährige Luciano Manara war, der im Jahr zuvor als mutiger Kämpfer an der Verteidigung Mailands beteiligt gewesen war. Garibaldi bewegte sich im Zickzackkurs und streute falsche Gerüchte über seine Vorhaben. Am 9. Mai bezog er Stellung auf der Anhöhe oberhalb von Palestrina, vierzig Kilometer außerhalb von Rom. Die Neapolitaner griffen an; anfangs kamen sie gut voran, doch nach drei Stunden heftiger Kämpfe wurden sie schließlich in die Flucht geschlagen. Garibaldi erhielt Befehl, sie nicht zu verfolgen; er solle sofort in die Stadt zurückkehren.
Mazzini fürchtete inzwischen, die Franzosen könnten doch wieder angreifen. Stattdessen baten sie um einen Waffenstillstand. Erfreut nahm Mazzini an, in dem Glauben, man wolle nun eine friedliche Lösung aushandeln. In Wirklichkeit aber warteten sie nur auf die Verstärkung, die ihre Streitkräfte auf dreißigtausend Mann erhöhen würde, ausgestattet mit moderner Belagerungsartillerie. Unter Ausnutzung der Waffenruhe wurde die Armee der Republik ausgesandt, um erneut die Neapolitaner anzugreifen. Etwa achttausend Männer, unter ihnen auch Garibaldi mit seiner Legion, waren Pietro Roselli unterstellt, einem Ex-Major der päpstlichen Armee. Roselli hatte den Vorteil, gebürtiger Römer zu sein. Ein Schlachtfeld hatte er noch nicht gesehen.
Roselli ging nach Militärhandbuch vor und plante, alle seine Männer gleichzeitig auf den Feind loszulassen. Angesichts dieses Vorhabens war es ein Fehler, Garibaldi als Vorhut voranzuschicken. Garibaldis Auffassung von Krieg bestand darin, ständig in Bewegung zu bleiben, den Feind zu verwirren, seine Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Standortkenntnisse auf die Probe zu stellen und ihn nie zur Ruhe kommen zu lassen. Als er in Velletri auf die Neapolitaner traf und spürte, dass sie nicht auf der Höhe ihrer Kräfte waren, befahl er den Angriff und rief Roselli dazu auf, so schnell wie möglich zu ihm zu stoßen.
Wieder folgte auf anfängliche Misserfolge ein gelungener Angriff der Reserve mit Garibaldi an der Spitze. Doch dieses Mal wurde Garibaldi bei dem Versuch, den ungeordneten Rückzug seiner eigenen Reitervorhut zu stoppen, überwältigt und ging ›in einem Haufen von Männern und gestürzten Pferden‹ zu Boden. Überall um ihn Neapolitaner mit Bajonetten und Säbeln. Garibaldi wurde von seinen Reservisten gerettet. Die meisten von ihnen Jugendliche. Danach dauerte es eine Weile, ehe er wieder aufstehen und ›Arme und Beine abtasten konnte, um festzustellen, ob etwas gebrochen war‹.
Die Neapolitaner zogen sich in die Stadt Velletri zurück, doch leider erschien der Hauptteil der römischen Armee nicht, um den Job zu Ende zu bringen. Roselli sagte, seine Männer könnten nicht ohne Lebensmittelrationen ausrücken. Er beschwerte sich, dass Garibaldi Befehle nicht befolgt hatte. Er wollte die Neapolitaner am folgenden Tag angreifen. Doch am nächsten Morgen war Velletri verlassen. Die Neapolitaner waren in der Nacht geflohen.
Die Franzosen hatten inzwischen um Rom herum Stellung bezogen. Bevor Garibaldi ausgezogen war, hatte er vorgeschlagen, die Villen am Gianicolo mit Gräben und Verteidigungswällen zu sichern. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass nichts geschehen war. Am 26. Mai bat ihn Mazzini um seine Einschätzung ihrer Chancen, die Stadt zu verteidigen. Garibaldi antwortete aggressiv: Er könne, sagte er, dem Krieg nur entweder als Diktator mit unbegrenzten Befugnissen oder als gemeiner Soldat dienen. »Sie haben die Wahl.« Mazzini ließ es darauf ankommen, und Garibaldi machte weiter wie zuvor: als Held des Volkes, aber ohne übergreifende Befehlsmacht, stets in der Kritik und doch in jeder Krise zu Hilfe gerufen.
General Oudinot, der die französischen Streitkräfte anführte, verkündete das Ende des Waffenstillstands für den 4. Juni und gewährte den französischen Staatsbürgern in Rom zwei Tage Zeit, um die Stadt zu verlassen. Tatsächlich griff er die Villa Corsini, die Schlüsselstellung der Italiener, schon in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni an. Roselli hatte noch am selben Abend den Stützpunkt inspiziert und den dortigen Truppen versichert, dass in den nächsten vierundzwanzig Stunden kein Angriff zu erwarten war. Der Hauptteil der Truppen war unten in der Stadt einquartiert, am anderen Ufer des Tiber, wo viele Offiziere in Privathäusern übernachteten und nicht schnell reagieren konnten. Garibaldi selbst befand sich in Trastevere und plagte sich mit heftigen Schmerzen aufgrund seiner Verletzung von vor einem Monat. Ihm stand einer der schlimmsten Tage seines Lebens bevor.
Das Problem war die Villa Corsini an sich. Direkt auf dem Hügel gebaut, war sie darauf ausgelegt, gegen eine Attacke aus der Stadt verteidigt zu werden, nicht jedoch gegen eine aus dem umliegenden Gelände. Hohe Steinmauern kanalisierten jeden Angriff von unten auf ein enges Tor zu, hinter dem direkt die Villa lag. Auf der anderen Seite war nur eine gewöhnliche Grenzmauer, die das weitläufige Grundstück umgab. Die Franzosen konnten im Schutz der Dunkelheit bis direkt an diese Mauer gelangen, ein Loch hineinsprengen, alle Weinberge und Gärten besetzen und die Villa fast kampflos einnehmen.
Garibaldi wurde um drei Uhr morgens informiert und versammelte so viele Männer, wie er konnte. Er wusste, es war entscheidend, das Haus und den Hügel zurückzugewinnen, ehe die Franzosen ihre Artillerie aufbauen und anfangen konnten, die tiefer gelegenen Stadtmauern zu zertrümmern. Er erwog einen Flankenangriff, doch dazu hätte er um die Grundstücksmauer herum gemusst, während die Franzosen bereits auf der anderen Seite standen. Er entschied sich für einen Angriff von vorn. Es war fünf Uhr morgens. Die Männer stürmten den Hügel hinauf auf das Tor zu, ohne jeden Schutz vor dem Kugelhagel.
Wäre Garibaldis Aktion einfach schiefgegangen, dann wäre das mit ziemlicher Sicherheit das Ende gewesen. Doch sie nahmen die Villa ein, wenn auch um den Preis hoher Verluste. Sie nahmen sie ein, konnten sie aber nicht halten. Die Franzosen hatten Kanonen. Sie waren stark in der Überzahl und verfügten über reichlich Deckung. Die römischen Reserven waren noch nicht eingetroffen. Die Villa musste erneut aufgegeben werden. Die Reservetruppen trafen ein. Die Villa wurde erneut eingenommen, wieder verloren, dann wieder eingenommen. Wieder verloren. Jedes Mal, den ganzen heißen Tag über, starben Hunderte Männer. Doch der Gewinn war die Schlacht an sich. Sobald es den Franzosen gelang, ihre Position zu festigen, wäre das Spiel aus.
Garibaldi hatte Mazzini wiederholt erklärt, dass Roms Freiwilligenheer außerhalb der Stadt wesentlich effektiver eingesetzt werden könnte. Er glaubte an das Momentum. Man musste die Initiative ergreifen. Waren seine Truppen in den alten Mauern eingeschlossen, würde man sie umzingeln und aushungern. Mazzini hingegen glaubte an den symbolischen Wert Roms, der Ewigen Stadt, und daran, dass Märtyrer nötig waren, um einen nationalen Mythos zu erzeugen. Die belagerte Stadt, so dachte er, würde für das zivilisierte Europa Gegenstand von Pathos und Verehrung werden, ein ruhmreiches Blutbad. Er hatte recht. Am 3. Juni lieferte ihm Garibaldi in seiner Verzweiflung dieses Blutbad. Bei Einbruch der Nacht hatte die Armee eintausend Männer verloren, unter ihnen viele seiner besten Kämpfer. Die Franzosen hielten die Villa, die günstige Stellung auf dem Hügel oberhalb der Stadt. Sie waren Herr der Lage.
Am Tag bevor wir zu unserer Wanderung aufbrachen, besuchten Eleonora und ich das Schlachtfeld. Man ist sofort verblüfft, wie klein das Gebiet ist; ein vielleicht dreihundert Meter langer grasiger Abhang am südlichen Rand des Gianicolo-Parks, unten die Porta San Pancrazio, wo Garibaldis Männer sich versammelten, und oben die Villa Corsini, die in der Schlacht zerstört wurde. An ihrer Stelle steht dort heute ein riesiger Torbogen. Der Ort trägt den Namen Piazzale dei Ragazzi di 1849.
Wir standen dort oben und schauten gen Westen über die flirrende Stadt, die sich weit und schutzlos unter uns erstreckte. Es war ein heißer römischer Tag, überall Touristen, die Eis aßen und den Schatten der eleganten Schirmkiefern genossen. Unten am Fuße des Hügels kann man noch eine schwarze französische Kanonenkugel, die im Mauerwerk einer weiteren Villa steckt, bestaunen und berühren. In den Gianicolo-Park hinein führt ein langer Weg, der von weißen Büsten auf niedrigen Plinthen gesäumt wird. Es sind Hunderte. Sie zeigen die Männer, die dort gekämpft haben. In die niedrige Brüstungsmauer zur Rechten ist über mehrere Hundert Meter in Großbuchstaben der Text der Verfassung der Römischen Republik eingraviert. Sie beginnt mit den Worten: SOUVERÄNITÄT IST DAS EWIGE RECHT DES VOLKES.
Eine Büste zeigt einen gut aussehenden, ernsten jungen Mann, der den Kopf über dem hohen Uniformkragen leicht nach rechts wendet. Goffredo Mameli war der Dichter, der die italienische Nationalhymne verfasst hat: »Fratelli d’Italia«. Er wurde am 3. Juni verwundet und starb nach vierwöchigem Todeskampf im Alter von einundzwanzig Jahren. Anscheinend hat ihm seine Krankenpflegerin Dickens vorgelesen, um die schmerzvollen Tage zu verkürzen. Oliver Twist.
In der Nähe der Büsten steht die kleine Statue eines zwölfjährigen Jungen mit nackter Brust, der Righetto hieß. Die französischen Kanonenkugeln waren in Wirklichkeit kleine Bomben mit brennenden Lunten, die kurz nach dem Aufprall explodieren sollten. Die Republik litt unter Munitionsknappheit und bot eine Belohnung für diejenigen, denen es gelang, eine der nicht explodierten Kanonenkugeln zu bergen. Frauen und Kinder in nassen Kleidern rannten auf die fallenden Bomben zu, um die Lunten zu löschen. Auf diese Weise fand Righetto den Tod und wurde zum Symbol des zivilen Widerstands.
Righetto starb am 29. Juni, über drei Wochen nach der Schlacht um die Villa Corsini. Es hatte so ausgesehen, als würde Rom sofort fallen, doch die wahnsinnigen Angriffe zur Rückeroberung der Villa waren immerhin dafür gut gewesen, den Verteidigern Zeit zu verschaffen, um ihre Stellungen weiter unten zu festigen. Paradoxerweise wurde ihre Entschlossenheit durch die furchtbaren Verluste eher gestärkt als geschwächt. Und obwohl Garibaldis Kritiker immer wieder sein Versagen an diesem 3. Juni beschworen, war er bei Soldaten und Volk beliebter denn je. Er hatte mitten unter ihnen gekämpft. Das Ziel schien erreichbar zu sein. Die Männer glaubten an ihre Sache. Die Moral in der Truppe war erstaunlich gut.
Vier heiße Wochen lang hielten die Verteidiger durch, während die Franzosen Mauern und Stadt zerstörten und die römischen Streitkräfte unablässig mit Heckenschützenfeuer in Atem hielten. Viele Kunstwerke wurden zerstört, viele Zivilisten getötet. Der Papst in seinem Refugium in Gaeta schäumte vor Wut über die Verzögerung, weil er glaubte, die Franzosen zeigten nicht genug Einsatz. General Oudinot drängte Mazzini zum Aufgeben, um weitere Verluste von Menschenleben zu verhindern. Er wollte nicht als Zerstörer Roms in die Geschichte eingehen. Mazzini beharrte darauf, bis zum letzten Mann zu kämpfen.
Unterdessen lagen die militärischen Führer im Zwist. Pisacane wollte, dass Garibaldi die Franzosen einkreiste, um die Villa Corsini zurückzugewinnen. Er weigerte sich. Er hielt es für aussichtslos. Er schlug vor, mit tausend Mann die Stadt zu verlassen und willkürlich die Franzosen anzugreifen, wo immer es sinnvoll erschien. Doch das gestattete Roselli nicht. Am 21. Juni durchbrachen die Franzosen die äußere Verteidigungsmauer und rückten vor. Dieses Mal weigerte sich Garibaldi, sie zurückzudrängen. Es würde nur ein weiteres Massaker geben. Immer wieder musste er sein Hauptquartier verlegen, wenn Gebäude unter dem Kanonenfeuer einstürzten. Die Stadt zerfiel um ihn herum zu Schutt und Asche. Ironischerweise wurden am 28. Juni endlich die Uniformen, welche die Legionäre nach Mazzinis und Pisacanes Willen tragen mussten, geliefert. Garibaldi hatte schlichte rote Hemden gewählt, ähnlich denen, die sie Jahre zuvor bei der Belagerung Montevideos getragen hatten. Damals war er auf eine Schiffsladung roter Stoffbahnen gestoßen, die für Schlachthofmitarbeiter vorgesehen war. Das Rot kaschierte die Blutflecken.
Am 29. Juni durchbrachen die Franzosen die zweite Verteidigungslinie. Diesmal führte Garibaldi einen entschlossenen Gegenangriff an. Er kämpfte ›wie Leonidas bei den Thermopylen‹, erinnerte sich der Historiker Candido Augusto Vecchi, der an seiner Seite dabei war. Luciano Manara fiel. Andrea Aguyar fiel. Die Lage war aussichtslos. Am Mittag des 30. Juni wurde ein Waffenstillstand vereinbart. Die Verfassunggebende Versammlung der Republik kam im Kapitol zusammen und debattierte darüber, ob man sich ergeben oder weiterkämpfen solle. Garibaldi wurde einbestellt, um seine Meinung zu sagen. Er kam direkt vom Schlachtfeld, schweißgebadet und staubverklebt. Mazzini drängte darauf, Barrikaden zu errichten und in den Straßen zu kämpfen. Garibaldi erklärte, die Franzosen würden einfach ihre Kanonen benutzen und alles zerstören; stattdessen sollten die Truppen aus der Stadt ausbrechen und sich auf den Hügeln verteilen. Roselli erlaubte es auch diesmal nicht; die Truppen seien demoralisiert und erschöpft, wandte er nicht ganz zu Unrecht ein. Wie konnten sie da den Krieg aufs Land verlegen? Letztendlich einigte sich die Versammlung darauf, ›eine Verteidigung, die unmöglich geworden ist, aufzugeben, aber dennoch im Amt zu bleiben‹. Mazzini trat empört zurück.
Die Lage war verwirrend. Weder hatte die Versammlung kapituliert, noch war die Regierung zurückgetreten. Roselli und Garibaldi behielten ihre Kommandohoheit; alles, was sie im Namen der Republik unternahmen, würde legitim sein. Auf der anderen Seite liefen Verhandlungen darüber, die Franzosen in die Stadt einmarschieren zu lassen. In diesen hektischen Stunden ging der amerikanische Chargé d’Affaires auf Garibaldi zu, um ihm eine sichere Überfahrt nach New York anzubieten. Garibaldi lehnte ab. Stattdessen erklärte er, er werde am Morgen des 2. Juli auf dem Petersplatz zu den Menschen sprechen. Der holländische Maler Jan Philip Koelman erinnert sich an die Szene.
Inmitten der wogenden Menschenmenge auf dem Platz erblickten wir die schwarze Feder an Garibaldis Kappe. Seine Offiziere verloren sich im Gedränge, und er selbst war von Zivilisten umringt, viele davon Frauen, die ihn von allen Seiten bedrängten. Nur langsam und mit Mühe erreichte er den ägyptischen Obelisken im Zentrum des Platzes. Dort blieb er stehen, wendete sein Pferd, und nachdem sich seine Männer um ihn geschart hatten, hob er die Hand, um dem Jubel Einhalt zu gebieten. Nach kurzer Zeit senkte sich eine tiefe Stille über die Menge.
Garibaldi fasste sich kurz: ›Das Glück, das uns heute verlassen hat, wird uns morgen hold sein. Ich verlasse Rom. Wer den Krieg gegen die Fremdherrschaft fortführen will, der kann mit mir kommen. Ich biete weder Bezahlung noch Quartier, noch Verpflegung; ich biete Mühseligkeiten, Hunger, Durst und alle Gefahren des Krieges. Wer den Namen Italiens nicht nur auf den Lippen, sondern auch im Herzen trägt, der folge mir!‹
Mit einhundertsiebzigjähriger Verspätung sind nun Eleonora und ich hier erschienen, um genau das zu tun: ihm zu folgen. Lieben wir dieses Land? In unseren Herzen? Ich lebe seit vierzig Jahren hier, bin aber letztendlich Engländer. Eleonora stammt aus Tarent in Apulien, einem Teil Italiens, der in den Augen vieler nicht von der Einheit des Landes profitiert hat. Andererseits habe ich nie den Wunsch verspürt, nach England zurückzugehen, und sie war nie in Versuchung, es den Zehntausenden jungen Italienern gleichzutun, die im letzten Jahrzehnt aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs das Land verlassen haben. Ich denke also, ja, wir lieben es.
Auf jeden Fall lieben wir die Blu Bar, die gegen sieben Uhr in der Vorstadtwüste kurz vor der Grande Raccordo Anulare, der großen Ringstraße an der Stadtgrenze, in Sicht kommt. Nach zweieinhalb Stunden Laufen sind wir hungrig, durstig und deprimiert von dem starken Verkehr, dem Rollsplitt auf den Straßen und den Bergen von nicht abgeholtem Müll.
Doch wir können uns nicht beklagen. Der korpulente Wirt der Blu Bar produziert im Handumdrehen zwei große Gläser frisch gepressten Orangensaft, cremige Cappuccinos und pralle Croissants. Er bringt alles auf einem Tablett nach draußen und serviert es uns an dem weißen Kunststofftisch mit dem Gebaren eines Butlers, der einen Lord bedient. Seine anderen Kunden sind Lkw-Fahrer und Fabrikarbeiter, die es morgens eilig haben. Niemand außer uns setzt sich hin. Dennoch scheint er es zu genießen, in aller Ruhe die Orangen für uns auszupressen und uns das Tablett an den Tisch zu bringen. Ohne Preisaufschlag. Erst als er unsere nagelneuen Rucksäcke und die Karte, die wir auf dem Tisch ausgebreitet haben, sieht, erlaubt er sich ein fragendes Lächeln. Was in Gottes Namen haben zwei Wanderer an einem Ort wie diesem verloren?
Die Frage ist berechtigt. Fakt ist, wir wissen zwar, wohin Garibaldi gezogen ist, aber wir wissen nicht, wie er dort hinkam. Zwei seiner Offiziere, Egidio Ruggeri und Gustav von Hoffstetter, führten während des Marschs Tagebücher, die sie in den 1850er-Jahren veröffentlichten. 1899 brachte Raffaele Belluzzi die beiden Versionen zusammen und fügte ein paar Details aus Briefen, unveröffentlichten Manuskripten und Interviews mit Überlebenden hinzu. 1907 ergänzte George Macaulay Trevelyan in seinem Buch Garibaldi’s Defence of the Roman Republic den Bericht noch durch Informationen von anderen Korrespondenten. Doch besteht unter ihnen keine Einigkeit hinsichtlich der genauen Wegstrecke, vor allem an den ersten beiden Tagen, und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Garibaldi sich die allergrößte Mühe gab, alle im Unklaren darüber zu lassen, wo er hinwollte.
Die Franzosen waren von Westen her in die Stadt eingedrungen, der Seite, die dem Meer am nächsten lag. Indem er von der Piazza San Giovanni startete, vermittelte Garibaldi den Eindruck, nach Süden ziehen zu wollen, doch am nächsten Morgen schlugen seine Männer ihr Lager vor der Hügelstadt Tivoli auf, dreißig Kilometer östlich von Rom. Niemand weiß genau, wo sie ihren Kurs änderten. Ruggeri berichtet, sie seien schnell im Kreis bis zur Via Tiburtina marschiert, die direkt nach Tivoli führt. Belluzzi glaubt, sie seien nach Südosten in Richtung der Albaner Berge und der kleinen Stadt Zagarolo, zweiundzwanzig Kilometer südlich von Tivoli, gezogen und hätten sich erst dort nach Norden gewandt. Trevelyan stimmt ihm zu, denn seiner Meinung nach war dies die einzige Möglichkeit, die Franzosen zu täuschen. Aber dies hätte, rechne ich aus, einen Marsch von einundfünfzig Kilometern bedeutet, und Hoffstetter, der eine professionelle militärische Ausbildung besaß, bemerkt: »Ein einzelner tüchtiger Fußgänger wird wohl 3 Miglien in der Stunde machen; eine größere Truppe jedoch in der Nacht oder in brennender Hitze und unerträglichem tiefem Staub im Allgemeinen 2 Miglien per Stunde marschiren.«
In diesem Fall sind sie zehn Stunden marschiert. Folglich höchstens zweiunddreißig Kilometer.
Ich habe monatelang darüber nachgedacht. Eines Tages kommt mir der Gedanke, dass Hoffstetters Meilen vielleicht nicht mit meinen Meilen identisch waren. Und siehe da, es stellte sich heraus, dass es eine italienische Meile gibt, oder vielmehr gab, die 1852 Meter oder 2025 Yards umfasste. Das heißt, Hoffstetters zwei Meilen pro Stunde waren tatsächlich 2,3 englische Meilen, womit in zehn Stunden Marsch (non-stop!) siebenunddreißig Kilometer zu schaffen wären. Doch auch das sind immer noch keine einundfünfzig Kilometer.
Wieso bin ich so besessen von der Idee, genau die gleiche Route zu nehmen wie sie? Ist das nicht eine Einschränkung, das genaue Gegenteil der Freiheit, für die Garibaldi stand? Je genauer man ein Geschichtsbuch anschaut, desto deutlicher wird, wie viele Lücken es hat, wie viel darin übertüncht wird. Alle Erzählungen sind im Grunde Politur, das weiß jeder Schriftsteller. Zum Beispiel sind sich die Historiker einig, dass die garibaldini Rom gegen neun Uhr abends verließen und am folgenden Morgen um sieben in Tivoli eintrafen, aber da es im 19. Jahrhundert noch keine Sommerzeit gab, wäre es dann nach unserer Zeit nicht zehn Uhr abends und acht Uhr morgens gewesen? Und keines der Bücher über die Römische Republik, die ich gelesen habe, erwähnt die damalige Einwohnerzahl Roms, die, wie ich schließlich herausfand, im Jahr 1848 nur 170.000 betrug, gegenüber den heutigen 2,9 Millionen Die garibaldini dürften also innerhalb von Minuten aus der Stadt heraus gewesen sein, während wir nach zweieinhalb Stunden immer noch durch einen Vorstadtdunst aus Kohlenmonoxid laufen.
Die Vergangenheit lässt sich nicht rekonstruieren. Wir würden gerne über Zagarolo nach Tivoli wandern, aber wir wissen genau, dass wir bei 37 Grad an unserem ersten Tag nie und nimmer einundfünfzig Kilometer schaffen können. Wir haben in den letzten Wochen ein bisschen trainiert, hauptsächlich in der flachen Landschaft südlich von Mailand, aber mehr als zweiunddreißig Kilometer an einem Tag sind es nie geworden. Nach einigem Hin und Her entscheiden wir, dass wir angesichts der Uneinigkeit unserer Quellen jede beliebige und halbwegs vernünftige Strecke nehmen können. Zum Beispiel die über die Via Tiburtina, die kürzeste. Immerhin wissen wir, dass die Via Tiburtina am Abend des 2. Juli 1849 schon existiert hat. Es gibt sie seit 286 vor Christus.
Aber ist diese Route sinnvoll? Niemand verlässt heutzutage Rom zu Fuß. Es gibt keine Fußwege, und nur kurze Abschnitte von Fernradwegen. Sobald man das Zentrum verlässt, existieren nicht einmal mehr Bürgersteige. Zusätzlich zu unseren Papierkarten hatten wir in die »Profi«-Version einer Wander-App investiert, die alle verfügbaren Fußwege anzeigt. Aber hier in der Blu Bar, knapp hundert Meter von dem Schild entfernt, auf dem rot durchgestrichen ROMA steht, findet die App weit und breit nichts Fußgängerfreundliches.
Wir setzen unsere Rucksäcke wieder auf, und die Rushhour in der Hauptstadt trifft uns mit Wucht. In der Unterführung unter der Autostrada del Grande Raccordo ist zwischen Wand und einer verblassten weißen Linie kaum Platz zum Gehen. Scheinwerfer rasen auf uns zu. Lastwagen donnern vorbei. Es ist beängstigend, und mit Sicherheit viel gefährlicher, als vor hundertsiebzig Jahren durch die Landschaft zu wandern. Dann folgt ein Gewirr aus Auffahrten und Hauptverkehrsadern, durch das wir uns einen Weg nach Norden in Richtung der Via Tiburtina bahnen. Wir gehen besonnen, drücken uns dicht an die Leitplanken. Um acht scheint die Sonne schon warm. Wir liegen im Zeitplan zurück. Brombeergestrüpp überwuchert die Leitplanken und zerkratzt uns Arme und Knöchel. Wir laufen über Trümmer und Müll: Glasscherben, überfahrene Tiere, benutzte Spritzen, Getränkedosen, Kondome und alle möglichen Plastikabfälle.
Als wir uns einer Autostrada-Überführung nähern, kommen uns ein paar Fußgänger entgegen, die ersten und letzten, denen wir an diesem Tag begegnen werden. Es sind Roma, eine weitere Gruppe von Menschen, die Minister Salvini mit Begeisterung hasst. Beneidenswert entspannt gehen sie im Gänsemarsch an uns vorbei, die Frauen in langen Röcken und Kopftüchern, die Männer mit dichten Bärten. Sie grüßen uns mit schiefem Lächeln, aber der Letzte in der Reihe, ein kleiner Junge, bleibt stehen. »Seid lieber vorsichtig«, sagt er. »Hier ist es gefährlich.«
Zu Fuß gehen bedeutet anscheinend, die eigene Klassenzugehörigkeit abzulegen, um für neue Allianzen offen zu sein.
Als wolle unsere App ihre Nützlichkeit unter Beweis stellen, schlägt sie jetzt Alternativen jenseits der Straßen vor, zum Beispiel durch das Gestrüpp einer Böschung an der Autostrada, oder entlang des Zauns einer Eisenbahnstrecke. Etwa achthundert Meter weit kämpfen wir uns zwischen Stacheldraht und kratzigen Büschen vorwärts. Ich frage mich allmählich, wann Eleonora wohl protestieren wird. Sie wird mir erklären, das Ganze sei eine Schnapsidee, und wir werden noch vor dem Mittagessen aufgeben.
Schließlich erreichen wir die Via Tiburtina an der Stelle, wo sie einen kleinen Ort namens Setteville durchquert. Nicht sieben Villen, wie der Name vermuten lässt, sondern reihenweise zehnstöckige rote Ziegelbauten mit Pizzerien, Baumärkten und Lebensmittel-Discountern im Erdgeschoss. Wir folgen der Tiburtina bis zum Ende der Hauptstraße und erkennen dann, dass es hoffnungslos ist. Die zweitausend Jahre alte Straße ist jetzt eine schmale asphaltierte Fahrbahn mit dröhnendem Lieferverkehr.
Während wir ratlos am Straßenrand stehen, hupt ein vorbeifahrender Lkw, der Fahrer streckt den Arm aus dem Fenster und winkt Eleonora mit einer unmissverständlichen Geste zu. Der Dritte in einer Stunde.
Ist dies der Zeitpunkt, an dem wir einen Bus nehmen müssen? Eleonora hat sich schnell als App-Expertin etabliert. Sie bringt die App dazu, uns einen Umweg anzubieten: ein Radweg Richtung Norden, gefolgt von einem Labyrinth aus kleinen Straßen. Er verlängert unsere Strecke um sechseinhalb Kilometer. Wir sind bereits fünf Stunden gegangen. Wir trinken einen Schluck Wasser, reiben uns noch einmal Arme und Beine mit Sonnencreme ein, und dann wird es endlich ein bisschen unterhaltsam.
Die Straße, die wir jetzt entlanggehen, heißt Via G. Leopardi. Es ist ein Tick der Italiener, Straßennamen exakt so auf die Schilder zu schreiben, wie Namen auch auf amtlichen Dokumenten oder in Namensverzeichnissen aufgeführt werden. Via D. Alighieri. Viale M. Buonarotti. Hochkultur und Bürokratie. Wir müssen jedes Mal darüber lachen. Ich habe ein Foto von Eleonora, auf dem sie zwischen Gestrüpp und rissigem Asphalt neben G. Leopardi – unserem Lieblingsdichter – steht, während ihr die Sonne auf den Hut scheint und sie breit lächelt, vollkommen überzeugt davon, dass wir Erfolg haben werden. Eine echte garibaldina. Anita, schreibt Ruggeri über Garibaldis Frau, hat immer versucht, die Männer aufzuheitern, egal, wie schlimm ihre Lage war. ›Es kommen wieder bessere Zeiten‹, soll sie ihnen gesagt haben.
Jetzt allerdings noch nicht. Als wir den Radweg erreichen, stellen wir fest, dass er genau zwischen der Leitplanke einer weiteren stark befahrenen Straße und einem hohen Zaun verläuft; wir sind eingezwängt. Links von uns braust der Verkehr und rechts von uns erstrecken sich verdorrte, abgeerntete Maisfelder. Die Felder sind schön anzusehen, aber unzugänglich. Auch nach über einer Stunde gibt es noch keine Anzeichen eines Wegs oder Pfades, und keine Lücke im Zaun. Wir begegnen nur einem einzigen Radfahrer, der so erstaunt ist, uns zu sehen, dass er anhält und uns erklärt, er habe immer eine Gartenschere dabei, falls Brombeersträucher den Weg blockieren.
Darin liegt eine gute Portion Ironie. Wir sind unterwegs in einer politischen Realität, nach der sich im 19. Jahrhundert so viele Patrioten sehnten: in einem freien, vereinten Italien. Wir werden auf unserer langen Wanderung durch das Land keine Grenzen überschreiten müssen. Wir brauchen unsere Papiere nicht ausländischen Soldaten zu zeigen und keine Abgaben an Zollposten zu bezahlen. Dennoch können wir keineswegs mehr frei durch das Land laufen, jedenfalls nicht ungefährdet. Zumindest nicht in der Umgebung von Rom. Und unser erster Versuch, uns der Erfahrung der garibaldini möglichst weit anzunähern, hat uns in Wirklichkeit von ihnen weggeführt. Als ich meine Unterarme auf der Toilette einer Tankstelle in kaltes Wasser tauche, wird mir bewusst, dass ich seit über einer Stunde nicht mehr an ihren Marsch gedacht habe.
›Tivoli‹, schreibt Hoffstetter, ist ›von Waldungen (den alten heiligen Hainen) rings umgeben und liegt auf einem Berge, der vom Gebirgszug durch die bekannten herrlichen Cascadellen getrennt ist‹. Er war ein kultivierter Mann. Um sieben Uhr morgens kamen die guten Bürger der Stadt, von einer Reiter-Vorhut geweckt, den Soldaten entgegen, um sie zu begrüßen. Sie brachten Brot, Fleisch und Wein in reichlichen Mengen. Ich stelle mir vor, wie Pferde durch die Nacht galoppieren, wie ihre Hufe auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Stadttor klappern und die Soldaten an die Türen klopfen, um die Menschen aufzuwecken. Wieder einmal wird mir beim Ausmalen der Situation klar, wie viel übertüncht wurde. Waren die Bewohner von Tivoli wirklich erfreut, frühmorgens geweckt und gebeten zu werden, auf die Schnelle fast fünftausend Männer zu verköstigen? Hoffstetter behauptet, ja. Wie dem auch sei, man entzündete Lagerfeuer und schon bald kochten und aßen die Männer. Dann legten sie sich im Schatten eines Waldes unterhalb der Stadtmauer schlafen, während Garibaldi und sein Stab sich daranmachten, sie in zwei Legionen à tausendachthundert Mann aufzuteilen, die sie jeweils in drei Kohorten zu sechs Zenturien gliederten. Offiziere wurden zugeteilt, Gruppen zusammengelegt oder geteilt. Das Problem war, dass Garibaldi, abgesehen von seinen eigenen Soldaten aus der Ersten Legion, keine Ahnung hatte, wer sich zum Mitkommen entschlossen hatte und was er von diesen Männern erwarten durfte. Beim Durchzählen in den frühen Morgenstunden vor Tivoli wurde klar, dass viele schon jetzt desertiert waren. Etliche hatten sich im Dunkeln davongeschlichen.
Wie gut ich sie verstehen kann! Am frühen Nachmittag, mit der Sonne im Zenit, wandern wir immer noch im Zickzack durch die sengend heiße Ebene, vorbei an Sandgruben und Steinbrüchen, über Flüsse, die nur noch Rinnsale sind, und suchen gelegentlich Schutz unter einem Feigenbaum. Die Landschaft hier ist markant. Wenn man Rom in Richtung Osten verlässt, endet das flache Land, das sich vor einem erstreckt, an einer kompakten Nord-Süd-Kette aus dunkelgrünen Hügeln. Zur Rechten liegen versengtes Grasland und ausgedehnte Vororte. Aber auf der linken Seite, Richtung Norden, erheben sich abrupt drei verbrannte braune Hügel aus der Ebene. Auf jedem liegt eine Stadt. Monterotondo, Mentana, Montecelio. Von ferne wirken diese Orte leicht heruntergekommen und exotisch. Nicht pittoresk, sondern auf eine sehr fremde Art rau und real. Und diese kegelförmigen Hügel scheinen in gewisser Weise über unsere lange Wanderung zu gebieten; es fühlt sich an, als könnten wir sie niemals überwinden, bis wir schließlich den steilen Hang erreichen, an dem der Weg hinauf nach Tivoli führt.
Unsere Tagesetappe mit einem steilen Aufstieg abzuschließen, wird in den nächsten Wochen zur Gewohnheit werden. Die Städte in Mittelitalien liegen fast alle auf Hügeln. Garibaldi wählte sie aus, weil sie gut zu verteidigen waren. Neben dem Weg, den wir uns ausgesucht haben, rauscht ein Bach ins Tal. Er wird durch ein Halbrohr an einer Steinmauer geleitet – lebhaftes, schäumendes Wasser, das uns einlädt, die Schuhe auszuziehen und die brennenden Füße darin zu kühlen. Nur leider gibt es hier keinen Schatten, in dem man sich aufhalten könnte. Und die Sonne brennt jetzt erschreckend stark. Wir stecken in Schwierigkeiten. Ich bin schon leicht benommen und fühle mich seltsam entrückt, als wir endlich das Stadttor passieren und in die relativ kühlen, engen Gassen von Tivoli eintreten; ich ringe nach Atem, und mein Herz rast von dem Aufstieg. Aber es ist zugleich seltsam erhebend. Das Gefühl wird stärker, als wir entdecken, dass er schon da ist, um uns zu begrüßen. Ja, eine kleine Büste mit typischer Kopfbedeckung, die zweifellos schon vor längerer Zeit von einem exponierteren Platz entfernt worden ist, steht versteckt zwischen Schaukeln und Rutschen auf dem Spielplatz im Stadtpark. Es ist beinahe unheimlich, aber wir sehen sie sofort – Garibaldi! Das wallende Haar, die tief liegenden Augen, der dichte Bart beschwören sogleich die ernste Gelassenheit, die so viele Statuen des Helden ausstrahlen. Auf der anderen Straßenseite, an der Mauer einer säkularisierten Kirche, ist eine Plakette angebracht, auf der steht:
Von seinen Feinden gefürchtet, vom Volk verehrt, rastete hier am 3. Juli 1849 Garibaldi mit seinen tapferen Männern.
Wir rasteten ebenfalls. Wir machten unser Bed & Breakfast ausfindig, gaben nach einer Weile den Versuch auf, unserer krankhaft geschwätzigen Wirtin zu erklären, dass wir von Rom zu Fuß hergekommen waren – eine abwegige Idee, mit der sie einfach nicht zurechtkam –, und hörten uns stattdessen geduldig ihre ausführlichen Anweisungen zum Parken eines hypothetischen Autos an. Ich fragte mich, wie sie nicht bemerken konnte, in welch erbärmlichen Zustand wir waren, vollkommen durchgeschwitzt, schmutzig, Arme und Beine zerkratzt.
»Da wir morgen weiterwandern wollen«, unterbrach Eleonora eine weitere, ebenso ausführliche Erläuterung der Frühstücksabläufe, »werden wir schon um fünf Uhr aufbrechen und zum Frühstück nicht mehr hier sein.«
Die gute Dame rang mit dieser Information.
»Vielleicht können Sie uns eine Kleinigkeit auf einem Tablett bereitstellen«, schlug Eleonora vor.
Später, als wir unter der eiskalten Dusche Wunden und Sonnenbrand untersuchten, lernten wir etwas, das nicht in den Geschichtsbüchern steht, nämlich dass die oberste Pflicht des Soldaten, oder der Soldatin, darin besteht, sich im Angesicht der kommenden Schlacht um seinen oder ihren Körper zu kümmern. Ich musste eine Blase aufschneiden; Eleonora hatte wunde Stellen an den Schlüsselbeinen, weil die Rucksackgurte scheuerten. »Coraggio«, erklärte sie. »Wir wussten ja, dass dieser Tag der schlimmste sein würde.«
Tivoli
Lasst die Karren stehen und nehmt stattdessen Maultiere. So entschied Garibaldi, erzählt uns Hoffstetter, als er in Tivoli über ihre Lage nachdachte. Erst nach einigen Tagen sollte mir klar werden, wie tief greifend diese Entscheidung sich auf unseren Sommer auswirken würde.
Doch wer war Gustav von Hoffstetter? Wohl kaum ein italienischer Name. Wir müssen die Leute, mit denen wir reisen werden, kennenlernen.
Geboren 1818 in Bayern (damals, zur Zeit unserer Expedition, also einunddreißig Jahre alt), hatte Hoffstetter die Militärakademie in München besucht, 1847 in der Schweizer Armee gedient und war im selben Jahr im Schweizer Bürgerkrieg an einem siegreichen Kampf beteiligt gewesen. 1848 hatte er seine professionelle Laufbahn in den Wind geschlagen, indem er sich auf die Seite liberaler Revolutionäre in Süddeutschland stellte. Die Liberalen wurden besiegt, und Gustav war gezwungen zu fliehen, zunächst zurück in die Schweiz, dann nach Italien.





























