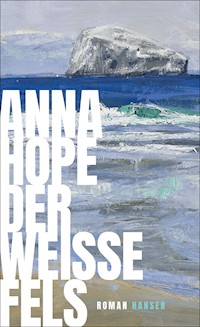
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Menschen, vier Jahrhunderte, schicksalhaft verbunden – der neue Roman von Anna Hope. Im Jahr 2020 reist eine Schriftstellerin mit ihrer Familie in ein mexikanisches Küstenstädtchen, dem ein weißer Fels vorgelagert ist. An eben diesen Ort flieht 1969 Jim Morrison vor dem Gesetz, vor fanatischen Fans der „Doors" und vor einem vom Vietnamkrieg gezeichneten Amerika. Zwei Schwestern des indigenen Yoeme-Stamms werden Anfang des 20. Jahrhunderts an diesen Felsen verschleppt. Und 1775 sticht ein spanischer Leutnant von hier aus in See, um die Eroberung des Kontinents voranzutreiben. Nach dem Bestseller „Was wir sind“ der neue mitreißende, kühne Roman von Anna Hope über vier schicksalhaft verbundene Menschen, für die ein heiliger Fels in Mexiko zum Wendepunkt ihrer Geschichte wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Vier Menschen, vier Jahrhunderte, schicksalhaft verbunden — der neue Roman von Anna Hope.Im Jahr 2020 reist eine Schriftstellerin mit ihrer Familie in ein mexikanisches Küstenstädtchen, dem ein weißer Fels vorgelagert ist. An eben diesen Ort flieht 1969 Jim Morrison vor dem Gesetz, vor fanatischen Fans der »Doors" und vor einem vom Vietnamkrieg gezeichneten Amerika. Zwei Schwestern des indigenen Yoeme-Stamms werden Anfang des 20. Jahrhunderts an diesen Felsen verschleppt. Und 1775 sticht ein spanischer Leutnant von hier aus in See, um die Eroberung des Kontinents voranzutreiben. Nach dem Bestseller »Was wir sind« der neue mitreißende, kühne Roman von Anna Hope über vier schicksalhaft verbundene Menschen, für die ein heiliger Fels in Mexiko zum Wendepunkt ihrer Geschichte wird.
Anna Hope
Der weiße Fels
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Hanser
Für meinen Vater Tony Hope (1945—2020)
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Anna Hope
Impressum
Inhalt
Die Schriftstellerin — 2020
Der Sänger — 1969
Das Mädchen — 1907
Der Leutnant — 1775
Der weiße Fels
Der Leutnant — 1775
Das Mädchen — 1907
Der Sänger — 1969
Die Schriftstellerin — 2020
Danksagung
Die Schriftstellerin
2020
Mama?
Ja, Liebes?
Wusstest du?
Was denn?
Eine Milliarde ist viel mehr als eine Tonne.
Allerdings. Da hast du recht.
Mama?
Ja, Liebes?
Kann ich noch eine Folge sehen?
*
Hinten im Van ist es sehr heiß.
Die kleine Tochter der Schriftstellerin hängt unbequem verdreht neben ihr auf dem Sitz, sie trägt Kopfhörer und starrt auf den verschmierten Laptopbildschirm, wo ein Trickfilm mit drei als Superhelden verkleideten Kindern läuft. Sie haben einen geflügelten Totempfahl und ein fliegendes Auto, ihre Gegenspieler sind ein junger Mann mit grauer Haarsträhne und ein Mädchen auf einem Hoverboard. Die Kinder treten als Gecko, Eule und Katze auf. In dieser Folge verliert der Junge im Geckokostüm seine Stimme, oder er findet sie wieder. Obwohl sie die Folge unzählige Male mit halbem Auge gesehen hat, weiß die Schriftstellerin es nicht mehr. Fünf Trickfilmfolgen, vor zehn Tagen in einem stickigen Hotelzimmer in Mexico City hastig heruntergeladen — mehr blieb ihrer Tochter nicht als Ablenkung von der endlosen Straße, als die Ausmalbücher, die Kekse, der Saft und die Geschichten ihren Reiz verloren hatten.
Die Frau wechselt die Position, und von ihrem Schoß rieseln salzige Krümel in den Fußraum. Ihr Rücken fühlt sich steif an. Alles an ihr ist steif. Ihre Wangen sind trocken von der Wüstenluft, die Lippen aufgesprungen. Vergangene Nacht hat sie in der Sierra Madre Occidental hellwach zwischen den anderen Mitreisenden am Lagerfeuer gesessen, Tausende Meter über dem Meeresspiegel. Kurz vor Morgengrauen kickten sie Erde über die Glut, packten alles zusammen — Schlafsäcke, verstaubte Decken, Mäntel, Mützen, Taschen, die Kinder — und trugen es auf der anderen Seite des Bergs wieder hinunter. Und jetzt, nach fast sieben Stunden Fahrt durch Kiefernwälder und steile Schluchten, verändert sich die Vegetation. Auf einmal gibt es Palmen und Bougainvilleen, und die Außenmauern der kleinen Läden am Straßenrand sind mit Werbung für Pacífico bemalt, das Bier der Küste — munter, nautisch; ein Anker und das Meer in einem Rettungsring.
Sie sollte wirklich versuchen zu schlafen, aber die Trickfilmfolgen müssen einzeln gestartet werden. Wenn sie jetzt eindöst, wird sie in spätestens elf Minuten wieder geweckt, was wahrscheinlich noch schlimmer wäre als gar kein Schlaf. Abgesehen davon werden sie in ein paar Stunden, oder weniger, nicht mehr in diesem Van sitzen, sondern ihr Ziel erreicht haben, ein verschlafenes Nest, ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Und dort, am Ende der letzten Etappe ihrer Reise, wartet ein klimatisiertes Hotelzimmer, ein Bett, ein kühles Pacífico, eine Mahlzeit. Und danach, vielleicht, etwas Schlaf.
Der Abspann läuft über den Bildschirm. Die Frau tippt auf Pause und will ihre Tochter zu sich ziehen, aber die Kleine windet sich. Sie fühlt sich heiß an, ihre Wangen sind gerötet. Ihr warmer, hefiger Atem riecht nach ungeputzten Zähnen.
Möchtest du etwas essen?
Die Frau beugt sich vor und wühlt in der Sitztasche. Die Ausbeute ist dürftig: alte Cracker, ein Apfel, scharfe Chips.
Ihre Tochter schüttelt den Kopf, die glasigen Augen wandern zurück zum Bildschirm. Milch, sagt sie. Mi-hilch.
Anscheinend trinkt sie jetzt gar kein Wasser mehr, sondern nur noch Milch. Wenn möglich Hafer, sonst auch gern Mandel, immer aus der Flasche und mindestens drei- oder viermal täglich. Was bedeutet, dass sie ständig bei einem der Läden am Straßenrand halten müssen.
Wir haben keine Milch, Süße. Aber bald machen wir Pause, und dann besorge ich welche. Versprochen.
Ihre Tochter verzieht das Gesicht. Sie sieht aus, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen oder um sich schlagen. Ich. Will. Mi-hilch, sagt sie.
Eigentlich hat ihre kleine Tochter während der ganzen langen Fahrt, während der vielen Stunden hier auf der Rückbank des Van und der vielen Kilometer auf dem mexikanischen Highway kaum einmal anders ausgesehen. Die Schriftstellerin kann es ihr nicht verübeln; im Grunde hat sie sich die meiste Zeit auf dieser Reise genauso gefühlt.
Ich. Will. Milch. ICH. WILL. MILCH!
Schätzchen. Wir haben keine Milch, das habe ich dir doch eben erklärt. Soll ich dir eine Geschichte vorlesen?, versucht sie es und greift nach dem Kindle.
Als ihre Tochter noch klein war, hatte die Schriftstellerin sich bei einer Eltern-Kind-Gruppe angemeldet. Die Kursleiterin hatte den anwesenden Müttern die Wichtigkeit klarer Ansagen eingeschärft.
Heutzutage, sagte sie, werden den Kindern zu viele Entscheidungen überlassen. Das verwirrt sie nur. Woher sollen sie wissen, was sie zu Abend essen möchten? Wir bilden uns ein, wir wären gute Eltern, weil wir ihnen eine gewisse Wahlfreiheit geben und unsere Anliegen in Form von Fragen vortragen, aber in Wahrheit macht uns das zum genauen Gegenteil.
Klare Ansagen statt Fragen, dann sind alle zufriedener.
Die Schriftstellerin hat den Dreh bis heute nicht raus.
Nein, sagt ihre Tochter kopfschüttelnd. Keine Geschichte! Lieber noch einen Trick-film.
Ihre Tochter ist erst drei Jahre alt, beherrscht die Kunst der klaren Ansagen aber jetzt schon. Die Frau zuckt mit den Schultern. An diesem Punkt des Spiels hat sie den Widerstand längst aufgegeben, und ihre Tochter weiß es.
Okay, sagt sie und bearbeitet die Tastatur. Wenn du meinst.
Sie klickt die nächste Folge an, und augenblicklich sind die Superheldenkinder aus dem digitalen Tiefschlaf erweckt, sausen durchs Bild und ziehen Kondensstreifen hinter sich her. Anscheinend wohnen sie in einer französischen Stadt, diese Superheldenkinder; im kalten Licht eines nördlichen Mondes toben sie über die Mansardendächer dicht gedrängter, grauer Häuser. Die Tochter der Schriftstellerin singt die Titelmelodie mit, ihre Unterschenkel schlagen im Takt gegen die Sitzkante.
Los in der Nacht … PJ Masks, Pyjamahelden, PJ MASKS, da-da-da …
Der schiefe Gesang bringt die Senegalesin in der Reihe vor ihnen dazu, sich halb umzudrehen und zu lächeln. Durch die Lücke zwischen den Sitzen ist ihre Tochter zu sehen. Das Kind schläft tief und fest an seine Mutter geschmiegt, sein Gesicht ist friedlich und entspannt, der Mund leicht geöffnet.
Es gibt so vieles über das Muttersein, was die Schriftstellerin gern wüsste. Beispielsweise, wie die elegante Senegalesin es schafft, ihr Kind während der anstrengenden Reise so still und ruhig zu halten, ganz ohne einen Bildschirm. Zuweilen ist sie streng, aber nie gemein, und ganz offensichtlich verliert sie nie, niemals die Nerven. Außerdem wüsste die Schriftstellerin gern, wo die Senegalesin bei jeder Pause und selbst an den unmöglichsten Orten einen Topf und heißes Wasser herzaubert. Sie gießt es in eine Schüssel, zieht ihre Tochter aus und wäscht sie darin.
Beim ersten Mal verschlug der Anblick des kleinen Mädchens, das da mitten in der Wüste knietief in einer roten Plastikschüssel stand, der Schriftstellerin die Sprache. Das Kind trug eine Lederschnur um die Taille.
Ist das ein Schutz?, hatte die Schriftstellerin schüchtern gefragt.
Die Senegalesin hatte bejaht und dann weiter ihr Kind gewaschen, mit sicheren Bewegungen und ohne jede weitere Erklärung.
Wovor?, hätte die Schriftstellerin am liebsten gefragt.
Und noch etwas hätte sie gern gewusst: Wo bekomme ich so einen Schutz her? Für mein Kind, und für mich?
Stattdessen hatte sie gefragt, ob sie sich die Schüssel kurz ausleihen dürfe, wenn die Senegalesin und ihr Kind mit Waschen fertig wären.
Später wurde die Tochter der Senegalesin mit einem süßlich duftenden Öl eingerieben und in saubere Kleidung gesteckt, während die Tochter der Schriftstellerin sofort wieder zum Spielen in den Dreck rannte. Die kompakte Wüstenerde — kein richtiger Dreck, eher ein Gemisch aus Staub und Sand — setzte sich überall fest, in den Haaren, der Kleidung, der Lunge. Ihre Tochter liebt diese Erde. Wenn sie abends rund um das Feuer ihr Lager aufschlugen, wollte ihre Tochter nicht bei ihnen im Schlafsack oder auf einer Decke liegen, sondern auf der Erde. Wenn sie ihren Willen nicht bekam, hat sie protestiert, geklagt, gejammert und geweint. Und so kam es jeden Abend vor den Augen der anderen Mitreisenden zu einem absurden Schauspiel, wenn die Schriftstellerin und ihr Mann versuchten, das kleine Mädchen vom Feuer wegzulocken und in den Schlafsack zu stecken.
Während dieser Szenen lagen die Senegalesin und ihre Tochter stets tief schlafend und aneinandergeschmiegt auf einer am Boden ausgebreiteten Decke. In dieser Position blieben sie scheinbar regungslos bis zum nächsten Morgen.
Draußen brennt die Sonne erbarmungslos, die Maisstängel auf den aufgeheizten Feldern werfen lange Schatten, die Straße zieht sich schnurgerade hin. Am Vormittag waren sie noch längere Zeit einem geschlängelten Fluss gefolgt, dem Grande de Santiago, doch in der letzten Ortschaft haben sie ihn überquert und dann seinem Weg nach Norden überlassen.
Vielleicht hätten sie anhalten und Milch kaufen sollen, aber ihre Tochter war endlich eingeschlafen. Alle schliefen zu diesem Zeitpunkt, alle außer der Schriftstellerin auf der Rückbank, ihrem Mann und den zwei Männern vorne neben ihm, ein Mexikaner und ein Kolumbianer. Die Männer unterhielten sich, und weil keine Musik lief, konnte sie alles verstehen. Es ging um einen Vorfall in der Nähe der Kleinstadt, durch die sie eben gefahren waren; angeblich hatten Mitglieder des Cartel Jalisco Nueva mit einem Raketenwerfer einen Polizeihubschrauber vom Himmel geholt. Die Männer hatten sich in einem gedämpften, nüchternen Ton unterhalten, während der Van über die Plaza rollte, vorbei an einer Kirche und kleinen Kindern in Schuluniform, die Hand in Hand vom Unterricht nach Hause liefen, mit hopsenden Ranzen auf dem Rücken.
La violencia, sagte der Mexikaner kopfschüttelnd, sobald sie wieder auf der offenen Landstraße waren. Es gebe einfach zu viel davon — zu viel Gewalt in den Schulen, zu viel Gewalt auf der Straße. Er spiele mit dem Gedanken, seine Heimatstadt Guadalajara zu verlassen und zusammen mit seiner senegalesischen Frau und der gemeinsamen Tochter nach Spanien auszuwandern.
Aber das ist nun über eine Stunde her. Inzwischen hat ihr Mann das Radio eingeschaltet und die Stimmung ist anders, irgendwie feierlich. Ihr Mann erzählt eine Anekdote und nimmt zum Gestikulieren immer wieder die Hände vom Lenkrad.
Die Schriftstellerin beugt sich vor und ruft: Kannst du bitte anhalten, wenn du einen OXXO siehst? Wir brauchen Milch.
Ihr Mann hat sie nicht gehört, denn die anderen lachen gerade über seine Geschichte. Der Mexikaner lacht, und auch die junge Französin, die direkt hinter ihrem Mann sitzt. Die junge Französin ist als Letzte zugestiegen und erst seit etwa vierundzwanzig Stunden mit von der Partie. Sie sind ihr im Gebirge begegnet, wo sie alleine unterwegs war, um für ein Buch über traditionelle Medizin zu recherchieren, das in Frankreich erscheinen soll. Jemand hat ihr eine Mitfahrt angeboten, möglicherweise sogar sie selbst, die Schriftstellerin. Sie weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber die junge Französin sagte sofort ja, warf ihren beneidenswert leichten Rucksack in den Van und setzte sich dann ganz nach vorn, wo der Fahrtwind angenehm kühl ist.
Die Schriftstellerin betrachtet den Rücken ihres Mannes, seine Schultern, den Winkel seines Arms im offenen Fenster des Van. Im Laufe der Reise hat er wieder mit dem Rauchen angefangen, und nun steckt ständig eine Zigarette zwischen seinen Fingern. An diese Version von ihm kann sie sich noch gut erinnern. So hat sie ihn vor zwanzig Jahren kennengelernt: aufgekratzt, übernächtigt, immer auf dem Sprung und Kette rauchend.
Sie werden sich trennen, sie und ihr Mann, nach zwanzig gemeinsamen Jahren.
Diese Tatsache ist neu.
Und erst ein paar Wochen alt. Davor war sie eher eine Möglichkeit, eine von mehreren denkbaren Optionen. Aber nun steht es anscheinend unwiderruflich fest.
Es gäbe viele Möglichkeiten, die Geschichte zu erzählen.
In einer davon trennt sie sich wegen einer Textnachricht, die er ihr letzten Herbst geschickt hat, zu Hause in England: Wir müssen reden. Als sie die Nachricht las, waren ihr zwei Dinge sofort klar. Erstens würde er ihr etwas erzählen, was sie nicht hören wollte, und zweitens wäre es etwas, was sie längst wusste.
Und genau so kam es dann auch.
Sie kann sich an ihre körperliche Reaktion erinnern, an ihren schnellen, flachen, fast hechelnden Atem. Okay, hatte sie gesagt. Wer?
Nachdem er mit seiner Aufzählung fertig war, rührte sie sich nicht. Sie saß da wie erstarrt und musste sich zunächst einmal sortieren. Ihr erster Gedanke war: Es könnte schlimmer sein. Es waren gar nicht so viele gewesen, und in keine davon hatte er sich verliebt. Keine davon war mit ihr befreundet oder schwanger geworden. Obwohl sie es sich früher immer so ausgemalt hatte, fragte sie nicht nach den Details. Dafür wäre später immer noch Zeit. In dem Moment glaubte sie tatsächlich noch, alles würde sich wieder einrenken.
Aber das wäre natürlich nur eine Version der Geschichte. Es gibt noch viele andere. Man könnte sie aus der Sicht der jungen Frau erzählen, die den Mann der Schriftstellerin in einer kleinen englischen Universitätsstadt gevögelt hat — von ihren Gefühlen, Sehnsüchten, Wünschen und Bedürfnissen. Die ganz Mutigen stellen sich die Sache aus der Perspektive des Ehebetts vor. Ein befreundeter Tischler hatte es angefertigt in dem Wissen, dass die beiden sich ein Kind wünschten. Man könnte das Bett zu Wort kommen lassen, es könnte von all den Nächten erzählen, von all den Formen der Liebe, der Traurigkeit, der Wut, des Kummers und der Abwesenheit, die es erlebt hat.
Oder man könnte einfach zugeben, dass die Sache kompliziert ist. Dass jede Geschichte mehrere Seiten hat, und fertig.
Die Schriftstellerin beugt sich vor und tippt der Senegalesin auf die Schulter. Kannst du meinem Mann bitte etwas ausrichten? Wir brauchen Milch.
Die Frau nickt, lehnt sich vor, tippt ihrerseits der Französin auf die Schulter und deutet auf den Ehemann, woraufhin die Französin den Arm ausstreckt und seinen Rücken berührt. Er sieht sich flüchtig um und lächelt, offenbar erfreut über die Berührung. Die Französin zeigt nach hinten, und das Gesicht des Ehemanns verändert sich, verdunkelt von einer Maske elterlicher Verantwortung.
Alles okay da hinten?
Milch, ruft die Schriftstellerin. Kannst du bitte anhalten, wenn du einen Supermarkt siehst? Wir brauchen Milch.
Klar.
Und würdest du bitte die Klimaanlage einschalten? Hier hinten ist es heiß.
Ihr Mann nestelt an der Einstellung herum. Der kühle Hauch erreicht die letzten Reihen nur knapp.
Danke.
Ihr Mann erzählt schon wieder. Er macht da weiter, wo er eben aufgehört hat, und sammelt die Fäden seiner Geschichte zusammen. Er redet ohne Punkt und Komma, macht einen auf Neal Cassady, hält Hof und lenkt dabei den Van.
Bei ihrer ersten Begegnung vor zwanzig Jahren in einem lichtdurchschossenen mexikanischen Dschungel hatten sie sich unter anderem über Bücher unterhalten. Er erzählte ihr, wie sehr er Kerouac verehrte. Der Teil von On the Road, wo sie nach Mexiko kommen und alles sich einfach … öffnet.
Er war Psychologiedozent und noch keine drei Monate in Mexiko. Er wollte den Schamanismus studieren, was am Ende darauf hinauslief, dass er alle psychotropen Pflanzen ausprobierte, die er finden konnten. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten wurde aus diesem studentischen Zeitvertreib im Laufe ihrer gemeinsamen Jahre eine echte Karriere. Alle zwei Jahre lädt er zu einer Konferenz an seiner Universität ein, wo Fachleute aus Forschung und Lehre voller Ernst über die potenzielle Bedeutung psychotroper Pflanzen für die westliche Wissenschaft und Medizin debattieren.
Seine Gäste, ehrgeizige junge Männer und Frauen mit Forschungsaufträgen von weltweit führenden Universitäten, haben seriöse Anliegen. Sie schlendern über den Campus und reden über ihre Experimente mit Psilocybin gegen Depressionen, mit Ayahuasca gegen generationsübergreifende Traumata, mit MDMA gegen PTBS bei israelischen und US-amerikanischen Kriegsveteranen. Sie besitzen haufenweise Daten. Sie haben Labore, fMRT-Geräte und jede Menge Akronyme. Außerdem haben sie potente Geldgeber, darunter Tech-Unternehmer aus dem Silicon Valley und Ex-Goldman-Banker.
Nach den gescheiterten Experimenten der Sechzigerjahre, sagen sie, erleben wir gerade eine Renaissance. Einen Goldrausch. Wir verschieben Grenzen.
Vor zwei Jahren war ihr Mann Teil eines Teams, das in einer Universitätsklinik im Norden von London LSD an junge Forscher verabreichte. Die Versuchspersonen waren Doktorandinnen aus Oxford, renommierte Mykologen, Mitarbeitende des CERN. Es handelte sich um eine leicht abgeänderte Versuchsanordnung aus den Sechzigerjahren. Die Probanden bekamen eine geringe Dosis LSD, eine Augenmaske und Kopfhörer und wurden gebeten, sich auf das größte theoretische Problem ihres jeweiligen Forschungsgebiets zu konzentrieren. Danach hatten die meisten sehr interessante Sachen zu erzählen.
Doch die Schriftstellerin findet den zunehmenden Einfluss der Vermögenden und die unhinterfragte Grenzverschiebung beunruhigend. Nicht einmal die alten Griechen bleiben verschont, denn einige Geldgeber haben ihre Firmen nach antiken Kulten oder Initiationsriten benannt.
Im Moment befindet ihr Mann sich in einem Sabbatjahr, teilfinanziert durch einen englischen Milliardär mit Hang zum Göttlichen. Einmal hat sie ihn zu seinem Mäzen begleitet, auf einen Landsitz mit fünfzig Zimmern, eigenem Wildgehege und einem von Edwin Lutyens entworfenen Gartentempel. Der Milliardär hatte weltweit führende Fachleute auf dem Gebiet der Anthropologie, Kulturgeschichte, Neuropsychopharmakologie, Ethnobotanik und Psychiatrie eingeladen, um bei einem Symposion über den ontologischen Status der entheogenetischen Wesensbegegnungen zu sprechen.
Damals war sie in der sechzehnten Woche schwanger gewesen und hatte die Vorträge nach kurzer Zeit ermüdend gefunden. An den Abenden versteckte sie sich in ihrem Zimmer und las Jane Austen, während die renommierten Wissenschaftler Wein und Whisky tranken oder auf dem Anwesen spazieren gingen.
Die Unterhaltung über Kerouac war ihr erst vor Kurzem wieder eingefallen. Sie hatte einen Podcast von zwei schlauen jungen Frauen mit sexy Stimmen gehört, die in einem Studio im Londoner Osten saßen und über berühmte überbewertete Romane sprachen. In dieser speziellen Folge war es um die Frage gegangen, ob man einem Mann mit einer Vorliebe für Kerouac jemals vertrauen dürfe.
Nein, lautete ihr Urteil. Auf keinen Fall. Und dann lachten sie, wie um zu sagen: Das war doch klar.
Die Schriftstellerin hatte sich bloßgestellt gefühlt, gerade so, als wären ihre Emotionen und der furchtbare Liebeskummer, den sie auszuhalten versuchte, vermeidbar gewesen, hätte sie einfach nur einen besseren Männergeschmack bewiesen.
Aber in Wahrheit hatte sie damals nichts gegen Kerouac. Als sie ein Teenager war, hing in ihrem Zimmer sogar eine Postkarte mit einem Zitat aus On the Road:
Denn die einzigen Menschen sind für mich die Verrückten, die verrückt sind aufs Leben, verrückt aufs Reden, verrückt auf Erlösung … die brennen wie phantastische gelbe funkensprühende Feuerwerksvulkane und wie Feuerräder unter den Sternen explodieren …
Die Kinder auf dem Laptopschirm liegen im Bett. Sie haben den Tag gerettet, oder die Nacht, oder beides, und tragen jetzt Pyjama.
Mama?
Ja?
Kann ich noch eine sehen?
Ja.
Die Schriftstellerin startet die nächste Folge: »Catboy und das gestohlene Schwert.«
Nicht die. Die kenne ich schon, Mama.
Eine andere haben wir nicht, Liebes.
MI-HILCH!, ruft das Kind. ICH WILL MILCH!
Der schlafende Mann auf dem Fensterplatz schräg gegenüber bewegt sich und öffnet ein Auge.
Lo siento, sagt die Schriftstellerin. Verzeihung.
Der Mann antwortet nicht. Stattdessen sieht er aus dem Fenster und verschafft sich einen Überblick. Sie sind jetzt auf dem Highway, in der Ferne ziehen Strommasten vorbei.
Cerca, sagt er. Una hora. Más o menos.
Sí, cerca, sagt die Schriftstellerin.
Der Mann klappt das Auge wieder zu. Anscheinend schläft er weiter.
Er ist schon über siebzig, wirkt aber zwanzig Jahre jünger. Er hat breite, volle Lippen und leicht nach unten weisende Mundwinkel, die ihm ein dauerhaft spöttisches Aussehen verleihen. Seine Haut ist faltenfrei. Er trägt eine schwarze Daunenjacke und darunter ein weißes Baumwollhemd und eine weiße Hose. Die Hose ist mit Hirschen in leuchtendem Rosa und Lila bestickt. Sie scheinen über die Säume zu springen. An den Füßen trägt der Mann Huaraches, Ledersandalen mit Sohlen aus Reifengummi. In der Sprache seines Volkes, der Wixárika, ist er ein Mara’akame, ein Schamane. Doch er entspricht nicht den damit verbundenen Erwartungen. Anscheinend betrachtet er es nicht als seine Aufgabe, anderen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Er liebt Witze; je derber, desto besser. Bei Tageslicht spricht er kaum ein Wort. Er ist auf keiner Webseite zu finden. Er braucht keine Fünf-Sterne-Bewertungen.
Nachts am Feuer ist er mit ihnen wach geblieben. Er wurde von Familienangehörigen aus mehreren Generationen begleitet: seinem Sohn, seiner Schwiegertochter und vier ihrer sieben Kinder. Am Ende der Nacht sang er fünf Lieder, wobei seine Stimme immer genau an den richtigen Stellen brach. Sie war tief, dann hoch, tief und dann wieder hoch, und zwischen den Liedern rückten die Reisenden aus Mexiko, Frankreich, Schweden, Deutschland, dem Senegal, Großbritannien und Kolumbien näher ans Feuer, beteten stumm oder im Flüsterton, sangen eigene Lieder, opferten den Flammen Schokolade oder Tabak, baten um Gesundheit oder bedankten sich. Überhaupt verhielten sie sich, als hätte es den Fortschritt der letzten fünfhundert Jahre nicht gegeben, keine Moderne, keine Wissenschaft, kein iPhone und kein Flugzeug, oder als wäre all das aus diesem geschützten, von Feuerschein und Sternenlicht erhellten Tal irgendwo in der Sierra Madre Occidental verbannt worden.
Beim letzten Lied des Mannes graute der Morgen. Als er mit Singen fertig war, ging er langsam um seine Mitreisenden herum und strich ihnen und ihren Kindern mit Federn über die Haut. Er zog die nach Tieren, Schweiß und Fett riechenden Federn über ihre Wangen, saugte sie dann der Länge nach ab und spuckte winzige Kristalle aus, die dem Feuer geopfert wurden. Danach, es war immer noch nicht richtig hell, sammelte er seine wenigen Sachen zusammen und führte die Gruppe den Berg hinunter, damit sie ihre Fahrt an die Küste fortsetzen konnte. Sein Sohn, seine Schwiegertochter und die Enkelkinder sind ihnen inzwischen weit voraus. Sie reisen mit dem eigenen Pick-up, die Kinder auf der Ladefläche zusammengekauert.
Wenn man der Kohlenstoffmethode glauben kann, mit der die Aschereste ihrer Feuerstellen untersucht wurden, sind die Rituale des Mannes und seiner Vorfahren seit vielen tausend Jahren unverändert. Ihre indigene Gruppe gehörte zu den wenigen, die nicht von den Spaniern besiegt wurden. Ursprünglich waren sie Wüstennomaden, die sich später ins Hochgebirge zurückzogen, um dem Schießpulver, der Folter und den Schikanen der Kolonisatoren zu entgehen. Bei der Strecke, die sie während der letzten zehn Tage in dem weißen Van zurückgelegt haben — einmal quer durchs zentrale und nordwestliche Mexiko, von Zacatecas bis zur Wüste von San Luis Potosí —, handelt es sich um einen uralten Pilgerweg. Früher legten die Menschen ihn natürlich nicht als internationale Reisegruppe einem in Guadalajara gemieteten weißen Van zurück, sondern gingen zu Fuß.
Der Schriftstellerin ist bewusst, wie unglaubwürdig das alles wirkt. Die Reise. Die Pilgerfahrt. Sie verspürt den Drang, alles in Anführungszeichen zu setzen, denn sie weiß, wie lächerlich es vielleicht klingt. Wie ein postmodernes Rätsel, oder wie der Anfang von einem Witz:
Warum fahren an einem Frühlingsnachmittag zu Beginn der dritten Dekade des einundzwanzigsten Jahrhunderts ein Mexikaner, ein Kolumbianer, eine Senegalesin, eine Französin, eine Deutsche, eine Engländerin und zwei Engländer, ein Schwede, zwei Kinder und ein siebzigjähriger Schamane in einem Van über einen Highway im mexikanischen Bundesstaat Nayarit?
Die Schriftstellerin hat Gesprächsfetzen aufgeschnappt, Hinweise darauf, was die anderen hier suchen. Der Schwede arbeitet in einem Büro in Stockholm und hat schlimme Depressionen, wegen der er sich schon umbringen wollte. Die Deutsche ist Ende vierzig, sieht aber viel älter aus, weil tausend Sorten Schmerz ihr Gesicht entstellt haben. Die Senegalesin spricht in der Gegenwart von Männern kaum ein Wort, doch neulich abends beim Kochen öffnete sie sich plötzlich und erzählte der Schriftstellerin, was sie hierhergebracht hat. Sie erzählte, wie sie ihren mexikanischen Ehemann im Senegal auf der Straße kennengelernt hatte. Wie sie sich in ihn verliebte und alles zurückließ — das Land ihrer Familie, ihre Mutter, ihre Cousinen und Tanten —, um in einem kleinen Haus am Rand einer mexikanischen Stadt ein neues Leben anzufangen. Sie macht die Pilgerreise für ihre kleine Tochter und nimmt die tagelange Fahrt, die Unannehmlichkeiten und den Schlafmangel deshalb gerne in Kauf. Sie möchte Opfer bringen und um Schutz bitten.
Das konnte die Schriftstellerin sofort verstehen. Sie ist aus demselben Grund hier: Sie möchte ein Opfer bringen und um Schutz bitten. Ja, genau.
Sie hätte mehrere Erklärungen für ihre Anwesenheit auf der Rückbank des Vans, und ihre Geschichte hat viele mögliche Startpunkte.
Sie könnte bei der Wahrheit bleiben und einfach zugeben, dass sie eine Schriftstellerin ist. Dass sie nach Mexiko gekommen ist, um zu recherchieren und einen Roman zu schreiben, von dem sie immer noch nicht weiß, wie er anfangen soll.
Aber das wäre nicht die ganze Wahrheit, denn die eigentliche Geschichte beginnt schon viele Jahre davor.
Wollte man sie auf eine möglichst knappe und geradlinige Weise erzählen, könnte man sagen, dass die Schriftstellerin und ihr Mann versucht haben, ein Kind zu bekommen, sieben Jahre lang. In diesen sieben Jahren ließen sie nichts unversucht. Diagramme, Diäten, Medikamente, Apps und Injektionen, doch es klappte nicht. Dann eines Tages erhielt der Ehemann eine Nachricht von dem jungen Mexikaner, der jetzt vorn im Van sitzt. Damals arbeitete er mit Indigenen aus Nordmexiko zusammen. Sie wollten Großbritannien besuchen. Der junge Mexikaner hatte gehört, dass der Mann der Schriftstellerin vielleicht eine Einladung verfassen könnte, auf der Sorte offiziellem Universitätsbriefpapier, das einem Schamanen der Wixárika durch die britische Passkontrolle hilft. Wäre das möglich?
Und so kam es, dass die Schriftstellerin sich vor ein paar Jahren an einem Lagerfeuer wiederfand und für ein Kind betete.
Das Ritual — das Gebet — fiel ihr nicht leicht. O nein. Wie um alles in der Welt sollte sie beten? Und an wen sollte sie sich nach zweitausend Jahren Christentum und Patriarchat überhaupt wenden? Wer hörte ihr zu? Gott? Das Feuer? Der blaue Hirsch, der den Wixárika heilig, ihrer eigenen Kultur aber fremd war? Woher nahm sie angesichts von Kolonialismus, Gewalt und Vertreibung das Recht, neben einem indigenen Schamanen am Lagerfeuer zu sitzen und um etwas zu bitten?
Aber weil alles andere erfolglos gewesen war, machte sie mit und befolgte die Anweisungen. Sie versuchte zu beten. Später, nach der Zeremonie, lag sie in einem kleinen Raum, wo der Schamane Holzkohle abbrannte und sich dann über sie beugte. Er saugte der Länge nach an einer Vogelfeder und zog kleine Kristalle heraus, die anscheinend aus ihrem Unterleib stammten. Er betrachtete die Kristalle und murmelte leise vor sich hin.
Vor einem Jahr war die Schriftstellerin dann zum ersten Mal in der Sierra gewesen. Es hatte sich um einen Pflichtbesuch gehandelt. Sie hatten für ein Kind gebetet, das Kind war zur Welt gekommen, und nun mussten sie ihren Teil der Abmachung erfüllen. Das Ganze hatte nichts mit Geld zu tun, zumindest nicht direkt. Es ging vielmehr darum, ein Opfer zu bringen. Sie mussten mit ihrer Tochter nach Mexiko reisen und sich persönlich bedanken.
Kurz nach ihrer Ankunft im Dorf erklärte man ihnen, sie müssten ein Schaf kaufen. Als sie das hörte, lachte die Schriftstellerin. Das soll ein Witz sein, oder? Aber der Schamane und seine Familie machten keine Witze. Sie meinten es todernst.
Das Tier wurde bei einer kleinen Zeremonie unter dem Holzkreuz auf dem Dorfplatz geschlachtet. Die Tochter der Schriftstellerin war unvoreingenommen und neugierig. Sie saß auf den Schultern ihres Vaters, trug den rosafarbenen Sonnenhut mit Nackenschutz und schaute zu, wie das Schaf zuckend verendete. Das Blut wurde in einer kleinen Kürbisschale aufgefangen, die Männer tunkten Federn hinein und tupften die zähe rote Flüssigkeit auf Münzen, auf ihre Haut und auf alles, was sie segnen wollten. Als sie das sterbende Schaf mit den großen, schwarzen, himmelwärts verdrehten Augen sah, wunderte die Frau sich sehr. Sie hatte sich eine Opfergabe immer als etwas Abstraktes, Ungreifbares vorgestellt, aber nun schien es nichts Greifbareres zu geben als dieses sterbende Tier.
Das Schaf wurde nach Hause getragen, wo die Frauen es still und zügig zerteilten, das Fleisch mit Gemüse und Wasser in einen großen Topf gaben, ihn mit Teig verschlossen und für Stunden aufs Feuer stellten. Später am Abend kamen die Besucher. Alle hatten Kunststoffteller, riesige Flaschen mit Cola und Fanta und Unmengen von Tortillas dabei. Sie setzten sich und warteten schweigend auf eine Portion Hammeleintopf. Auf Fleisch vom dem Schaf, das zum Dank für das Leben ihrer Tochter geschlachtet worden war.
Trotz ihrer Daunenjacken, Pick-ups und Handys orientieren sich die Wixárika an einer älteren, ursprünglicheren Logik, die auf Gegenseitigkeit und Opfern basiert. An einer Sonne, die nicht von Natur aus aufgeht. Einer Sonne, die angesungen werden will und der man danken muss.
Im Seitenfach ihrer Reisetasche stecken mehrere kleine Kürbisschalen, Xukuri, jede so groß wie der Handteller einer Erwachsenen. An den Innenseiten kleben Figuren aus Bienenwachs. Am Vortag hatten sie im Schatten einer strohgedeckten Hütte gesessen und die Figuren eigenhändig hergestellt. Auf Geheiß kneteten sie das Wachs zu einem Hirsch, zu einer Korngarbe, zu einzelnen Figuren, die für die Mitglieder ihrer Familie standen. Die Schriftstellerin war unzufrieden mit ihrem Werk. Ihre Figuren waren unsauber und undefiniert, der Hirsch wirkte einfach nur schief. Sie wusste ja nicht einmal genau, wie eine Korngarbe aussah. Aber sie gab sich Mühe, das Wachs zu formen und in den ausgehöhlten Kürbis zu drücken.
In ein paar Stunden werden sie beim weißen Fels angekommen sein und ihre Opfergaben aufs Wasser setzen.
In der Reisetasche ihres Mannes steckt eine mit einem blauen Band verzierte Kerze, die dritte von insgesamt dreien. Die erste haben sie vor einer Woche in der Wüste zurückgelassen und die zweite auf dem Gipfel des heiligen El Quemado. Die dritte und letzte werden sie dem Meer darbieten.
Der Van wird langsamer und biegt vom Highway auf eine Tankstelle ein. Jenseits der Zapfsäulen befindet sich ein Laden. Kein OXXO-Supermarkt, aber vielleicht haben sie ja Glück.
Ihr Mann hält neben einer der Säulen, beugt sich aus dem Fenster und bittet den Tankwart vollzumachen.
Der Mara’akame öffnet ein Auge und sieht den kahlen Betonplatz. Muy bonito, sagt er trocken und schließt das Auge wieder.
Auf einmal taucht ihr Mann neben ihr auf. Er beugt sich durch das geöffnete Fenster herein und zieht eine Grimasse für seine Tochter. Die Kleine blickt entzückt zu ihm auf, hebt die Hände und legt sie ihm an die Wangen.
Papa!
Zwischen ihnen ein flirrendes Kraftfeld aus körperlicher Nähe, als hätten sie einander seit Monaten oder Jahren nicht mehr gesehen.
Wie ist es hier hinten?, fragt er.
Heiß.
Ja. Hat die Klimaanlage geholfen?
Ein bisschen. Kannst du hierbleiben und auf sie aufpassen, damit ich Milch kaufen kann?
Klar.
Die Schriftstellerin wühlt in der Sitztasche, findet ihr Portemonnaie und klettert über Füße, Taschen und verstaubte Decken auf den Asphalt hinunter. Die Zapfsäulen und die Ölpfützen am Boden reflektieren das gleißende Sonnenlicht. Die Hitze durchdringt alles. Ihr Mann ist inzwischen zur Fahrerseite herumgekommen, und als er sich streckt, wird ein Teil seines Oberkörpers sichtbar. Ein bleicher Hautstreifen, der in seiner Jeans verschwindet. Er trägt Stiefel, ein Halstuch, ein schwarzes, besticktes Hemd, wie es zu einem Cowboy passen würde, eine Baseballkappe und eine ironische Sonnenbrille, die er unterwegs an einem Straßenstand gekauft hat. Ein lächerliches, unpraktisches, verspiegeltes Teil, wie es eine Frau in den Achtzigerjahren getragen haben könnte, aber irgendwie nimmt man ihm den Look ab.
Jetzt ist es nicht mehr weit, sagt er und unterdrückt ein Gähnen.
Ja. Brauchst du irgendwas?
Er zuckt mit den Schultern. Wasser?
Okay.
So reden sie inzwischen miteinander. Wie Figuren in einem Theaterstück: verknappt, ein bisschen gekünstelt, immer auf den Punkt.
Sie zögert. Früher hat sie ihm die Hände an die Wangen gelegt, oder um den Nacken. Auf die Haut, wo sein Oberkörper in der Jeans verschwindet. Früher küssten sie sich manchmal stundenlang. Seine Berührungen machten sie fast wahnsinnig. Inzwischen nicken sie einander zu wie entfernte, freundlich gestimmte Bekannte.
Sie läuft über die Tankstelle zu den Toiletten. Sie trägt immer noch dieselbe Kleidung wie am Lagerfeuer: wärmende Leggings, langer Rock, langärmeliges Thermounterhemd. In der Kabine schält sie sich zuerst aus der dicken Leggings, dann aus dem verschwitzten, statisch knisternden Unterhemd. Sie geht aufs Klo und wäscht sich die Hände. Ihr Gesicht in dem kleinen Spiegel wirkt verschreckt: misstrauische Augen, strähnige Haare, rissige, fast blutig aufgesprungene Lippen.
Aus dem Spender tropft ein kleiner, leuchtend grüner Seifenklecks. Wie immer muss sie beim Händewaschen an den britischen Premierminister denken, an sein Clownsgesicht, das sie daran erinnert, zweimal Happy Birthday zu singen. Weil sie eine gute Bürgerin ist, hält sie sich dran.
Als sie vor drei Tagen zuletzt WLAN hatten, schaffte sie es, die Schlagzeilen zu lesen. Was bei ihrer Abreise aus Mexico City vor einer Woche noch beherrschbar erschienen war, hatte sich rapide gewandelt. Leere Supermarktregale in England, in Italien überfüllte Intensivstationen. Toilettenpapier und Handdesinfektionsmittel waren in den meisten Geschäften ausverkauft, und der britische Premier trat vor die Nation und wies die Leute an, sich zwanzig Sekunden lang die Hände zu waschen — so lange, wie es dauert, zweimal Happy Birthday zu singen.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday to yo-ou. Happy Birthday to you.
Vor ein paar Monaten war sie fünfundvierzig geworden. Sie hatte mehr als die Hälfte ihres Lebens hinter sich.
Im besten Fall.
Aber diese Seuche, das neuartige Coronavirus, ist nicht der apokalyptische Reiter, mit dem die Schriftstellerin gerechnet hat.
Denn im vorletzten Sommer hatte sie während einer Hitzewelle den Aufsatz eines englischen Forschers gelesen, der noch für das laufende Jahrzehnt eisfreie arktische Sommer prognostizierte — und damit eine weltweite Lebensmittelknappheit und einen baldigen Zusammenbruch der Gesellschaftsordnung.
Kurz darauf hatte sie in einem YouTube-Video eine Frau mittleren Alters gesehen, die in ihrem Wohnzimmer saß und einen Vortrag mit dem Titel »Heading for Extinction and What to Do About It« hielt. Die Frau besaß einen Doktortitel in molekularer Biophysik und zählte seelenruhig die Fakten auf — dass es in der Luft mehr Kohlenstoff gab als je zuvor seit dem Perm, an dessen Ende siebenundneunzig Prozent des irdischen Lebens durch Schwefelwasserstoff ausgelöscht wurden. Die Erde steckt mitten im sechsten Massenaussterben ihrer Geschichte, und der Auslöschungsvorgang beschleunigt sich ständig. Die Regierung hat alle Vernunft fahren lassen und vor einer Lobby für fossile Brennstoffe und kurzfristige Gewinnmaximierung kapituliert. Die Frau sprach von Hedge-Fonds-Managern und CEOs großer Investmentfirmen, die ihren unterirdischen Bunkern den letzten Schliff verpassen und sich jetzt fragen, wie sie das Kommando über ihre Sicherheitskräfte behalten sollen, wenn das Geld nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft plötzlich wertlos wird.
Mit derselben Seelenruhe erklärte die Frau, die einzig logische Reaktion auf die kriminelle Untätigkeit der Regierungen sei der gewaltlose zivile Ungehorsam. Sie sprach von Aktionen, für die es Opfer zu bringen gebe. Von der Notwendigkeit, gute Vorfahren zu sein. Jetzt sei nicht Hoffnung gefragt, sondern Mut. Mut ist der feste Wille, ohne Aussicht auf ein Happy End das Richtige zu tun.
Sie sprach von den Suffragetten, von Gandhi und von Martin Luther King. Von der Bedeutung jener Menschen, die bereit sind, sich bei Massendemonstrationen und Störaktionen verhaften zu lassen und ins Gefängnis zu gehen.
Auf den wissenschaftlichen Aufsatz und das YouTube-Video hatte die Schriftstellerin genau so reagiert wie auf ihren Mann, als er ihr seine Seitensprünge beichtete: Ihr Atem ging flacher, und sie begann auf fast schon komische Weise zu hecheln. Ihre Handflächen wurden schweißnass. Sie meinte, sich selbst aus einer gewissen Entfernung zu sehen. Dieser Atem, diese Hände, dieser Körper — es fühlte sich an wie ein Schock und war zugleich eine Bestätigung dessen, was sie längst wusste.
Nacht für Nacht lag sie wach, folgte ihrem Twitter-Feed, las einen Artikel nach dem anderen und erfuhr, was bei einer Erderwärmung um zwei Grad, um drei Grad, um vier Grad passieren würde.
Am meisten erschreckte sie die Nichtlinearität des Ganzen, die Existenz feststehender Kipppunkte, ab denen die Welt sich mit verheerenden Folgen aufheizen und den Amazonas in eine Savanne verwandeln wird. Das weiße, lichtreflektierende Polareis — der Albedo-Effekt — geht zurück, während das dunkle Wasser immer mehr Kohlenstoff speichert. Alles wird verdreht und auf den Kopf gestellt, der Kohlenstoff erst gebunden und dann in die Welt gespritzt.
Sie und ihre Tochter gingen auf den staubigen Landstraßen rund um das Dorf spazieren und sammelten Brombeeren. Sie brachte dem Kind bei zu benennen, was es sah: Weißdorn, Haselstrauch, Kastanie, Amsel, Eiche.
Sie besuchte die Eltern-Kind-Gruppe und schaute zu, wie ihre Tochter und die anderen Kinder den Jahreszeiten mit Bastelarbeiten huldigten und sie im Liedkreis besangen, doch in ihr tobte ein Kampf um die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Bald würde es keine Jahreszeiten mehr geben, kein Pflanzen, Blühen, Gedeihen und keine Ernte, keinen Rhythmus, an dem die Menschheit sich seit über elftausend Jahren orientierte, seit der Eisschmelze zu Beginn des Holozäns.
Wir brauchen neue Geschichten, sagten die Leute, neue Erzählungen, die uns einen Ausweg aus dem Chaos weisen.
Aber als der Sommer immer heißer und aus dem Herbst ein Winter wurde und die erschreckenden Nachrichten einfach nicht mehr abrissen (anscheinend waren die Insekten von den Windschutzscheiben genauso verschwunden wie aus den Wäldern, ganze fünfundsiebzig Prozent davon, ohne dass irgendwer dafür eine Erklärung hätte), fiel der Schriftstellerin, wenn sie nachts wach lag, nur noch eine Sorte von Geschichten ein, nämlich Horrorgeschichten. Immer wieder musste sie an diese eine Szene in Cormac McCarthys Die Straße denken, in der die Mutter begreift, dass sie zu schwach ist und sich mit einem Obsidiansplitter umbringt.
Weil der Papierspender leer ist, trocknet sie sich die Hände am Rock und tritt dann wieder ins Freie. Während sie über die Tankstelle zum Laden geht, schirmt sie sich die Augen mit einer Hand ab.
Der Schriftstellerin ist klar, dass sie und ihr Mann heute oder morgen — sobald sie die Reise geschafft, etwas gegessen und geschlafen haben — die Laptops aufklappen und sich einen Überblick über die Lage verschaffen müssen. Sie werden Entscheidungen treffen und Fluggesellschaften kontaktieren müssen, die sie nach Hause zurückbringen werden oder auch nicht. Falls es ihnen gelingt, sich einen Platz im Flieger zu sichern, werden sie Mexiko verlassen und ins graue England zurückkehren, wo sie ein trostloser Frühling, leere Regale und womöglich der Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung erwarten.
In den Kühlregalen kann sie keine Milch entdecken, weder aus Hafer oder Mandel noch von einer Kuh, stattdessen nur Wasser und Bier. Sie nimmt die größte Wasserflasche heraus und bezahlt am Tresen.
An einem Tag im vergangenen April, als es selbst im Schatten fünfundzwanzig Grad warm war, hatte die Schriftstellerin zusammen mit mehreren tausend anderen Menschen den Oxford Circus im Zentrum Londons besetzt. Sie hatte ganz vorn gesessen, neben einem rosafarbenen Boot, benannt nach einer ermordeten Aktivistin aus Honduras. Vier Beamte der Metropolitan Police waren an sie herangetreten und hatten ihr erklärt, sie verstoße gegen Abschnitt vierzehn des Public Order Act. Sie wurde aufgefordert, den Platz zu verlassen, und als sie der Bitte nicht nachkam, beugten die Beamten sich herunter, zwei über ihre Arme und zwei über die Beine, und trugen sie fort.
Sie wurde auf eine Wache in der Nähe der Victoria Station gebracht und musste die Nacht in einer Zelle verbringen, wo sie die unter die Decke gesprühte Nummer einer Drogenberatungsstelle anstarrte. Alle halbe Stunde kam jemand an die Tür und sah nach ihr. Sie bekam eine Decke und in der Mikrowelle aufgewärmte Kartoffeln mit Bohnen.
In jenen Apriltagen waren über tausend Demonstranten verhaftet worden. Im Herbst stand sie zusammen mit zwei anderen Frauen vor Gericht, einer Großmutter aus Swansea und einer Gärtnerin aus Oswestry. Die Großmutter saß auf der Anklagebank und weinte. Die Gärtnerin sagte aus, sie bekomme die Auswirkungen des Klimawandels jeden Tag bei der Arbeit zu sehen; außerdem habe sie zwei erwachsene Töchter, die sich weigerten, Kinder in diese Welt zu setzen. Die Veränderungen, riesengroß im Verhältnis zu ihrem eigenen, kleinen Leben, brachen ihr das Herz.
Die Schriftstellerin hatte ihr bestes Kleid angezogen und auf nicht schuldig plädiert. Sie sagte, ihr Verhalten sei der Bedrohungslage angemessen gewesen. Sie erklärte dem Richter, sie habe es für ihre Tochter getan. Dafür, dass es für ihr Kind überhaupt noch eine Welt gibt.
Während sie auf der Anklagebank saß, wurde ihr bewusst, dass der ganze Vorgang etwas von einer Performance oder von einem Theaterstück hatte. Die Gerichtsschreiberin, eine Frau Mitte fünfzig, brach in Tränen aus. Der Richter hörte die Schriftstellerin an, nickte und verurteilte sie anschließend zu einer Geldstrafe. Als sie den Saal verließ, hatte sie das berauschende, schwindelerregende Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.
Aber manchmal hatte die Schriftstellerin eine andere Sorte Gericht vor Augen, ein Zukunftsgericht der Generationen, wo sich ihr Jahrgang für Verbrechen gegen die Zukunft verantworten muss und sie sich abermals auf der Anklagebank wiederfindet.
Was haben Sie getan, als Sie realisierten, dass die Welt in Flammen steht?
Ich habe demonstriert. Ich wurde verhaftet und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.
Und warum haben Sie demonstriert?
Ich habe es für meine Tochter getan. Sie soll eine Zukunft haben. Ich hatte keine andere Möglichkeit.
Keine andere Möglichkeit?
Um auf das Ausmaß der Bedrohung aufmerksam zu machen.
Und dann?
Dann bin ich Langstrecke nach Mexiko geflogen.
Verstehe. Können Sie das begründen?
Ich wollte mich bedanken und ein Opfer bringen. Ich wollte für meine Tochter um Schutz bitten, außerdem habe ich für ein Buch recherchiert.
Und dafür mussten Sie um die halbe Welt fliegen? Um zehn Kilometer über dem Meeresspiegel an einem Lagerfeuer zu sitzen und die Knochen eines tierischen Vorfahren Ihrer Tochter in die Flammen zu werfen?
Sie bezahlt das Wasser und geht zurück zum Van. Im Tank Dinosaurierknochen aus einer Wüste in Syrien oder Kuwait oder von einem Ölfeld in Venezuela.
Ungefähr zu der Zeit, als sie verhaftet wurde, fragte eine führende Schwarze Aktivistin in einem Tweet, ob die Leute in den Zellen sich wohl ebenso bereitwillig hätten festnehmen lassen, wenn ein Polizeigewahrsam in ihrer Geschichte zumeist tödlich geendet hätte.
Die Schriftstellerin hatte es gelesen und sich sofort in der Defensive gefühlt. Genau das war doch die Absicht dahinter gewesen — weiße Menschen aus der Mittelschicht, Großmütter und Pfarrer, Ärzte und Rabbiner, machten von ihren Privilegien Gebrauch, indem sie sich verhaften ließen.
Aber inzwischen ist sie sich nicht mehr so sicher, oder wenigstens ist sie sich mehr und mehr des eigenen Wunsches bewusst, selbst ein Teil der Geschichte sein zu wollen und irgendwie den Planeten zu retten.
Sie weiß ganz genau, dass sie dort in der Zelle nur eine Touristin war.
Manchmal beschleicht sie das Gefühl, in einer Escher-haften Umgebung festzusitzen. Jeder Schritt wird neue Komplikationen, neue Täuschungen, neue Konsequenzen nach sich ziehen.
Wäre es denn besser, gar nichts zu tun?
Fertig?, fragt ihr Mann.
Ja.
Sie klettert zurück auf ihren Sitz. Ihre Tochter sieht sie erwartungsvoll an und fragt: Milch?
Nein, keine Milch. Nur Wasser, mein Schatz.
Ihre Tochter verzieht das gerötete Gesicht. Ich. Will. Milch!!
Mäuschen, es tut mir leid, aber die hatten keine Milch.
ICH. WILL. MILCH!
Es tut mir leid. Ich habe … Wir sind fast da, versprochen. Du musst einfach noch ein bisschen durchhalten. Bitte.
Ihr Mann lässt den Motor an und die Musik setzt vorne wieder ein, offenbar eine Playlist des Kolumbianers. Cuuumbiaaaa!
Sie füllt etwas Wasser in die Trinkflasche. Das Kind nimmt einen Schluck und stößt die Flasche von sich weg. Die Schriftstellerin öffnet den Laptop und setzt ihrer Tochter die Kopfhörer auf. Die Superheldenkinder springen über die Dächer. Diesmal singt ihre Tochter nicht mit.
Als sie wieder auf dem Highway sind, lässt sie die Seitenscheibe herunter, und sofort knallt der Fahrtwind herein. Draußen ist statt der roten Erde auch Gebüsch zu sehen. Feiner Sandstaub. Hohe Palmen. Nun ist es nicht mehr weit. Auf einmal sind alle wach: die drei Männer auf der Fahrerbank, dahinter die Französin und die Deutsche; die Senegalesin, deren Tochter gurrend an einem Orangenstückchen nuckelt, der Mara’akame und die beiden Männer ganz hinten. Jemand dreht die Musik lauter. Sie alle können es spüren — das Ozon, das Meer, das nahende Ende der Reise.
Plötzlich haben ihre Handys wieder Empfang, Nachrichten trudeln ein. Mit verkniffenem Gesicht beugen sie sich über die Geräte. Die Senegalesin hört eine lange Sprachnachricht von einer Frau ab, ihrer Mutter vielleicht.
Sie tauschen sich über die Meldungen aus ihren jeweiligen Newsfeeds aus. Die WHO hat Corona zur Pandemie erklärt, Trump den nationalen Notstand ausgerufen.
Angeblich sollen Grenzen dichtgemacht werden, und nun fragen sie sich nervös, welche wohl betroffen sind.
Was, wundert die Schriftstellerin sich, wäre passiert, wenn alles zusammengebrochen wäre, während sie dort oben in der Sierra Madre waren, kilometerweit von der nächsten Stadt und dem nächsten WLAN entfernt? Wie in einem dieser Zombie-Filme, wo das Virus binnen Stunden die Welt verwüstet und nur ein paar wenige Inseln menschlichen Lebens übrig bleiben, von denen aus es gilt, die Erde neu zu bevölkern. Wie hätten sie sich geschlagen?
In Gedanken legt sie eine Rangliste an — das Apokalypse-Quartett. Der Mexikaner käme prima klar — er kann Tiere schlachten und ganz generell mit einem Messer umgehen. Die anderen Männer sind weniger geschickt. Einige von ihnen haben eine Machete dabei, wissen aber nicht, wie man sie richtig benutzt; im Grunde handelt es sich bloß um Requisiten. Die Schriftstellerin würde auf die Senegalesin setzen. Sie kann auf Holzkohlefeuer kochen und aus kargen Resten eine Mahlzeit zusammenstellen. Sie schläft auf einer Decke am Boden. Ihr Kind ist stets sauber. Sie würde immer eine Lösung finden und jede Aufgabe meistern. Sich selbst sieht die Schriftstellerin eher unten auf der Liste. Ihr Wunsch nach Alleinsein. Ihre überwältigende, lähmende Bequemlichkeit, ihr Wunsch nach einem weichen Bett. Abgesehen davon sind Schriftstellerinnen im Krisenfall wirklich nicht gefragt.
Ihr Ehemann würde sich wahrscheinlich ganz gut machen.
Sie hat sich schon oft überlegt, dass ihr Ehemann mit seinen kräftigen, zupackenden Händen und seiner angeborenen Sorglosigkeit im Fall einer Seuche, eines Brandes oder einer Überschwemmung der ideale Begleiter wäre. Als sie während des vergangenen Jahres immer wieder von Zukunftsängsten überwältigt wurde, ist sie oft in sein Arbeitszimmer gegangen und hat sich dort auf den Boden gesetzt.
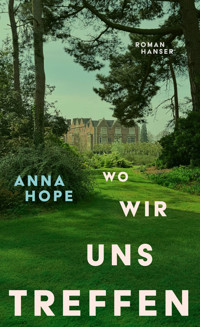
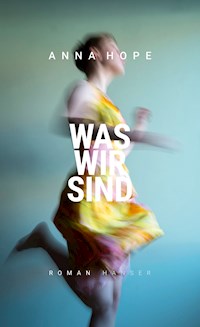
![Wo wir uns treffen [ungekürzt] - Anna Hope - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0bdcb599c9c03b46dc2b2dbc39b0f017/w200_u90.jpg)
![Was wir sind [ungekürzt] - Anna Hope - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3bb8d8a70d2cebce7280ac9ef325a2fc/w200_u90.jpg)

























