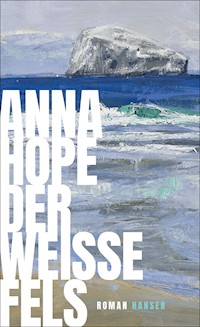Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Geschwister, ein großes Erbe und ein zweifelhaftes Vermächtnis – eine packende Familiengeschichte von Anna Hope Als der Egomane Philip Brooke stirbt, kommen seine Kinder Frannie, Milo und Isa für fünf Tage auf dem gewaltigen Familienanwesen in Sussex zusammen. Haupterbin Frannie hat hier vor Jahren die Führung übernommen. Sie will die Ländereien renaturieren und für ihre siebenjährige Tochter eine Zukunft schaffen. Doch der unstete Milo hat andere Pläne – und den Segen seines Vaters dafür. Isa kämpft gegen innere Dämonen, sie hat die Tochter von Philips langjähriger Geliebter zur Beerdigung eingeladen. Und die kennt das wahre Erbe der Brookes aus den Zeiten des Empire. "Wo wir uns treffen" ist ein meisterlich komponierter Familienroman über die Beziehungen, die uns für immer prägen, über ererbten Besitz und historische Verantwortung – feinsinnig, klug und packend bis zum Schluss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Als der Egomane Philip Brooke stirbt, kommen seine Kinder Frannie, Milo und Isa für fünf Tage auf dem gewaltigen Familienanwesen in Sussex zusammen. Haupterbin Frannie hat hier vor Jahren die Führung übernommen. Sie will die Ländereien renaturieren und für ihre siebenjährige Tochter eine Zukunft schaffen. Doch der unstete Milo hat andere Pläne — und den Segen seines Vaters dafür. Isa kämpft gegen innere Dämonen, sie hat die Tochter von Philips langjähriger Geliebter zur Beerdigung eingeladen. Und die kennt das wahre Erbe der Brookes aus den Zeiten des Empire. »Wo wir uns treffen« ist ein meisterlich komponierter Familienroman über die Beziehungen, die uns für immer prägen, über ererbten Besitz und historische Verantwortung — feinsinnig, klug und packend bis zum Schluss.
Anna Hope
Wo wir uns treffen
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer
Hanser
Das englische Landhaus —
es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt.
Vita Sackville-West
Tag eins
ES IST KURZ VOR Tagesanbruch. Frannie liegt in der Dunkelheit des Schlafzimmers, neben ihr im Bett Rowan. Irgendetwas hat sie geweckt. Vielleicht der Wind, der die Richtung gewechselt hat und raschelnd durch die neuen Blätter gefahren ist, vielleicht Rowan, die sich im Schlaf bewegt hat. Ihre Tochter, die jetzt fest schläft, der Atem ruhig und regelmäßig, die Arme auf der Matratze ausgestreckt, die in der Nacht aber wieder über den Treppenabsatz gekommen ist, von einem Albtraum aufgeschreckt, weinend und voller Angst. Frannie sieht auf ihr Handy — fast vier Uhr. Ihr Schlaf ist vorbei, da ist sie sich sicher, und so gleitet sie aus dem Bett und tastet nach dem Kleiderhaufen von gestern Nacht — eine Jeans und ein alter Hoodie.
Rowan rührt sich nicht, als sich Frannie auf dem Bettrand die Kleider überstreift und dann auf Zehenspitzen durchs Zimmer schleicht, vorsichtig zwischen den noch unausgepackten Kartons, den Koffern und den Bilderrahmen hindurch, die stapelweise an der Wand lehnen, und hinaus auf den Treppenabsatz. Leise schließt sie die Tür hinter sich und geht die Treppe hinunter, den hinteren Flur entlang zur Stiefelkammer, wo sie Arbeitsjacke und Mütze anzieht, ihre Gummistiefel im Dunklen findet und hineinschlüpft.
Draußen, im Schatten des massigen Hauses, ist es kalt, und Frannies Atem bildet Wolken in der stillen Luft. Über ihr ist der Himmel marineblau, im Westen steht tief ein gelber Mond. Sie nimmt den Pfad durch den Küchengarten, dann öffnet sie das Riegeltor und tritt hinaus in den Park. Gen Süden, in der Talsohle, hat sich Nebel über den Fluss und den von ihm gespeisten See gebreitet, er klammert sich geradezu an das büschelige Gras am Rand des Wassers. Sie zögert, unsicher, welche Richtung sie einschlagen soll, und geht dann weiter den Hügel hinauf, durch die langen Gräser — die Rispen schwer von Tau, verklumpt mit Dung und Blumen und Kuckucksspeichel, voller Disteln und Ampfer und Kreuzkraut. Ihre Jeans ist über dem Rand der Gummistiefel jetzt feucht, ihr Atem vertieft sich, die Arme schwingen locker, sie geht in Richtung Westen. Setzt vorsichtig ihre Schritte. Es ist Mai, und häufig nisten Vögel an den Pfaden: Heidelerchen, Feldlerchen. Manchmal schlafen auch Kühe dort. Zwei ihrer Longhorn-Rinder stehen kurz vor dem Kalben, und nicht selten trifft man zu dieser Zeit des Jahres auf eine Mutter und ihr neugeborenes Junges, die in einem Flecken flach gedrückten Grases beieinanderliegen.
Der Boden unter ihren Stiefeln ist hart. Den ganzen April hindurch hat es kaum geregnet, die Erde hebt und senkt sich in tiefen Furchen und Rillen, zu Beginn des Jahres durchwühlt von den Schweinen, die im lehmigen Erdreich nach Pflanzen und Insekten suchten. Im Augenblick aber halten sich die Schweine etwas weiter oben auf; sie lehnen sich gern an die Stämme der alten Eichen am Rand von Neds Wald. Im Herbst gibt es dort die meisten Eicheln, und sogar jetzt, im späten Frühjahr, sind noch welche zu finden. Sie weiß, dass sich die Tiere, gesellig, wie sie sind, im Schlaf aneinanderbuckeln, in eine Mulde im Boden geschmiegt.
Sie schickt ein rasches Gebet zum Himmel, dass auch ihre Tochter ungestört weiterschlafen möge, während sie hinaufsteigt, auf die alte hohle Eiche zu, die den Hügelkamm bewacht. Über ihr kommt der Umriss des Stamms gerade in Sicht, altersgebeugt und eingesunken wie eine Girlande. Beim Erklimmen des Hügels bleibt sie kurz stehen, um Atem zu schöpfen. Unter ihr steigt der Nebel nach oben und enthüllt die Biegung des Flusses; das Mondlicht liegt silbrig auf dem Wasser und auf dem Dach und den Kaminen des Hauses. Von hier aus wirkt das Haus, das sich an den Hang des Tals schmiegt, beinahe bescheiden.
Sie lehnt sich an den Stamm der Eiche, die knorrige Rinde ist durch den Stoff ihrer Kleidung zu spüren. Wie alt? Unmöglich zu sagen. Da das Kernholz von Pilzen und Käfern zerfressen ist, kann man die Ringe nicht zählen, doch die Eiche taucht als bereits dickstämmiger Baum im Porträt ihres Ahnen in der Bibliothek auf — gemalt beim Bau des Hauses vor zweihundertvierzig Jahren.
Ihr Vater sagte immer, der Baum sei mindestens vierhundert Jahre alt. Er habe über das Tal gewacht, als die Eisenschmiede vom eingedämmten Fluss, vom Hammer Pond, betrieben wurde. Er sei da gewesen, als ihr Ahne das Haus errichtete, zwanzig Zimmer aus Sussex-Sandstein, aus einem Steinbruch, nur etwas mehr als einen Kilometer von hier entfernt, Ablagerungen desselben Flusses, den sie jetzt unter sich sieht: Millionen Jahre Fels, Schicht für Schicht für Schicht. Der Baum sei Zeuge gewesen, wie das Land von Brooke zu Brooke weitergegeben wurde, über sieben Generationen hinweg. Und jetzt gehört alles ihr — schwindelerregender Gedanke —, dieses Haus, dieses Tal, dieser Baum, dieses Land; über vierhundert Hektar davon. In zwei Tagen werden sie ihren Vater beerdigen. Irgendwie ist es immer noch schwer zu glauben, dass er nicht mehr da ist.
Plötzlich eine Bewegung, ein kleines Zucken zu ihrer Rechten. Ein Rudel Damhirsche taucht hinter einem Dornengestrüpp auf. Ihr Tritt ist leicht, beinahe lautlos. Frannie wird ganz still, noch stiller, um die Tiere nicht zu stören, sie macht ihren Atem dünn und spärlich, unsichtbar in der kalten Luft, aber sie wittern sie, spüren sie und blicken alle auf einmal in ihre Richtung. Sie weiß, dass sie sie kennen, ihre Gestalt, ihre Absicht, dass ihre Fluchtdistanz bei ihr geringer ist als bei anderen, und doch: Als sie da stehen und einander in der annähernden Dunkelheit betrachten — Damhirsch und Frau, Frau und Damhirsch —, fangen die wilden Tiere an zu laufen.
Frannie sieht ihnen zu, ihres Atems beraubt, und ein Teil von ihr läuft mit ihnen: Ihr Herz fliegt, während sie weiter den Hügel hinaufstürmen zum alten Forstland hin. Sie sehnt sich danach, ihnen zu folgen, obwohl sie weiß, dass sie umkehren sollte — sie ist weit weg von ihrem Bett, und ihre Tochter hat in letzter Zeit nicht gut geschlafen; Rowan wird außer sich sein, wenn sie aufwacht und allein ist. Aber es ist schön hier draußen, die kalte Luft in der Lunge zu spüren — und überhaupt: Wie lange ist sie schon nicht mehr so spazieren gegangen, allein? Seit einiger Zeit fällt es ihr schwer, richtig zu atmen. Tief zu atmen.
Also dreht sie sich um und folgt dem Pfad des Wilds. Das Haus liegt hinter ihr, seinem Schlummer überlassen, während sie die alte Nadelbaumpflanzung betritt. Hier, im Gewirr des Dornengestrüpps und der jungen Birken, huschen ungesehene Tiere vor ihren Schritten davon. Die Gerüche sind anders, die Erde atmet den Duft verrottenden Bärlauchs, von Hasenglöckchen und welkem Laub aus, dazu der salzige Geruch des frühen Adlerfarns, der schon hüfthoch steht und schnell wächst.
Dann bleibt sie stehen — denn da ist der Gesang eines Vogels, getragen von der stillen Luft. Es regt sich keine Brise, und leicht schwebt der Gesang dahin. Zuerst denkt sie, es sei ein Rotkehlchen oder eine Amsel, die Ersten, die bei Tagesanbruch singen, doch es ist noch immer dunkel und der Gesang klingt fremder, fließender. Ihr Herz schlägt schneller, während sie lauscht: Es ist eine Nachtigall. So muss es sein. Kein anderer Vogel singt in der Dunkelheit. Kein anderer Vogel singt so vor Tagesanbruch. Sie geht weiter, der durchdringende Gesang zieht sie durch die Dunkelheit zu sich.
Der Vogel sitzt ganz oben auf einem Schwarzdornstrauch und ist gerade sichtbar — eine kleine braune Gestalt, die sich gegen den Himmel abzeichnet, rotkehlchengroß. Frannie schließt die Augen, atmet ein, während das Lied die Luft zu seltsamen Formen schnitzt. Sie weiß, wie weit der Vogel geflogen sein wird, um hier zu singen — Tausende von Kilometern von der Westküste Afrikas aus: die Sahara, Portugal, Spanien, Frankreich; die dunklen Gewässer zwischen dort und hier, wo man nirgends anhalten und nirgends rasten kann, nachts reisen, allein, dieselbe Route, die seine Vorfahren jahrtausendelang geflogen sind, seit das Eis schmolz und die Erde sich erwärmte. Tausende von Kilometern, um hier zu nisten, in ihrem Wald. Sie weiß, der Vogel wird das innen hohle Schwarzdorngewirr der Sicherheit vor Beutegreifern wegen gewählt haben, vor Rabenvögeln und Hermelinen und Wieseln. Sie weiß auch, dass sie mit der Geschichte dieses Vogels verflochten ist: Denn hätte sie nicht die Nadelbäume gefällt, hätte sie nicht das Licht auf diesen Boden fallen lassen, dann wären die Weiden- und Dornensträucher nicht gewachsen. Diese Zufluchten, die einem kleinen braunen Vogel jetzt Sicherheit gewähren — einem Vogel so gefährdet in diesem Land, dass sie seine Brutstätten hier an den Fingern ihrer Hände abzählen kann.
Frannie lauscht seinem Gesang, ist von sanfter Hochstimmung erfüllt, als der Vogel sein Lied in den Himmel gießt. Sie weiß nicht, wie lange sie da steht — die Zeit steht still, sie selbst wird immer dünner, während ihre Sinne sich weiten. Und obwohl sie ihre Namen kennt — Schwarzdorn, Weißdorn, Salweide —, sind die Dornbüsche, die sie umgeben, jetzt mythisch im Mondenschein, große, bucklige Wesen, die schlafen und jederzeit geweckt werden können. Und sie, die noch vor Minuten eine Frau, eine Mutter, eine trauernde Tochter gewesen ist, ist etwas anderes — ein Tier, nicht mehr, nicht weniger.
Und während sich der Himmel erhellt und die Sonne aufzugehen beginnt, stimmen andere in den Gesang der Nachtigall ein, Amsel und Rotkehlchen, Buchfink und Zilpzalp und Zaunkönig, Ringeltaube und Aaskrähe und Saatkrähe und Eichelhäher, alle Vögel — sie singen und schicken ihr Lied in die klingende Morgendämmerung.
*
Grace steht am Fenster, die Hände am schweren Vorhang, und sieht nach draußen. Momentan fällt es ihr schwer, morgens zu schlafen, die frühen Sonnenaufgänge, das viele Licht. Die Helligkeit hat sie geweckt, zusammen mit den Vögeln.
Es ist drei Wochen her, seit er gestorben ist. Zwei Tage, bis sie ihn beerdigen. Vier weitere Tage noch in diesem Haus, dann — nicht mehr.
Wie viele Nächte hat sie hier verbracht? Sie versucht, es auszurechnen, es gelingt ihr nicht, aber es müssen Tausende gewesen sein: Sie kam vor fast fünfzig Jahren zum ersten Mal hierher, da war sie einundzwanzig und schrecklich jung, jetzt ist sie siebzig und schrecklich alt. Wenngleich sie sich nicht so fühlt, wie sie hier in dieser zitronenfarbenen Morgendämmerung steht.
Wie viele Morgen also, mit diesem Blick auf die Parklandschaft, die zum See hin abfällt, das Glitzern des Flusses, der ihn speist, das frische Grün der Baumwipfel in Neds Wald. Die gedrungene normannische Kirche im Tal darunter. Fünfzig Jahre an Morgen. Am allerersten von ihnen, an dem Morgen, nachdem Philip sie geküsst und Anspruch auf sie erhoben hatte, hatte sie an genau diesem Fenster gestanden. Von den Feldern unten war Nebel aufgestiegen, und sie hatte die Zelte der Festivalbesucher sehen können, Menschen, die umherliefen, bloße Umrisse von hier oben aus, mit Decken über den Schultern, wie Kriegsüberlebende oder eine Armee kurz vor der Schlacht. Das hätte hundert Jahre her sein können, fünfhundert. Siebenhundert. Und als sie hier gestanden hatte, hoch oben, einundzwanzig Jahre alt, benommen vor lauter Schlafmangel und schwindlig von der Spur von Philips Lippen auf den ihren, hatte Grace sich gefühlt, als hätte sie jemand aus Schlamm und Schlacht geborgen und in die Höhe getragen, zu diesem Horst, zu dieser Aussicht.
Was würde sie nun zu ihm sagen, könnte sie sich zum Geist ihres einundzwanzig Jahre alten Ich wenden, hier neben ihr, nach draußen blickend?
Lauf.
Dreh dich um und lauf um dein Leben.
Nun. Es ist vorbei. Er ist tot. Und bald, in sehr wenigen Tagen, wird sie dieses Haus verlassen und in Frannies Cottage auf der anderen Seite des Parks ziehen: vier Nächte noch, dann ist sie weg. Dort, wo die Dielen breit und von unten beheizt sind. Wo die Küche modern und geräumig und warm ist. Der Gedanke daran ist so tröstlich, dass sie singen könnte. Nie wieder wird sie sich gegen diese unebenen Dielen wappnen oder unter den Demütigungen der edwardianischen Sanitäreinrichtungen leiden müssen. Nie wieder in Wollschichten und schlecht geheizten Räumen durch den Winter frieren. Und nie, nie wieder wird sie den Blick von Philips Großmutter ertragen müssen.
Grace tritt zwei Schritte vom Fenster zurück. Da ist sie, die Frau höchstpersönlich, ihr Mann an der Wand auf der anderen Seite des Fensters, zwei Kohleporträts, als Skizze 1914 von Sargent angefertigt. Er in seiner Uniform als Captain, sie mit dieser wundervollen Haarpracht aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, hochgesteckt, frisiert und mit einem Band zusammengehalten — und mit dem Blick der ewigen Hochmütigkeit der herrschenden Klasse, dem Ausdruck, der Grace fünfzig Jahre lang sagte: Ich kenne dich, ich kenne dein weiches, spießiges, kleines Herz. Niemals stählern genug, um diese Aussicht zu verdienen.
Was würde sie sagen, die Frau in dem Porträt, würde man sie zum Park drehen? Grace wünscht sich, sie hätte seine Verwandlung noch erlebt — wie gerne hätte sie den Ausdruck auf ihrem Gesicht gesehen. Der Park mit seinen wühlenden Schweinen und robusten, kleinen Ponys, mit Kühen, die gern auch mal direkt vor den Säulenvorbau scheißen, die kniehohen Gräser, die verwahrlosten Ränder und das ganze wuchernde, sich selbst überlassene Unkraut.
Einmal — Grace weiß nicht mehr genau, wann, aber es war eines der vielen, vielen Male gewesen, als Philip weg gewesen war, um eine seiner Frauen in London zu vögeln —, da hatte sie sie abgenommen, beide Porträts, Großvater und Großmutter, weil sie es nicht mehr ertragen hatte, in ihrer Einsamkeit und ihrem Elend von ihnen gesehen zu werden und sie im Wohnzimmer mit den Gesichtern zur Wand hinter das Klavier gestellt. Als Philip zurückkam und ihre Abwesenheit bemerkte, wurde er wütender, als sie ihn je gesehen hatte. Ob sie irgendeine Vorstellung davon hatte, wie viel sie wert waren? Wie sehr er sie schätzte? Sie waren alles, was er hatte. Sie sagte ihm damals nicht, dass seine wirkliche Großmutter, die echte Frau vom Porträt, noch immer am Leben war, in einem Pflegeheim an der A 24 — allerdings mittlerweile völlig verrückt —, und nach ihrem verlorenen Ehemann in seiner Captain-Uniform rief, auch wenn dieser Ehemann mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor in Nordfrankreich in Stücke gerissen worden war. Grace sagte auch nicht, dass er, wenn er sie doch so sehr schätzte, diese seine Großmutter, vielleicht ja besuchen, ihr Blumen mitbringen, sie in ihren wirren Gedanken trösten, ihre Hand halten könnte? Stattdessen sagte sie nichts, richtete sich auf, ging langsam die flachen Treppenstufen hinunter, nahm die Porträts und hängte sie wieder auf. Sie fasste sie nie wieder an.
Trauma.
Ein Wort, das die Generationen nach ihr anscheinend sehr mögen. Sie könnte von ihrem eigenen Trauma sprechen. Aber sie hat die Würde gewahrt. Sie ist so erzogen worden.
Und jetzt ist sie da, mit dieser Leichtigkeit, dieser Belebung, an diesem heiteren Morgen im Mai.
Darf sie sich heiter fühlen?
Vielleicht.
Sie hebt den Fensterriegel, stößt das Fenster auf und atmet die Morgenluft ein. Sie weiß, dass sie versuchen muss, sie zu verbergen, diese Leichtigkeit, die sie mit sich zu reißen droht — denn es ist unschicklich, das weiß sie, sich so leicht zu fühlen, so frei, in einer Woche wie dieser.
Sie hat sich angeboten, heute das Abendessen zu machen, nur sie und die Kinder. Nur etwas Leichtes. Etwas Einfaches, draußen serviert — in letzter Zeit ist das Wetter für die Jahreszeit wirklich ungewöhnlich warm. Also ja: Salat aus dem Gewächshaus, Wurstwaren vom Anwesen. Sie will eine wunderbare Mahlzeit für ihre Kinder zubereiten, bevor das Wochenende beginnt. Sie will es mit Geschäftigkeit kaschieren, dieses Gefühl. Sich selbst mit Aufgaben anleinen, damit sie nicht davonschwebt.
*
Rowan wacht schreiend auf.
Sie weiß zuerst nicht, dass sie es war, die geschrien hat, da ist nur das Geräusch und Dunkelheit. Sie setzt sich auf, ihr Herz rast, sie weiß wieder, wo sie ist und wo nicht; sie ist nicht zu Hause im Cottage, nicht in ihrem Zimmer. Sie ist im großen Haus, wo sich die Schatten bis in die schwarze Weite jenseits des Bettrandes hinaus ausdehnen. »Mami?« Sie streckt die Arme aus, aber ihre Mutter ist nicht da.
»Mam?«, ruft sie.
Jetzt richtet sie sich auf und brüllt: »Maaaam!!!!«
Geräusche vom Treppenabsatz, das Öffnen und Schließen einer Tür, Schritte, die näher kommen. Licht ergießt sich ins Zimmer, aber es ist nicht ihre Mutter, die das Zimmer betritt. »Was ist denn, Rowan?«, fragt ihre Großmutter. »Was ist denn los, um Himmels willen?«
»Ich hatte einen schlimmen Traum.« Sie schaudert. »Einen Albtraum. Ich hab nach Mam geschrien und geschrien, aber sie ist nicht gekommen.«
»Ach, du meine Güte.« Ihre Großmutter macht das große Licht an, Rowan blinzelt. »Was für ein Theater.«
Rowans Herz klopft noch immer wild, macht sie Theater? Sie hat nicht beschlossen zu schreien — es ist einfach passiert. »Wo ist Mam?«, fragt sie noch einmal, lauter, weinerlicher. »Warum hat sie mich allein gelassen?«
»Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist sie draußen und arbeitet. Also …« Ihre Großmutter bindet einen Knoten in den Gürtel ihres Morgenmantels und setzt sich dann zu ihr aufs Bett. »Erzählst du mir, wovon du geträumt hast?«
Rowan verzieht das Gesicht, als sie sich daran erinnert. »Von Opa.«
»Was ist mit Opa?«
»Er war tot. Aber er hat auch gelebt. Er war in seinem Sarg und konnte nicht raus. Und ich war Opa, ich war er und hab geschrien. Aber dann hab ich mich in etwas Flüssiges verwandelt, und da waren Fliegen in meinem Mund. Und dann war ich wach und hab auch geschrien.«
»Du lieber Himmel«, sagt Oma Grace. »Das klingt nicht sehr schön.«
»Das war’s auch nicht. Das war es wirklich, wirklich nicht.« Sie kann die Fliegen immer noch spüren — wie schrecklich sie sich angefühlt haben in ihrem ganzen Mund.
»Nun, das war nur ein Traum. Ich bin mir sicher, dass deine Mutter bald zurückkommt. Und ich bin hier, gleich am anderen Ende des Flurs. Also warum kuschelst du dich nicht noch mal ein und versuchst, wieder zu schlafen?«
»Nein«, entgegnet Rowan heftig.
»Warum nicht?«
»Ich hab Angst.«
»Wovor?«
»Vor meinem Traum. Und vor der Dunkelheit. Und vor diesem Haus. Es ist gruselig. Ich mag es nicht.«
»Ach so … Aber du wirst es mögen, ganz sicher«, erwidert Oma Grace. »So etwas braucht Zeit.«
»Ich werde es nie mögen«, insistiert Rowan. »Ich werde es immer hassen.«
»Himmel. Wie kannst du da so sicher sein?«
»Du magst es ja auch nicht. Und du wohnst hier schon so lange.«
»Ich mag es auch nicht? Warum denkst du das?«
»Na, wenn du es wirklich mögen würdest«, gibt Rowan langsam zurück, »dann würdest du nicht unser Haus wollen.« Da fällt ihr plötzlich etwas ein, etwas ganz Einfaches, seltsam, dass es ihr erst jetzt einfällt. »Können wir unser Haus zurückhaben? Wenn du das hier noch magst?«
»Äh …« Grace streicht die Bettdecke glatt mit ihren dünnen Händen. »Nein, leider nicht.«
»Warum nicht?«
»Nun ja … aus vielen Gründen.«
»Zum Beispiel?«
Ihre Großmutter seufzt, steht auf und geht zum Fenster. »Ich werde alt. Und ich werde nur immer älter. Schon bald werde ich mit all diesen blöden Treppen und mit dem ganzen Platz nicht mehr zurechtkommen. Außerdem«, fährt sie fort und zieht die Vorhänge zurück, »ist es Zeit für eine Veränderung.«
»Aber —«
»Hör zu«, unterbricht Grace sie, während Licht ins Zimmer strömt, »es ist ein wunderschöner Morgen. Ich muss raus zum Ananashaus und Salat holen. Komm doch mit, wie wär’s? Zieh nur schnell einen Pulli über deinen Schlafanzug. Es ist noch lange keine Schule. Wir sehen nach, ob schon Erdbeeren reif sind, fürs Frühstück.«
Rowan überlegt. Sie liebt Erdbeeren, vor allem die ganz frühen aus dem Ananashaus, die so klein und süß sind — die sind fast ihre Lieblingsfrüchte.
Aber dann denkt sie an Opa Philip, an seinen Leichnam im Bestattungsinstitut, wie kalt und dunkel und einsam es dort sein muss. Und hier ist Oma Grace, lebendig und warm steht sie da und redet über reife Erdbeeren in der Morgensonne. »Bist du gar nicht traurig, Oma?«, fragt Rowan sie.
»Traurig?« Grace geht wieder zum Bett hinüber.
»Weil Opa tot ist?«
»Natürlich bin ich traurig, aber Opa ging es sehr schlecht. Er hatte große Schmerzen. Deshalb kann man auch sagen, dass es in gewisser Weise eine Erleichterung ist.«
»Was ist das, eine Erleichterung?«
»Das ist, wenn man das Gefühl hat … dass man etwas loslassen kann. Dass das das Richtige ist.«
»Aber bist du nicht wenigstens ein bisschen traurig?«
»Doch, doch«, gibt Grace zurück. »Sehr traurig. Wirklich. Aber man kann von außen nicht immer sehen, wie es drinnen aussieht, oder? Das wäre dann doch ein fürchterliches Durcheinander, meinst du nicht?«
Rowan denkt nach. Über genau so etwas denkt sie gerne nach. So etwas kann einem Gesellschaft leisten, so etwas kann man eine schöne lange Weile im Kopf hin und her wenden. »Das wäre sehr … scheußlich«, stimmt sie schließlich zu.
»Ja«, erwidert ihre Großmutter mit einem Lächeln. »Wirklich sehr scheußlich.«
*
Als Frannie wieder in den Park kommt, summt ihr Handy. Sie zieht es aus der Tasche. Eine Nachricht von ihrer Mutter.
Rowan ist wach.
Scheiße.
Ist sie okay?, tippt sie zurück.
Es geht ihr gut. Sie war ein bisschen durcheinander, weil du nicht da warst.
Wir ziehen uns an und gehen spazieren.
Dann die blinkenden Auslassungspunkte, als ihre Mutter hinzufügt:
Lass dir Zeit.
Frannie starrt ungläubig auf ihr Telefon.
Bist du sicher?
Ja.
Danke, tippt sie. Dann bin ich ein bisschen im Büro. Bis nachher.
Während sie den oberen Weg in Richtung der Bürogebäude nimmt, fragt sie sich, wie lange sie wegbleiben kann. Wie lang die Leine ihrer Mutter ist.
Das Verhältnis zu Grace ist in letzter Zeit nicht das einfachste gewesen.
Ihre Mutter erhebt Anspruch auf das Cottage, in dem Frannie die vergangenen zehn Jahren gelebt hat. Als Frannie protestierte — vorschlug, der Umzug könne vielleicht bis nach der Beerdigung warten, bis ihre Tochter sich an den Gedanken gewöhnt hatte, sich von dem Haus, in dem sie geboren war, zu verabschieden, von dem einzigen Zuhause, das sie je gekannt hatte —, schüttelte ihre Mutter nur den Kopf. Ich habe diesem Haus fünfzig Jahre meines Lebens gegeben. Damit ist jetzt Schluss.
Also war ihr nichts anderes übriggeblieben, als sich zu fügen, das Cottage innerhalb nur weniger Tage zusammenzupacken und sich so ganz nebenbei um das Anwesen zu kümmern, die Beerdigung zu planen, einen Kalkulationsbogen nach dem anderen auszufüllen, in Mails penibelst ihre Geschwister in cc zu setzen und dabei nur die oberflächlichsten Antworten zu erhalten. Von ihrem Bruder: Sieht doch gut aus, Fran! Von ihrer Schwester: Wir sehen uns vor Ort. Lass uns dann reden.
Sie ist keine für Einsamkeit anfällige Frau, doch seit Neuestem, seitdem ihr Vater gestorben ist, hat sie ihren schwarzen Zug nach unten gespürt: Die Einsamkeit kriecht in alle Ritzen, wie der Schimmel zwischen den Küchenfliesen. Einsamkeit und Müdigkeit. Eine Müdigkeit so bleiern, dass sie sie nicht schlafen lässt.
Frannie lässt sich selbst in ihr Büro. Sie legt ihre Mütze auf den Schreibtisch und geht in die kleine Küche. Schaltet den Wasserkocher ein und spült die Kaffeekanne aus.
Während das Wasser sich erhitzt, zieht sie ihr Handy hervor und macht sich ein paar kurze Notizen.
Damhirsche
Hat die Kuh gekalbt??
Nachtigall.
Sie spürt noch einmal den leisen, tiefen Schauer der Begegnung. Die offiziellen Kanäle müssen informiert werden, sie werden kommen wollen, prüfen wollen, hören und protokollieren wollen — der erste auf dieser Seite des River Medway aufgezeichnete Vogel seit über dreißig Jahren. Warum bloß ist sie nicht schon früher im Jahr hier draußen gewesen? Nur sie ist morgens auf diesen Lichtungen unterwegs; die Camper sind alle auf der anderen Seite des Anwesens, genau wie Ned. Der Vogel singt vielleicht schon seit Tagen, vielleicht schon seit einer Woche. Und wie lange wird er noch singen? Drei Wochen? Höchstens vier, bis er seine Partnerin herbeigerufen hat, erschöpft von ihrer eigenen epischen, einsamen Reise, bis sie seinen Gesang für gut und sein Revier für tadellos befunden hat.
Ihr erster Gedanke ist, die Neuigkeit sofort ihrem Vater mitzuteilen, denn sie zeigt, dass es funktioniert hat — die Entscheidung vor acht Jahren, die Nadelwälder zu roden, ihr erster großer Eingriff in der Führung des Anwesens, und bislang noch immer der kostspieligste und riskanteste und brutalste: über einhundertzwanzig Hektar Kahlschlag hinter dem Sitz der Familie. In diesem ersten Winter sah das Land wie ein Schlachtfeld aus, gefällte Bäume, nebeneinander aufgereiht wie die Leichen der Gefallenen. Und als dann der Regen kam und sich der Waldboden in Sumpf und Schlamm verwandelte, als die frisch freigelegte Erde an der Seite des entblößten Tals hinab- und in den See rutschte, ihn füllte und verstopfte, da zweifelte und verzweifelte sie. Nicht so ihr Vater. Und als sich der Schnee im ersten Frühjahr zurückzog, kam zuerst der Adlerfarn und sog die Sonne in sich auf, dann Birke, Schwarzdorn, Weißdorn, dann Eichen, ihre Samen von den Eichelhähern gepflanzt, und die Dornensträucher dehnten sich aus und gediehen und wuchsen.
Und jetzt — dieser Vogel. Diese Nachtigall.
Es hat funktioniert, Pa. Es hat funktioniert.
Sie schüttet Kaffeepulver in die Kanne, gießt Wasser darauf, trägt Kanne und Tasse zum Schreibtisch und klappt ihren Computer auf, auf dessen Bildschirm ein Worddokument erscheint.
Pa — Trauerrede.
Die Überschrift steht da, sonst ist die Seite leer.
Nachtigall??, schreibt sie.
Wiederansiedlung?
Rückkehr??
Sie wechselt zu ihren Mails, sieht im überfüllten Eingangspostfach eine von Simon von vor einer halben Stunde.
Fran —
tut mir leid, dass ich heute Morgen nicht da bin. Musste mit dem Zug nach London. Sophie hat angerufen, und wir hielten es beide für das Beste, das Treffen vorzuverlegen.
Ich erzähl dir später alles. Hoffe, ich bin vor Ende Geschäftsschluss heute zurück.
In ihrer Brust macht sich Angst breit, aber sie widersteht dem Drang, ihn sofort anzurufen und eine Erklärung von ihm zu verlangen.
Okay, tippt sie als Antwort. Warten wir ab.
Unter Simons Mail ist eine von der Lehrerin ihrer Tochter. In der Betreffzeile steht: Rowan gestern, abgeschickt wurde die Mail vor etwas mehr als einer Stunde, um sechs Uhr morgens.
Guten Morgen, Francesca,
ich wollte Sie nur kurz über Rowans Verhalten in der Schule gestern informieren. Anscheinend haben die jüngsten Ereignisse sie etwas mitgenommen, vor allem im Hinblick auf den Tod ihres Großvaters. Wir wissen alle, wie nah sie Ihrem Vater stand und wie sehr Sie alle mit natürlichen Prozessen verbunden sind. Allerdings sind einige der Wörter, die sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit dem Vorgang der menschlichen Verwesung benutzt, für die anderen Kinder doch verstörend.
Rowan ist in keinerlei Schwierigkeiten. Ich wollte Ihnen das nur mitteilen.
Es wäre toll, wenn wir kurz darüber sprechen könnten, wenn Sie einen Augenblick Zeit haben. Einige Fakten sind für die anderen Kinder im Moment einfach ein bisschen zu viel.
Beth
Frannie schüttet ihren Kaffee hinunter, gießt nach, trinkt und liest sich die Mail noch einmal durch.
Es stimmt, Rowan hat in letzter Zeit viele Fragen gestellt, andererseits hingen bei ihnen zu Hause immer schon Unmengen von Schaubildern, auf denen zu sehen war, dass eine tote Eiche viel mehr Arten beherbergt als eine lebende und wie viele seltene und gefährdete Käfer und Pilze Totholz zum Leben und Gedeihen brauchen. Und als Rowan fragte, ob das auch auf Menschen zuträfe, und Frannie klar wurde, dass sie die Frage nicht beantworten konnte, weil sie es nicht wirklich wusste, gab sie »menschliche Verwesung« in die Suchmaschine ein. Sie ersparte ihrer Tochter zwar die Bilder, informierte sich aber gemeinsam mit ihr, was mit einer Leiche nach einer grünen Bestattung passiert.
Was ist besser? Mit Euphemismen beruhigen oder die Wahrheit sagen?
Sie nippt an ihrem Kaffee und drückt auf »Antworten«.
Liebe Beth,
danke für Ihre Mail.
Lassen Sie mich ehrlich sein: Ich glaube, dass ein großer Teil der derzeitigen suizidalen Entwicklung unserer sogenannten Zivilisation unserer Unfähigkeit geschuldet ist, uns den Tatsachen des Todes voll und ganz zu stellen.
Wenn sich Rowan für den absolut natürlichen Prozess der Verwesung interessiert und dieses Interesse mit anderen Kindern ihres Alters teilen will, weiß ich einfach nicht, wo das Problem liegen soll.
Ich spreche gern noch ausführlicher mit Ihnen darüber.
Viele Grüße,
Francesca Brooke
Ihr Finger schwebt über der »Senden«-Taste, während sie das Gesicht von Rowans Lehrerin vor Augen hat: jung und schrecklich ernst. Es ist ihre erste Stelle — sie ist letztes Jahr mit ihrem Verlobten von London nach Sussex gezogen, um dort neu anzufangen und in dieser winzigen Dorfschule zu unterrichten. Frannie geht noch einmal in die Mail und löscht den zweiten Satz. Sie liest sie erneut und löscht dann alles, außer:
Danke für Ihre Mail, Beth.
Ich spreche gern noch ausführlicher mit Ihnen darüber.
Viele Grüße,
Francesca Brooke
*
Milo stellt das Auto auf dem oberen Parkplatz ab, steigt aus und setzt sich einen kleinen Rucksack auf. Er wird später zum Haus runterfahren, jetzt braucht er erst einmal Luft. Er nimmt einen mit Holzhäckseln bedeckten Weg, der am Rand eines Campingplatzes mit zwei Schäferhütten und mehreren verstreuten Jurten entlangführt. Normalerweise sieht man hier überall Camper mit rosigen Gesichtern, die Koffer und Campingkocher und Campingstühle in Schubkarren hin und her transportieren oder mit einem Bio-Ale in der Hand auf der Bank vor dem Honesty Shop sitzen. Aber heute ist alles still. Am Gatter hängt ein kleines, handbeschriftetes Schild.
BIS MONTAG GESCHLOSSEN
In der Ferne erkennt er die Frau, die den Campingplatz führt, die Freundin seiner Schwester, Wren, auf dem Weg hinüber zur Toilettenanlage. Sie sieht ihn ebenfalls und hebt einen Arm zur Begrüßung. Er grüßt zurück und geht dann weiter den Weg hinunter.
All das, geht es ihm durch den Kopf, von den Holzhäckseln über die Segeltuchjurten und die handbeschrifteten Schilder bis zu der Frau, die den Platz betreibt, ist Teil derselben Ästhetik, die seine Schwester seit ihrer Newbury-Zeit so sehr liebt: Shabby Chic. Die farbenfrohen Tagesdecken auf den Futons. Schön, wunderschön sogar, wenn man fünfundzwanzig Pfund die Nacht zum Campen hinlegt oder mehrere Hundert, um in einer Schäferhütte zu übernachten. Schön für naturausgehungerte Stadtbewohner mit einem Hang zur Hippiekultur; weniger schön, wenn du ein ganz anderes Level an Luxus gewohnt bist.
Und doch: Die Leute scheinen es zu lieben. Ein Yoga-Kuppelzelt, eine Feldküche mit saisonaler Karte, auf der nur ein Gericht steht. Eine Hochzeitsscheune mit sagenhaftem Blick auf Ashdown Forest im Süden, die zwei Jahre im Voraus ausgebucht ist. Eine Flitterwochensuite mit einem Whirlpool, der früher mal ein Whiskyfass war. Anscheinend ist hinfällig-rustikal genau das, was manche Leute wollen.
Nicht seine Leute, wohlgemerkt, aber bitte.
Ein Stückchen weiter den Pfad entlang, und das Haus selbst kommt in Sicht, golden leuchtet es im Licht dieses frühen Morgens. Nun, diese Ästhetik ist mehr nach seinem Geschmack. Gott, wie schön es ist. Die beiden Flügel mit ihrer Tempelfront, die Säulen des palladianischen Mittelteils, die an die des Tempels von Paestum erinnern, das ganze Konzept baut auf dem Apollo-Tempel von Delos auf. Was auch immer sich innerhalb dieser Mauern ereignet haben mag — die Klarheit und Ausgewogenheit des goldenen Ensembles raubt ihm immer wieder den Atem.
Weiß seine Schwester eigentlich, was ihr da jetzt gehört?
Vermutlich nicht. Solange er denken kann, war Frannie immer vollkommen uninteressiert an Besitztümern jeglicher Art, und er wüsste auch nicht, warum sich das ändern sollte, nur weil sie jetzt ein ziemlich großes und ziemlich großartiges Besitztum geerbt hat, eines der frühesten und schönsten Greek-Revival-Häuser im ganzen Land, das sich immer noch in privater Hand befindet. An seinen Wänden eine kleine, aber bedeutende Kunstsammlung, darunter eines der letzten Familienporträts, die Sir Joshua Reynolds gemalt hat, bevor er erblindete und starb. Doch seine Schwester hat wenig Gespür für die Vergangenheit, kann dorisch nicht von ionisch unterscheiden, einen Portikus nicht von Pilastern, und im Grunde, denkt er, will sie es auch gar nicht. Dennoch hat sie ihre Sache ordentlich gemacht, ganz fabelhaft ordentlich sogar; Ehre, wem Ehre gebührt, und so. Letzten Monat hat sie es sogar aufs Cover von Country Life geschafft: Philip, Frannie und Rowan, alle in Pose neben der Wächtereiche, zwischen den Schneeglöckchen und den Schweinen und den Dornensträuchern. Philip dünn, fast verschluckt von seiner Daunenjacke, Frannie mit ihrer üblichen Mütze und der Arbeitshose, den robusten Stiefeln. Zum Bild gab es einen Artikel, ein Interview, das einen Monat, bevor sein Vater starb, geführt worden war und das Milo teilweise auswendig kennt:
Francesca und Philip Brooke über das Denken wie eine Eiche
Vater wie Tochter zeigten jeder auf seine Art einen sehr englischen Hang zum Radikalismus in ihrer Vergangenheit: Philip, der das Anwesen im tragisch frühen Alter von achtzehn Jahren erbte, wurde im Chelsea der späten Sechziger berühmt-berüchtigt und war der führende Kopf hinter dem mittlerweile legendären Indie-Festival The Teddy Bears’ Picnic, das im ungeheuer heißen Sommer des Jahres 1976 auf dem Gelände des Anwesens abgehalten wurde. Auf dem Festival lernte er seine wunderschöne Frau Grace kennen, die er bald danach heiratete und die seitdem immer an seiner Seite geblieben ist.
Und dann ist da Francesca, seine Tochter, eine Veteranin der Straßenprotestbewegung. Als Teenager verhaftet bei dem Versuch, das Leben einer Eiche in einem uralten Wald zu retten — was könnte englischer sein als das?
Hier, auf ihrem renaturierten Landsitz, kommen die beiden schließlich zusammen und bieten uns eine Vision der Zukunft — das Albion-Projekt — im Einklang mit der Vergangenheit.
Er hatte den Artikel gelesen und las ihn dann noch einmal. Er hätte eine Menge dazu sagen können, stattdessen schickte er seiner Schwester nur eine Nachricht: Glückwunsch, Fran, ein toller Artikel.
Nun geht er weiter hinab, der Weg wird steiler in der Kurve, die am alten Eisentor endet. Er hebt den Riegel und betritt den Obstgarten; so kann er eine Abkürzung zu den Büros seiner Schwester nehmen und das Haus meiden — er ist noch nicht ganz bereit für das Haus. Außerdem weiß er, die beste Chance, Frannie zu erwischen, bevor ihr Tag sie in tausend verschiedene Richtungen führt, hat er jetzt.
Links von ihm, hinter der Scheibe im Ananashaus, bewegen sich zwei Gestalten. Er tritt näher, späht durch das stockfleckige Fenster und sieht seine Mutter und seine Nichte, die sich über das Erdbeerbeet beugen und Früchte pflücken.
Sie wirken unzertennlich. Er erinnert sich daran. Kann, wenn er soll, ein Bild, Bilder von sich selbst heraufbeschwören. Der Geruch seiner Mutter. Ihre Nähe. Das weiche Streichen ihres Haars über seine Haut. Einen Augenblick lang steht er einfach da in der Sonne, getroffen von einem Schmerz so vollkommen, so vertraut und doch so heftig, so schrecklich in seiner Vollkommenheit, dass er ihn nach all den Jahren immer noch umwirft.
Da ist sie, seine Mutter: Eva und die Schlange in einer Person.
Er fragt sich, ob er sich davonschleichen kann, den Pfad hinauf, ohne entdeckt zu werden, doch zu spät: Seine Mutter hat ihn gesehen, winkt, und so hat er keine andere Wahl als hineinzugehen. Er zieht noch einmal an seiner E-Zigarette, bevor er die Tür aufdrückt und das Gewächshaus betritt, wo die Luft wie im Hochsommer ist und berauschend moschusartiges Grünzeug sich gegen die Scheiben drängt.
»Milo! Schatz!« Seine Mutter geht auf ihn zu und hält ihm die Wange zum Kuss hin. Der vertraute Geruch: Seife und Nivea. Warme Haut.
»Du siehst gut aus, Mam«, sagt er. Und es stimmt, denkt er, sie sieht wirklich gut aus. Sie trägt einen ausgeleierten Wollpullover über ihrem Nachthemd und Gummistiefel. Kein Make-up, natürlich nicht. Sie trägt nie Make-up. Dafür ihr Haar, wie sie es immer getragen hat, in der Mitte geteilt, fällt es auf ihre Schultern, hellgraue Strähnen zwischen den blonden. Sie ist immer noch irgendwie auffällig schön, die Schönheit ungetrübt von Alter oder Kummer.
»Was machst du hier so früh?«
»Ach«, entgegnet er, »ich muss was mit Fran besprechen.«
»Wegen des Zentrums?«
»Wir nennen es jetzt Klinik, aber ja — deswegen.«
Grace betrachtet ihn, sie hat den Kopf zur Seite geneigt. »Du siehst auch gut aus«, sagt sie dann. »Aber du hast abgenommen.«
»Ich habe gefastet.«
»Gefastet?«
»Intervallfasten.«
»Ähm …?«
»Das ist gerade in. Verlängert das Leben. Ich esse nichts vor zwei Uhr nachmittags.«
»Du meine Güte. Na, übertreib’s nicht, in Ordnung? Und vergiss nicht, dass wir heute alle gemeinsam zu Abend essen. Nur wir vier. Und Rowan natürlich«, fügt sie hinzu und dreht sich zu ihrer Enkelin um, die gerade mit ihrer Schüssel ankommt. »Ich koche.«
»Bestimmt nicht«, erwidert er. »Das will ich auf keinen Fall verpassen. Was gibt’s denn? Eier mit Toastsoldaten?«
»Sei nicht sarkastisch, Milo-Schatz. Das passt nicht zu dir.«
»Wirklich? Bist du dir da sicher?«
Seine Mutter schüttelt den Kopf und sieht zu Rowan hinab. »Onkel Milo hält sich für witzig«, sagt sie. »Ich denke, er ist eher unhöflich. Was meinst du, Ro?«
»Ich mag Eier mit Toast.«
»Wer mag die nicht?« Milo dreht sich zu seiner Nichte.
Wie seine Schwester, die Kleine: Frannies Kind via Windbestäubung. Vom Vater wird nie gesprochen. In ihrem Gesicht gibt es nur wenige Hinweise — die Brooke-Gene haben gewonnen, seine Nichte ist das Ebenbild seiner Schwester. Derselbe grauäugige ernste Blick.
All das gehört dir, kleines Mädchen. Immer weiter, jetzt in deiner Erblinie, Frannie. In seinem Magen öffnet sich eine Falltür. Ist das richtig, denkt er, dass ein Kind, dessen Abstammung unbekannt ist, über zweihundert Jahre englische Geschichte erben soll? Über vierhundert Hektar englisches Land?
»Was pflückt ihr da?«, fragt er.
»Erdbeeren«, antwortet Rowan und zeigt auf ihre Schüssel. »Hier.« Grace hält ihm die Hand hin. »Wir konnten nicht widerstehen. Probier mal.«
Er steckt sich eine in den Mund. Die Beere schmeckt säuerlich, süßsauer, wie die Bonbons, die er früher immer in Papiertüten am Kiosk gekauft hat.
»Wow! Die sind lecker! Kein Wunder, dass ihr die alle weggenascht habt.«
»Wenn du deine Schwester findest«, ruft seine Mutter ihm nach, als er sich zum Gehen wendet, »dann sag ihr doch bitte, dass wir jetzt zum Haus zurückgehen, um zu frühstücken.«
»Sag ihr, wir haben eine Überraschung für sie«, ruft Rowan noch hinterher. »Aber erzähl ihr nichts von den Erdbeeren!«
Milo salutiert und geht wieder nach draußen. Er hat den säuerlichen Geschmack der Erdbeere noch immer im Mund, als er den Weg zu den Büros des Anwesens weiter hinaufgeht, einer Reihe umgebauter Kuhställe. Frannie sitzt schon über den Computer gebeugt am Schreibtisch. Er klopft ans Fenster. Sie sieht auf, ein missbilligender Blick, bevor sie ihn hineinwinkt.
»Du sahst ganz vertieft aus«, begrüßt er sie.
»Ich versuche nur, noch ein bisschen was zu erledigen, bevor ich Ro für die Schule fertig machen muss.«
»Ich hab sie gerade getroffen, unten am Ananashaus, mit Grace.«
»Ah, gut … Warte kurz, lass mich das schnell noch abschicken.« Frannie dreht sich wieder zum Bildschirm und tippt wie wild. Während er wartet, öffnet Milo seinen Rucksack und zieht die Mappe mit dem Ausdruck der Präsentation heraus. Auf dem Deckblatt ist die Skizze eines Baumhauses zu sehen; eine Ranke kommt daraus hervor und schlingt sich um eine vage menschliche Gestalt, die sich an ein Geländer lehnt und in die Weite blickt. Die Zeichnung gefällt ihm, er hat der Designerin ein paar zentrale Bilder vorgegeben, und sie hat daraus etwas Großartiges geschaffen. Er legt die Mappe auf den Schreibtisch. »Ist es okay, wenn ich hier vape?«
»Wenn’s sein muss«, erwidert Frannie.
Er zieht die E-Zigarette aus seiner Tasche, geht zum offenen Fenster hinüber und nimmt einen langen Zug. Dann bläst er den Rauch nach draußen.
»Okay.« Sie sieht vom Bildschirm auf und schiebt sich im Stuhl etwas vom Schreibtisch weg. »Jetzt bin ich da. Wie geht’s dir, Milo?«
»Gut«, erwidert er, während er noch einmal kurz an der E-Zigarette zieht und sie dann wieder einsteckt. »Glaube ich. Ich halte mich senkrecht. Hatte viel zu tun, das hat mich abgelenkt.«
»Ja. Ich auch.«
»Denk ich mir.« Er geht zum Schreibtisch zurück, nimmt sich einen Stuhl und setzt sich ihr gegenüber. »Ich wollte dich noch kurz erwischen, bevor der Wahnsinn hier losgeht.«
»Losgeht? Der läuft schon ne ganze Weile, würde ich sagen …«
»Und um dir das zu zeigen.« Er legt eine Hand auf die Mappe.
»Was ist das?« Frannie beäugt sie misstrauisch.
»Das ist der Entwurf.«
»Der Entwurf wofür?«
»Komm schon«, entgegnet er. »Dein Ernst?«
»Hilf mir auf die Sprünge …«
»Okay, Fran. Die Präsentation, die wir potenziellen Investoren für Die Lichtung gezeigt haben. Ich wollte, dass du weißt, wie weit wir derzeit sind.«
»Wir?«
»Ich und Luca«, erwidert Milo leichthin. »Er fliegt morgen ein.«
Panik huscht über ihr Gesicht. »Milo, nein. Das geht nicht. Er ist nicht eingeladen.«
»Natürlich ist er eingeladen, Fran. Es ist Luca.«
»Ich versichere dir, dass er es nicht ist. Hier ist die Gästeliste. Ich habe sie dir als Google Doc geschickt, zusammen mit dem Gottesdienstablauf, damit du zustimmen konntest. Ich kann sie dir vorlesen, wenn du willst. Es sind wirklich nur wir, Milo, nur die engste Familie. Das war das, was Pa wollte. Was er festgelegt hat, um genau zu sein.«
»Okay, Schwesterherz. Wenn ich mich recht erinnere, hat Pa am Morgen nach seiner Behandlung auch festgelegt, und zwar ziemlich deutlich, dass er diese Klinik auf seinem Land haben will. Wenn Luca also investiert, dann ist er meines Erachtens auch eingeladen. Er hat Pa geliebt, Pa hat ihn geliebt, und wie ich gerade gesagt habe, kommt er früher, um sich das Ganze anzusehen … da kann ich ja nicht irgendwelchen Stuss von mir geben… ich muss vorbereitet sein, wenn er ankommt, Fran, und du auch.«
Sie lehnt sich im Stuhl zurück, die Arme vor der Brust verschränkt. »Du hast mir nicht erzählt, dass Luca investiert.«
»Musste ich das?«
»Das ist schon ein ziemlich großer Brocken an Information, Milo.«
»Fran«, erwidert er geduldig, »er hält diesen Ort für etwas Besonderes. Wir sollten ihm auf Knien für sein Angebot danken. Hast du eine Ahnung, wie viel Musik in den Investitionen auf diesem Sektor ist?«
»Nicht die geringste.«
»Es ist Wahnsinn. Die Patentszene geht durch die Decke. Das ist ein verdammter Goldrausch …« Er legt die Hand auf die Präsentation und schiebt sie in ihre Richtung. »Willst du nicht Teil des Goldrauschs sein, Fran?«
»Ich weiß nicht so recht«, gibt sie zurück. »Hat sich ein Goldrausch je gut ausgewirkt? Auf die indigene Bevölkerung? Die menschliche oder die nicht menschliche.«
»Na ja.« Er grinst. »Ein bisschen heißer Scheiß ist schon daraus hervorgegangen.«
»Zum Beispiel?«
»San Francisco? Nur für den Anfang.«
Sie lächelt nicht.
»Ach, komm schon, Fran. Das war ein Witz. Humor? Weißt du noch, was das ist?«
»Milo. Ernsthaft. Ich hab keine Zeit.«
»Für Humor? Oder für mich?«
»Ganz ehrlich: Für beides nicht. Jedenfalls im Moment nicht.«
»Okay. Dann bin ich jetzt mal ganz ernst. Ich sehe, dass du beschäftigt bist, ich sehe, dass du gestresst bist, aber das hier ist sehr, sehr wichtig für mich. Bitte … nur kurz …« Er schiebt die Präsentation noch näher zu ihr hin. Seine Schwester seufzt, fast nicht hörbar, sieht auf das Deckblatt und liest dann laut.
Die Lichtung
Die Menschheit steht am Scheidepunkt. Die Lichtung ist unser Angebot.
Eingebettet in sechs Hektar uralten Waldlands, inmitten eines renaturierten Familienanwesens.
Ein Ort, an dem uns Mutter Natur willkommen heißt und uns einlädt zu heilen.
Ein Ort, an dem wir uns den Anforderungen unserer Zeit stellen können.
Ein Ort, an dem wir wieder zueinander finden können.
Frannie sieht ihren Bruder mit hochgezogener Augenbraue an. »Scheidepunkt? Angebot??«
»Der Text ist nur ein Platzhalter«, winkt er ab.
Frannie blättert zur zweiten Seite, zu einem mit Photoshop bearbeiteten Bild von Phase eins der Lichtung: Baumhäuser, durch Stege verbunden, darauf Menschen. »Sieht aus wie das Teddy Bears’ Picnic«, sagt sie.
»Stimmt. Wir haben der Designerin ein paar von den alten Fotos gegeben. Es war eine große Inspiration, kulturell und ästhetisch — warum also nicht darauf zurückgreifen?«
»Ich weiß nicht, Milo. Vielleicht, weil ich die letzten zehn Jahre Tag und Nacht geschuftet habe, um die Verbindungen des Anwesens mit der Vergangenheit aufzuarbeiten.«
»Ach, Fran. Es war Kult! Außerdem wird es die Teddy-Bear-Neuauflage: Es werden zwar Baumhäuser im Wald stehen, alle mit eigenem Rasendach, aber drinnen — Luxus pur. Kein Hippiemist, alles nach Passivhausstandard. Die Architektin, mit der wir in Kontakt sind, hat gerade erst dieses fantastische Retreat in Costa Rica fertiggestellt. Jeder Kunde soll seinen eigenen Therapeuten, seinen eigenen Betreuer haben. Seinen eigenen Koch. Seinen eigenen Masseur. Ein Fünf-zu-eins-Verhältnis.«
»Fünf zu eins?«
»Das Verhältnis von Personal zu Kunde. Viel Geld für viel Aufmerksamkeit. Aber jetzt kommt’s erst. Die Leute werden gar nicht merken, wie luxuriös alles ist, weil alles so unglaublich … geerdet sein wird. Stell’s dir vor wie Soho House auf Speed und dann vergiss das Bild ganz schnell wieder, denn das ist im Vergleich zu uns die reine Unternehmensscheiße.«
Frannie blättert zur nächsten Seite, das virtuelle Innere eines Baumhauses, in gedämpften Grau-, Braun- und Grüntönen.
»Das wirkt ein bisschen … gesichtslos. Ich meine, es sieht aus wie in einem Hotel.«
»Diese Leute müssen einen gewissen Standard bekommen, sonst zahlen sie nicht.«
Auf der nächsten Seite ist das Bild eines großen, achteckigen Gebäudes zu sehen, dessen Rasendach von Wildblumen übersät ist. »Das ist das Heilzentrum. Darin sollen die Gruppenzeremonien stattfinden.«
»Zeremonien?« Sie schaut entsetzt.
»Zeremonien, Behandlungen. Wir arbeiten noch an der Sprache.«
»Das klingt nach Sekte.«
»Wir sind keine Sekte, Fran.«
»Und warum hat das Gebäude diese Form?«
»Weil es auf den Prinzipien der heiligen Geometrie basiert.«
»Heilige Geometrie?«
»Darüber redet man gerade, Fran.«
»In Kalifornien vielleicht.«
»In Sussex auch. Es bedeutet, dass die Form mit bestimmten Prinzipien im Einklang ist — mit denen, die dem Kosmos zugrunde liegen. Wie im Haupthaus.«
Frannie sieht ihn verständnislos an.
»Die Architektur? Die Bezüge zum Tempel auf Delos? Apollo? Ist das dein Ernst? So was solltest du wissen, Fran. Es ist jetzt dein Haus.«
Sie geht nicht darauf ein, und er drängt sie auch nicht, steht nur auf, geht wieder zum Fenster hinüber und zieht an seiner E-Zigarette, während sie weiterblättert. Im letzten Bild sind die exakten Koordinaten der Lichtung mittels Google Earth auf einer Karte verzeichnet.
»Sie wird ihre eigene Zugangsstraße haben«, erklärt er, »auf der anderen Seite des Anwesens. Die wird so gut wie gar nicht stören. Du wirst noch nicht einmal merken, dass sie da ist.«
Sie blickt auf die Seite und runzelt die Stirn. »Was ist mit Ned?«
»Ned? Na ja — wir werden ihn erwähnen. Schließlich hat er Teddy Bears’ Picnic gebaut. Er hat es erfunden. Er ist der OG. Außergewöhnlich. Wahnsinn. Ein Wahnsinnsteil von all dem.«
»Nein, ich meine, was ist mit seinem Bus? Der steht mitten in eurem Heilzentrum, oder nicht …?« Sie zeigt auf die Satellitenaufnahme eines Busdachs. »Wenn ich die Koordinaten richtig lese.«
»Jetzt noch«, erwidert er und geht zum Schreibtisch zurück. »Aber Busse haben Räder. Es gibt jede Menge andere Orte, an denen er stehen kann.«
»Der Bus mag Räder haben, aber die haben sich seit fast mehr als fünfzig Jahren nicht bewegt.«
»Okay, hör zu, das ist Phase zwei. Wir denken, wir können hier mit dem Bauen beginnen …« Er tippt mit seiner E-Zigarette auf die Nordostecke des Walds, oben bei Faery Field.
»Und dann? Was passiert, wenn ihr Phase zwei bauen wollt?«
Jetzt runzelt Milo die Stirn. »Na ja … Das Land gehört ihm nicht, oder?«
»Gut.« Seine Schwester seufzt und schließt die Mappe. »Weißt du, Milo, das fühlt sich irgendwie nicht … richtig an. Wir müssen auf jeden Fall eine Durchführbarkeitsstudie in Auftrag geben, bevor irgendetwas davon gemacht wird. Das wird dauern. Vielleicht kannst du im Augenblick, wenn du es so eilig hast, darüber nachdenken, das alles woanders zu bauen.«
»Wie woanders?«
»Wenn Luca so scharf auf das Projekt ist, kann er doch sicherlich das Geld aufbringen, es woanders zu bauen? Ibiza? Kalifornien? Warum muss es ausgerechnet hier sein?«
»Fran.« Er legt die E-Zigarette weg und atmet richtige Luft ein. »Es muss ausgerechnet hier sein, weil das mein Zuhause war. Ich will die Marke auf diesem Gefühl der Familienverbundenheit aufbauen: elementar, authentisch, englisch. Und es muss außerdem ausgerechnet hier sein, weil ich Pa hier behandelt habe. Er war das Saatkorn …«
»Mir war nicht klar, dass er das Saatkorn für eine Firma war, Milo«, entgegnet Frannie. »Ich dachte, er war unser Vater, der im Haus seiner Ahnen an Krebs stirbt.«
»Ach, Fran! Sie hat ihm geholfen. Die Behandlung, meine ich. Oder etwa nicht?«
Sie macht nur ein leises, undeutbares Geräusch. Es könnte Ja oder Nein bedeuten. »Sieh mal«, sagt sie dann, »das klingt alles sehr … beeindruckend. Und ich kann sehen, wie viel Leidenschaft du da reinsteckst. Aber im Moment … habe ich einfach mit meinen eigenen Dingen schon genug zu knabbern. Das klingt viel ehrgeiziger, als ich es mir vorgestellt hatte.«
»Was denkst du wirklich, Schwesterherz? Was ist los? Komm schon. Sag’s mir.«
»Na gut, Milo«, sagt Frannie. »Du willst wissen, was ich denke? Ich denke, dass das Begräbnis unseres Vaters in nicht einmal zwei Tagen stattfinden wird und dass noch scheiße viel zu tun ist. Zum Beispiel habe ich es noch nicht einmal geschafft, meine Trauerrede zu schreiben. Ich denke, dass bislang niemand großartig seine Hilfe bei irgendetwas angeboten hat. Ich denke daran, wo Simon gerade ist — ich weiß, dass er sich heute Vormittag mit der Rechtsberaterin trifft, um über die Erbschaftssteuer zu reden, und ich will wissen, was da besprochen wird und warum man mich nicht dazugebeten hat. Und ich denke daran, in welchem Zustand das Haus ist — ich habe noch nicht einmal einen einzigen Karton oder Koffer ausgepackt, seit wir aus dem Cottage hierhergezogen sind. Ich denke an Rowan und frage mich, ob sie sich bei Mam wohlfühlt, wohl wissend, dass ich in drei Minuten los muss, dass ich den Hügel runterrennen und sie hetzen muss, damit sie rechtzeitig für die Schule fertig ist, in der sie sich im Augenblick definitiv nicht wohlzufühlen scheint und für die ich keine saubere Uniform habe. Ich frage mich, ob ich genug von den einzigen Snackriegeln habe, die sie mag, damit ich ihr einen für die Schule mitgeben kann, oder ob sie alle sind, weil ich zusätzlich zu allem anderen auch keine Lebensmittel bestellt habe, denn ich bin verdammt noch mal umgezogen und konnte die Adresse noch nicht ändern.«
»Okay, Fran. Okay.« Er tritt einen Schritt zurück. »Brauchst du eine Umarmung?«
»Nein. Bitte. Verschon mich damit.« Sie beginnt, ihre Sachen zusammenzusammeln — Autoschlüssel, Handy, Mütze.
»Na gut. Wie wär’s dann damit.« Er stellt sich zwischen sie und die Tür. »Wie wär’s, wenn ich dir was zum Lesen schicken würde? Luca hat gerade ein großes Interview mit Forbes gemacht, das liefert dir ein bisschen Kontext, und vielleicht noch das eine oder andere dazu. Danach beschäftige ich mich nur noch damit, dir bis zur Beerdigung zu helfen, und du findest Zeit für ein Treffen mit mir und Luca, während er hier ist.«
Sie seufzt. »Herrgott. Du bist erbarmungslos. Okay. Schick mir den Artikel. Und wann kommt er?«
»Morgen. Bis Sonntag.«
Sie schüttelt den Kopf, nimmt ihr Telefon zur Hand, öffnet den Kalender. »Morgen Nachmittag?«
»Wie viel Uhr?«
»Drei?«
»Perfekt.« Er tippt den Termin in sein Handy und verstaut es dann wieder in seiner Gesäßtasche. »Also, Frannie. Was brauchst du?«
»Das hättest du mich vor zwei Wochen fragen sollen. Um dann zu kommen und es zu erledigen.«
»Vor zwei Wochen war ich in Kalifornien. Hab das Terrain sondiert.«
»Klar hast du das.« Sie dreht sich zu ihrem Computer um und ruft ihre Mails auf. »Gut. Die kam gerade vom Bestattungsinstitut. Sie brauchen den Sarg spätestens morgen Mittag. Ned weiß das noch nicht, also kannst du zu ihm runtergehen? Dich um den Sarg kümmern? Es ihm sagen?«
»Den Sarg?«
»Ja. Ned flicht ihn. Aus Weide.«
»Ich dachte, Pa wollte auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden?«
»Wollte er auch.«
»Und?«
»Keine Chance.«
»Warum nicht?«
»Die Bundesstraße ist viel zu nah.«
»Im Ernst?« Er kichert. »Was hat er dazu gesagt?«
»Weshalb besitzt man vierhundert Hektar Land, wenn man sich nicht einmal auf einem Scheißscheiterhaufen verbrennen lassen kann, wenn man das will?«
»Jesus.« Milo schüttelt den Kopf. »Pa.« Er tritt wieder einen Schritt zurück und hält die Arme auf. »Ach, Fran. Komm schon her.«
Sie verdreht die Augen. »Na gut. Aber nicht diesen kalifornischen Mist. Ich brauche eine schöne, steife, englische Umarmung.« Sie stehen beieinander, er nur ein wenig größer, groß genug, um das Grau im Braun ihrer Haare zu sehen, um die Knötchen und Noppen in ihrem uralten Kaschmirpulli zu spüren. Seine Schwester, Eignerin von vierhundert Hektar. Gewinnerin der Lotterie des Lebens. Angespannt bis auf die Knochen.
»Du musst dich entspannen, Fran.«
»Und du musst aufhören, mir zu sagen, was ich muss.«
Sie regt sich, will sich losmachen, aber er hält sie fest und spricht in ihr Ohr.
»Vermisst du ihn?«
»Natürlich.«
»Er ist gut gestorben, oder?«
»Ist er.«
»Er wollte das, Frannie.« Er lehnt sich zurück, hält sie auf Armeslänge Abstand. »Du hast gesehen, wie sehr er das wollte.«
»Genug jetzt.« Sie schiebt ihn weg.
»Okay.« Milo öffnet die Arme, lässt sie los. »Ich bin weg.«
Er macht sich auf, hinunter in Richtung Westseite des Hauses und in den Park.
Dieselbe Strecke, die er so viele Male zuvor gegangen ist. Er läuft nicht, er schreitet (schließlich ist er über vierzig und trägt weiße Turnschuhe — aus nachhaltigen Quellen, zwar mit Kautschuk vom Amazonas, aber trotzdem) durch Gras und eingetrockneten Dung. Eine Strecke, die seine Füße auswendig kennen, auch wenn sie jetzt so anders ist; der Swimmingpool ist nicht mehr da, der Tennisplatz aufgeschüttet.
Wie oft? Wie viele Ausflüge hier hinunter, um Ned ausfindig zu machen? Um die Schule hinter sich zu lassen, wo er keine andere Wahl hatte, als sich den obskuren Regeln um der Regeln willen zu unterwerfen:
Kein Rennen in den Korridoren.
Kein Singen oder Pfeifen oder Rennen im Hof.
Bis dreizehn Jahre keine langen Hosen.
An jedem Wochenende, an dem er Ausgang hatte, an jedem ersten Ferientag lief er nach der obligatorischen Fahrt nach Hause und dem steifen Plausch mit seiner Mutter und seinem Vater die Treppe hinauf in sein Zimmer, wo er die verhasste Uniform gegen Jeans und Pulli eintauschte, bevor er hier hinunterkam, wo sanfte Gesetzlosigkeit herrschte.
Er kommt zum Fluss, überquert ihn auf der alten Holzbrücke und geht unter dem abblätternden gemalten Schild hindurch, das noch immer am Eingang zu Neds Wald hängt.
Teddy Bears’ Picnic!
Pu der Bär mit einem Joint in der Hand und Sonnenbrille, Kanga hüpft stoned wie sonst was herum, Tigger mit Augen wie die der Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch — alles eine herrlich bekiffte Siebzigerjahreanspielung auf den Hundert-Morgen-Wald, nur wenige Kilometer von der Grenze ihres Grundstücks entfernt.
Normalerweise hört man die Musik, sobald man unter dem Schild hindurchschlüpft: Hawkwind, Van Morrison, Dylan, die von Neds altem Plattenspieler durch den Wald dröhnen. An seiner Bandauswahl kann man schon von Weitem Neds Stimmung erraten, schon an der Biegung des Flusses sagen, wie es ihm geht, aber heute ist alles still — nur die gelegentliche Klage einer Kettensäge in der Ferne, verstreuter Vogelgesang, das Scheuern der Gummisohlen seiner Turnschuhe auf der Erde. Nur der blaue Schleier der Hasenglöckchen und das besonders durchdringende Grün junger Blätter. Heute ist das erste Anzeichen von Ned nicht Musik, sondern Chaos: das Gestell eines Lastwagens aufgebockt auf Ziegelsteinen, ein paar UPVC-Fenster, die an Plastikkisten lehnen, ein umgekipptes Ölfass, das zur Niststätte eines Tiers geworden ist, wenngleich unklar ist, welches Tier genau darin nistet und seit wann. Motoren, Drahtrollen, ein Palimpsest halb aufgegebener Projekte, ein dichter werdender Hänsel-und-Gretel-Pfad von Fahrzeugteilen, die zur Lichtung führen — zu Neds Feuer, zu seinem Zuhause, einem hübschen alten Schulbus aus den Sechzigern. Und alles, denkt Milo, ist trotz seines Charmes, trotz der Sonne, die an diesem wunderschönen Morgen im Spätfrühling Lichttupfer auf die Waldwiese wirft, in einem zugegeben ziemlich erbärmlichen Zustand.
Ned sitzt an diesem Morgen nicht am Feuer, auch nicht auf dem Ledersofa unter der durchhängenden Zeltplane. Milo nimmt die Stufen und steckt den Kopf in den Bus, aber dort ist Ned auch nicht, nur der vertraute Geruch von Holzrauch und Schweiß, alten Büchern und Dope. Ein halb aufgegessener Pie liegt auf dem Herd. Die Kaffeetasse ist noch warm.
Milo geht wieder hinaus in die Sonne und zum Feuer. Auf dem Rand des Aschenbechers auf der Sitzfläche des Sofas balanciert ein Joint. Die Kettensäge heult wieder auf, dieses Mal tiefer im Wald. Ned wird ausästen, nimmt er an, oder was auch immer er da tut mit der Kettensäge und den Bäumen. Er sollte ihn suchen gehen, sollte ihm Frannies Nachricht überbringen, aber das eilt nicht. Er nimmt den Joint, kauert sich hin und zündet ihn an einem glühenden Stück Holz an. Aus seinem Mund treibt ein dünner, träger Kringel, er hängt in der Luft und löst sich dann weich im Dunst der Sonne auf. Der grüne Geschmack von Zuhause, dasselbe Gras, das Ned hier unten angebaut, gedealt und geteilt hat, solange Milo denken kann — an diesem Ort, wo sich alle Kinder immer trafen, er und Isa und Jack, und Luca, wenn er sie besuchte. Frannie allerdings nie. Nicht seine große Schwester. Nicht seine ältere, moralische, aufrechte Schwester, die schon als Teenager so war, die nie, solange er sich erinnern kann, ein Faible für Drogen hatte. Oder dafür, die Kontrolle zu verlieren. Immer moralisch überlegen oder zumindest in dem Glauben, es zu sein. Schon als Kind.
Allmählich versteht er es, wirklich — er nimmt noch einen langen, herrlichen Zug —, wie sie Drogen vielleicht mit einem Aspekt ihres Vaters verbindet, mit dem Teddy Bears’ Picnic und der Geschichte dieses Landes. Aber das jetzt ist etwas anderes — das sind Arzneien, keine Drogen, Zeremonien, keine Partys, das ist Heilung und nicht Hedonismus. Das ist keine Idee, sondern eine Vision — eine, die vor einem Jahr in einem Behandlungszentrum in Amsterdam über ihn kam.
Während einer fünftägigen Psilocybintherapie. Drei Wochen zuvor, nachdem Sasha ihm gesagt hatte, dass sie ihn verlassen würde, war er in einer öffentlichen Toilette irgendwo in der Nähe der Liverpool Street aufgewacht, unter dem Blick einer Reinigungskraft, die voller Entsetzen oder Angst oder beidem auf ihn herunterstarrte. Dort gelandet war er, nachdem er in seiner Verzweiflung Luca angerufen und am nächsten Morgen ein Flugticket von Lucas persönlicher Assistentin in seinem Maileingang vorgefunden hatte. Dazu eine Nachricht von Luca: Ich denke, das wird dir helfen.
Was er dort vorfand, veränderte nicht weniger als sein Leben: eine kleine Gruppe Mitsuchender, drei Therapeuten. Fünf Tage, an denen der Friedhof seiner Seele aufgeräumt wurde. Und in der letzten Zeremonie, als das Weinen und das Reinigen und das embryonale Wimmern vorüber waren, kam die Vision: Die Lichtung. Sein eigenes Behandlungszentrum auf dem Grundstück seines Elternhauses. Um Menschen wie ihm zu helfen. Internatsüberlebenden. Sexsüchtigen. Drogensüchtigen. Sonstwassüchtigen. Wie hieß das noch gleich, worüber Frannie sich endlos ausließ? Er zieht noch mal am Joint. Die trophische Kaskade? Schalte die Spitze der Nahrungskette aus. Bring die großen Beutegreifer zurück, und das ganze System richtet sich neu aus: Die Wölfe fressen die Damhirsche, die Damhirsche benehmen sich wieder ordentlich, die Bäume haben die Chance zu wachsen. Alles und jeder profitiert. Das Ökosystem beginnt zu gedeihen.
Na gut, und jetzt seine Version davon: Heile die an der Spitze, und das ganze verdammte Ding gerät wieder ins Gleichgewicht. Heile die Anführer und du heilst die Welt.
Und ja, er hat bei seinem Vater angefangen, denn wo zur Hölle hätte er sonst anfangen sollen? Dieser Legende von einem Vater, diesem Löwen von einem Vater: Philip Ignatius Brooke. Als die Ärzte ihnen sagten, der Krebs hätte sich auf die Leber ausgebreitet, und ihm noch einen Monat gaben, sah Milo, dass dieser Löwe von einem Vater — ein Mann, der, soweit Milo wusste, nie in seinem Leben vor irgendetwas Angst gehabt hatte — nun Angst vor dem Sterben hatte. Deshalb leitete er Philip die Studien weiter, die Forschungsberichte, die erstaunlichen Ergebnisse: erhebliche und anhaltende Reduzierung von Depression und Angstzuständen bei Patienten mit lebensbedrohlicher Krebserkrankung … Erhöhung der Lebensqualität, mehr Lebenssinn und Optimismus, dabei weniger Angst vor dem Tod. Schließlich hatte sein Vater zugestimmt. Er verscheuchte seine Mutter, seine Schwestern und die Pfleger für einen Tag von Philips Bett und gab ihm die Behandlung: dreißig Milliliter Psilocybintinktur von einem Kontakt in den Staaten. Er gab seinem Vater ein Paar Kopfhörer, setzte ihm eine Augenmaske auf, startete die Playlist, setzte sich zu ihm und hielt ihm acht Stunden lang die magere Hand. Und als Philip wieder emportauchte, ins schwindende Nachmittagslicht dieses Wintertages, war es, als schwimme er vom Grund eines tiefen, wunderschönen Ozeans nach oben. Als sei er frei. Rechtzeitig wiedergeboren, um zu sterben.
Milo, Milomilomilo, sagte er, das ist fantastisch, so überwältigend und so seltsam.
Er hatte sich seinem Vater nie näher gefühlt als in diesem Augenblick. Und später an diesem Abend, ihre Hände waren immer noch ineinander verschränkt, erzählte Milo seinem Vater von seiner Vision.

![Wo wir uns treffen [ungekürzt] - Anna Hope - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0bdcb599c9c03b46dc2b2dbc39b0f017/w200_u90.jpg)
![Was wir sind [ungekürzt] - Anna Hope - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3bb8d8a70d2cebce7280ac9ef325a2fc/w200_u90.jpg)