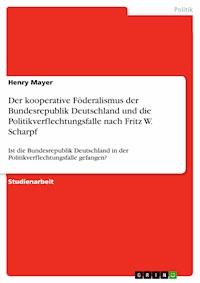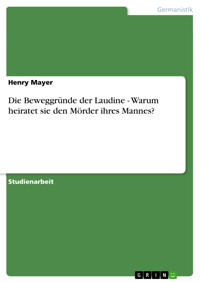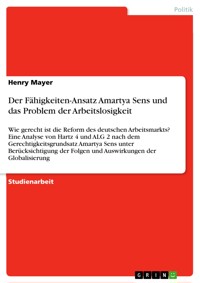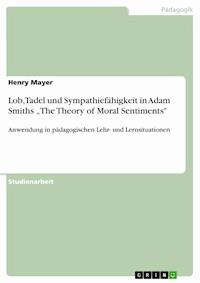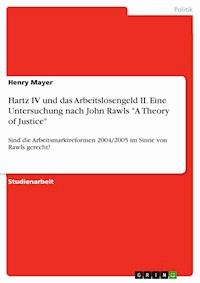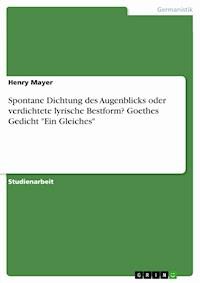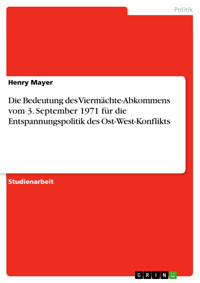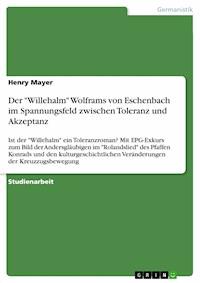
Der "Willehalm" Wolframs von Eschenbach im Spannungsfeld zwischen Toleranz und Akzeptanz E-Book
Henry Mayer
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,0, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Orient wurde im christlichen Mittelalter des 12. und 13. Jahrhunderts größtenteils als ein „Reich der Antichristen, bevölkert von hässlichen, deformierten, mit (christlichen) Menschen kaum vergleichbaren Heiden“ angesehen. Diesen Menschen begegnete man, vor allem im Frühmittelalter, feindselig und intolerant. Dies spiegelt auch die Literatur der damaligen Zeit wieder. Exemplarisch kann hierfür das >Rolandslied< des Pfaffen Konrad (um 1170) stehen, in dem ein sehr verachtendes und negativ-eintöniges Bild der Andersgläubigen gezeichnet wird. Wolframs von Eschenbach >Willehalm< (um 1217/1220), neben dem >Rolandslied< das zweite große epische Werk des Mittelalters, dem die Kreuzzüge als Hauptthematik zu Grunde liegen, erscheint im Vergleich geradezu als Ausnahmeerscheinung – klingen doch hier für diese Zeit bisweilen sehr versöhnliche Töne im Umgang mit Andersgläubigen an: Neben den obligatorischen Schlachtszenen finden sich wertneutrale, teils sogar wohlwollende, ehrwürdige Beschreibungen der Sarazenen. Darüber hinaus wird die Tötung von Heiden als Sünde dargestellt und zur Schonung von Andersgläubigen aufgerufen. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Bild der Andersgläubigen in Wolframs >Willehalm< untersucht. Zentral ist hierbei die Frage, in wie weit die Darstellung des Heidentums als tolerant definieren werden kann: Ist der >Willehalm< ein Toleranzroman des Mittelalters? Anhand ausgewählter Textstellen wird das Toleranzdenken im Text untersucht, wobei auf die Kreuzzugsmotivation der Christen, auf die Darstellung der Andersgläubigen in der Erzählung und auf die als „Toleranzrede“ betitelte Ansprache der konvertierten Heidin Gyburc, in der sie zur Schonung der Andersgläubigen in der anstehenden Schlacht appelliert, eingegangen wird. Außerdem wird die Figur des auf christlicher Seite kämpfenden Heiden Rennewarts zur Bewertung herangezogen. Mit den Ergebnissen der Textanalysen wird dann in einem vierten Schritt ein Fazit gezogen, ob bzw. in wie weit man den >Willehalm< als Toleranzroman bezeichnen kann. Im Rahmen des ethisch-philosophischen Grundlagenstudiums im Staatsexamenstudiengang (EPG) enthält diese Arbeit einen Exkurs, in welchem auf das >Rolandslied< Bezug genommen wird. Es werden die Heidendarstellungen und die Kreuzzugsmotivation der beiden Romane miteinander verglichen und untersucht, auf welche kulturellen Veränderungen sich vorhandene Unterschiede im Umgang mit den Andersgläubigen im Mittelalter bzw. in ihrer Darstellung zurückführen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Page 2
Vorwort
Der Orient wurde im christlichen Mittelalter des 12. und 13. Jahrhunderts größtenteils als ein „Reich der Antichristen, bevölkert von hässlichen, deformierten, mit (christlichen) Menschen kaum vergleichbaren Heiden“ angesehen.1Diesen Menschen begegnete man, vor allem im Frühmittelalter, feindselig und intolerant. Dies spiegelt auch die Literatur der damaligen Zeit wieder. Exemplarisch kann hierfür das >Rolandslied< des Pfaffen Konrad (um 1170) stehen, in dem ein sehr verachtendes und negativ-eintöniges Bild der Andersgläubigen gezeichnet wird (vgl. 5.). Wolframs von Eschenbach >Willehalm< (um 1217/1220), neben dem >Ro-landslied< das zweite große epische Werk des Mittelalters, dem die Kreuzzüge als Hauptthematik zu Grunde liegen, erscheint im Vergleich geradezu als Ausnahmeerscheinungklingen doch hier für diese Zeit bisweilen sehr versöhnliche Töne im Umgang mit Andersgläubigen an: Neben den nach wie vor vorhandenen Schlachtszenen finden sich viele wertneutrale, teils sogar wohlwollende und ehrwürdige Beschreibungen der Sarazenen. Darüber hinaus wird die Tötung von Heiden als Sünde dargestellt und zur Schonung von Andersgläubigen aufgerufen. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher das Bild der Andersgläubigen in Wolframs >Willehalm< genauer untersucht. Zentral ist hierbei die Frage, in wie weit man die Darstellung des Heidentums als tolerant definieren kann: Kann der >Willehalm< als Toleranzroman des Mittelalters angesehen werden?
Die Klärung dieser Frage erfolgt in vier Schritten: Zu Beginn wird eine Definition des Begriffs Toleranz gegeben und dieser von dem Begriff der Akzeptanz abgegrenzt. Dabei wird in einem begriffsgeschichtlichen Überblick die Wirkung der Toleranz sowohl in der Zeit des Mittelalters als auch in der Neuzeit beleuchtet. Es folgen in einem zweiten Schritt biographische Angaben zur Person Wolframs von Eschenbach, eine kurze Inhaltsübersicht des >Willehalm< und ein Abriss über die Entstehungsgeschichte des Romans. Anhand ausgewählter Textstellen wird dann im dritten Schritt das Toleranzdenken im >Willehalm< untersucht, wobei auf die Kreuzzugsmotivation der Christen, auf die Darstellung der Andersgläubigen in der Erzählung und auf die als „Toleranzrede“2betitelte Ansprache der konvertierten Heidin Gyburc, in der sie zur Schonung der andersgläubigen Feinde in der anstehenden Schlacht appelliert, eingegangen wird. Außerdem wird die Figur des auf christlicher Seite kämpfenden Heiden Rennewarts zur Bewertung herangezogen. Mit den Ergebnissen dieser Textanalysen wird dann in einem vierten Schritt ein Fazit gezogen, ob bzw. in wie weit man den >Willehalm< als Toleranzroman bezeichnen kann. Im Rahmen des ethisch-philosophischen Grundlagenstudiums im Staatsexamenstudiengang (EPG) enthält diese Arbeit darüber hinaus ei-1Dallapiazza,Michael: Der Orient im Werk Wolframs von Eschenbach, in: Deutsche Kultur und Islam
am Mittelmeer. Akten der Tagung Palermo, 13.-15. November 2003, hg. von Laura Auteri und Mar-
gherita Cottone, Göppingen 2005 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 725), S. 108.
2So u. a. bei Stein, Siegfried: Die Ungläubigen in der mittelhochdeutschen Literatur von 1050 bis
1250, Darmstadt 1933, S. 73.
Page 3
nen Exkurs, in welchem auf das >Rolandslied< Bezug genommen wird. In diesem EPG-Exkurs werden die Heidendarstellungen und die Kreuzzugsmotivation der beiden Romane miteinander verglichen und untersucht, auf welche kulturellen Veränderungen sich vorhandene Unterschiede im Umgang mit den Andersgläubigen im Mittelalter bzw. in ihrer Darstellung zurückführen lassen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
1. Zum Begriff der Toleranz
1.1 Definition und Abgrenzung zu Akzeptanz
Formal wird unter dem BegriffToleranz(lat. tolerare: dulden) die „Tugend geduldigen Ertragens abweichender Überzeugungen, die Duldung eines Übels, in engerem Sinne das Gewährenlassen anderer religiöser Bekenntnisse“ verstanden.3Eine inhaltliche, auf den Glauben bezogene Definition der „Anerkennung verschiedener echter Möglichkeiten der Begegnung mit dem Heiligen“ gründet auf das christliche Menschenbild der „einzelnen als mit Freiheit, Gewissen und Vernunft von Gott geschaffene[n] Person.“4Demnach ist auch in Einklang mit dem Absolutheitsanspruch des Katholizismus eine Gottes- bzw. Christusbeziehung in anderen Religionen nicht ausgeschlossen. Das verbindliche katholische Absolutheitsgebot gilt demnach auch nicht als intolerant, jedoch dessen „unrechtmäßige Verwirklichung“ in der Form, dass andere Glaubensrichtungen unterdrückt werden.5Für die Ausbildung von Toleranz ist immer eine identische Wertebasis der beiden Parteien, dem Tolerierenden und dem Tolerierten, notwendig.6Sie ist somit ein praktischer und kein theoretischer Begriff und christlich im Gebot der Nächstenliebe verortet.7Toleranz kann und muss abgegrenzt werden vom Begriff der Akzeptanz und gilt dabei, ausgehend von obiger Definition, als Vorstufe zu Akzeptanz.8Bei dieser wird ein von den eigenen Vorstellungen abweichender Zustand ebenfalls geduldet, zusätzlich jedoch als ebenbürtig angesehen.9Die Toleranz wurde im Laufe der Geschichte immer mehr zu einem vorrangig politischen Thema. Mit dem Zeitalter der Aufklärung kam es schrittweise zu einer politischen Verwirklichung der Toleranzforderung in Form der auf Menschenrechten (wie Meinungs- und Religionsfreiheit und der Freiheit der Person an sich) und auf der Trennung von Staat und Kirche
3Lellek, O.: Toleranz, Lexikon des Mittelalters VIII, Sp. 849f.
4Schlette, Heinz Robert: Toleranz, in: Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit, hg. von
Heinrich Lutz, Darmstadt 1977 (Wege der Forschung 246), S.199.
5Ebd, S. 201.
6Sabel, Barbara: Toleranzdenken in mittelhochdeutscher Literatur, Wiesbaden 2003 (Images medii
aevi Interdisziplinäre Beiträge zur Mittelalterforschung 14, S. 14.
7Müller, Max/Halder, Alois: Philosophisches Wörterbuch, Freiburg 1988, S. 317f.
8Brugger, Walter: Toleranz, in: Philosophisches Wörterbuch, 17. Aufl., Freiburg 1976, S. 408: Tole-
ranz ist die „Haltung eines Menschen, der bereit ist, die Überzeugungen anderer […], die er für falsch
oder verwerflich hält […], nicht zu unterdrücken. Sie besagt weder Billigung solcher Überzeugungen
noch Gleichgültigkeit gegen das Wahre und Gute.“
9Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Auflage, Berlin 2002, S.
26: Entlehnt aus dem lateinischen (acceptare) bedeutet akzeptieren soviel wie „annehmen“.
Page 4
basierenden modernen Demokratie. In unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft ist die Toleranz zu einem Grundwert geworden - „derjenige, der die Wahrheit zu besitzen überzeugt ist, [muss] auch dem auf Grund des eigenen Glaubens als ‚irrend’ Erkannten das Recht […] zugestehen, seiner Ansicht durch Wort und Tat Geltung zu verschaffen.“10Toleranz ist so zu einer Grundfrage des menschlichen Zusammenlebens geworden, die immer wieder neu gestellt werden muss11und daher in entwickelten Kulturen, zu denen auch das Mittelalter gezählt werden kann, zu erwarten ist.12Mehrheitlich findet sich heute zunehmend eine synonyme Verwendung der Begriffe Toleranz und Akzeptanz.13Dadurch wird der feine Bedeutungsunterschied, der im Spannungsfeld zwischen gleichmütiger Duldung und ebenbürtiger Anerkennung liegt, undeutlich.